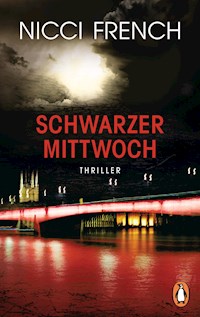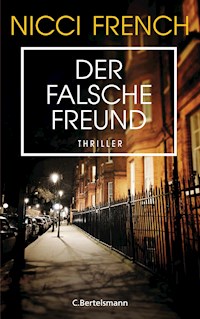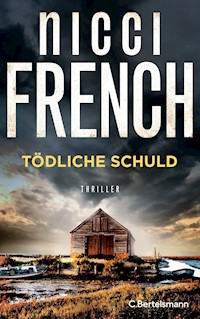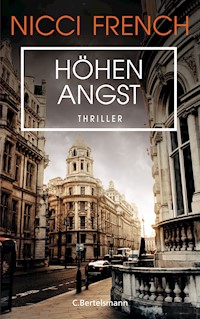Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Frieda Kleins Ex-Lebensgefährte Sandy wird ermordet in der Themse aufgefunden. An seinem Handgelenk befindet sich ein Patientenarmband mit ihrem Namen. Frieda ist tief getroffen und gerät noch dazu bald ins Visier der Polizei, bei der sie an wichtigen Stellen höchst unbeliebt ist. Doch bevor es zur Anklage kommt, hat Frieda Klein sich abgesetzt und ermittelt auf eigene Faust. Wie hat Sandy nach der Trennung von ihr gelebt? Wer waren seine Geliebten, Freunde, Kollegen? Frieda stellt fest, wie wenig sie ihren Ex-Partner kannte, nd als sie hinter das Geheimnis kommt, schwebt sie in höchster Gefahr ...
Ein psychologischer Thriller, der Frieda in dunkle Lebenswelten führt und sie von ihrer verletzlichsten Seite zeigt ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
NICCI FRENCH
MÖRDERISCHER FREITAG
PSYCHOTHRILLER
Deutsch von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Originalausgabe erschien 2015
unter dem Titel »Friday on my Mind«
bei Michael Joseph (Penguin), London.
Copyright © 2015 by Joint-up Writing, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
beim C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Karte: Peter Palm
Covergestaltung: any.way Hamburg nach einem Entwurf von buxdesiogn, München unter Verwendung des Covermotivs von René Mansi / urbancow/ Getty Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15502-5V007
www.cbertelsmann.de
Für Kersti und Philip
1
Kitty war fünf und schlechter Laune. Bei den Kronjuwelen hatten sie lange anstehen müssen, obwohl die gar nicht so besonders waren. Bei Madame Tussauds hatten sie noch länger warten müssen, dabei erkannte Kitty die meisten Wachsfiguren nicht mal, und wegen der Menschenmassen konnte sie sowieso nicht viel sehen. Außerdem hatte es genieselt. Und sie hasste die U-Bahn. Wenn sie auf dem Bahnsteig stand, kam es ihr jedes Mal so vor, als rauschte aus der Dunkelheit etwas Schreckliches auf sie zu.
Sobald sie dann aber das Schiff bestiegen, besserte sich ihre Laune ein wenig. Der Fluss war so breit, dass man sich fast vorkam wie auf dem Ozean, weil er mit den Strömungen und Gezeiten auf und ab wogte. Eine Plastikflasche trieb vorbei.
»Wo treibt die hin?«, fragte Kitty.
»Zum Meer«, antwortete ihre Mama. »Die ganze weite Strecke bis zum Meer.«
»Die Themsebarriere wird sie aufhalten«, warf ihr Vater ein.
»Nein, wird sie nicht«, widersprach Kittys Mama. »Für so eine Flasche ist sie kein echtes Hindernis.«
Während das Schiff vom Kai ablegte, rannte Kitty hektisch hin und her. Sobald sie auf der einen Seite des Flusses etwas Interessantes entdeckte, hatte sie das Gefühl, auf der anderen Seite oder am Bug etwas Wichtiges zu verpassen.
»Beruhige dich, Kitty«, meinte ihre Mutter. »Was hältst du davon, wenn du in deinem Büchlein eine Liste machst und alles aufschreibst, was du siehst?«
Also holte Kitty ihr neues Notizbuch heraus, mit dem Elefanten vorne drauf. Und ihren neuen Stift. Sie schlug eine frische Seite auf, schrieb die Zahl eins und umringelte sie mit einem Kreis, der eher herzförmig als rund geriet. Dann blickte sie sich um.
»Was ist das Große da?«
»Was meinst du?«
»Das da drüben.«
»Das Riesenrad? Es heißt London Eye.«
Sie notierte es als Nummer eins.
Ihr Ausflugsschiff war fast leer. Es war Freitag, außerdem hatte es gerade erst zu regnen aufgehört. Kittys Eltern tranken Kaffee, und Kitty, die wegen einer Lehrerfortbildung schulfrei hatte und sich schon seit Wochen auf diesen Ausflug freute, saß mit gerunzelter Stirn über ihrem Notizbuch, während eine Stimme durch den Lautsprecher verkündete, die Themse sei ein sehr geschichtsträchtiger Fluss. Von hier aus, erklärte die Stimme, sei Francis Drake aufgebrochen, um den Erdkreis zu umrunden. Und hierher sei er mit einem Schiff voller Schätze zurückgekehrt und Sir Francis Drake geworden.
Kitty war so beschäftigt, dass sie sich fast ein wenig gestört fühlte, als ihr Vater sich neben sie setzte.
»Wir haben angehalten«, informierte er sie, »damit wir uns die Themse und London Bridge ansehen können.«
»Ich weiß«, antwortete Kitty.
»Kennst du ›London Bridge is Falling Down‹?«
»Wir haben es in der Schule durchgenehmt.«
»Durchgenommen.«
Sie ignorierte seinen Einwand und schrieb einfach weiter.
»Was hast du denn alles gesehen?«
Während Kitty das Wort vollendete, das sie gerade schrieb, lugte ihre Zungenspitze aus dem Mundwinkel hervor. Dann hielt sie das Notizbuch hoch. »Sechs Sachen«, verkündete sie.
»Was für sechs Sachen?«
»Das Riesenrad.«
»Was noch?«
»Einen Vogel.«
Ihr Vater lachte. Mit gerunzelter Stirn starrte sie ihn an.
»Was ist da lustig?«
»Nichts, du hast sehr gut beobachtet. Einen Vogel. Was noch?«
»Ein Schiff.«
»Welches? Dieses?«
»Nein.« Sie verdrehte die Augen. »Ein anderes Schiff.«
»Gut.«
»Einen Baum.«
»Wo?«
»Er ist nicht mehr zu sehen.« Sie schaute wieder auf ihr Notizbuch. »Ein Auto.«
»Ja, am Fluss fahren viele Autos entlang. Sehr gut, Kitty. Noch was?«
»Einen Waal.«
Ihr Vater warf einen Blick auf das Büchlein. »Den schreibt man mit nur einem ›a‹. W-A-L. Aber die Themse ist ein Fluss, kein Meer. Es gibt hier keine Wale.«
»Ich habe ihn aber gesehen.«
»Wann?«
»Gerade.«
»Wo?«
Kitty deutete in die entsprechende Richtung. Ihr Vater stand auf und ging zur Seite des Schiffs hinüber. Ab diesem Zeitpunkt wurde der ohnehin schon aufregende Tag noch aufregender. Ihr Vater schrie etwas. Dann wandte er sich zu Kitty um und rief ihr zu, sie solle genau dort bleiben, wo sie sei, und sich keinen Schritt von der Stelle bewegen. Anschließend rannte er das Deck entlang und die Treppe hinunter. Der Mann, der durch den Lautsprecher seine Erklärungen abgab, verstummte einen Moment. Als er kurz darauf in lautem Ton weitersprach, klang seine Stimme völlig verändert. Andere Leute liefen über das Deck und starrten an der Seite hinunter. Auch sie stießen aufgeregte Rufe aus. Eine fette Frau fing zu weinen an.
Der Lautsprecher verkündete, die Leute sollten von der Seite wegbleiben, aber sie hielten sich nicht daran. Kittys Mutter kam zu ihr, setzte sich neben sie und begann über ihr weiteres Programm für den Tag zu reden, und auch über die Sommerferien, die nun nicht mehr fern waren. Sie planten einen Campingurlaub. Plötzlich hörte Kitty ein lautes Motorengeräusch und stand auf. Sie sah ein riesiges Motorboot den Fluss entlangbrausen und immer näher kommen, bis es schließlich neben ihnen stoppte. Kitty spürte, wie seine Wellen ihr eigenes Schiff so heftig zum Schaukeln brachten, dass sie fast das Gleichgewicht verlor. Ihre Mutter erhob sich nun ebenfalls und stellte sich zu allen anderen an die Reling. Kitty sah nichts als Rücken und Hinterköpfe. Es war wie bei Madame Tussauds, wo ihr Papa sie auf seine Schultern heben musste.
Dieses Mal aber konnte sie zum Rand der Gruppe gelangen und durch die Eisenstäbe der Reling spähen und die Aufschrift an der Seite des Boots lesen: Polizei. Das würde die Nummer sieben auf ihrer Liste werden. Zwei Männer stiegen zu einem kleinen Absatz am hinteren Ende des Boots hinunter. Einer von ihnen hatte riesige gelbe Sachen an und trug dazu Handschuhe, die aussahen, als wären sie aus Gummi. Er ging damit tatsächlich ins Wasser. Die Männer benutzten Seile und begannen das Ding aus dem Wasser zu ziehen. Die Leute auf dem Schiff stießen Geräusche aus, die wie Stöhnen klangen, und ein paar traten von der Reling zurück, sodass Kitty eine noch bessere Sicht hatte. Andere Leute hielten ihre Telefone hoch. Das Ding sah seltsam aus, total aufgeblasen, fleckig und milchig weiß, aber Kitty wusste trotzdem, was es war. Die Männer verstauten es in einer großen schwarzen Tüte mit Reißverschluss.
Danach fuhr das Polizeiboot noch näher an das Ausflugsschiff heran, und einer der Männer stieg vom Boot auf das untere Schiffsdeck. Der andere Mann – derjenige mit dem riesigen gelben Anzug – blieb auf dem Boot. Er band ein Seil fest und sicherte es mit einem Knoten. Als er fertig war, richtete er sich auf. Sein Blick fiel genau in dem Moment auf Kitty, als sie ihm zuwinkte. Lächelnd winkte er zurück, woraufhin sie noch einmal winkte.
Nun passierte nichts mehr, also setzte Kitty sich wieder. Sie schrieb eine Nummer sieben, umringelte sie und notierte »Polizei«. Dann betrachtete sie Nummer sechs. Sorgfältig strich sie das Wort »Waal« durch, Buchstabe für Buchstabe, bis es völlig ausgelöscht war. Voller Konzentration schrieb sie: »M-A-N-N.«
2
Detective Chief Inspector Sarah Hussein und Detective Constable Glen Bryant stiegen aus dem Wagen. Hussein fischte ihr Handy aus der Tasche, während Bryant eine Zigarettenschachtel und ein rosa Plastikfeuerzeug aus der seinen zog. Er war ein hochgewachsener, kräftig gebauter Mann mit kurz geschorenem Haar, großen Händen und Füßen und breiten Schultern wie ein Rugbyspieler. Im Moment schwitzte er ziemlich. Neben ihm wirkte Hussein klein, kühl und kompakt.
»Es wird heute später«, sagte sie in ihr Telefon. »Ich weiß. Es tut mir leid. Du kannst den Mädchen Nudeln machen. Oder Pizza, es sind welche in der Gefriertruhe. Keine Ahnung, bis wann ich es nach Hause schaffe. Sie sollten nicht aufbleiben und auf mich warten. Du auch nicht.« Sie sah einen Mann auf sie beide zusteuern. »Nick, ich muss aufhören. Tut mir leid.«
Der Mann trat zu ihnen. Sein Gesicht war gerötet, sein Haar zerzaust. Er hatte mehr Ähnlichkeit mit einem Trawlerfischer als mit einem Polizeibeamten.
»Hallo.« Er streckte Bryant eine Hand hin. Letzterer blickte zwar leicht betreten drein, griff aber trotzdem danach. »Ich bin Detective Constable O’Neill. Sie müssen DCI Hussein sein.«
»Eigentlich …«, begann Bryant.
»Das ist Detective Constable Bryant«, erklärte Hussein kühl. »Ich bin DCI Hussein.«
»Oh! Entschuldigen Sie. Ich dachte …«
»Keine Sorge, daran bin ich schon gewöhnt.«
Husseins Blick wanderte den Fluss entlang, nach rechts zur Tower Bridge und nach links zum Canary Wharf und dann hinüber zu den schicken neuen Wohnungen von Rotherhithe, direkt an der Themse.
»Schöne Wohnlage«, bemerkte sie.
»Sie sollten das Ganze mal im November sehen.«
»Mich wundert, dass man diese Seite noch nicht für Wohnungen verkauft hat. Gelände in so erstklassiger Lage, hier ganz vorne am Fluss.«
»Wir bräuchten trotzdem noch Platz für unsere Boote.« DC O’Neill deutete auf ein Gebilde, das aussah wie ein großes quadratisches Zelt aus blauer Plastikplane. Hussein zog ein Gesicht.
»Ist das Ihr Ernst?«
»Wir legen sie da hinein, um einen schnellen ersten Blick auf sie zu werfen. Damit wir entscheiden können, ob wir Sie rufen sollen oder nicht.« O’Neill zog die Plane zur Seite und ließ Hussein eintreten. Drinnen bewegten sich zwei Gestalten mit Plastikhauben, Überschuhen und weißen Kitteln vorsichtig um die Leiche herum. »Manchmal sind wir nicht sicher. Aber diesem Kandidaten hier wurde die Kehle durchgeschnitten.«
Bryant sog tief und hörbar die Luft ein, während O’Neill sich mit einem Lächeln nach ihm umwandte. »Sie halten das für schlimm? Sie sollten sie sehen, wenn sie ein, zwei Monate im Wasser waren. In manchen Fällen kann man nicht mal mehr sagen, welches Geschlecht sie haben. Selbst ohne Klamotten.«
Die Leiche lag in einem großen, flachen Metallbecken. Der ganze Körper wirkte aufgedunsen, als hätte man ihn mit einer Pumpe voll Luft geblasen. Das Fleisch war unnatürlich bleich, zugleich aber auch fleckig, wie marmoriert. Gesicht und Hände wiesen Blutergüsse auf. Der Leichnam trug noch Kleidung, ein dunkles Hemd, eine graue Hose und feste Lederschuhe, eher schon Stiefel. Beim Anblick der nach wie vor doppelt verknoteten Schuhbänder konnte Hussein nicht umhin, sich vorzustellen, wie er sich hinuntergebeugt und sie fest zugezogen hatte.
Sie zwang sich, das Gesicht zu betrachten. Es waren Überreste der Nase vorhanden, allerdings kaum noch mehr als freigelegte Knorpel. Die Gesichtszüge wirkten verschwommen, wie zerfressen, doch die durchgeschnittene Kehle war deutlich zu erkennen.
»Er sieht übel zugerichtet aus«, stellte sie schließlich fest.
Bryant gab neben ihr ein kleines, zustimmendes Geräusch von sich. Er hatte sein Taschentuch gezückt und tat, als würde er sich die Nase putzen.
»Das hat gar nichts zu sagen«, erklärte O’Neill, »abgesehen von der Kehle. Der Fluss beutelt sie ziemlich, und die Vögel machen sich über sie her. Hinzu kommt, dass im Sommer manches schneller geht.«
»Wo wurde er gefunden?«
»Nahe der HMS Belfast, oben an der London Bridge. Aber das muss ebenfalls nichts heißen. Er könnte überall in den Fluss gefallen sein, irgendwo zwischen Richmond und Woolwich.«
»Haben Sie schon eine Ahnung, wie lange er im Wasser lag?«
O’Neill neigte den Kopf zur Seite, als stellte er im Geiste Berechnungen an.
»Er trieb an der Oberfläche. Wir sprechen also von rund einer Woche. Nicht länger als zehn Tage, seinem Zustand nach zu urteilen.«
»Das bringt uns nicht viel weiter.«
»Es ist eine gute Art, eine Leiche loszuwerden«, entgegnete O’Neill. »Viel besser, als sie zu vergraben.«
»Befand sich irgendetwas in seinen Taschen?«
»Kein Portemonnaie, kein Telefon, kein Schlüssel, nicht mal ein Taschentuch. Auch keine Uhr.«
»Sie haben also gar nichts?«
»Sie meinen, Sie haben gar nichts. Er ist jetzt Ihr Baby. Aber doch, es gibt etwas. Sehen Sie sich sein Handgelenk an.«
Hussein zog ihre Plastikhandschuhe an und beugte sich über den Leichnam. Sofort stieg ihr ein schwacher, süßlicher Geruch in die Nase, über den sie gar nicht erst nachdenken wollte. Ums linke Handgelenk trug der Mann ein Plastikband. Sanft hob sie es an.
»Sieht aus wie eines von den Dingern, die man im Krankenhaus bekommt.«
»Das war auch unser Gedanke. Allem Anschein nach steht sein Name drauf.«
Hussein beugte sich tiefer hinunter. Die Schrift war kaum noch zu lesen. Nur mit Mühe gelang es ihr, sie zu entziffern, Buchstabe für Buchstabe.
»Klein«, sagte sie schließlich. »Dr. F. Klein.«
Während sie auf das Eintreffen des Wagens warteten, blickten sie hinaus auf den Fluss, der in der Spätnachmittagssonne funkelte. Es hatte zu regnen aufgehört. Der Himmel war inzwischen blassblau, durchzogen von rosaroten Wolkenstreifen.
»Ich wünschte, es wäre nicht ausgerechnet an einem Freitag passiert«, meine Bryant.
»Da kann man nichts machen.«
»Normalerweise ist das mein Lieblingstag, fast schon ein zusätzliches Stück Wochenende.«
Hussein zog ihre Handschuhe aus. Sie dachte an die Verabredungen, die sie nun absagen musste, die tief enttäuschten Gesichter ihrer Töchter und den Groll von Nick. Er würde versuchen, sich nichts anmerken zu lassen, aber das machte es nur noch schlimmer. Gleichzeitig ging sie im Geiste bereits die Liste von Aufgaben durch, die vor ihr lagen, und sortierte sie nach ihrer Dringlichkeit. Zu Beginn eines Falls war das immer so.
»Ich fahre mit in die Rechtsmedizin. Finde du währenddessen schon mal heraus, wer dieser Doktor Klein ist und aus welchem Krankenhaus das Namensschild stammt, falls es sich überhaupt um ein Krankenhaus handelt. Du hast ja ein Foto davon gemacht, oder?«
Bryant hob sein Telefon hoch.
Dem Plastikband zufolge war Dr. Klein am 18. November geboren, doch das Geburtsjahr konnten sie nicht entziffern. Unter dem Namen befanden sich zwei Buchstaben und dann eine Reihe von kaum lesbaren Zahlen, außerdem so etwas wie ein Strichcode.
»Überprüfe die vermissten Personen«, fügte Hussein hinzu, »männlich, mittleren Alters, vermisst gemeldet irgendwann in den letzten zwei Wochen.«
»Ich rufe dich an, wenn ich etwas herausfinde.«
»Ruf mich auf jeden Fall an.«
»Klar, meine ich ja.«
Das Plastikband mit dem Namen stammte aus dem New End Hospital in Hampstead. Bryant rief dort an und wurde von einer Abteilung zur nächsten weitergereicht, bis er schließlich bei einer Assistentin des medizinischen Direktors landete. Ihm wurde sehr entschieden erklärt, dass er mit einem solchen Anliegen persönlich erscheinen müsse, weil sie andernfalls keine persönlichen Informationen über Angestellte oder Patienten herausgäben.
Also zuckelte er schwitzend und voller Ungeduld im dichten Berufsverkehr den Hügel hinauf. Wahrscheinlich wäre er zu Fuß schneller gewesen; er sollte sich einen Roller zulegen, ging ihm durch den Kopf, oder ein Motorrad. Im Büro des medizinischen Direktors überprüfte eine dünne Frau in einem roten Kostüm erst einmal gewissenhaft seinen Ausweis. Anschließend wiederholte er sein Anliegen und zeigte ihr das Foto auf seinem Telefondisplay.
»Mein Gedanke war, dass es sich um jemanden handeln muss, der hier arbeitet.«
Die Frau wirkte unbeeindruckt.
»Diese Armbänder sind für Patienten, nicht für Angestellte.«
»Ach ja, klar. Sie müssen entschuldigen.«
»Die Angestellten tragen laminierte Ausweise.«
»Ich interessiere mich mehr für den Träger dieses Bands hier.«
Er wurde gebeten zu warten. Der Minutenzeiger der großen Wanduhr rückte vor. Bryant fühlte sich verschwitzt und schmutzig. Vor seinem geistigen Auge sah er immer wieder das aufgedunsene, mit Wasser vollgesogene Etwas, das einmal ein Mann gewesen war. Die Frau kehrte mit einem bedruckten Blatt in der Hand zurück.
»Die betreffende Person wurde hier vor drei Jahren aufgenommen«, erklärte sie, »und zwar als Notfall.« Sie blickte auf das Blatt hinunter. »Mit schlimmen Riss- und Stichwunden. Scheußliche Sache.«
»Vor drei Jahren?«, wiederholte Bryant stirnrunzelnd. Eher an sich selbst gewandt, fügte er hinzu: »Warum hat er dann immer noch sein Krankenhausarmband getragen?«
»Es war kein Er, sondern eine Frau, eine Patientin. Doktor Frieda Klein.«
»Haben Sie eine Adresse?«
»Adresse, Telefonnummer.«
In Husseins Gedächtnis regte sich etwas. »Warum kommt mir dieser Name bekannt vor?«
»Keine Ahnung. Soll ich sie anrufen?«
»Ja. Bitte sie, in die Rechtsmedizin zu kommen.«
»Zur Identifizierung der Leiche? Ich hoffe, sie ist dem gewachsen.«
Hussein stand draußen vor der rechtsmedizinischen Abteilung und verspeiste eine kleine Tüte Chips. Sie beobachtete, wie Frieda Klein dem Beamten durch den fensterlosen Gang folgte. Sie war vermutlich etwa so alt wie Hussein selbst, aber größer, und trug eine graue Leinenhose und ein weißes T-Shirt. Ihr dunkles, fast schwarzes Haar war hochgesteckt. Sie schritt schnell und leichtfüßig dahin, doch Hussein bemerkte, dass ihr Gang trotzdem ein wenig schleppend wirkte, wie bei einer verletzten Tänzerin. Je näher sie kam, desto deutlicher trat die Blässe ihres ungeschminkten Gesichts hervor. Sie hatte sehr dunkle Augen, von denen Hussein sich nicht nur oberflächlich gemustert, sondern eingehend analysiert fühlte.
»Doktor Frieda Klein.«
»Ja.«
Während Hussein sich und Bryant vorstellte, versuchte sie die Stimmung der Frau einzuschätzen. Dabei musste sie an Bryants Worte denken, nachdem er mit der Dame telefoniert hatte: Diese Doktor Klein kam mir gar nicht so überrascht vor.
»Sie sollten sich darauf einstellen, dass es kein schöner Anblick ist.«
Die Frau nickte.
»Er trug meinen Namen an seinem Handgelenk?«, fragte sie.
»Ja.«
Der Raum war hell erleuchtet und sehr still und kalt. In der Luft hing der vertraute, gleichermaßen ranzige wie antiseptische Geruch, der einem hinten im Hals stecken blieb.
Vor dem Seziertisch blieben sie stehen. Die Gestalt war mit einem weißen Tuch bedeckt.
»Sind Sie bereit?«
Die Frau nickte. Ein Angestellter trat vor und zog das Tuch weg. Husseins Blick war nicht auf die Leiche gerichtet, sondern auf das Gesicht von Frieda Klein. Deren Miene veränderte sich nicht, sie biss nicht einmal die Zähne zusammen. Aufmerksam betrachtete sie den Kopf der Leiche. Ohne mit der Wimper zu zucken, beugte sie sich darüber. Ihr Blick wanderte hinunter zu der klaffenden Wunde am Hals.
»Ich weiß nicht«, sagte sie schließlich. »Ich kann es nicht sagen.«
»Vielleicht wäre es hilfreich, wenn sie sich die Kleidung ansehen würden, in der er gefunden wurde.«
Die Sachen lagen in einem Regalfach, zusammengefaltet in transparenten Plastiktüten. Hussein nahm sie nacheinander aus dem Fach und hielt sie Doktor Klein zur Ansicht hin. Ein durchnässtes dunkles Hemd. Eine graue Hose. Die schweren Lederschuhe mit den blauen, doppelt geknoteten Schuhbändern. Hussein hörte die Frau neben sich leise nach Luft schnappen. Einen Moment lang hatte sich Frieda Kleins Gesichtsausdruck verändert wie eine Landschaft, auf die ein dunkler, kalter Schatten gefallen war. Die Finger ihrer rechten Hand krümmten sich leicht, als wollte sie die Hand heben, um die Tüte mit den Schuhen zu berühren. Dann wandte sie sich wieder dem grausigen Leichnam zu und starrte in sehr gerader Haltung auf ihn hinunter.
»Ich weiß, wer das ist«, erklärte sie in leisem, ruhigem Ton. »Es ist Sandy. Alexander Holland. Ich erkenne ihn an seinen Schuhen.«
»Sie sind ganz sicher?«, fragte Hussein.
»Ich erkenne ihn an seinen Schuhen«, wiederholte Frieda Klein.
»Doktor Klein, ist mit Ihnen alles in Ordnung?«
»Ja, danke.«
»Haben Sie eine Ahnung, warum er Ihr altes Krankenhausarmband um sein Handgelenk trug?«
Ihr Blick wanderte zu Hussein und dann zurück zur Leiche.
»Wir waren mal zusammen. Vor einer ganzen Weile.«
»Aber jetzt nicht mehr.«
»Jetzt nicht mehr.«
»Verstehe«, antwortete Hussein in neutralem Ton. »Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist bestimmt nicht leicht für Sie. Natürlich brauchen wir trotzdem sämtliche Informationen, die Sie uns zu Mister Holland nennen können. Und Ihre aktuellen Kontaktdaten benötigen wir ebenfalls, damit wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung setzen können.«
Sie nickte leicht. Hussein hatte den Eindruck, dass es sie große Anstrengung kostete, nicht die Fassung zu verlieren.
»Er wurde ermordet?«
»Wie Sie sehen, wurde ihm die Kehle durchgeschnitten.«
»Ja.«
Nachdem sie ihnen die gewünschten Informationen gegeben hatte und gegangen war, wandte sich Hussein an Bryant.
»Sie hat irgendetwas Seltsames an sich.«
Bryant war hungrig und lechzte nach einer Zigarette. Er streckte sich, stand einen Moment auf den Fußballen und ließ sich dann wieder sinken.
»Sie wirkte sehr ruhig, das muss man ihr lassen.«
»Ihre Reaktion, als sie die Schuhe sah – die war seltsam.«
»Inwiefern?«
»Ich kann es nicht genau sagen. Wir müssen die Frau auf jeden Fall im Auge behalten.«
3
Als die Schwester von Alexander Holland ihnen die Tür öffnete, fielen Hussein gleich mehrere Sachen gleichzeitig auf. Zum einen machte sich Elizabeth Rasson wohl gerade zum Ausgehen fertig, denn sie trug ein schönes blaues Kleid, aber noch keine Schuhe, und wirkte ein wenig aufgelöst, als wäre sie mitten in ihren Vorbereitungen gestört worden. Außerdem schrie irgendwo im Haus ein Kind, während eine Männerstimme es zu beruhigen versuchte. Darüber hinaus registrierte Hussein, dass Hollands Schwester groß, dunkelhaarig und auf eine herbe Art ziemlich gut aussehend war und dass Bryant, den sie dicht hinter sich spürte, so steif und aufrecht dastand wie ein Soldat in Habtachtstellung. Sie hatte das Gefühl, dass er mit angehaltener Luft wartete, bis sie die Worte aussprach, die das Leben dieser Frau verändern würden.
»Elizabeth Rasson?«
»Worum geht es? Sie kommen zu keinem sehr günstigen Zeitpunkt. Wir müssen gleich los.« Ihr Blick fiel auf die hinter ihnen liegende Straße, während sie genervt seufzte.
»Ich bin Detective Chief Inspector Sarah Hussein. Das hier ist mein Kollege Detective Bryant.« Sie zeigten beide ihre Dienstausweise vor.
Hussein spürte in solchen Augenblicken immer ein Ziehen zwischen den Schulterblättern und hinten im Hals. Egal, wie ruhig und gut vorbereitet sie war, empfand sie es doch nie als Routine oder einfach als Teil ihres Jobs, einem Menschen ins Gesicht zu sehen und ihm mitzuteilen, dass eine geliebte Person gestorben war. Sie kam direkt vom Bruder dieser Frau, der aufgedunsen und bereits verwesend auf dem Seziertisch gelegen hatte.
»Polizei?«, fragte die Frau mit zusammengekniffenen Augen. »Worum handelt es sich?«
»Sie sind die Schwester von Alexander Holland?«
»Sandy? Ja. Was ist mit ihm?«
»Dürfen wir reinkommen?«
»Warum? Steckt er in Schwierigkeiten?«
Am besten, man sagte es geradeheraus, möglichst klar und deutlich, ohne Raum für Zweifel zu lassen; so hatten sie es alle im Rahmen ihrer Ausbildung gelernt, auch wenn das inzwischen viele Jahre her war. So machte sie es jedes Mal: Sie sah ihrem Gegenüber in die Augen und verkündete mit fester Stimme, dass ein Mensch, den die betreffende Person gekannt und vielleicht sogar geliebt hatte, gestorben war.
»Ich bedaure sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Bruder tot ist, Misses Rasson.«
Elizabeth Rasson wirkte schlagartig sehr bestürzt. Sie verzog das Gesicht zu einer fast schon komischen, an eine Zeichentrickfigur erinnernden Grimasse.
»Mein aufrichtiges Beileid zu Ihrem Verlust«, fügte Hussein sanft hinzu.
»Ich verstehe nicht. Das kann nicht sein.«
Hinter ihnen kam eine junge Frau den Gehsteig entlanggelaufen und stürmte durch das Gartentor in den Vorgarten. Ihr Pferdeschwanz saß schief, und ihre runden Wangen waren vom Laufen gerötet.
»Es tut mir leid, Lizzie!«, keuchte sie. »Der Bus. Freitagabend. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte!«
Hussein forderte Bryant mit einer raschen Handbewegung auf, sich um die junge Frau zu kümmern, woraufhin er diese am Arm nahm und von der Haustür weglotste.
»Wir wollten eigentlich gerade aufbrechen«, erklärte Lizzie Rasson mit dumpfer Stimme, »zum Abendessen zu Freunden.«
»Darf ich eine Minute reinkommen?«
»Tot, sagen Sie? Sandy?«
Hussein führte sie ins Wohnzimmer.
»Möchten Sie sich setzen?«
Aber Lizzie Rasson blieb mitten im Zimmer stehen. Ihr attraktives Gesicht wirkte plötzlich knochig, ihr Blick leer. Oben wurde das Kindergeschrei immer lauter und schließlich so schrill, dass es klang, als brächte es Glas zum Bersten. Hussein konnte sich das zornrote Gesicht genau vorstellen.
»Wie ist er gestorben? Er war doch gesund. Er war fast jeden Tag joggen.«
»Die Leiche Ihres Bruders wurde heute in der Themse gefunden.«
»In der Themse? Sandy ist ertrunken? Aber er war ein guter Schwimmer. Wieso war er denn überhaupt im Fluss?«
Hussein zögerte einen Moment. »Ihm wurde die Kehle durchgeschnitten.«
Schlagartig verstummte das Geschrei. Im Raum herrschte plötzlich Stille. Lizzie Rasson sah sich um, als hielte sie nach etwas Ausschau: Ihr leerer Blick schweifte über Möbelstücke, Bücher, Familienfotos. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Nein«, sagte sie in entschiedenem Ton, »ganz bestimmt nicht.«
»Ich weiß, dass das für Sie schrecklich ist, aber wir müssen Ihnen dennoch ein paar Fragen stellen.«
»Die Kehle durchgeschnitten, sagen Sie?«
»Ja.«
Lizzie Rasson ließ sich schwer auf einen Sessel fallen und streckte die langen Beine von sich. Sie wirkte auf einmal linkisch.
»Woher wissen Sie, dass er es ist? Es könnte sich um eine Verwechslung handeln.«
»Er wurde eindeutig identifiziert.«
»Von wem?«
»Doktor Frieda Klein.«
Hussein beobachtete Lizzie Rassons Reaktion auf ihre Worte. Sie sah, wie ihr Gegenüber unwillkürlich das Gesicht verzog und die Zähne zusammenbiss.
»Frieda. Armer Sandy«, sagte sie so leise, als spräche sie mit sich selbst. »Armer, armer Sandy.«
Sie hörten schnelle Schritte die Treppe herunterkommen. Ein kräftig gebauter Mann mit einem offenen Gesicht und rötlichem Haar betrat den Raum.
»Bestimmt freut es dich zu hören, dass er endlich schläft. War das gerade Shona an der Tür?«, fragte er. In dem Moment entdeckte er Hussein, registrierte den schockierten Gesichtsausdruck seiner Frau und hielt mitten in der Bewegung inne.
»Sandy ist tot.« Nun, da sie die Worte selbst aussprach, begriff sie, dass dem tatsächlich so war. Lizzie Rasson hob eine Hand an den Mund und presste sie dann gegen ihre Wange. »Sie sagt, man hat ihm die Kehle durchgeschnitten.«
»O mein Gott!«, stieß ihr Ehemann aus. Einen Moment stützte er sich an der Wand ab, als wäre ihm schwindlig. »Er wurde umgebracht? Sandy?«
»Sie behauptet es.«
Eilig durchquerte er den Raum, kauerte sich neben den Sessel, in den seine Frau gesunken war, griff nach ihren schmalen Händen und umschloss sie fest mit den seinen, die groß und grobknochig waren.
»Sind sie sicher?«
Sie stieß ein gepresstes, zorniges Schluchzen aus.
»Frieda hat ihn identifiziert.«
»Frieda«, wiederholte er. »Lieber Himmel, Lizzie!«
Inzwischen hatte er einen Arm um ihre Schultern gelegt. Ihr blaues Kleid wirkte bereits ziemlich verknittert. Tränen traten ihr in die Augen und begannen ihr über die Wangen zu laufen.
»Ich weiß.« Sie schluckte hörbar und wischte mit dem Handgelenk die Feuchtigkeit unter ihrer Nase weg.
Ihr Mann wandte sich schließlich an Hussein.
»Sie brauchen nicht alles zu glauben, was Ihnen diese Frau erzählt«, erklärte er, wobei sein Gesicht einen harten Zug annahm. »Warum hat sie ihn überhaupt identifiziert?«
Bryant trat in den Raum und stellte sich neben Hussein. Sie roch, dass er eine Zigarette geraucht hatte, bevor er ins Haus gekommen war. Er hasste solche Situationen.
»Ich bedaure Ihren Verlust sehr«, erwiderte Hussein. »Trotzdem müssen wir Ihnen ein paar Fragen stellen, und je eher wir das tun, desto besser ist es für den Verlauf der Ermittlungen.«
Hussein betrachtete das Paar. Es war schwer zu beurteilen, ob sie überhaupt begriffen, was ihnen da mitgeteilt wurde. Bryant hatte mittlerweile sein Notizbuch herausgeholt.
»Könnten Sie uns zuallererst den vollen Namen Ihres Bruders bestätigen, außerdem Geburtsdatum und aktuelle Adresse – und können Sie uns sagen, wann Sie ihn das letzte Mal gesehen haben?«
Als sie das Haus der Rassons schließlich wieder verließen, war der Himmel bereits dunkel, auch wenn sich die Luft immer noch warm anfühlte.
»Was wissen wir?«, fragte Hussein, während sie in den Wagen stiegen.
Bryant nahm einen großen Bissen von dem Sandwich, das er sich besorgt hatte. Thunfisch und Mayonnaise, ging Hussein durch den Kopf – das nahm er immer, oder wahlweise höchstens noch Huhn und Pesto.
»Wir wissen«, fuhr sie fort, ohne seine Antwort abzuwarten, »dass Alexander Holland zweiundvierzig Jahre alt war und als Arzt im King George’s gearbeitet hat, im Fachbereich Neurologie. Er ist vor knapp zwei Jahren nach einem kurzen Aufenthalt in den USA nach London zurückgekehrt und wohnte seitdem in einer Seitenstraße der Caledonian Road.«
Sie hielt den Schlüssel hoch, den Lizzie Rasson ihnen gegeben hatte.
»Außerdem wissen wir, dass er allein lebt, nicht in einer festen Partnerschaft, zumindest, soweit seine Schwester informiert ist. Dass sie ihn das letzte Mal vor elf Tagen gesehen hat, am Montag, dem 9. Juni, und er dabei wie immer wirkte. Dass ihm die Kehle durchgeschnitten wurde, und zwar von links nach rechts, sodass wir wahrscheinlich auf der Suche nach einem Rechtshänder sind, und dass die Leiche in der Themse gefunden wurde, wo sie an der Oberfläche trieb. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte bezüglich der Frage, wo die Leiche im Wasser gelandet ist, wissen jedoch, dass Holland seit mindestens einer Woche tot ist, wodurch sich bezüglich des möglichen Todeszeitpunkts ein Fenster vom 10. Juni oder eventuell sogar vom späten Abend des 9. Juni bis zum Freitag, dem 13. Juni, ergibt.«
»Für manche Leute ein Unglückstag«, warf Bryant ein.
Hussein ignorierte seine Bemerkung. »Außerdem wissen wir, dass er am Freitag, dem 20. Juni, gefunden wurde und dass er seiner Schwester zufolge viele Freunde und keine Feinde hatte. Wobei Letzteres nicht stimmen kann.«
Sie streckte die Hand aus. Bryant reichte ihr sein Sandwich. Sie nahm einen Bissen und gab es ihm dann wieder zurück. In ihrer Tasche vibrierte ihr Handy, aber sie holte es nicht heraus. Wahrscheinlich war es eine von ihren Töchtern. Wenn sie ranging, bekam sie bloß noch mehr Schuldgefühle und wurde dadurch von ihrer Arbeit abgelenkt.
»Sonst noch was?«, fuhr sie fort.
»Seine Schwester und ihr Mann mögen Frieda Klein nicht besonders.«
4
Tja«, sagte Bryant.
»Du klingst enttäuscht«, stellte Hussein fest.
Hussein und Bryant standen in Sandy Hollands Wohnung, angetan mit Überschuhen und Handschuhen.
»Ich hatte mit Blut gerechnet«, erklärte Bryant, »mit Spuren eines Kampfes. Aber da ist nichts. Es sieht aus, als wäre er aus freien Stücken hinausmarschiert.«
Hussein schüttelte den Kopf. »Wenn man jemanden in seinem eigenen Zuhause tötet, lässt man die Leiche vermutlich dort. Sie nach draußen zu schaffen ist einfach ein zu großes Risiko.«
»Hältst du es nicht für denkbar, dass der Mörder ihn hier getötet und anschließend alles sauber gemacht hat?«
»Möglich ist es«, antwortete Hussein, klang jedoch skeptisch. »Die Spurensicherung wird uns darüber sowieso Aufschluss geben. Für mich sieht es hier blitzblank aus.«
Die beiden drehten rasch eine Runde durch die Wohnung. Sie erstreckte sich über die beiden obersten Stockwerke. Es gab ein Wohnzimmer mit zwei großen Fenstern, aus dem man in eine schmale Küche gelangte, außerdem ein kleines Arbeitszimmer und oben ein Schlafzimmer mit einer Dachterrasse, von der man über Dächer und Kräne blicken konnte.
In jedem Raum standen Bücherregale. Bryant zog einen großen Band heraus, schlug ihn auf und schnitt eine Grimasse.
»Glaubst du, er hat die alle gelesen? Ich verstehe kaum ein Wort.«
Hussein wollte gerade antworten, als ihr Telefon klingelte. Sie ging ran. Bryant beobachtete ihr Mienenspiel: Zunächst wirkte sie irritiert, dann überrascht, am Ende irgendwie beunruhigt.
»Ja«, sagte sie, »ich werde da sein.«
Sie beendete das Gespräch und hing einen Moment ihren Gedanken nach. Sie schien vergessen zu haben, wo sie war.
»Schlechte Nachrichten?«, fragte Bryant.
»Keine Ahnung«, antwortete Hussein. »Es geht um die Frau, die den Leichnam identifiziert hat: Frieda Klein. Der Computer hat ihren Namen ausgespuckt. Vor zwei Wochen hat sie jemanden als vermisst gemeldet.«
»Alexander Holland?«
»Nein, einen Mann namens Miles Thornton. Sophie ist der Sache nachgegangen, und ehe sie es sich versah, bekam sie einen Anruf aus dem Büro des Polizeipräsidenten.«
»Du meinst, Crawford? Weswegen denn?«
»Wegen des Falls. Im Zusammenhang mit Frieda Klein. Er möchte mich sprechen. Auf der Stelle.«
»Stecken wir in Schwierigkeiten?«
Hussein wirkte verblüfft.
»Wieso sollten wir? Wir haben doch noch gar nichts gemacht.«
»Möchtest du, dass ich mitkomme?«
Hussein schaute sich um.
»Nein, du musst hierbleiben.«
»Wo soll ich denn anfangen? Wonach suche ich?«
Hussein überlegte einen Moment.
»Ich habe nach einem Telefon oder Computer oder Portemonnaie Ausschau gehalten, aber nichts gefunden. Könntest du mal dein Glück versuchen?«
»Klar.«
»Außerdem lag an der Eingangstür ein Stapel Post. Der sollte uns klären helfen, wann Holland das letzte Mal hier war. Und sieh zu, dass du mit den Leuten in der anderen Wohnung reden kannst und herausfindest, wann sie ihn das letzte Mal getroffen haben.«
»Mache ich.«
»Die Spurensicherung müsste bald eintreffen. Mir ist klar, dass die Jungs es nicht mögen, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben, aber an der Schlafzimmertür hingen zwei Bademäntel, und im Nachttisch lagen Kondome. Sie sollten die Laken untersuchen.«
»Ich werde sie darauf hinweisen.«
DC Sophie Byrne begleitete Hussein und ging mit ihr ein paar der Ausdrucke durch, während sie am St. James’s Park entlangfuhren. Hussein kam sich vor, als versuchte sie auf dem Weg in eine Prüfung verzweifelt, noch rasch den Stoff zu wiederholen, den sie sich längst hätte ansehen sollen. Dabei war sie nie dieser Typ gewesen. Sie war gerne gut vorbereitet, sonst fühlte sie sich unbehaglich.
Man erwartete sie bereits. Ein uniformierter Beamter lotste sie durch die Sicherheitskontrolle und dann in einen Aufzug hinauf in ein Stockwerk, zu dem man nur mit einer speziellen Karte Zutritt bekam. Schließlich wurde sie einer Empfangsdame vorgestellt, die sie ins Büro des Polizeipräsidenten führte. Zunächst sah sie nur gleißendes Licht. Ihr war nicht klar gewesen, wie hoch oben sie sich befand. Sie verspürte den kindlichen Drang, zum Fenster zu eilen und erst einmal die Aussicht über den Park zu genießen.
Bei Crawfords Anblick fielen ihr mehrere Sachen gleichzeitig auf: sein lächelndes, rötliches Gesicht, seine Uniform, die Größe seines Schreibtisches und wie leer dieser Tisch war, mal abgesehen von einer einzigen Akte. Hatte er denn keinen Papierkram zu unterzeichnen? Oder war er sogar dafür zu wichtig?
»Detective Chief Inspector Hussein«, sagte Crawford langsam, als ließe er sich jedes einzelne Wort auf der Zunge zergehen. »Endlich lernen wir uns persönlich kennen.«
»Nun ja«, begann Hussein, wusste dann aber nicht, wie sie fortfahren sollte.
»Wir sind stolz, eine leitende Beamtin aus Ihrer Ecke der Stadt zu haben.«
»Vielen Dank, Sir.«
»Woher kommen Sie, Sarah? Ich meine, ursprünglich.«
»Aus Birmingham, Sir.«
Sie schwiegen beide einen Moment. Hussein blickte aus dem Fenster. Die Sonne schien. Plötzlich musste sie daran denken, wie schön es wäre, dort draußen zu sein und an einem Sommerabend im Park spazieren zu gehen, statt jetzt hier zu stehen.
»Erzählen Sie mir etwas über diesen Fall«, fuhr Crawford schließlich fort. »Alexander Holland.«
Mit einer Handbewegung forderte er sie auf, vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Sie berichtete ihm über den Fund des Leichnams, seinen Zustand und Hollands Wohnung.
»Und Sie haben Frieda Klein kennengelernt?«
»Ja, kurz.«
»Was halten Sie von ihr?«
»Sie war diejenige, die den Leichnam identifiziert hat. Holland trug ihr Krankenhausarmband am Handgelenk.«
»Das klingt ein bisschen seltsam.«
»Die beiden waren mal ein Paar.«
»Also, dass man jemandes Ring trägt, ist mir ja bekannt, aber …«
»Ich hatte mir schon vorgenommen, noch einmal mit ihr zu sprechen.«
»Inwieweit sind Sie denn über sie informiert?«
»Bisher weiß ich nur das, was eine meiner Beamtinnen mir vorhin auf der Herfahrt berichtet hat. Der Name kam mir zwar irgendwie bekannt vor, aber ich konnte mich nicht erinnern, woher. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie die Therapeutin, die vor ein paar Jahren an der Befreiung des Faraday-Jungen beteiligt war und auch zur Aufklärung des Mordes unten in Deptford beigetragen hat. Außerdem gab es da noch diesen anderen Fall, das ›Horrorhaus von Croyden‹, wie es in der Regenbogenpresse hieß. Das war ebenfalls diese Frieda Klein.«
»Sie sollten nicht alles glauben, was Sie in der Zeitung lesen.«
»Ich halte mich nur an das, was in den Polizeiakten stand. War sie in den Fall nicht auch involviert?«
Crawford stieß eine Art verächtliches Schnauben aus. »Man kann auf die eine oder andere Weise involviert sein«, antwortete er.
»Ich verstehe nicht recht.«
»Sie wissen doch, wie das ist«, erklärte er. »Wenn wir ein Ergebnis haben, wollen plötzlich alle auf den Wagen aufspringen. Und die Zeitungen fahren voll darauf ab – auf die Vorstellung, dass irgendeine gottverdammte Therapeutin hier bei uns hereinschneit und uns sagt, wie wir unsere Arbeit machen sollen.«
»Aus den Zeitungen weiß ich lediglich, dass ihr irgendetwas zur Last gelegt wurde. Worum es dabei im Einzelnen ging, habe ich vergessen.«
»Sie kennen nicht mal die halbe Wahrheit«, entgegnete Crawford düster.
Es folgte eine weitere Pause.
»Sie müssen entschuldigen«, unterbrach Hussein leicht irritiert das Schweigen. »Ich bin wahrscheinlich schwer von Begriff, aber mir ist nicht ganz klar, worauf Sie hinauswollen.«
Crawford beugte sich vor und schob mit den Fingerspitzen seiner rechten Hand die Akte über den Tisch.
»Das ist die andere Akte über Frieda Klein«, erklärte er. »Meine Akte. Sie können sie mitnehmen.« Er stand auf und trat ans Fenster. »Aber Sie bekommen von mir gleich die Kurzfassung.« Er drehte sich um. Als Hussein sein Gesicht sah, schien ihr, als hätte jemand einen Regler hochgedreht, um seinen Zorn zu steigern. »Ich sage Ihnen eines, Sarah … Ist es in Ordnung, wenn ich Sie Sarah nenne?«
»Natürlich, Sir.«
»Als jemand mich anrief und mir von dem Leichenfund berichtete und dass diese Frieda Klein damit zu tun habe, nahm ich mir vor, dieses Mal umgehend in Erfahrung zu bringen, wer für den Fall zuständig ist, und die betreffende Person zu warnen. Sie haben Klein ja schon kennengelernt und wahrscheinlich als eine ruhige, fleißige Sorte Ärztin eingestuft …«
»Ich habe sie eigentlich gar nicht …«
»Aber das ist sie nicht. Sie meinen, in der Zeitung etwas über sie gelesen zu haben.« Er trat wieder an den Schreibtisch und klopfte auf die Tischplatte. »Ich werde Ihnen sagen, was nicht in der Zeitung stand. Wussten Sie, dass sie eine Frau umgebracht hat?«
»Umgebracht?«
»Sie hat sie erstochen. Und ihr dann auch noch die Kehle durchgeschnitten.«
»Stand sie deswegen vor Gericht?«
»Nein, man ging davon aus, dass sie in Notwehr gehandelt hat. Aber nicht einmal das hat Klein zugegeben. Sie hat behauptet, es sei Dean Reeve gewesen, der in dem Faraday-Fall der Kidnapper war.«
Hussein runzelte die Stirn.
»Dean Reeve? Der ist doch gestorben. Er hat sich erhängt, bevor die Polizei ihn schnappen konnte.«
»Genau. Aber wir sprechen hier von Frieda Klein. Für sie gelten andere Regeln als für den Rest von uns. Sie hat diese fixe Idee, dass Dean Reeve noch lebt und statt seiner damals sein eineiiger Zwillingsbruder starb. Das ist natürlich lächerlich. Außerdem reden alle immer nur darüber, dass Klein es geschafft hat, den Faraday-Jungen und das Mädchen zu retten. Kein Mensch erwähnt jemals die andere Frau, die Klein ins Spiel brachte, dann aber nicht retten konnte.«
»Auf welche Weise hat Klein sie ins Spiel gebracht?«
»Was?« Crawford wusste im ersten Moment nicht recht, was er darauf antworten sollte. »An die Einzelheiten erinnere ich mich nicht. Es steht alles in den Akten. Vor ein paar Jahren wurde Klein auch einmal wegen Körperverletzung festgenommen, nachdem sie in einem Restaurant im Westend eine Schlägerei angefangen hatte.«
»Eine Schlägerei? Kam es zu einer Verurteilung?«
»Sie wurde nie zur Verantwortung gezogen«, fuhr Crawford fort, »auch wenn mir bis heute schleierhaft ist, warum nicht.« Er klopfte auf die Akte. »Aber das finden Sie alles hier drin.«
»Steht sie immer noch auf der Gehaltsliste der Polizei?«
»Lieber Himmel, nein! Dafür habe ich persönlich gesorgt. Das Letzte, was ich von ihr hörte, war, dass sie oben in Suffolk wegen einer Vergewaltigung Zeter und Mordio schrie und mit Anschuldigungen um sich warf, bis der Mann, den sie beschuldigte, am Ende selbst ermordet wurde. Das ist es, was ich Ihnen zu sagen versuche, Sarah: Wo auch immer diese Frau auftaucht, kommt es zu Problemen, und Menschen werden getötet. Das einzig Gute an dem neuesten Trauerspiel ist, dass Klein sich oben in Suffolk aufhielt und die dortige Polizei ärgerte, statt hier unten uns zu nerven.«
»Wegen einer Vergewaltigung?«, hakte Hussein nach. »War sie selbst das Opfer, oder hat sie in einem Fall von Vergewaltigung ermittelt?«
»Ein bisschen von beidem, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Ende der Geschichte war, dass zwei Leute ermordet wurden – was der übliche Lauf der Dinge zu sein scheint, wenn Doktor Klein die Finger im Spiel hat.«
Hussein griff nach der Akte.
»Sie müssen entschuldigen«, sagte sie, »aber mir ist noch immer nicht ganz klar, worum es hier eigentlich geht. Wollen Sie behaupten, diese Frau leide unter Wahnvorstellungen, oder unterstellen Sie ihr eine gewisse Systematik, oder haben Sie einen konkreten Verdacht, oder … was?«
»Im Lauf der Ermittlungen wird es sicher erforderlich werden, mit bestimmten Leuten zu sprechen. Ich kann Ihnen einen Psychologen nennen, mit dem wir tatsächlich zusammenarbeiten, Hal Bradshaw. Er teilt meine Vorbehalte bezüglich der Leistungen von Doktor Klein. Zwischen den beiden kam es zu einer Art Zusammenstoß, und am Ende brannte sein Haus bis auf die Grundmauern nieder. Wobei er ihr das erstaunlich wenig krumm genommen hat, das muss ich schon sagen.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass Frieda Klein auch noch eine Brandstifterin ist?«
Crawford breitete mit einer Geste unschuldiger Hilflosigkeit die Hände aus. »Ich will gar nichts andeuten«, entgegnete er. »Ich bin bloß ein schlichter Polizeibeamter. Ich lasse mich lediglich von den Indizien leiten, und in diesem Fall deuten die darauf hin, dass Frieda Klein überall Chaos hinterlässt. Was für eine Rolle sie bei alldem im Einzelnen gespielt hat, war von Anfang an schwer nachzuvollziehen. Wie Sie selbst wohl bald feststellen werden, hat Frieda Klein nämlich noch ein paar sehr seltsame Bundesgenossen. Auf welche Weise diese Dinge zustande kommen, entzieht sich zugegebenermaßen meiner Kenntnis, aber sie passieren, und zwar immer wieder.«
»Als Doktor Klein damals tatsächlich – in welchem Ausmaß auch immer – mit der Polizei zusammengearbeitet hat«, sagte Hussein, »wer war da ihr Ansprechpartner?«
»Wissen Sie, die Frau ist ja obendrein auch noch raffiniert. Sie hat mit einem meiner DCIs zusammengearbeitet, Malcom Karlsson, und der ist ihr schlichtweg verfallen. Das hat sie ausgenutzt.«
»Verfallen? Soll das heißen, die beiden hatten eine Beziehung?«
Crawford zog ein Gesicht. »Ich sage nicht, dass sie eine hatten, schließe es aber auch nicht aus. Genaueres weiß ich nicht und möchte keine Mutmaßungen anstellen. Ich sage nur, dass es Mal Karlsson meiner Meinung nach die Optik verschoben hat, was diese Frau betrifft. Aber bestimmt werden Sie selbst mit ihm sprechen wollen. Seien Sie trotzdem schon einmal vorgewarnt, dass man sich nicht ganz auf seine Einschätzung verlassen kann, wenn es um Frieda Klein geht.«
Hussein blickte auf die Akte hinunter.
»Es ist aber auch möglich, dass Frieda Klein mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun hat.«
Crawford stand auf und kam hinter seinem Schreibtisch hervor, um Hussein aus ihrem Sessel hochzuhelfen.
»Genauso gut ist es möglich«, entgegnete er, »dass man in ein Haifischbecken fällt und der Hai einen nicht frisst. Trotzdem ist es besser, einen schützenden Käfig um sich zu haben.«
Hussein lächelte über den extremen Vergleich.
»Sie ist doch nur eine Zeugin«, gab sie zu bedenken.
»Es kann nie schaden, sich zu wappnen«, meinte Crawford. »Und sollten Sie irgendwelche Probleme mit ihr haben, dann denken Sie daran, dass ich hundertprozentig hinter Ihnen stehe.«
5
Was haben wir?« Hussein blickte die Männer und Frauen an, die sich im Besprechungsraum um sie scharten.
Was haben wir? Diese Worte gebrauchte sie immer, wenn ein Fall erst wenige Stunden oder höchstens ein, zwei Tage alt war und sie zunächst die Ecken und Kanten des Rahmens zusammensetzten, ehe sie sich dem Durcheinander der Puzzleteilchen zuwandten, aus denen sich dann das Bild formen ließ.
»Soll ich anfangen?«, meldete sich Bryant zu Wort. »Unser Opfer heißt Alexander Holland, seines Zeichens …«, er warf einen Blick auf das Blatt, das vor ihm lag, »… Professor der Kognitionswissenschaft am King George’s College hier in London.«
»Was versteht man darunter?«, erkundigte sich Chris Fortune. Er war neu im Team. Hussein fiel auf, dass er ständig mit einem Knie wippte und energisch Kaugummi kaute. Wahrscheinlich versuchte er gerade, mit dem Rauchen aufzuhören.
»Dass er gescheiter ist als wir. Oder gescheiter war. Am 6. Juni ging an der Uni das Semester zu Ende, seitdem sind die großen Sommerferien. Das erklärt, warum sich wegen seines Fehlens dort niemand Gedanken gemacht hat. Wobei aus unseren Aufzeichnungen hervorgeht, dass eine Frau …«, er warf erneut einen Blick auf seine Notizen, »… eine Doktor Ellison hat offenbar bei der Polizei angerufen und sein Verschwinden gemeldet. Allerdings ist nicht ganz klar, aus welchem Grund sie sich Sorgen um ihn gemacht hat. Er war zu dem Zeitpunkt erst ein paar Tage abgängig. Sie meinte, er habe sich nicht wie verabredet bei ihr gemeldet.«
»Doktor Ellison?«
»Ja.«
»Gut. Weiter.«
»Er hatte die Stelle noch nicht lange. Sie wurde speziell für ihn geschaffen. Vorher war er ein paar Jahre in den Staaten gewesen, von wo er aber vor anderthalb Jahren zurückkam.«
»Warum?«
»Warum was?«
»Warum ist er zurückgekommen?«
»Das weiß ich nicht.«
»Weiter.«
»Er war zweiundvierzig. Einmal verheiratet, mit einer Maria Lockhart, aber seit acht Jahren geschieden.«
»Wo hält sich die Frau zurzeit auf?«
»Sie lebt mit ihrem neuen Ehemann in Neuseeland. Und nein, sie hat London nicht erst vor Kurzem einen Besuch abgestattet, um ihren Ex umzubringen. Kinder hat er keine. Die Eltern sind beide schon gestorben. Eine Schwester lebt hier in London. Mit der haben wir ja bereits gesprochen.«
Hussein dachte an die aufgelöste Frau in dem blauen Kleid, die vor Bestürzung die Hände gerungen und immer wieder den Kopf geschüttelt hatte.
»Gibt es eine feste Partnerin?«
»Bisher wissen wir von keiner.«
»Sophie.« Hussein nickte der jungen Frau zu, die sich mit nervöser Miene aufrichtete. »Berichte uns doch mal, was in seiner Wohnung gefunden wurde.«
Aufmerksam lauschte sie Sophies Ausführungen. Obwohl Alexander Holland noch nicht lange in seiner Wohnung gelebt hatte, verrieten die Räume etwas über den Mann. Offenbar hatte er gerne gekocht, denn seine Töpfe und Pfannen waren teuer und offensichtlich benutzt, und in den Schränken fanden sich viele ordentlich verstaute Zutaten sowie Kochbücher. Getrunken hatte er allem Anschein nach auch gern: Die Recyclingtonne unterhalb der Treppe enthielt jede Menge leere Weinflaschen, und in der Küche gab es einen beachtlichen Vorrat an vollen, außerdem ein paar Flaschen Whisky. Nach seinen Tennis- und Squashschlägern, Joggingklamotten und mehreren Paar Laufschuhen zu urteilen, war er ein sportlicher Typ gewesen. Die teuren Hemden und Jacken in seinem Kleiderschrank ließen vermuten, dass er auch etwas von einem Dandy hatte. Darüber hinaus war er wohl Kunstliebhaber. Zumindest hingen an den Wänden Gemälde und in seinem Schlafzimmer zwei Zeichnungen. In der Schublade neben seinem Bett lagen Kondome, er war also sexuell aktiv.
»Vermutlich sexuell aktiv«, wandte Hussein ein.
Wie Sophie Byrne weiter erklärte, hingen zwei Bademäntel am Haken, einer für einen Mann und ein kleinerer für eine Frau, wobei das Damenmodell von verschiedenen Personen getragen worden war. Im Badezimmerschränkchen fand sich ein Vorrat an Zahnbürsten, außerdem Paracetamol und Mundspülung. Er hatte viel gelesen, hauptsächlich Fachbücher, die mit seiner Arbeit zu tun hatten.
»Bemerkenswert ist jedoch«, fuhr Sophie Byrne fort, »was alles nicht da ist. Kein Pass. Kein Portemonnaie. Kein Computer. Kein Telefon.«
»Schlüssel?«
»Ein Set Schlüssel in einer Schale neben der Eingangstür, außerdem ein paar, die nicht zur Wohnung gehören.«
»Vielleicht zur Wohnung seiner Schwester?«
»Das überprüfen wir gerade.«
»Korrespondenz?«
»Nein – aber die befand sich wahrscheinlich auf seinem Computer, von dem ebenfalls jede Spur fehlt.«
»Wir sollten vermutlich in der Lage sein, sie von seinem Server zu bekommen. Oder vielleicht hat er in seinem Büro an der Uni einen Computer stehen. Kannst du dich darum kümmern, Chris?«
»Klar.« Chris unterstrich seine Bereitschaft mit einer besonders energischen Kaubewegung.
»Auf seinem Schreibtisch lag ein Notizbuch«, fuhr Sophie Byrne fort, »aber es enthielt hauptsächlich die üblichen Listen. Sachen, die er erledigen wollte. Einkaufslisten. Außerdem hatte er sich so eine Art Zeitplan notiert. Daten und Zeiten mit Sternchen daneben. Überschrieben mit ›WH‹.«
»WH?«
»Ja.«
»Gut. Was ist mit Anrufen, Glen? Gibt es da Grund zur Freude?«
»Ah.« Bryant machte einen zufriedenen Eindruck. Er räusperte sich und griff dann nach einem Stapel zusammengehefteter Blätter. »Wie ihr ja alle wisst, wurde sein Handy nicht gefunden, aber wir verfügen über eine Liste der Anrufe, die er in den letzten sechs Monaten getätigt hat, also ab Anfang des Jahres.«
»Und?«
»Mehr als ein Drittel aller Anrufe gingen an ein und dieselbe Nummer.«
»Und wessen Nummer war das?«, fragte Hussein, obwohl sie die Antwort bereits erriet.
»Die von Frieda Klein.«
»Wirst du eine Pressekonferenz einberufen?«, wandte sich Bryant nach der Besprechung an Hussein.
»Ja, aber erst morgen.«
»Sollen wir sie zur Vernehmung kommen lassen?«
»Doktor Klein? Nein, noch nicht. Ich glaube, es gibt da ein paar Leute, mit denen ich vorher sprechen muss.«
Ihr fiel etwas ein, das sie schon die ganze Zeit wie ein leichtes Nagen im Hinterkopf spürte.
»Als unser Computer gleich zu Anfang den Namen Frieda Klein ausspuckte, ging es doch um eine Vermisstenmeldung. Miles Thornton. Kannst du dir das mal genauer ansehen?«
»Hereinspaziert, hereinspaziert«, sagte der Mann, während er nach ihrer Hand griff und sie einen Moment mit festem Griff umklammerte.
Hal Bradshaw war barfuß und wirkte auf eine kunstvolle Art unfrisiert. Seine Brillengläser waren von langen, schmalen Rechtecken umrahmt, die es einem schwer machten, seine Augen als Ganzes wahrzunehmen. Vielleicht war das ja der Sinn der Sache. Er führte sie in sein Arbeitszimmer, einen hellen Raum voller Bücherregale. Über dem Schreibtisch hingen mehrere gerahmte Zeugnisse und ein Foto, das Bradshaw zeigte, wie er einem prominenten Politiker die Hand schüttelte. Als er nun zu einem langen Sofa hinüberdeutete, ließ sie sich am einen Ende nieder, woraufhin er sich ziemlich dicht neben sie setzte. Er roch nach Sandelholz.
»Danke, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben, Doktor Bradshaw. Noch dazu an einem Sonntag.«
»Professor, um genau zu sein. Allerdings erst seit Kurzem.« Er lächelte bescheiden. »Ich hatte schon mit Ihnen gerechnet.«
Sie starrte ihn ein wenig überrascht an. »Ich weiß. Ich habe Sie ja angerufen und den Termin mit Ihnen vereinbart.«
»Nein, ich meinte, nachdem ich erfahren hatte, dass Frieda Klein die Leiche ihres Freunds gefunden hatte. Besser gesagt, ihres Exfreunds.«
»Darf ich fragen, wie Sie davon erfahren haben?«
Bradshaw zuckte mit den Achseln. »Das ist so abgesprochen.«
»Mit der Polizei?«
»Genau«, antwortete er. »Man hält mich auf dem Laufenden. In diesem Fall hat mich sogar der Polizeipräsident höchstpersönlich angerufen.«
»Wobei es gar nicht stimmt, dass Doktor Klein Alexander Holland gefunden hat. Sie war lediglich diejenige, die ihn identifizierte.«
»Ja, ja«, antwortete er, als würde sie damit nur untermauern, was er gesagt hatte. »Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Oder Kaffee?«
»Nein, danke. Ich bin hier, weil Polizeipräsident Crawford meinte, es wäre sinnvoll, wenn ich mir erst einmal ein paar Hintergrundinformationen über Doktor Klein beschaffe.«
Bradshaw schüttelte bedächtig den Kopf. Dabei setzte er eine Miene auf, die sein gut aussehendes Gesicht auf eine nachdenkliche Art traurig wirken ließ.
»Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, so gut ich kann.«
»Ich habe die Akte gelesen, die der Polizeipräsident mir gegeben hat. Können wir vielleicht mit dem Fall Dean Reeve beginnen?«
»Dean Reeve ist tot.«
»Ja, ich weiß, aber …«
»Aber Frieda Klein ist davon überzeugt, dass er noch lebt und dass er …«, er lehnte sich zu Hussein hinüber, »… es auf sie abgesehen hat.«
»Wissen Sie, warum sie dieser Meinung ist?«
»Ich habe ein Buch über genau dieses Thema geschrieben.«
»Vielleicht könnten Sie Ihre Argumentation kurz zusammenfassen.«
»Menschen wie Frieda Klein – kluge, redegewandte, neurotische, extrem reflektierte und auf Selbstschutz bedachte Menschen – können ein Persönlichkeitsmerkmal entwickeln, das wir narzisstische Wahnvorstellung nennen.«
»Sie meinen, sie erfindet Dinge?«
»Eine Person wie Frieda Klein hat das Bedürfnis, sich stets als Nabel der Welt zu fühlen, und ist unfähig, eigenes Versagen zu akzeptieren oder die Verantwortung dafür zu übernehmen. Was Dean Reeve betrifft, wissen Sie vielleicht – oder auch nicht –, dass er als direkte Folge von Doktor Kleins Einmischung eine Studentin ermordet hat.«
»Ich habe gelesen, dass eine Frau namens Kathy Ripon aller Wahrscheinlichkeit nach von Dean Reeve getötet wurde.«
»Doktor Klein hat das kompensiert, indem sie sich selbst eingeredet hat, dass er noch lebt und es auf sie abgesehen hat. Auf diese Weise macht sie sich selbst zur Zielperson und zum Opfer, zur Heldin der Geschichte, wenn Sie so wollen, statt sich mit den Folgen ihres eigenen Handelns auseinanderzusetzen.«
»Zumindest hat sie Matthew Faraday gerettet, oder etwa nicht?«
»Sie mischt sich gern in Ermittlungen ein, um anschließend die Lorbeeren zu ernten. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. In gewisser Weise handelt es sich dabei um ein weiteres Symptom. Wissen Sie denn auch Bescheid über die arme junge Frau, Beth Kersey, die von Frieda Klein getötet wurde?«
»Ich habe gelesen, dass Beth Kersey psychisch gestört war und das Ganze in Notwehr geschah.«
»Ja. Aber das ist nicht Frieda Kleins Version der Geschichte, oder? Sie behauptet vielmehr, sie habe Beth Kersey nicht getötet, weder in Notwehr noch sonst wie. Ihr zufolge war es Dean Reeve. Na, erkennen Sie allmählich ein Muster?«
»Ich erkenne zumindest, worauf Sie hinauswollen. Aber vielleicht hat sie ja die Wahrheit gesagt«, gab Hussein zu bedenken.
Bradshaw hob die Augenbrauen.
»Sarah«, sagte er. »Ich darf Sie doch Sarah nennen?« Genau wie der Polizeipräsident, dachte Hussein gereizt, ließ sich aber nicht zu einer Antwort herab. »Tja, Sarah, sie glaubt wahrscheinlich sogar selbst, dass sie die Wahrheit sagt – oder zumindest ihre Version der Wahrheit. Zum Glück bin ich ein gutmütiger, nachsichtiger Mensch und bilde mir außerdem ein, recht verständnisvoll zu sein.« Er legte eine Pause ein, doch Hussein hielt es nicht für nötig, dem etwas hinzuzufügen. »Auch wenn ich guten Grund zu der Annahme habe, dass sie tatsächlich mein Haus in Brand gesteckt hat.«
»Dafür haben Sie keine konkreten Beweise.«
»Ich weiß, was ich weiß.«
»Warum hätte sie das tun sollen?«
»Vielleicht bin ich das, was sie gern wäre. Ich habe mir einen gewissen Namen gemacht. Das ist ihr wohl ein Dorn im Auge.«
»Sie glauben, sie hat aus Neid Ihr Haus angezündet?«
»Es ist zumindest eine Theorie.«
»Worauf wollen Sie hinaus, Doktor Bradshaw?«
»Professor. Ich will Sie nur warnen. Sie sollten vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Die Frau kann recht überzeugend wirken. Außerdem hat sie sich mit Leuten umgeben, die sie in ihrer Geltungssucht bestärken. Ein paar von denen werden Sie wahrscheinlich kennenlernen. Vor anderthalb Jahren hat sie wegen einer angeblichen Vergewaltigung Alarm geschlagen, woraufhin zwei Leute ums Leben kamen. Und bestimmt wissen Sie auch, dass sie verhaftet wurde, nachdem sie auf einen anderen Therapeuten losgegangen war. Womöglich ein weiterer Rivale? Hmm?«
»Sie wurde nicht unter Anklage gestellt.«
»Meiner Meinung nach eskaliert ihr Verhalten allmählich. Ich war gar nicht überrascht, als ich hörte, dass man ihren Geliebten tot aufgefunden hat.«
»Was wollen Sie damit andeuten?«
»Ich möchte nur, dass Sie wissen, womit Sie es zu tun haben, Sarah.«
»Sie meinen, mit einer gewalttätigen Brandstifterin und an Wahnvorstellungen leidenden Irren, die möglicherweise mehrere Menschen getötet hat? Ich werde schon auf mich aufpassen.«
Bradshaw runzelte die Stirn, als fände er Husseins Ton verdächtig. »Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich, Sarah?«
»Mir war nicht klar, dass es hier darum geht, für eine Seite Partei zu ergreifen.«
»Dem Polizeipräsidenten dürfte es gar nicht gefallen, wenn Sie seine Warnungen ignorieren.«
Vor ihrem geistigen Auge tauchte der rotgesichtige Polizeipräsident Crawford auf. Dann dachte sie an die dunklen Augen und die versteinerten Züge von Frieda Klein, das fast unmerkliche Zucken, das über ihr Gesicht gehuscht war, als sie neben der Leiche stand.
»Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben«, erklärte sie, während sie sich erhob.
An der Tür legte Bradshaw ihr seine Hand auf den Arm.
»Werden Sie sich mit Malcolm Karlsson treffen?«
»Vielleicht.«
»Natürlich gehört er zu denen, die mit Klein zusammengearbeitet haben.«
»Aus Ihrem Mund klingt das, als wäre das etwas Schlimmes.«
»Er hat mit ihr an einem Strang gezogen.«
»Das klingt fast noch schlimmer.«
»Sie können sich ja selbst ein Urteil bilden.«
»Was soll ich sagen?«, meinte Detective Chief Inspector Karlsson. »Sie war eine geschätzte Kollegin, und mittlerweile sind wir befreundet.«
»Kannten Sie auch Alexander Holland?«
»Sandy.« Karlsson bemühte sich um einen sachlichen Ton, ließ sie dabei aber nicht aus den Augen. »Ja.«
»Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass er ermordet wurde.«
Karlsson war sichtlich schockiert. Er wandte einen Moment den Blick ab, bis er sich wieder einigermaßen gefangen hatte. Dann begann er Fragen zu stellen, und Hussein musste ihm alles von Anfang an erzählen, von der Entdeckung des Leichnams, seinem Zustand, dem Plastikband mit Friedas Namen an seinem Handgelenk und Friedas Besuch in der Rechtsmedizin. Er saß nach vorne gelehnt in seinem Sessel und hörte ihr aufmerksam zu.
»Können Sie mir etwas über seine Beziehung zu Doktor Klein erzählen?«, fragte sie.
»Eigentlich nicht.«
»Ich dachte, Sie sind mit ihr befreundet.«
»Frieda ist ein sehr verschlossener Mensch. Über solche Dinge spricht sie nicht. Die beiden haben sich vor gut einem Jahr getrennt, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.«
»Wer hat Schluss gemacht?«
»Das müssen Sie Frieda fragen.«
»Haben Sie ihn seitdem gesehen?«
Karlsson zögerte. »Ja, ein paarmal«, antwortete er schließlich widerstrebend, »aber jeweils nur kurz.«
»Hat es ihm zu schaffen gemacht, dass die Beziehung in die Brüche ging?«
»Auch das werden Sie Frieda fragen müssen. Ich kann mich dazu nicht äußern.«
»Es tut mir leid«, sagte Hussein, »aber meiner Meinung nach ist das keine richtige Antwort.«
»Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich es nicht wirklich weiß. Über so etwas würde Frieda nie mit mir sprechen.«
»Polizeipräsident Crawford scheint der Meinung zu sein, dass Doktor Klein bestenfalls unzuverlässig ist und schlimmstenfalls auf eine gefährliche Weise psychisch instabil.«
»Ach, Unsinn.«
»Er ist Ihr Chef.«
»Ja. Sie werden sich selbst ein Urteil bilden müssen.«
»Das habe ich vor. Und Doktor Bradshaw …« Sie brach ab und grinste in sich hinein. »Entschuldigung, Professor Bradshaw hat es noch drastischer ausgedrückt.«
»Sie waren ja ganz schön fleißig.«
»Demnach können Sie mir also gar nichts sagen, das mir eventuell weiterhilft?«
»Nein.«
Sie wandte sich zum Gehen, drehte sich dann aber noch einmal um.
»Haben Sie eine Ahnung, wofür die Initialen ›WH‹ stehen könnten?«
Karlsson überlegte einen Moment.
»Vielleicht für das Warehouse«, meinte er schließlich.
»Was ist das?«
»Eine therapeutische Einrichtung.«
»Hat Doktor Klein etwas mit dieser Einrichtung zu tun?«
»Sie arbeitet manchmal dort. Und sie gehört zum Vorstand.«
»Danke.«
Eine Beamtin namens Yvette Long führte sie hinaus. Die Frau machte dabei ein finsteres Gesicht, als hätte Hussein sie irgendwie beleidigt.
Beim Verlassen des Gebäudes erhielt sie einen Anruf von Bryant.
»Dieser Typ, den Doktor Klein vermisst gemeldet hat …«
»Ja?«
»Miles Thornton. Er war ein Patient von ihr.«
»War?«
»Er ging nur phasenweise zu ihr in Therapie – in letzter Zeit eher weniger, weil er ein paar Wochen lang in einer geschlossenen Anstalt verbringen musste. Er litt an einer Psychose und galt als Gefahr für sich selbst und andere. Jetzt scheint er verschwunden zu sein. Zumindest hat ihn in letzter Zeit niemand mehr zu Gesicht bekommen. Seine Angehörigen wirken allerdings nicht übermäßig besorgt: Sie sagen, er verschwinde öfter mal, ohne vorher Bescheid zu geben.«
»Aber Doktor Klein hat ihn als vermisst gemeldet.«
Es folgte eine kurze Pause. Hussein konnte sich genau vorstellen, wie Bryant nachdenklich auf dem Rand seines Daumens herumkaute.
»Warum ist das wichtig?«, fragte er schließlich.
»Wahrscheinlich ist es gar nicht wichtig. Aber findest du es nicht auch ein bisschen seltsam, wie viel Kummer und Gewalt diese Frau umgibt? Bradshaw würde sagen, dass das nur ein weiterer Beweis für ihre ›narzisstischen‹ Wahnvorstellungen ist.«
»Wie bitte?«
»Vergiss es. In diesem Fall mischen zu viele Ärzte und Professoren mit.«
6
Das Warehouse entsprach nicht Bryants Vorstellung von einer medizinischen Einrichtung. Die Kombination aus gelaugtem Kiefernholz, Metall und Spiegelglas ließ die Klinik eher wie eines der Kunstzentren wirken, durch die man als Kind bei Schulausflügen manchmal geschleust wurde. Und die Frau, mit der er am Vortag telefoniert hatte, sah auch nicht aus wie eine Verwaltungschefin. Mit ihren dunklen Augen und dem extravaganten Kleidungsstil kam sie ihm eher vor wie eine Flamencotänzerin oder eine Wahrsagerin. Bryant hatte ihr erklärt, er wolle über Frieda Klein sprechen, woraufhin sie sichtlich misstrauisch geantwortet hatte, Reuben McGill sei gerade mit einem Patienten beschäftigt, er werde also warten müssen.
Bryant wartete in Pazs Büro. Wenn sie telefonierte, erschien sie ihm wie ein völlig anderer Mensch: Sie lachte, schmeichelte oder gab in freundlichem Ton Anweisungen. Sobald sie jedoch auflegte und sich nach ihm umblickte, verfinsterte sich ihre Miene. Bryant versuchte, Konversation zu machen. Kannte sie Frieda Klein persönlich? Selbstverständlich, lautete die knappe Antwort. Schon lange? Ein paar Jahre. Sahen sie sich häufig? Immer dann, wenn Frieda in die Klinik kam. War das oft der Fall?