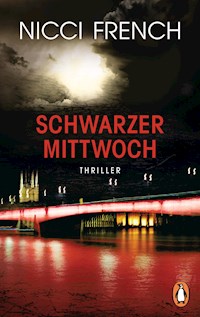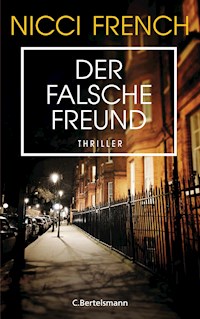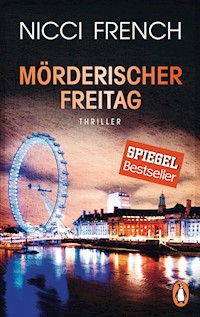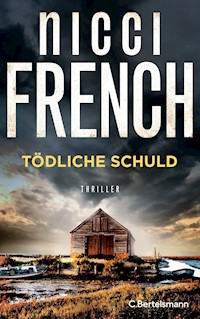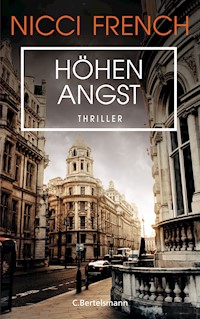2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die gefährlichen Schatten der Vergangenheit
Es soll ihr Abschiedsgeschenk sein: Jane – Exfrau des ältesten Sohnes der Familie Martello – plant den Bau eines Glaspavillons im Park des Landsitzes. Doch dann wird genau an der Stelle ein Skelett gefunden. Für Jane bricht eine Welt zusammen: Bei der Toten handelt es sich um Natalie, die seit 25 Jahren spurlos verschwundene Tochter des Hauses und Janes beste Freundin. Als sich herausstellt, dass die damals 16-Jährige schwanger war, hüllt sich die Familie in Schweigen. Nur Jane macht sich auf die Suche nach der Lösung des dunklen Geheimnisses – die für sie zu einer beängstigenden Begegnung mit der eigenen Vergangenheit wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nicci French
Der Glaspavillon
Aus dem Englischen von Petra Hrabak,Barbara Reitz und Christine Strüh
Der Glaspavillon
Jedes Jahr treffen sich die Mitglieder der Martello-Familie an einem Wochenende im Spätherbst auf ihrem feudalen Landsitz zur Pilzsuche. Es ist immer ein fröhliches Zusammenkommen, der Auftakt für die noch folgenden gesellschaftlichen Ereignisse. Doch diesmal wird im Park des Anwesens ein Skelett gefunden. Bei der Toten handelt es sich um Natalie, die seit fünfundzwanzig Jahren verschwundene Tochter des Hauses. Nach den ersten Untersuchungen steht fest, dass Natalie ermordet wurde. Die Familie ist schockiert. Vor allem Jane, Natalies Schwägerin und beste Freundin, ist zutiefst beunruhigt. Auf eigene Faust macht sie sich auf die Suche nach der Lösung des dunklen Geheimnisses …
Autoren
Hinter dem Namen Nicci French verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit langem sorgen sie mit ihren höchst erfolgreichen Psychothrillern für Furore. Sie leben mit ihren Kindern in London.
Von Nicci French außerdem bei Goldmann lieferbar:
Höhenangst. Roman (44893) Der Sommermörder. Roman (45425) Das rote Zimmer. Roman (45734) In seiner Hand. Roman (45946) Der falsche Freund. Roman (46176) Der Feind in deiner Nähe. Psychothriller (46576)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe von »Der Glaspavillon« erschien 1997 unter dem Titel »Memory Games« bei William Heinemann, London.
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Nicci French Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1997 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHNeumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: plainpicture.com/Schoo Flemming
ISBN: 978-3-641-24598-6V003
www.goldmann-verlag.de
FÜR EDGAR, ANNA, HADLEY UND MOLLY
1. KAPITEL
Ich schließe die Augen. In meinem Kopf ist alles noch da. Der morgendliche Dunst, der sich den Konturen des Bodens anschmiegt. Die beißende Kälte, die mir in der Nase schmerzt. Ich muss alle Kraft aufbieten, wenn ich mir ins Gedächtnis zurückrufen will, was sich an jenem Tag, an dem wir die Knochen – ihre Knochen – entdeckten, sonst noch zugetragen hatte.
Als ich den rutschigen, grasbewachsenen Abhang vor dem Haus hinabging, sah ich, dass die Arbeiter bereits warteten. Sie hielten Becher mit Tee in den Händen und rauchten. Ihr warmer, feuchter Atem stieg in Dampfwolken vor ihren Gesichtern auf. Zwar war erst Oktober, doch so früh am Morgen konnte man die Sonne hinter den Nebelschwaden nur erahnen. Ich hatte meinen Overall eine Spur zu ordentlich in die Gummistiefel gesteckt, während die Männer natürlich die übliche Kluft der Landbewohner trugen: Jeans, Acrylpullover und schmutzige Lederstiefel. Um sich warm zu halten, traten sie von einem Bein aufs andere, und sie lachten über etwas, das ich nicht hören konnte.
Als sie mich erblickten, verstummten sie sofort. Da wir uns alle seit Jahren kannten, wussten sie nicht so recht, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollten – jetzt, da ich ihr Boss war. Mir hingegen bereitete das keine Schwierigkeiten, weil ich auf Baustellen stets von Männern umgeben war, selbst auf ganz kleinen wie dem sumpfigen Fleckchen Land meines Schwiegervaters in Shropshire. Absurderweise wurde das Anwesen »Stead – Stammsitz« genannt, eine Bezeichnung, die zunächst die ironische Distanz der Familie zu ihrem Gutsherrentum verriet, die aber mit der Zeit immer ernster gemeint wurde.
»Hallo, Jim«, sagte ich und streckte ihm die Hand entgegen. »Sie konnten also der Versuchung nicht widerstehen, selbst herzukommen. Freut mich.«
Jim Weston gehörte zu Stead wie das Gewächshaus oder der Keller, in dem selbst an Ostern noch der süße Duft der Äpfel hing. Es gab keinen Gegenstand auf dem Anwesen, mit dem er nicht auf irgendeine Weise verbunden war. Er hatte die Fensterrahmen ausgewechselt und gestrichen und an glühendheißen Augusttagen mit nacktem Oberkörper das Dach gedeckt. Bei jedem Malheur – egal, ob es sich um den Schimmelbefall der Mauer, einen Stromausfall oder eine Überschwemmung handelte – rief Alan Jim aus Westbury zu Hilfe. Und stets weigerte sich Jim zu kommen. Zuviel zu tun, war die übliche Antwort. Doch eine Stunde später rumpelte sein klappriger Lieferwagen die Einfahrt hinauf. Dann besah Jim sich nachdenklich den Schaden, klopfte mit traurigem Kopfschütteln seine Pfeife aus und murmelte etwas von modernem unbrauchbaren Zeug. »Mal seh’n, was ich da tun kann«, sagte er schließlich. »Irgendwie werde ich es schon zusammenflicken.«
Es gehörte zu Jim Westons Eigenart, dass er nie etwas zum Listenpreis oder überhaupt für Geld kaufte, wenn es sich durch Gefälligkeit, im Tausch oder sogar über die verschlungeneren Pfade des Schwarzmarktes von Shropshire besorgen ließ. Als er meinen Plan für den Pavillon sah, wurde sein Gesicht lang und länger. Das Gästehaus – gedacht für Kinder, Kindeskinder, Ex-Frauen und sonstige Verwandte, die sich zu den Familienfeiern der Martellos zusammenfanden – war mein Abschiedsgeschenk an die Familie; ein Traumhaus, wie ich es für mich selbst bauen würde. Ich hatte mir die relativ geschützte Lage des Grundstücks zunutze gemacht und einen Pavillon von absoluter Transparenz entworfen. Nur Streben, Deckenträger und Glas. Es war ein Wunder an Funktionalität. Als ich Claud, meinem zukünftigen Ex-Ehemann, die Pläne zeigte, fuhr er sich zerstreut mit den Fingern durch sein schütteres braunes Haar und murmelte etwas von wirklich interessant und gut gelöst, was seine übliche Reaktion auf alles und jedes war; selbst meine Ankündigung, ich hätte mich zur Scheidung entschlossen, hatte er in diesem Stil aufgenommen. Ich hoffte, dass wenigstens sein Bruder Theo meine Absicht erkannte. Ihn erinnerte der Entwurf an seine alten Metallbaukästen, woraufhin ich erwiderte: »Ja, genau. Hübsch, nicht wahr?« Dabei war seine Bemerkung als Beleidigung gemeint. Schließlich unterbreitete ich den Plan dem Patriarchen selbst, Alan Martello, meinem Schwiegervater.
»Was ist das?« fragte er. »Ein Metallrahmen? Und wo ist das, was drum herum gebaut wird? Kannst du davon nicht auch eine Zeichnung anfertigen?«
»Das ist das Haus, Alan.«
Er schnaubte verächtlich in seinen grauen Bart. »Ich will nichts, was uns schwedische Architekturkritiker auf den Hals hetzt. Ich möchte etwas, in dem es sich wohnen lässt. Nimm das Stück Papier wieder mit und bau das Haus in Helsinki oder sonst wo weit weg von hier. Sicher wird dir irgendein durch Steuergelder finanziertes Komitee dafür einen Preis verleihen. Wenn wir schon so ein verdammtes Haus in unseren Garten stellen müssen – weshalb, will mir sowieso nicht ganz in den Kopf –, dann eins im englischen Landhausstil, aus Ziegeln und Sandstein oder einem anderen anständigen Material aus der Gegend.«
»Das klingt aber nicht nach dem zornigen jungen Alan Martello«, flötete ich. »Neue Wege in der Architektur, Innovation – hattest du dich nicht immer für so was begeistert?«
»Ich bin nicht mehr jung und auch nicht mehr zornig, außer über dich. Mach aus dieser strukturalistischen Scheußlichkeit etwas, das ich als Haus erkennen kann.«
So war Alan: umwerfend barsch und charmant. Ich war dankbar, dass er mich immer noch so liebevoll ausschelten konnte, obwohl ich im Begriff war, mich von seinem Sohn scheiden zu lassen. Trotzdem hielt ich hartnäckig an meinem Entwurf fest. Schließlich gab Alan nach, wohl auch vom Rest der Familie sanft dazu gedrängt.
»Was ist das hier, Mrs. Martello?« hatte Jim Weston beim Anblick des Bauplans gefragt und mit seiner Pfeife auf die Metallkonstruktion gedeutet.
»Jim, bitte nennen Sie mich Jane. Das sind Metallträger.«
»Hmm.« Er schob die Pfeife wieder zwischen die Lippen. »Geht das nicht auch mit Stein?«
»Jim, darüber können wir jetzt nicht diskutieren. Es gibt kein Zurück mehr. Alles ist bereits in Auftrag gegeben und bezahlt.«
»Hmm«, brummte er.
»Hier heben wir aus, nur einige Meter tief …«
»Nur«, murmelte Jim.
»Dann die Betonsockel, hier und hier; der Unterbau, die Isolierschicht und die Membrane, darüber der Estrich, anschließend das geflieste Erdgeschoß. Die Metallträger verankern, der Rest ist ein Kinderspiel.«
»Isolierschicht?« wiederholte Jim misstrauisch.
»Ja. Unglücklicherweise gibt es seit 1875 ein Gesundheitsgesetz, an das wir uns bis heute zu halten haben.«
Jetzt, zu Beginn des ersten Arbeitstages, ähnelte Jim mehr einem knorrigen Baum als einem Mann, der hergekommen war, um die Arbeiten zu überwachen. Sein Gesicht, das zeitlebens jedem Wetter ausgesetzt gewesen war, erinnerte an die Haut einer Kröte. Haarbüschel sprossen ihm aus Nase und Ohren. Weil er so alt war, bestand seine Rolle darin, seinen Sohn und seinen Neffen herumzukommandieren; ihre Rolle wiederum schrieb ihnen vor, seine Anweisungen nicht zu befolgen. Ich begrüßte die beiden jüngeren Männer ebenfalls.
»Was habe ich da gehört? Sie wollen auch graben?« fragte Jim misstrauisch.
»Nur den ersten Spatenstich. Ich habe gerade gesagt, ich möchte einen Spatenstich tun, wenn’s recht ist. Es ist wichtig für mich.«
Während meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Architektin habe ich mir etwas angewöhnt, das schon fast einem Aberglauben gleichkommt: Ich muss beim ersten Spatenstich dabei sein. Dies ist tatsächlich ein Moment rein sinnlichen Vergnügens, in dem ich mir oft wünsche, ich könnte mit eigenen Händen graben. Nachdem man Monate, manchmal sogar Jahre an der Erstellung von Plänen gearbeitet, nervöse Auftraggeber besänftigt und mit sturen Beamten im Baureferat verhandelt hat, nach all den Kompromissen und dem Papierkrieg tut es gut, nach draußen zu gehen und sich daran zu erinnern, dass es eigentlich nur um Erde und Ziegel und das richtige Anbringen der Rohre geht, damit sie im Winter nicht platzen.
Das Schönste daran sind die zehn bis fünfzehn Meter tiefen Aushebungen, die den eigentlichen Bauarbeiten vorausgehen. Man steht am Rand eines Baulochs im Herzen von London und blickt auf Jahrtausende vergangener Menschenleben. Zuweilen ahnt man noch die Überreste eines alten Hauses, und mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, wonach Bauunternehmer heimlich Beton über einen alten Fußboden aus der Römerzeit gegossen haben, um einer Auseinandersetzung mit den Archäologen aus dem Weg zu gehen. Denn oft muss man endlos warten, bis sie ihre Untersuchungen abgeschlossen haben und die Genehmigung zum Weiterbau erteilen. Wir errichten unsere Gebäude auf den Ruinen, die längst vergessene Vorfahren hinterlassen haben, und in einigen hundert oder tausend Jahren werden unsere Nachkommen ebenso vorgehen und auf unseren verrosteten Deckenträgern und dem bröckeligen Beton etwas Neues hochziehen. Auf unseren Toten.
Das hier würde nur ein winziges Loch werden, ein Kratzer an der Oberfläche. John reichte mir einen Spaten. Ich trat in die Mitte des rechteckigen Bauareals, das ich tags zuvor ausgemessen und mit einem Seil abgegrenzt hatte, und stieß den Spaten in den Boden.
»Pass auf deine Nägel auf, Mädchen«, hörte ich Jim hinter mir sagen.
Ich drückte den Spatengriff entschlossen nach unten und dann zu mir. Das Rasenstück wurde angehoben und legte ein keilförmiges Stückchen Erde und Lehm frei.
»Schön weich«, bemerkte ich.
»Die Jungs machen den Rest«, meinte Jim. »Wenn es Ihnen recht ist.«
Eine Hand auf meiner Schulter ließ mich zusammenzucken. Es war Theo. In meiner Erinnerung ist Theo Martello siebzehn Jahre alt; er trägt das schulterlange Haar in der Mitte gescheitelt, seine Haut ist blass, und die vollen, geschwungenen Lippen schmecken leicht nach Tabak. Er ist groß und dünn und trägt einen überlangen Militärmantel. Schwierig, zwischen ihm und meinem jetzigen Gegenüber eine Verbindung herzustellen, diesem – o Gott! – über vierzigjährigen Mann mit den scharf geschnittenen Gesichtszügen, dem Dreitagebart, dem kurzgeschnittenen, graumelierten Haar. Was war er älter geworden! Aber wir waren alle älter geworden!
»Wir sind gestern erst spät angekommen und haben dich nicht mehr gesehen«, sagte er.
»Ich bin früh schlafen gegangen. Aber warum bist du in dieser Herrgottsfrühe schon auf den Beinen?«
»Ich wollte dich unbedingt sehen.«
Er zog mich an sich und umarmte mich. Ich drückte mich fest an meinen Lieblingsschwager.
»Ach, Theo«, sagte ich, als er mich losließ. »Es tut mir leid. Es tut mir so leid wegen Claud.«
Er lächelte. »Mach dir keine Gedanken. Tu, was du tun musst. Es war mutig von dir, hier aufzutauchen und der ganzen Familie die Stirn zu bieten. Übrigens, wer kommt denn eigentlich?«
»Alle natürlich. Sämtliche Martellos. Und die Cranes auch, koste es, was es wolle. Dad und mein Bruder samt Familie sind noch nicht hier, aber mit ihnen sind wir vierundzwanzig. Das Königshaus mag untergehen, und möglicherweise ist uns die Bedeutung des Christfests abhandengekommen – aber die jährliche gemeinsame Pilzsuche der Martellos findet trotzdem statt.«
Theo zog die Brauen hoch. Beim Lächeln bildeten sich um seine Augen und um seinen Mund kleine Fältchen. »Wie immer die alte Spötterin!«
»Ach, ich glaube, ich bin einfach nervös. Mein Gott, Theo, erinnerst du dich an die Fähre, die vor Jahren gesunken ist? Ein Rettungsboot wurde zu Hilfe geschickt, aber die Frauen und Kinder konnten nicht hinüberklettern. Da hat sich ein Mann zwischen die beiden Schiffe gelegt, und sie sind über ihn hinweggestiegen.«
Theo lachte. »Und du warst die erschöpfte menschliche Brücke, stimmt’s?«
»Manchmal habe ich mich so gefühlt. Oder besser, wir, Claud und ich, haben uns so gefühlt. Das schwache Verbindungsglied zwischen den Martellos und den Cranes.«
Theos Gesicht verhärtete sich. »Du überschätzt dich, Jane. Wir gehören alle zusammen. Wir sind doch eine Familie. Und wenn es eine besondere Verbindung gibt, dann ist es die Freundschaft zwischen unseren Vätern, die schon lange vor uns existierte. Das sollten wir nicht vergessen.« Er lächelte wieder. »Du warst höchstens ein zweitrangiges Bindeglied. So was wie eine sekundäre Nut.«
Ich musste kichern. »Höre ich da einen technischen Fachausdruck? Was, zum Teufel, ist eine sekundäre Nut?«
»Schon gut, vergiss es – du bist die Expertin. Ich habe nie mit Holz gearbeitet. Und ich freue mich, dass du gekommen bist, auch wenn es für dich ein Spießrutenlaufen war.«
»Ich musste das hier beaufsichtigen, oder etwa nicht? Jetzt fürchte ich, dass ich über meinen Zeichnungen in Tränen ausbrechen und sie verschmieren werde.«
Wir traten durch die Flügeltüren in die Küche und nahmen uns jeder einen Becher Kaffee. Aus dem oberen Stockwerkwaren Tassengeklapper und rauschende Klospülungen zu hören.
»Mach die Tür hinter dir zu, verdammt noch mal. Es ist kalt«, schrie jemand von drinnen.
»Reg dich nicht auf, ich bin gerade auf dem Weg nach draußen.« Es war Jonah, Theos Bruder.
»Hallo, Fred«, begrüßte ihn Theo.
Jonah nickte über den abgedroschenen Martello-Witz. Er und Alfred waren Zwillingsbrüder, die einander zumindest als Kinder und Jugendliche zum Verwechseln ähnlich gesehen hatten. Theo hatte mir einmal verraten, die beiden hätten tatsächlich ohne Wissen der betreffenden jungen Damen mit der Freundin des jeweils anderen geschlafen.
»Man kann uns Zwillinge an der Nase unterscheiden, Theo«, belehrte ihn Jonah. »Fred ist der mit der roten Nase und ohne Sonnenbräune.«
»Ach ja, darauf wollte ich dich gerade ansprechen, Jonah. Woher stammt die Bräune diesmal?«
»Tucson, Arizona. Ein Kosmetikkongress.«
»Gut?«
»Ein paar interessante Möglichkeiten lagen in der Luft.« Jonah bemerkte Theos Lächeln. »Jetzt, da jeder so gesunde Zähne hat, müssen wir uns was Neues einfallen lassen.«
Theo beugte sich vor und sog den Dampf ein, der aus Jonahs Becher aufstieg.
»Anscheinend gehört dazu auch die Zahnpasta in Form eines heißen Getränks«, sagte er.
»Pfefferminztee«, antwortete Jonah. »Ich möchte den Tag nicht mit einem unnatürlichen Stimulans beginnen.«
Damit drehte er sich zu mir um, und seine tugendhafte Miene wich einem traurigen Lächeln. Mein Gott, würden mich an diesem Wochenende alle so anlächeln?
»Jane, Jane«, sagte er und umarmte mich mit einer Herzlichkeit, die nur dadurch beeinträchtigt wurde, dass er sich gleichzeitig bemühte, den Becher mit Kräutertee in einer Hand zu balancieren. »Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen.« Dann deutete er hinunter auf die Aktivität im Gras. »Toll, was du da für unsere Familie tust. Wenn es doch nur schon fertig wäre, dann müssten Meredith und ich nicht noch eine Nacht mit den Kindern in einem Zimmer verbringen. Sie haben höchstens drei Minuten am Stück geschlafen. Und Fred samt den Mitgliedern seiner Familie, die nicht im Internat sind, schliefen nebenan. Soweit ich informiert bin, sind die einzigen Paare, die ein Zimmer für sich haben, Alan und Martha und außerdem dein Sohn und seine Mieze.« Letzteres war eindeutig ein Seitenhieb.
»Alan wollte unbedingt, dass Jerry und Hana ein Zimmer für sich bekommen«, protestierte ich. »Vielleicht bedeutet es für ihn ein voyeuristisches Vergnügen. Ich weiß nicht einmal, wo mein jüngerer Sohn abgeblieben ist.«
»Geschweige denn mit wem«, fügte Jonah hinzu. »Aber ich würde es nie wagen, die unantastbare Tradition in Frage zu stellen, die dir das Recht einräumt, Natalies Zimmer zu bewohnen. Klingt wie eine Schlafzimmerposse.«
Ich folgte Jonah und Theo in die Küche zurück, aber mir war weder nach Essen zumute, noch wollte ich mich in die Menge derer einreihen, die Eisschrank und Herd umkämpften. Nirgends eine Spur von meinen Söhnen. Außer Alan und Martha, die das Vorrecht der Gastgeber genossen und sich erst später zu uns gesellten, fehlte so gut wie keiner. Claud, der nach seiner Nacht auf der Couch zerzaust und ein bisschen jämmerlich aussah, stand am Gasherd und rührte in einer großen Pfanne mit Eiern. Er nickte mir freundlich zu.
Vor genau einem Jahr hatte ich die vier Brüder zum letzten Mal zusammen in diesem Raum gesehen. In ihrer Freizeitkleidung wirkten sie wieder wie Studenten oder sogar Schuljungen, die lachten und einander neckten. Nur Claud bildete die Ausnahme – bei ihm wirkte legere Kleidung immer etwas deplatziert. Er brauchte eine Uniform und strikte Regeln. Die Zwillinge mit ihrer dunklen Haut und den hohen Wangenknochen hätten nach einer unbequemen Nacht auf einer Couch bestimmt umwerfend ausgesehen. Aber Claud benötigte acht Stunden Schlaf und einen gutgeschnittenen Anzug, um am besten zur Geltung zu kommen. Aber dann kam er tatsächlich sehr gut zur Geltung.
Ich schnappte mir eine Banane aus der Obstschale und verschwand mit meinem Kaffee wieder nach draußen. Die Dunstschleier lösten sich allmählich auf und wichen einem blauen Himmel. Es war fast acht Uhr. Ein schöner, wenn auch kalter Tag kündigte sich an. Vermutlich haben die meisten von uns eine Landschaft im Kopf, die auftaucht, sobald man die Augen schließt. Meine bestand aus den hügeligen, im Patchworkmuster aneinandergereihten Feldern und Wäldern rings um Stead. Jeder Baum, jeder Weg und jeder Zaun riefen Erinnerungen in mir wach, Erinnerungen an lange Sommertage und Wochenenden im Schnee, mit kahlen Bäumen oder Frühlingsblumen – und alles verschmolz ineinander, all die Jahre und Jahrzehnte. Das Herrenhaus selbst war alles andere als alt – der Stein über der Eingangstür trug die Inschrift »1909 – P. R. F. de Beer«, den Namen des unbekannten Mannes, der das Haus hatte bauen lassen. Aber auf uns hatte es immer alt gewirkt. Die Eingangstür, die von uns jedoch nie als solche genutzt wurde, befand sich auf der anderen Seite. Die Auffahrt, die von dort wegführte, mündete in die B 8372. Bog man links ab, gelangte man nach Wales, rechts ging es nach Birmingham. Doch dort, wo ich jetzt stand, vor Pullam Wood, sah ich über eine kleine Senke hinweg auf die Vorderfront des Hauses mit den Türen, durch die man das Wohnzimmer und die Küche betrat. Darüber waren die Fenster von Alans und Marthas Schlafzimmer und von den Gästezimmern. Noch ein Stockwerk höher befand sich Alans Büro, sein Allerheiligstes, das die gesamte Etage einnahm und von einem lächerlichen Holztürmchen gekrönt wurde. Obwohl das Haus groß war, wirkte es gemütlich, und obwohl es solide gebaut war, waren die Böden uneben und die Wände dünn wie Papier.
Ich erreichte den Rand des Waldes – in den ich mich nie vorwagte –, wandte mich nach rechts, streifte ein wenig umher und ging den Abhang hinab, bis ich bei den Männern angelangt war, die mit dem Bagger die Erde aushoben. Ich hörte das Geräusch eines Autos, Pauls unverwechselbarer Saab, ein erstklassiger Wagen, aber nicht so übertrieben, dass er gewisse politische Überzeugungen Lügen strafte. Dad stieg vorsichtig auf der Beifahrerseite aus und schlurfte hinüber zum Haus. Dann tauchte auf der gleichen Seite Erica auf und eilte Vater nach. Offenbar hatte sie auf dem Rücksitz gesessen, denn sie trug Rosie im Arm, die in nahezu theatralischer Haltung schlief. Paul sah sich um und entdeckte mich, und wir winkten uns zu. Jetzt waren alle da.
Kurz nach zehn hatten sich alle auf dem Rasen zur großen Pilzsuche versammelt. Die Familie nebst Anhang war so zahlreich, dass man sie für eine Jagdgesellschaft hätte halten können, wenn sich eine Meute Hunde in ihrer Mitte befunden hätte. Alle Brüder waren mit ihren Familien gekommen, mein Bruder Paul hatte sogar seine ehemalige und auch die derzeitige mitgebracht. Mir fiel eines dieser unlesbaren Kapitel des Alten Testaments ein: Alan zeugte Theo und Claud, Jonah und Fred. Chris zeugte Paul und Jane. Ohne mich waren es zwanzig Personen, die herumstanden und plauderten. Man war noch nicht abmarschbereit, weil ein Teil der jüngeren Generation auf sich warten ließ, unter ihnen bemerkenswerterweise Pauls drei Töchter mit seiner ersten Frau Peggy. Ungefähr zehn nach zehn tauchten sie auf, klobige Stiefel an den Füßen, langhaarig, ganz in schwarz, die gleiche gelangweilte Miene auf allen drei hübschen Gesichtern. Da ich an dem Ausflug nicht teilnahm, hielt ich mich etwas abseits und konnte die Szene gut überblicken. Himmel, was für eine Familie! Alle trugen abgewetzte Jeans und alte Pullover, nur Martha und Alan waren ordentlich gekleidet. Dies war ihr großer Tag! Alan trug ein grotesk korrektes langes Jackett, in dem ihm nicht mal die Niagarafälle etwas anhaben konnten. Sein Auftreten erinnerte immer etwas an einen Theater-Workshop, als sei der Darsteller in die Requisite geschickt worden, um sich dort als alternder Schriftsteller ausstaffieren zu lassen, der das Leben eines Gutsbesitzers führte. Er verfügte sogar über einen Stock, wie ihn Errol Flynn gern für seine Fechtkämpfe benutzte, die er auf umgestürzten Baumstämmen über rauschenden Flüssen ausfocht. Martha hingegen sah mit ihrem schneeweißen Haar bezaubernd aus, so schlank wie ihre Enkelinnen und wie diese ganz in Schwarz. Nur die Doc Martens fehlten. Ihrer Jacke sah man an, dass sie ausgedehnte Wanderungen erlebt hatte, und am Arm trug sie einen Weidenkorb in der genau richtigen Größe. So konnten die Pilze nicht durcheinanderpurzeln oder verderben. Die anderen hatten fast ausnahmslos Plastiktüten dabei. Ich hatte Martha einmal zu erklären versucht, Plastiktüten seien entgegen herkömmlicher Meinung gut für die Aufbewahrung von Pilzen geeignet, wenn man sie noch am gleichen Tag verzehren wollte – was wir stets taten –, aber Martha hatte mir gar nicht zugehört.
Alan klopfte mit seinem Stock auf den Boden. Ich erwartete beinahe einen Donnerschlag.
»Vorwärts!« rief er.
Bei jedem anderen hätte so ein Befehl lächerlich geklungen.
Dann überschlugen sich die Ereignisse. Ich ging ins Haus, setzte mich an den Küchentisch und wartete, bis man mich wieder brauchte. Nachdem ich die Zeitung zur Hälfte gelesen und ein paar Fragen im Kreuzworträtsel gelöst hatte, hörte ich ein Klopfen und blickte auf. Hinter der Glastür erkannte ich Jims Gesicht. Er sah blass und erschrocken aus und bedeutete mir, ihm zu folgen. Einen Moment lang sträubte sich etwas in mir, der Aufforderung nachzukommen.
Als ich aus der Tür trat, ging Jim bereits wieder auf den Bauplatz zu. Die Aushubarbeiten schienen fast beendet zu sein, und ich fragte mich, ob er mir das auf eine umständliche Art mitteilen wollte. Die Männer standen um den Bagger herum und machten Platz, als ich näher kam.
»Wir haben etwas gefunden«, sagte Jims Neffe. Er sah aus, als wäre er am liebsten davongelaufen.
Ich blickte zu Boden. Zunächst war nicht viel zu sehen. Karamelbraune Lehmerde, ein paar zerbrochene Ziegel. Woher stammen sie? Ach ja, hier musste der alte Grillplatz gewesen sein. Wie lange das schon zurücklag! Und dann waren da ein paar Knochen, schrecklich weiße Knochen, die aus der Erde herausragten. Ich sah die Männer an. Wollten sie, dass ich irgendetwas unternahm?
»Stammen die von einem Tier?« fragte ich. Absurd. »Vielleicht von einem Haustier, das man hier beerdigt hat?«
Jim schüttelte langsam den Kopf und kniete nieder. Ich wollte nicht hinsehen müssen.
»Hier sind ein paar Stofffetzen«, sagte er. »Kleine Stücke. Und eine Gürtelschnalle. Es muss sie sein. Natalie, ihr kleines Mädchen.«
Ich musste endlich hinschauen. Bisher hatte ich in meinem Leben nur eine Leiche gesehen. In den letzten Minuten ihres langen Leidens hatte ich die Hand meiner Mutter gehalten, hatte gesehen, wie der Tod jeden Ausdruck von ihrem Gesicht wischte und ihr gepeinigter Körper entspannt in die Kissen sank. Ich hatte meine Lippen auf ihr warmes Gesicht gedrückt. Tags darauf hatte ich es in der Aussegnungshalle noch einmal berührt – wächsern, kalt und hart. Und hier lagen nun die Überreste von Natalie, meiner geliebten Freundin, seit fünfundzwanzig Jahren für immer sechzehn Jahre alt. Ich kniete nieder und zwang mich, die Knochen genauer zu betrachten. Es mussten die von den Beinen sein, lang und dick. Ich erkannte Stoffreste, schwarz und schmutzig. Plötzlich fühlte ich mich seltsam unbeteiligt, nur neugierig. Kein Fleisch, natürlich nicht. Keine Sehnen. Die Knochen, die bereits freigelegt waren, lagen einzeln da. Die Erde um sie herum war dunkler als die übrige. Ob sich ihre Haare zersetzt hatten? Der Schädel war noch nicht freigelegt. Ich sah ihren schlanken Körper vor mir. In jenem Sommer braungebrannt. Ihren Leberfleck auf der rechten Schulter und ihre langen Zehen. Wie hatte ich das so lange vergessen können?
»Jemand sollte die Polizei rufen.«
»Ja, Jim, ja. Ich kümmere mich darum. Ich denke, wir sollten jetzt nicht weitergraben. Gibt es in Westbury eine Polizeistation?«
Es gab keine. Ich musste mir im Telefonbuch die Nummer der Polizei in Kirklow heraussuchen. Ich kam mir ziemlich albern vor, als ich jemandem am anderen Ende der Leitung mitteilte, wir hätten Knochen gefunden, wahrscheinlich die von Natalie Martello, die seit dem Sommer 1969 vermisst wurde. Doch sie nahmen mich ernst, und bereits nach kurzer Zeit trafen zwei Polizeiwagen ein, dann ein Zivilauto und ein Krankenwagen, der eher wie ein Lieferwagen aussah. Eigenartig, dass ein Krankenwagen Knochen einlud, die man ohne weiteres in einem kleinen Karton hätte abtransportieren können. Einer der Polizisten stellte mir seltsame Fragen, aber ich war so verwirrt, dass ich sie kaum beantworten konnte. Der Fundort wurde notdürftig mit einer zeltartigen Plane abgedeckt. Leichter Regen fiel.
2. KAPITEL
Das Messer schnitt durch die schwammigen Schichten bis in das cremefarbene Fleisch. Ich zog die schleimige Haut ab und warf ein genießbares Stück Hut in eine große Schüssel. Peggy trug einen weiteren, bis oben hin mit Pilzen gefüllten Eimer herein. Sie duftete nach Wald und Erde, und ihre khakifarbene Hose war ganz verdreckt. Ihre Stiefel hatte sie im Flur ausgezogen.
»Hier sind noch ein paar«, sagte sie und griff sich ein Messer.
Behutsam nahm ich die gelben Pfifferlinge, die zuoberst lagen und an Wachsblumen erinnerten, und schnupperte an den Rändern ihres trichterförmigen Hutes. Ein Geruch wie Aprikosen.
»Wer hat die gefunden?« fragte ich.
»Theo, wer sonst? Alles in Ordnung, Jane?«
»Du meinst, was Claud angeht?«
»Nein, den heutigen Tag.«
»Ich weiß nicht.«
Im Eimer fand ich außerdem warzige Knollenboviste, nach Anis duftende Schafchampignons und schmackhafte Austernpilze. Feuchter Pilzgeruch durchzog die Küche; wurmige Schirmlinge verstopften das Spülbecken, Stielreste bedeckten die Arbeitsflächen. Ich wischte mir die zitternden Hände an der Schürze ab und strich mir die Haare aus der Stirn. Obwohl die Küche hell erleuchtet war, kam mir alles unwirklich vor – sowohl die schauerliche Entdeckung im Garten als auch die Parodie der Alltäglichkeit hier in der chaotischen Küche, dem Mittelpunkt des großen Hauses. Waren wir alle verrückt geworden? Ein Haus voller Menschen, die unter Schock standen, Gefangene eines seltsamen Rituals? Ich stürzte mich in Geschäftigkeit.
»Ihr wart wirklich tüchtig«, sagte ich zu Paul, der soeben durch die Küche ging, ein paar verstaubte Rotweinflaschen an die Brust gedrückt.
»Du hättest dabei sein sollen! Doppelt so viele hätten wir mitbringen können! Manche sind allerdings ungenießbar.«
Bevor er wieder hinausging, warf er einen verstohlenen Blick auf Peggy. Er wirkte abgekämpft. Jeder von uns musste mit seinen Gedanken und Problemen selbst fertig werden. Aber Paul hatte die zusätzliche Belastung, dieses Wochenende in Gesellschaft seiner Ex-Frau, seiner jetzigen Frau und seiner Schwester verbringen zu müssen, die im Begriff war, sich von seinem besten Freund scheiden zu lassen. Man durfte einfach nicht zu viel nachdenken.
Ich begann, die Pilze zu zerkleinern. In den Töpfen siedete das Wasser. Es beruhigte mich, Dinge koordinieren zu können. Ich öffnete die Backofentür und stach mit einer Gabel in die roten Paprikaschoten, deren Haut Blasen warf.
»Jane? Claud hat mich gebeten, dir diese hier zu bringen.« Mein Vater streckte mir drei pralle Knoblauchzehen entgegen. Bereits im Hinausgehen – vermutlich wollte er rasch zurück zu seinem Kreuzworträtsel neben dem Kaminfeuer – fügte er plötzlich hinzu: »Es wird schon alles wieder in Ordnung kommen, meinst du nicht auch?« Seine Augen waren verquollen, als hätte er geweint. Ich tätschelte seinen Rücken.
»Bestimmt«, sagte ich mechanisch.
Ich schälte sechs Knoblauchzehen und zerdrückte sie in einer großen Pfanne auf dem Herd. Peggy stand über das Spülbecken gebeugt und putzte die restlichen Pilze. Dabei summte sie leise vor sich hin. Plötzlich sagte sie: »Es tut mir wirklich leid, es muss schrecklich für dich gewesen sein, als du es … sie … gefunden hast.«
»Ja«, bestätigte ich, »aber nicht schlimmer als für die anderen.«
Ich mochte nicht reden. Ich behielt meine Gefühle für mich und wollte sie nicht hier ausbreiten, während ich das Abendessen kochte. Nicht vor Peggy. Doch sie war nicht zu bremsen.
»Ihr wart alle sehr tapfer. Es ist komisch, aber zum ersten Mal habe ich mich von der Familie ausgeschlossen gefühlt. Ihr wisst, wie ihr miteinander umgehen müsst.«
Ich wandte mich zu ihr um und nahm ihre Hand.
»Peggy«, sagte ich matt, »das stimmt nicht, das weißt du genau. Wir alle gehören zu dieser Familie, die bei Alan und Martha beginnt und nirgendwo endet.«
»Ich weiß. Vielleicht liegt es daran, dass ich Natalie nicht gekannt habe.«
»Es liegt lange zurück.«
»Ja«, sagte Peggy, »die sagenhafte und idyllische Kindheit in der Familie Martello. Da seid ihr euch alle einig, nicht wahr? Das erinnert mich immer …« Sie brach ab, weil sie etwas vor dem Fenster bemerkte. »Sieh dir das an! Ich bringe sie um! Weshalb kann Paul ihnen nicht die Leviten lesen? Angeblich ist er doch der Vater!«
Und schon stürmte sie aus der Küche. Durchs Fenster sah ich, dass ihre Töchter wie Verschwörer hinter einem Busch beisammenstanden und rauchten. Sie hielten sich offenbar für unsichtbar. Noch immer ohne Schuhe pirschte Peggy sich lautlos an sie heran. Jerry und Robert hatten früher in ihrem Zimmer bei weit geöffnetem Fenster geraucht und waren anschließend nach Zahnpasta riechend nach unten gekommen. Ich hatte nie ein Wort darüber verloren. Auch ich hatte damals heimlich geraucht. Spätabends im Garten, wenn ich keinen Schlaf finden konnte, weil ich über mein Leben nachsann. Später rauchten Jerry und Robert auch in meiner Gegenwart und boten mir sogar Zigaretten an, obwohl ich das Rauchen zu jener Zeit bereits aufgegeben hatte. Heute hätte ich allerdings alles für einen tiefen Zug gegeben.
Ich verrührte den blassgelben Knoblauch in der Pfanne. Endlich allein. Endlich eine kurze Verschnaufpause, um nachzudenken und mich auf den bevorstehenden Abend vorzubereiten.
»Wie steht’s, Mum? Böse, dass du die ganze Kocherei allein machen musst?«
Robert beugte sich zu mir herunter. Mein großer, hübscher Sohn. Sein glattes, blondgefärbtes Haar hing ihm schräg ins eine Auge. Er trug zerrissene Jeans, ein altes verwaschenes Sweatshirt und darüber ein kariertes Hemd, nicht zugeknöpft. Er war barfuß und sah gut aus.
»Geht schon. Es ist mir sogar ganz recht. Könntest du den Salat waschen?«
»Eigentlich nicht«, antwortete Robert, öffnete den Kühlschrank und spähte hinein. »Gibt’s da drin was für mich zu essen?«
»Nein. Was machen die anderen?« wollte ich wissen.
»Guter Gott, bei wem soll ich anfangen?« Mit spöttischer Geste zählte er sie an den Fingern ab. »Theo spielt Schach mit Chris. Dad bastelt eigentlich nur an der Sitzordnung rum und delegiert die Platzierung der Teller. Jonah, Alfred und Meredith machen einen Spaziergang; wahrscheinlich wollen sie klammheimlich einen Blick in dieses Zelt da draußen werfen. Hana und Jerry liegen miteinander in der Badewanne. Und so weiter und so fort. Großvater und Großmutter habe ich nicht gesehen. Sie sind bestimmt oben in ihrem Zimmer.«
Es entstand eine Pause. Robert blickte mich gespannt an. Ich kippte die Pilze in das heiße Öl. Er wartete auf etwas.
»Was gibt’s?« fragte ich so neutral wie möglich.
Plötzlich bekam ich weiche Knie, und mir wurde flau im Magen. Robert schloss die Hände um den Mund und begann wie durch ein Megaphon zu sprechen. Seine Stimme klang zornig.
»Hallo, hallo, ist jemand dort draußen? Hier spricht Rob Martello, ein Besucher aus der realen Welt. Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass auf dem Grundstück Knochen gefunden worden sind. Die einzige Tochter von Mr. und Mrs. Martello lag fünfundzwanzig Jahre lang zirka einen Meter von der Haustür entfernt und fünf Zentimeter unter der Erdoberfläche begraben. Die Veranstalter bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass aufgrund dieses Funds das Abendessen erst ein wenig später serviert werden kann. Wir hoffen, Ihnen damit keine Unannehmlichkeiten zu bereiten.«
Unwillkürlich musste ich lachen, aber es klang matt.
»Robert!«
Es war Claud, der hinter Robert hereingekommen war. »Ich weiß, das ist alles sehr unangenehm …«, begann er, wurde jedoch sofort von Robert unterbrochen.
»Was? Unangenehm? Man hat die Leiche deiner Schwester im Garten ausgebuddelt! Was soll daran unangenehm sein? Außerdem liegt es doch bereits mehrere Stunden zurück, oder etwa nicht? Und die Polizei hat die Knochen beseitigt. Vielleicht hätte Alan die Beamten bitten sollen, vor ihrem Wegfahren das Loch wieder zuzuschütten. Im jetzigen Zustand besteht die Gefahr, dass jemand morgen früh auf dem Weg zur nächsten gottverdammten Pilzsuche reinfällt und sich an die Sache erinnert.«
Claud bemühte sich vergebens, ein strenges Gesicht zu machen. Er lächelte resigniert.
»Du hast recht, Rob, wir werden nicht besonders gut damit fertig, aber …«
»Aber der Schein muss gewahrt werden. Ein paar Knochen dürfen den Martellos schließlich nicht ein tolles Wochenende vermasseln. Sonst geht womöglich noch was Wichtiges schief. Zum Beispiel könnte der falsche Wein zum falschen Pilz serviert werden.«
Claud wurde ernst. »Robert, hör auf damit. Natalie war bereits vor deiner Geburt verschwunden. Daher ist es für dich schwierig, das zu verstehen. Wir haben uns mit der Zeit an den Gedanken gewöhnt, dass Natalie wohl tot ist. Aber deine Großmutter, meine Mutter, wollte es sich nie eingestehen. Sie hat immer versucht, sich einzureden, dass Natalie nur weggelaufen ist und eines Tages wieder auftaucht.« Claud legte den Arm um Robert, was ihm dank seiner Körpergröße auch gelang. »Der heutige Tag ist schrecklich für sie. Er ist für uns alle furchtbar, aber ganz besonders für sie. Wir müssen stark sein und sie unterstützen. Glück im Unglück, dass es passiert ist, während wir alle hier versammelt sind. So können wir uns gegenseitig trösten. Aber vor allem müssen wir Martha zur Seite stehen. Es gibt viel zu bereden, Robert, nicht nur in Bezug auf Natalie. Und das werden wir auch tun, ich verspreche es. Aber heute sollten wir vielleicht einfach nur zusammen sein. Vergiss nicht, dass die Überreste offiziell noch nicht identifiziert worden sind.«
»Und ist es da nicht das beste, einfach nur gemeinsam zu essen?« fügte ich hinzu. »Komm her, mein Liebling.« Ich zog Robert an mich. »Ich komme mir albern vor, weil ich dir nur bis ans Kinn reiche.«
»Also, hilfst du mir, Rob?« fragte Claud.
»Ja, ja, Dad, in Ordnung«, sagte Robert. »Wir können uns alle wie erwachsene Menschen benehmen. Vielleicht ließe sich aus dem Loch da draußen eine Attraktion machen. Mum, könntest du nicht vielleicht einen neuen Entwurf von deinem Pavillon machen, so dass er das Loch umschließt?«
»Wirst du uns nun helfen oder nicht?« fragte Claud mit einer für ihn typischen plötzlichen Schärfe.
Robert hob übertrieben unterwürfig die Hände. »Ja. Ich werde mich benehmen«, versicherte er und verließ die Küche.
Hilflos zuckten Claud und ich die Achseln. Seitdem wir über die Trennung gesprochen hatten, kamen wir besser miteinander zurecht, und ich spürte, dass ich mich vor gefährlicher Nostalgie hüten musste.
»Danke«, sagte ich. »Gut gemacht.«
Claud beugte sich über eine Kasserolle. »Das duftet herrlich«, sagte er. »Wie du gesagt hast: Wir sind immer noch gute Freunde, nicht wahr?«
»Hör auf.«
»Ich meine ja nur.« Er machte eine Pause. »Ich denke, wir essen um neun. In Ordnung?«
Er musterte mich. Ich trug eine Trainingshose und ein Herrenhemd, das früher einmal Jerome gehört hatte. Ich hatte das erstbeste übergezogen, das mir nach der heißen Dusche in die Hände gefallen war. Alles hatte ich wegwaschen wollen: den Schweiß von der harten körperlichen Arbeit, die Tränen, die schlammige Erde, in der das Skelett gelegen hatte.
»Gut. Dann muss ich mich allerdings sofort um das Fleisch kümmern.«
Ich zerrieb Rosmarin über den halbfertigen Lammbraten und schob ihn in den Ofen. Zu meiner Verwunderung leistete Claud mir weiterhin Gesellschaft, obwohl er doch sicher alle Hände voll zu tun hatte. Er lehnte sich gegen die Arbeitsplatte und drehte einen Pilz in seinen Fingern hin und her.
»Sie halten uns für verrückt.«
»Wer?«
»Die Leute aus der Gegend. Sie essen nur die Pilze in den Schachteln, die man in den Supermärkten bekommt. Aber es ist doch klar, was sie abstößt. Die Pilze sehen ein bisschen aus wie Fleisch, findest du nicht auch? Alles andere als bekömmlich.«
Claud strich mit dem Finger über den Pilz.
»Pilze haben kein Chlorophyll. Sie können den Kohlenstoff nicht selbst erzeugen und müssen sich von anderen organischen Stoffen ernähren.«
»Ist das nicht bei allen Pflanzen so?«
»Es macht mir manchmal Sorgen, dich so reden zu hören«, bemerkte er mit traurigem Unterton in der Stimme, und schlagartig wurde mir klar, dass ich mich ab jetzt nicht mehr darüber zu ärgern brauchte.
»Wie geht es Martha? Hast du mit ihr gesprochen?«
»Mutter geht es wunderbar«, entgegnete Claud.
Der Ton seiner Stimme ließ keinerlei Zweifel daran, dass ich mich heraushalten sollte. Gerade wollte ich ebenso kühl antworten, als Peggy mit roten Wangen und verdreckten Wollsocken in die Küche stürmte. Sie schnappte sich ein Glas und eine Flasche Whisky und lief wieder hinaus.
»Peggy«, rief Claud ihr nach, »vergiss nicht, wir essen in ungefähr einer Stunde, und dann gibt es jede Menge Wein!«
»Claud!« zischte ich vorwurfsvoll, doch Peggy besaß ein großes Selbstbewusstsein. Ich hörte sie nur verächtlich schnauben, während sie die Treppe hochstapfte. Claud wandte sich wieder mir zu und erkundigte sich ausnehmend freundlich: »Alles in Ordnung, Jane?«
In diesem Moment stürzte Erica herein – eine Wolke von Parfüm, purpurrote Fingernägel und kupferfarbene Locken.
»Claud, endlich hab ich dich gefunden. Theo braucht dringend deine Hilfe. Im oberen Stockwerk müssen unbedingt Betten umgestellt werden. Jane, mein Engel, kann ich dir was helfen?«
Sie hatte sich bereits zum Abendessen umgezogen. Ihr langer, geschlitzter Rock schleifte über den Boden, die auberginefarbene Seidenbluse bauschte sich über ihrem üppigen Busen, Armreifen klimperten an ihren Handgelenken, lange Ohrringe baumelten ihr fast auf die Schultern. Verglichen mit der armen Peggy und ihrer trägen, demonstrativen Nachlässigkeit wirkte sie wie eine exotische Pflanze.
»Peggys kleine Mädchen haben sich gerade in den Schuppen verdrückt«, kicherte sie nun. »Ach, noch mal fünfzehn sein und in einem Schuppen rauchen. Himmel, was für ein seltsamer, schrecklicher Tag. Arme Natalie. Ich meine, man kann doch sicher davon ausgehen, dass es Natalie ist und nicht irgendein archäologisches Überbleibsel. Sie ist es bestimmt, und ihr habt allen Grund, euch mies zu fühlen. Ich empfinde den Tod von Kindern ganz anders seit der Sache mit Rosie, weißt du. Natürlich hätte es mir vorher auch was ausgemacht, aber jetzt würde ich mich wahrscheinlich umbringen. Frances und Theo meinen, dass es für Martha und Alan eine Erleichterung ist. Aber ich frage mich, ob das stimmt.«
Sie tauchte ihre Krallen in eine Schüssel mit Oliven und schob gedankenverloren ein paar in ihren großen roten Mund.
Claud begann systematisch die Flaschen zu entkorken, bis acht aufgereiht nebeneinanderstanden. Ich rieb Parmesankäse in die dampfende Pfanne mit Pilzrisotto und fügte ein Stück ungesalzener Butter hinzu – nicht aus dem Kühlschrank, sondern aus der Speisekammer, wie sich das für Butter gehört. Ich hatte mir immer eine Speisekammer gewünscht. Vor dem Fenster sah ich Theo und seine Frau Frances groß und elegant vorbeigehen. Frances redete lebhaft auf ihn ein; ihre Augen wirkten hart, aber ich konnte weder ihre Worte hören noch Theos Gesicht sehen. Plötzlich drehte mein Schwager den Kopf zu mir und sah mir geradewegs in die Augen.
Wenn ich auf Stead bin, bewohne ich dasselbe Zimmer wie damals in meiner Kindheit. Natalie und ich stritten uns früher eher wie Schwestern denn als Freundinnen darum, wer in dem Bett am Fenster schlafen durfte, wobei Natalie sich gewöhnlich durchsetzte. Sie war hier zu Hause, es war ihr Zimmer, ihr Bett. Nach ihrem Verschwinden war es mir unmöglich, dort zu schlafen, wo sie gelegen hatte. Ich nahm das Bett gegenüber, unter der Dachschräge, hörte die Schläge der Standuhr aus dem Flur im Erdgeschoß und zuweilen die Rufe der Eulen aus dem nahen Wald. Wenn ich mitten in der Nacht aufwachte, sah ich manchmal für einen Moment die Umrisse von Natalies Körper unter den Laken, bevor mir wieder alles einfiel. Martha hatte nichts von Natalies Sachen weggeräumt, weil sie stets mit ihrer Rückkehr rechnete. Jedes Jahr, wenn wir in den Ferien zu Besuch kamen, musste ich meine Kleider zwischen die von Natalie legen, die in Folie verpackt waren. Sie wurden mir zusehends fremder, bis ich bemerkte, dass es die Anziehsachen eines jungen Mädchens waren, aus denen ich herausgewachsen war, hinein in das Erwachsenendasein. Eines Tages waren sie nicht mehr da.
Ich zog die Vorhänge zurück und blickte aus dem Fenster auf den Garten, der allmählich in der Dunkelheit verschwand. Wie Rauch schwebte der Abendnebel über dem Gras. Der Himmel war tiefblau, nur der Horizont schimmerte noch rosa. Morgen werden wir schönes Wetter haben, schoss es mir durch den Kopf. Seltsam geformte Laubhaufen lagen auf dem Rasen und warteten darauf, verbrannt zu werden. Weiter rechts sah ich noch eine Erhebung, etwas niedriger – das Zeltdach der Polizei. Ob es irgendwo eine Firma zur Herstellung von Zelten gab, die man über Leichenfundorten aufstellte? Offensichtlich. Alles war ganz still. Unten am Waldrand saßen Pauls drei Töchter, ihre Körper verschmolzen zu einem einzigen dunklen Schatten. Vom Erdgeschoß drangen Stimmen zu mir herauf, doch ich konnte keine Worte verstehen. In einem Rohr gurgelte es, ein Abfluss vor dem Haus rauschte. Ich hörte Schritte vor meinem Zimmer. Wahrscheinlich waren es Jerome und die schöne Hana, die vorbeischlichen, rosig vom Duschen und in Handtücher eingehüllt. Ich meinte, ein unterdrücktes Schluchzen zu vernehmen.
3. KAPITEL
Marthas und Alans Auftritt wirkte wie einstudiert. Mein Schwiegervater, der bei seinem Eintritt gerade etwas zu seiner Frau sagte, unterstrich seine Worte mit einer Geste seiner großen Hände. Sein Bauch wölbte sich üppig über den Gürtel, der Bart sah eher ungepflegt aus, und das graue Haar fiel ihm bis auf den Kragen. Der grellfarbene Schlips hingegen entsprach der neuesten Mode, und sein Tweedjackett war untadelig. Immer ganz der Bohemien, der auf seine Kleidung keinen Wert legte – allerdings ein Bohemien von der reichen Sorte. Er umarmte Frances, die zufällig an der Tür stand, und bedachte Jerome mit einem herzhaften Klaps auf den Rücken. Jerome, mit kurzgeschnittenem Haar, in Jeans und schwarzem T-Shirt, wirkte traurig und befangen. Er widmete sich ausschließlich Hana, die von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet war, was ihre slawischen Züge betonte.
»Jetzt sind wir ja alle versammelt!« rief Alan. »Ich brauche unbedingt etwas zu trinken.«
Martha neben ihm wirkte blass und schmaler, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihre glänzenden Augen verrieten, dass sie in den letzten Stunden geweint hatte. Jonah ging zu ihr und küsste sie auf die Wange. Er war ein gutaussehender Mann mit dunklen Haaren und blauen Augen. Weshalb hatte ich weder ihn noch Fred je attraktiv gefunden – wie Theo in jenem langen heißen Sommer? Unserem Sommer. Vermutlich, weil jeder der beiden wie ein halber Mann wirkte. Selbst ihre Ehefrauen, ihr Beruf, ihr Heim hatten keine eigenständigen Persönlichkeiten aus ihnen gemacht. Für mich waren sie immer noch Jonah-Fred, die Zwillinge, und ich fand ihre Ähnlichkeit nach wie vor ein bisschen komisch, wenn nicht sogar absurd. Ob sie die Leute noch immer zum Narren hielten?
Als Claud die erste Champagnerflasche entkorkte, hielten ihm alle erwartungsvoll die Gläser entgegen. Jemand flüsterte mir etwas ins Ohr. Es war Peggy.
»Ich bin mir nicht sicher, ob Champagner den Umständen wirklich angemessen ist!«
Ich zuckte unverbindlich die Achseln. Alan klopfte mit dem Feuerzeug gegen sein Champagnerglas, und als er sich sicher war, dass ihm alle ihre Aufmerksamkeit schenkten, trat er in die Mitte des Zimmers. Eine ganze Weile herrschte völlige Stille. Alan blickte gedankenvoll in die Runde. Als er endlich zu sprechen begann, war seine Stimme so leise, dass wir alle die Ohren spitzen mussten.
»Ihr wisst, wie gerne ich euch mit einem Scherz begrüße, aber unser Treffen hat eine andere Wendung genommen als geplant. Gewiss möchte jeder von euch wissen, was ich gerade mit Clive Wilks, dem Chef der Kriminalpolizei in Kirklow, am Telefon besprochen habe. Er hat sich verständlicherweise sehr vorsichtig geäußert, aber auf meine Frage, ob es die sterblichen Überreste eines sechzehnjährigen Mädchens sein könnten, meinte er, das sei durchaus möglich. Was natürlich keine große Überraschung ist.« Er lächelte dünn. »Ich fürchte, der Bau von Janes wunderschönem Pavillon muss erst einmal verschoben werden.
Das Pilzessen ist uns zur Tradition geworden, und die Zusammenkunft unserer beiden Familien mit allen Kindern und nächsten Angehörigen bedeutet mir sehr viel.« Die Zuhörer wurden unruhig. Worauf wollte er hinaus? »Aber an heute werde ich mich bis ans Ende meiner Tage erinnern. Vor fünfundzwanzig Jahren ist unsere Tochter Natalie verschwunden. Eine Zeitlang glaubten wir, oder zumindest versuchten wir zu glauben«, er blickte zu Martha, die mit den Tränen kämpfte, »dass sie davongelaufen war und wieder zu uns zurückkommen würde. Diese Hoffnung verblasste zwar mit der Zeit, schwand jedoch nie vollständig. Auf jemanden vergeblich zu warten, ist schrecklich, wirklich ganz schrecklich. Heute haben wir sie nun gefunden und können endlich angemessen ihren Tod beweinen. Sie kann nun zur letzten Ruhe gebettet werden. Ich denke, ich sollte etwas über sie sagen, ich sollte sie, meine einzige Tochter, beschreiben. Aber mir fehlen die Worte.«
Auf einmal war Alan ein verlorener, trauriger alter Mann. Ich hörte ein deutlich alkoholisiertes Flüstern an meinem Ohr.
»Dieser elende Schauspieler. Er liebt so was, stimmt’s?«
Fred. Er war bereits betrunken. Ich bedeutete ihm, still zu sein.
»Sie war klug, schön und jung; das Leben lag noch vor ihr.« Ich hörte ein unterdrücktes Schluchzen, wusste aber nicht, aus welcher Ecke es kam. »Sie war aufsässig, und sie war stur.« Jetzt rannen Tränen über Alans Wangen. »Sie mochte keine Abschiede. Schon als kleines Mädchen schob sie mich weg, wenn ich sie vor der Schule umarmen wollte. Nie winkte sie aus einem Bus, immer hielt sie den Blick nach vorn gerichtet. So war sie, mein kleines Mädchen, nie sah sie zurück. Doch jetzt können wir uns von ihr verabschieden.« Alan blickte auf das Glas in seiner Hand. Etwas gefasster fügte er hinzu: »Damit beginnt für uns ein neuer Lebensabschnitt.« Er legte einen Arm um Marthas schmale Schultern; sie hielt sie gestrafft, um nicht von ihrem Kummer überwältigt zu werden. »Vielleicht kann ich jetzt sogar wieder ein ordentliches Buch schreiben«, fügte er mit einem kurzen Auflachen hinzu. »Wie auch immer, ihr sollt wissen, wie ich mich freue, dass wir alle hier versammelt sind. Ihr alle habt Natalie geliebt und sie euch.« Er hielt sein Glas in die Höhe, und der Champagner funkelte im Schein des Feuers. »Ich erhebe mein Glas auf Natalie.«
Wir sahen einander an. Entsprach das den Regeln des guten Geschmacks?
»Auf Natalie.«
Ehe ich auch nur einen Schluck trinken konnte, hatte ich bereits die Hälfte verschüttet, denn Fred hatte mich überschwänglich an sich gedrückt.
»Es tut mir leid wegen deiner Ehe, Jane«, erklärte er mit schwerer Zunge. »Und wegen des Pavillons. Ich habe mich schon so darauf gefreut, dort übernachten zu können. Aber jetzt wird für immer ein Geist darin umherwandern, stimmt’s?«
»Das würde ich nicht sagen.«
»Doch, doch«, bekräftigte Fred. »Aber die eigentliche Frage ist …« Hier legte er eine so lange Pause ein, dass ich schon dachte, er hätte endgültig den Faden verloren, »… ob es ein glücklicher oder ein unglücklicher Geist ist.«
»Keine Ahnung«, antwortete ich und suchte nach einem Fluchtweg.
»Und welche Geheimnisse er lüften wird.«
»Ja, aber jetzt essen wir erst mal«, sagte ich und fügte mit lauter Stimme hinzu: »Bitte zu Tisch!«
Es war vorbei. Auf der zu Beginn so stilvoll gedeckten Tafel herrschte ein wüstes Durcheinander. Das Kerzenlicht machte die Gesichter weicher, die Stimmen wirkten gedämpft. Bei den jungen Leuten, die vor dem Feuer Karten spielten, kam keine Spur von Ausgelassenheit auf. Sogar Alan sprach leise, als er einen Vortrag über den Zustand des zeitgenössischen Romans hielt und dabei den Stiel seines Glases zwischen den Fingern drehte. Ich war erneut in Freds Fänge geraten, der mir doch tatsächlich vorschlug, Claud und ich sollten seine Frau Lynn mit der Abwicklung unserer Scheidung beauftragen. Bevor er mir jedoch die Vorzüge dieser Lösung genauer erklären konnte, wurde Lynn auf ihn aufmerksam und schickte ihn zu Bett.
»Ich falle nur, wenn ich gestoßen werde«, erklärte er, als Lynn ihn unerbittlich nach oben geleitete.
»Alles in Ordnung mit ihm?« fragte ich Lynn, als sie wieder nach unten kam.
Lynn war eine gutaussehende, selbstsichere Frau, wie immer sehr elegant in ihrem dunklen Samtrock.
»Er ist mit der Umstrukturierung des Trustfonds beschäftigt«, erklärte sie. »Ganz schön nervenaufreibend.«
»Kündigungen?«
»Stellenabbau«, sagte sie.
Ich hoffte, sie würde mir mehr darüber erzählen, aber als sie anfing, mir ihr Mitgefühl wegen der bevorstehenden Scheidung kundzutun, verlor ich das Interesse. Ich suchte nach einem Vorwand, das Gespräch beenden zu können und trat zu Hana und Jerome, der immer noch schmollte. Aber auf meine Fragen erhielt ich nur einsilbige Antworten. Daraufhin ging ich zu Theo, der ins Feuer starrte und zusammenzuckte, als ich seine Schulter berührte. »Verzeihung«, bat ich ihn.
Er drehte sich um, schien mich aber kaum wahrzunehmen.
»Mir gehen die albernsten Dinge durch den Kopf«, erklärte er. »Als Natalie noch klein war, elf oder zwölf, übten wir im Sommer Rad schlagen. Ich schaffte es immer nur, wenn ich es ganz schnell machte. Natalie lachte mich dann aus und meinte, ich würde die Beine nicht weit genug in die Höhe strecken. Sie machte es mir vor, wobei ihr das Kleid oder der Rock manchmal bis über den Kopf rutschte. Wir Jungen lachten sie dann aus. Allerdings schaffte sie es langsam, wie es sich gehörte. Runter auf die Hände, dann ein Bein langsam in die Höhe, dann das andere, wie zwei Speichen eines Rads. Und wieder runter. Perfekt. Aber wir waren zu stolz, um ihr das zu sagen.«
»Das hat sie bestimmt nicht gestört«, sagte ich. »Sie wusste immer, was sie konnte.«
»Ich erinnere mich, wie sie drüben am Fenster im Sessel saß und las – dabei hatte sie immer diesen verärgerten Gesichtsausdruck, wenn sie sich konzentrierte. Komisch.«
Ich nickte, brachte aber keinen Ton heraus. Ich war noch nicht soweit.
»Kennst du das alte Klischee: Man kommt von der Schule und muss feststellen, dass sich die kleine Schwester zur Frau gemausert hat? So habe ich es ein bisschen empfunden, als sie zwischen vierzehn und sechzehn war. Ich kam in den Ferien nach Hause, und sie ging mit den Jungs aus, mit denen sie früher gespielt hatte. Dann tauchte Luke auf, erinnerst du dich?« Ich nickte. »Ich fühlte mich ganz komisch. Nicht besonders gut. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, dass wir alle erwachsen wurden, auch Natalie, die irgendwann Kinder kriegen würde. Aber dazu ist es nie gekommen.«
Er drehte sich zu mir. Seine Augen standen voller Tränen. Ich griff nach seiner Hand.
»An diesen ernsten Blick erinnere ich mich gut«, sagte ich leise. »In diesem furchtbaren, völlig verregneten Sommer, als sie mir erklärte, sie würde jetzt jonglieren lernen, und dann tagaus, tagein mit den drei blöden Bohnensäckchen übte. Auf ihrem Gesicht erschien dieser grimmige Ausdruck, und man sah immer ihre Zungenspitze in einem Mundwinkel. Jeden Tag trainierte sie, und irgendwann klappte es tatsächlich!« Wir saßen ganz nahe beieinander und tuschelten wie zwei Verliebte. »Ich sehe sie noch hier vor dem Feuer liegen. Die Flammen spiegelten sich in ihren Augen. Ich lag direkt neben ihr. Wenn uns jemand ansprach, kicherten wir nur. Lieber Himmel, bestimmt waren wir ziemlich nervig.«
Endlich lächelte Theo.
»Das kann man wohl sagen.«
Der Bann war gebrochen. Im Hintergrund öffnete Claud gerade eine Flasche Portwein. Der dickflüssige, purpurfarbene Wein gluckerte leise in die Gläser auf dem Tablett. Claud hob die Hände, und das Gemurmel verstummte. »Auf die Köchin!« sagte er und lächelte mich wehmütig über die Reste des Mahls hinweg an. Auf einmal wirkte dieses Festessen fast wie ein Abschied. Ich fragte mich, wie es wohl weitergehen mochte, und spürte, dass ich Angst hatte vor der Zukunft.
4. KAPITEL
In der morgendlichen Kälte wollte mein Auto zunächst nicht anspringen. Der Motor stotterte und starb etliche Male ab, bis er sich schließlich freigehustet hatte. Ich kurbelte das Fenster herunter und blickte in das finstere Gesicht meines jüngeren Sohnes.
»Tschüs, Jerome, tschüs, Hana. Ruft mich an, wenn ihr wieder in London seid. Und fahrt vorsichtig.«
Hana gab mir einen Kuss durchs Fenster. Rosie warf ich eine Kusshand zu, worauf sie mit dem Finger auf mich zeigte und ihn anschließend in die Nase steckte. Paul lud eine Unmenge Gepäck in sein Auto. Als ich ihn rief, winkte er mir zu. Alan und Martha standen nebeneinander, um mich zu verabschieden. Ich lehnte mich aus dem Fenster, ergriff Alans Hand und drückte sie.
»Alan« sagte ich, »sollen wir uns treffen, wenn du das nächste Mal in London bist?«
Mir war unbehaglich zumute, als würde ich ihn bitten, mit mir in Kontakt zu bleiben. Er strich mir mit der Hand übers Haar.
»Jane«, meinte er, »du wirst immer unsere Schwiegertochter bleiben. Nicht wahr, Martha?«
»Natürlich«, sagte sie und umarmte mich.
Sie duftete so vertraut nach Puder und Holzfeuer. Sie hatte es immer verstanden, umwerfend sexy und gleichzeitig beruhigend schlicht zu sein. In ihren Augen standen Tränen, als sie mich zum Abschied küsste, und für einen Augenblick überfiel mich der brennende Wunsch, das, was ich in die Wege geleitet hatte, ungeschehen zu machen: die Trennung von ihrem Sohn und die elenden Pläne für den Glaspavillon, die zur Entdeckung ihrer toten Tochter geführt hatten. Sie drückte meine Hand.
»Eigentlich bist du für uns sogar noch mehr eine Tochter als eine Schwiegertochter.« Zögernd fügte sie hinzu: »Lass mich nicht im Stich, Liebes.«
Was meinte sie damit? Wie sollte ich sie im Stich lassen? Claud trat mit einem eleganten Koffer aus dem Haus. Er kam ein paar Schritte auf uns zu, blieb dann aber stehen. Er würde das Ganze mit Würde tragen, aber weiterhin für mich da sein, dachte ich, während ich ihn betrachtete. Wie vertraut dieser Mann mir war. Ich wusste, wo er seine Jeans gekauft und in welcher Reihenfolge er seine Sachen in den Koffer gelegt hatte. Wusste, welche Musik er im Auto hörte und dass er die Tachonadel nicht höher als auf hundertzehn klettern ließ. Bestimmt rief er mich sofort von seiner neuen kleinen Wohnung in Primrose an, um sich zu vergewissern, dass ich gut daheim angekommen war. Anschließend würde er sich einen Whisky einschenken und sich ein Omelett backen.
Robert, den ich in meinem Wagen nach London mitnahm, saß still und angespannt neben mir. Sein blasses, glattes Gesicht war unbewegt. Ich legte für einen Moment meine Hand auf seine, dann hob ich sie, um Claud zu winken. Er nickte uns zu.
»Auf Wiedersehen, Jane!« rief er und stieg in sein kleines Auto.
Wir verließen Stead gleichzeitig. Während der langen Fahrt durch Shropshire sah ich Clauds blaues Auto und sein dunkles Haar im Rückspiegel. Als wir die Autobahn erreicht hatten, schaltete Robert laute Musik ein. Ich drückte aufs Gaspedal, und bald hatten wir Claud weit hinter uns gelassen.
Zigaretten sind etwas Wundervolles. Jeden Morgen ging ich erst einmal unter die Dusche und anschließend im Bademantel einen Stock tiefer. Ich mahlte mir ein wenig Kaffee, goss frisch gepressten Orangensaft in ein Glas und zündete mir die erste Zigarette an. Während ich rauchte, überdachte ich Pläne für neue Projekte. Ich rauchte, sooft ich den Telefonhörer zur Hand nahm. Ich rauchte im Auto – mein Gott, wie sehr hätte Claud das verabscheut. Oft rauchte ich auch im Dunkeln, abends. Ich sah zu, wie die glühende Spitze Leuchtspuren in der Luft hinterließ. Meine Tage waren eingeteilt in kleine Nikotinportionen. Und ich rauchte jeden Morgen beim Durchblättern der Zeitung, wenn ich nach Neuigkeiten über Natalies Überreste suchte, die man inzwischen mit Hilfe gerichtsmedizinischer Untersuchungen zweifelsfrei identifiziert hatte. Der Guardian schrieb über die »unglückliche Tochter des angry young man«. »Martello-Tragödie« hieß es in der Mail. Alan gab Interviews. Meistens waren Archivbilder dabei, die ihn als jungen Mann zeigten, zu Zeiten größeren Erfolgs.
Gegen Ende der Woche rief mich ein Kriminalbeamter aus Kirklow an. Man wollte sich rein routinemäßig mit mir unterhalten. Nein, ich bräuchte nicht extra nach Kirklow zu kommen, zwei Beamte hätten nächste Woche ohnehin in London zu tun. Wir vereinbarten einen Termin, und am Dienstag der folgenden Woche saßen Punkt elf Uhr dreißig zwei Kriminalbeamte im vorderen Zimmer: Detektive Sergeant Helen Auster, die das Gespräch führte, und Detektive Constable Turnbull, ein kräftiger Mann mit straff nach hinten gekämmtem Haar. Ich kochte Kaffee, und Turnbull und ich zündeten uns eine Zigarette an.
Auster trug ein nüchternes graues Flanellkostüm. Sie hatte hellbraunes Haar und durchdringende gelbliche Augen, die offenbar auf einen Punkt hinter meinem Kopf gerichtet waren. Sie trug einen Ehering und war jung, schätzungsweise zehn Jahre jünger als ich. Während wir an unserem Kaffee nippten, tauschten wir Belanglosigkeiten über London aus. Sie hatten es offensichtlich nicht eilig, zur Sache zu kommen. Schließlich schnitt ich das Thema an.
»Treffen Sie sich hier in London mit allen Verwandten von Natalie?«
Helen Auster lächelte und warf einen Blick in ihr Notizbuch. »Wir kommen gerade von Ihrem Vater, von Mr. Crane«, sagte sie mit einem leichten Birmingham-Akzent. »Nach dem Mittagessen sind wir mit Theodore Martello in seinem Büro auf der Isle of Dogs verabredet. Anschließend fahren wir zur BBC-Zentrale und führen dort ein Gespräch mit Ihrem Bruder Paul.«
»Sie werden den größten Teil des Tages im Verkehr festsitzen«, stellte ich mitleidig fest. »Glauben Sie denn, dass sich jemand nach so langer Zeit überhaupt noch an etwas erinnert?«
»Wir müssen ein paar Dinge klären.«
»Glauben Sie, dass Natalie ermordet wurde?«
»Nicht auszuschließen.«
»Weil sie vergraben wurde?«
»Nein, weil es Hinweise gibt, dass sie erwürgt wurde.«
»Reichen die Knochenfunde aus, um das feststellen zu können?«
Auster und Turnbull wechselten einen Blick.
»Ein kleines Detail hat uns darauf gebracht«, erklärte Auster. »Bei einer Strangulation bricht meistens das Zungenbein, das zwischen Unterkiefer und Kehlkopf liegt. Dieser Knochen ist bei der Toten gebrochen. Allerdings befand sich die Leiche lange Zeit in der Erde.«
»Jemand muss die Leiche vergraben haben«, sagte ich.
»Richtig«, bestätigte Auster.
»Hat diese Person sie auch umgebracht?«