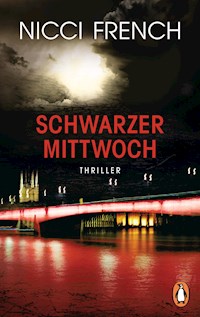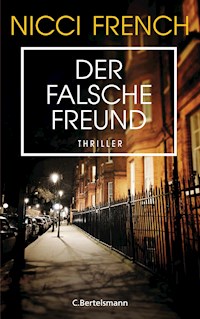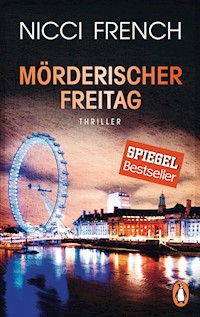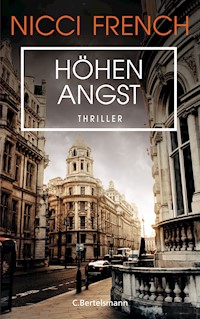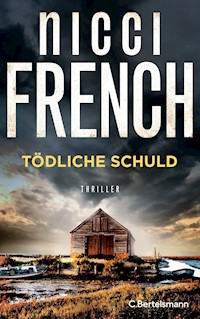
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der süchtig machende Thriller der Bestsellerautoren: Wenn ein kleiner Gefallen zum tödlichen Verhängnis wird ...
Liam war Judes erste Liebe, doch nach einem tragischen Unglück vor vielen Jahren verschwand er ohne Erklärung aus ihrem Leben. Nun steht er plötzlich wieder vor ihr – und bittet sie um einen Gefallen. Jude ist inzwischen erfolgreiche Ärztin und glücklich verlobt, doch mit Liam fühlt sie sich noch immer verbunden, und so sagt sie zu. Schließlich handelt es sich nur um eine winzige Kleinigkeit. Doch wenige Tage später steht die Polizei vor ihrer Tür: Liam ist tot, ermordet. Jude ist die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat und gilt somit unmittelbar als Hauptverdächtige. Sie weiß, dass nur sie allein herausfinden kann, was wirklich geschah. Doch je tiefer sie in Liams Leben eintaucht, desto unwiederbringlicher verstrickt sie sich in einem tödlichen Netz aus Lügen und Geheimnissen, und bald ist auch ihr eigenes Leben in Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
NICCI FRENCH – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit über zwanzig Jahren sorgen sie mit ihren außergewöhnlichen Thrillern international für Furore und verkauften weltweit über acht Millionen Exemplare. Die beiden leben in Südengland. Zuletzt erschien die achtteilige Bestsellerserie um Ermittlerin Frieda Klein sowie die Stand-Alone-Thriller Was sie nicht wusste, Eine bittere Wahrheit und Ein dunkler Abgrund, die ebenfalls sofort nach Erscheinen in die SPIEGEL-Bestsellerliste einstiegen. Mit ihrem neuen Thriller Tödliche Schuld halten sie ihre Leser*innen erneut in Atem.
»Nicci French schreibt brillante Psychothriller.« BRIGITTE
»Nicci French – das ist einfach immer wieder eine Garantie für spannende Unterhaltung.« hr4
»Nicci French macht absolut süchtig.« The Independent
www.cbertelsmann.de
NICCI FRENCH
TÖDLICHE SCHULD
THRILLER
Aus dem Englischen von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Favour bei Simon & Schuster, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2022
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Irmgard Perkounigg
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildung: mauritius images / Geoffrey Stradling / Alamy / Alamy Stock Photos; www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29585-1V001
www.cbertelsmann.de
Für Kersti
Prolog
Ein Kreischen gellte durch die Nacht. Sie wusste nicht, ob es von ihr selbst kam oder von ihm, während er die Hände vors Gesicht riss, oder vom Wagen, als er mit schlitternden Reifen von der Fahrbahn geriet. Plötzlich war da ein Moment der Stille, der Baum vor der Windschutzscheibe, schwarzes Laub im Scheinwerferlicht. Metall knirschte, dann ging das Licht aus. Sie schlug mit dem Gesicht hart auf, Schmerz explodierte in ihrem Schädel zu grellen Farben. Als sie den Kopf hob und die Augen öffnete, sah sie pulsierende Abstufungen von Blau, Rot und scheußlichem Violett. Ein Gefühl von Entsetzen durchflutete sie, schlimmer als der Schmerz.
»Bitte helft mir«, sagte Jude, an niemanden gerichtet.
Sie waren auf der Heimfahrt von einer Party, mit Liams rostigem altem Fiat, bei dem ein Seitenspiegel nur noch von Klebeband gehalten wurde und jedes Mal ein unheilvolles Rattern einsetzte, sobald es etwas steiler bergauf ging. Vorne saßen Jude und Liam, hinten Yolanda und Benny, wobei Benny völlig weggetreten war, den Kopf an Yolandas Schulter, den Mund weit offen, und Yolanda ebenfalls fest schlief. Jude warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett: Es war zwei Uhr morgens, aber immer noch warm nach einem glühend heißen Tag. Es fühlte sich an, als würde jeden Moment der Himmel aufreißen und sich eine Regenflut in die ausgedörrte, rissige Erde ergießen.
Es war überhaupt ein heißer Sommer gewesen. Jude musste daran denken, wie sie im Mai und Juni ihr Abitur geschrieben hatte, während gleißendes Sonnenlicht durch die großen Fenster fiel: mit schwitzigen Fingern, Schweißperlen auf der Stirn und feuchten Flecken unter den Achseln. Das erschien ihr inzwischen so weit weg, wie eine andere Welt, denn seit Mitte Juni war sie verliebt – trunken vor Liebe wie nie zuvor. Ihr Körper schmerzte regelrecht davon. Sie konnte spüren, wo seine Finger sie berührt hatten. Ihre Lippen waren wund. Auf der Party hatte er sie in den Garten hinausgeführt und geküsst, bis sie sich beinahe vor aller Augen auf den Rasen gelegt hätte, doch er hatte geflüstert: »Später.« Sie spürte noch seinen heißen Atem in ihrem Ohr. Nun war später: Sie würden Yolanda absetzen, Benny aus dem Wagen hieven, bis zu seiner Haustür zerren und dann weiterfahren, in den Wald. Liam hatte im Kofferraum seines Wagens eine Decke liegen. Ihr machte es nichts aus, wenn es regnete. Sie stellte sich vor, wie sich ihre nassen Körper aneinanderpressen würden, und empfand einen Schauder der Vorfreude.
Sie sah zu ihm hinüber. Er spürte ihren Blick und legte seine Hand auf ihren Oberschenkel, den dünnen Stoff ihres Kleides. Liam Birch: so gar nicht ihr Typ. Liam war neben der Spur – Jude nicht. Sie wusste schon seit der Grundschule, dass sie mal Ärztin werden würde, und arbeitete seitdem ohne Unterbrechung hart darauf hin. Sie hatte bereits einen Studienplatz, und wenn ihre Prüfungsergebnisse es zuließen – woran sie nicht zweifelte –, wäre sie in sechs Wochen auf dem Weg nach Bristol.
Liam wusste noch nicht, wie es bei ihm weitergehen sollte. Er war handwerklich sehr geschickt, konnte fast alles reparieren und mit wenigen Bleistiftstrichen etwas höchst Lebendiges, Verblüffendes schaffen. Jude hatte ihm mehrfach geraten, Kunst zu studieren, doch er zuckte jedes Mal nur mit den Schultern und antwortete, er wolle erst mal sehen, wie sich die Dinge entwickelten, als läge die Entscheidung gar nicht bei ihm – als würde ihn das Leben einfach überrollen und mit sich tragen. Vielleicht würde er auf Reisen gehen, meinte er: weg von dieser mittelgroßen Stadt in Mittelengland, wo er schon sein Leben lang mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder wohnte. Sie blickte auf die Hand hinunter, die warm und schwer auf ihrem Oberschenkel lag. Was würde passieren, wenn sie zur Uni ging? Sie hatten nicht über die Zukunft gesprochen, und auch kaum über die Vergangenheit. Sie wusste nicht viel über Liams Familie, seine Kindheit, seine früheren Beziehungen. Was zählte, war jetzt und hier: das wunderbare Gefühl, dass ihr Körper sich irgendwie aufzulösen schien, sobald er sie berührte oder sie nur daran dachte, wie er sie berührte – die Art, wie er sie ansah und ihren Namen sagte.
Sie waren nicht in dieselbe Schule gegangen. Liam hatte die Oberstufe der großen Schule besucht, die am Rand der Stadt in Shropshire lag, wo sie beide lebten, und Jude die Gesamtschule. Trotzdem hatte sie ihn wahrgenommen, eine hochgewachsene, schlaksige Gestalt mit dunklem Haar, das dringend geschnitten gehörte, und Klamotten, die nie neu aussahen: zerrissene Jeans, T-Shirts mit geheimnisvollen Aufschriften, eine seltsame grüne Jacke, die an jedem anderen schrecklich ausgesehen hätte, er jedoch gut tragen konnte. Sie hatte ihn in den vergangenen zwei Jahren des Öfteren registriert, wie er mit einer Gruppe anderer Teenager die Straße entlangging, rauchte, aus Dosen trank und dabei immer cool und unglaublich erfahren wirkte.
Ein paar Tage nach ihrer letzten Prüfung stellte ein Freund sie ihm auf einer Party vor. Sie wartete darauf, dass er sagen würde: »Hey, Jude«, um anschließend über seinen eigenen Witz zu lachen, doch das tat er nicht. Sie rechnete damit, dass er sich gleich wieder umdrehen und zu seiner eigenen Clique zurückkehren würde, doch auch das tat er nicht. Stattdessen erzählte er ihr von einem Fuchswelpen, den er an dem Tag überfahren hatte, und dass er erst gedacht habe, ein kleines Kind sei vor ihm auf die Straße gelaufen. Der Fuchs habe noch gelebt und erbärmlich geschrien, sodass sich schnell ein paar Schaulustige versammelt hätten. Er habe ihn töten müssen, erklärte er, indem er ihm einen Stein vom Gehsteig gegen den Kopf knallte, und anschließend in den Wald gebracht. Fast eine halbe Stunde habe er den noch warmen, durchdringend riechenden Kadaver auf dem Arm getragen. Er kam ihr leicht zugedröhnt vor. Seine Pupillen wirkten vergrößert, weshalb seine Augen in dem schwachen Licht sehr dunkel, fast schwarz aussahen. Überrascht stellte Jude fest, wie freundlich er wirkte, und wie jung. Beinahe – nun ja, beinahe normal. Einfach ein gut aussehender Junge.
Die ersten paar Wochen war es ein wundervolles Geheimnis, das sie wie einen Schatz hütete. Sie erzählte es nicht einmal ihren Freundinnen, weil sie nicht wollte, dass sie die Augen verdrehten oder es durch irgendeine beiläufige Bemerkung als unwichtig abtaten – oder aber als allzu wichtig oder allzu erstaunlich einstuften. Sie wollte nicht hören, dass eine von ihnen auch schon mit ihm zusammen gewesen war oder von einer wusste, die es war, oder Getratsche über ihn mitbekommen hatte: über seinen Leichtsinn und seine plötzlichen, unerklärlichen Wutausbrüche. Sie wollte nicht, dass jemand sagte: »Bei dem musst du aufpassen.« Selbst jetzt widerstrebte es ihr noch, darüber zu reden. Hin und wieder gingen sie zusammen auf eine Party, so wie an diesem Abend, und erst gestern hatten sie den Tag mit einer Gruppe von Freunden am Fluss verbracht. Sie hatte mit Rosie über ihn gesprochen, während sie am Flussufer nebeneinander im hohen Gras lagen, den Blick auf den blauen Himmel gerichtet. Ihren Eltern aber hatte sie es nicht erzählt. Sie wusste, dass sie beunruhigt wären von Liam, der Gras rauchte, Pillen schluckte, manchmal ein bisschen ungewaschen aussah und nicht zur Uni gehen würde. Vielleicht machte gerade das seine Anziehungskraft aus: dass er einer war, den ihre Eltern nicht gut fänden. Im September würde sie sowieso nach Bristol aufbrechen. Er war ihr Intermezzo, ihr Sommer, ihre Auszeit.
»Mir ist ein bisschen schlecht«, murmelte Yolanda auf dem Rücksitz, noch im Halbschlaf.
»Dreh das Fenster runter«, meinte Liam.
»Ich glaube, ich muss wirklich kotzen.«
»Nicht in meinem Wagen!«
»Es dauert nicht mehr lang bis zu dir«, erklärte Jude. »Sag uns trotzdem, wenn wir anhalten sollen.«
Doch Yolanda gab keine Antwort, weil sie wieder eingeschlafen war. Aus ihrer Richtung kam ein gurgelndes Schnarchen, dann ein Grunzen.
Jude fühlte sich selbst leicht beschwipst. Liam hatte auch viel getrunken und weiß Gott was eingeworfen. Doch es war nur eine kurze Fahrt. Ein paar große Tropfen landeten auf der Windschutzscheibe. Sie hob eine Hand, um sein Gesicht zu berühren, und spürte, dass er lächelte.
Dann sagte er: »Fuck!«, oder schrie es.
Denn vor ihnen beschrieb die Straße eine scharfe Kurve, doch der Wagen fuhr geradeaus weiter, weg von der Straße, auf die Bäume zu. Das alles passierte schrecklich langsam, wie in Zeitlupe, mit beängstigend klarem Blick auf die Kata-strophe und eine Welt, die nie wieder sein würde, wie sie war.
Ein Kreischen gellte durch die Nacht.
Jude konnte nicht sagen, in welche Richtung sie lag. Ihr Kopf pochte vor Schmerz, erst die eine Kopfhälfte, dann die andere. Hinten schluchzte Yolanda heftig. Von Benny war gar nichts zu hören.
»Seid ihr verletzt?«, meldete sich Liam in der Dunkelheit zu Wort. Sein Ton klang drängend.
»Ich kann nichts sehen.« Jude hob eine Hand und berührte ihr Gesicht, das sich warm und klebrig anfühlte. »Ich blute«, erklärte sie.
»Kannst du aussteigen?«, fragte Liam.
»Ich weiß nicht. Yolanda? Benny? Seid ihr in Ordnung? Was ist passiert? Was machen wir denn jetzt?«
Liam stieg aus, kam auf ihre Seite und half ihr aus dem Wagen. Sie war nicht fähig zu stehen, ihre Beine zitterten zu sehr, deswegen ließ er sie ins Gras sinken. Schemenhaft konnte sie sein bleiches Gesicht erkennen. Er wandte sich wieder dem Wagen zu, um Yolanda zu helfen, die vom Auto weg stolperte und sich dann heftig auf die Straße übergab. Jude hörte Erbrochenes auf den Asphalt klatschen.
Es fing zu regnen an. Sie hörte Liam auf Benny einreden.
»Atmet er?«
»Ja, er atmet. Aber er braucht Hilfe. Ich rufe einen Krankenwagen.«
»Muss das sein?«
Liam ging neben ihr in die Hocke und wischte ihr mit dem Saum seines T-Shirts Blut aus dem Gesicht. »Es wird alles gut.«
Tränen und Regentropfen brannten auf ihren Wangen. Ihre Zunge fühlte sich geschwollen an. »Das ist ein Albtraum!«
Liam sprach inzwischen in sein Telefon. Wie konnte er so ruhig bleiben? Jude ließ den Kopf sinken und schlug die Hände vors Gesicht. Sie hörte Yolanda schluchzen und den Wind in den Bäumen wehen und irgendwo draußen in der nassen Dunkelheit den Ruf einer Eule.
Dann in der Ferne eine Sirene.
Als Erstes traf der Krankenwagen ein, wenige Minuten später ein Streifenwagen, dann noch einer. Blaulicht zuckte über den Wald, über die in den Baum gerammte Motorhaube und die bleichen, verängstigten Gesichter der vier jungen Leute, die im Wagen gesessen hatten. Die Sanitäter waren damit beschäftigt, Benny auf eine Trage zu heben, als er endlich die Augen aufschlug.
»Lasst mich los!«, stieß er hervor. »Was läuft denn hier ab?«
Eine Frau beugte sich über Jude und sprach in beruhigendem Ton auf sie ein, doch Jude verstand sie nicht, weil es in ihrem Kopf so laut dröhnte. Dagegen hörte sie sehr wohl, dass ein Polizeibeamter von Liam wissen wollte, ob es sein Wagen sei.
Er bejahte. Sie hob den Kopf, woraufhin er sie anblickte und lächelte. Als wäre das Ganze bloß ein Scherz, dachte Jude. Als würde nichts davon wirklich eine Rolle spielen: Solche Sachen passierten eben.
Er wurde gefragt, ob er gefahren sei, ob er etwas getrunken habe, ob sie alle angeschnallt gewesen seien. Anschließend bekam er gesagt, dass man ihn einem Alkoholtest unterziehen werde.
Sie sah Liam mit den Schultern zucken. Das blaue Licht blitzte über sein Gesicht. Dann ging wieder alles durcheinander, bis sie schließlich begriff, dass er zur offen stehenden Tür eines der Polizeifahrzeuge geführt wurde. Er schaute sich nach ihr um und hob die Hand zu einer Geste, die ihr vorkam wie ein Abschiedsgruß.
Das war im Grunde das Ende – das Ende von Liam und Jude und der bittersüßen Qual der ersten Liebe, das Ende ihres Sommers, das Ende ihrer Kindheit.
Jude blieb zwei Tage im Krankenhaus. Sie hatte eine Kopfverletzung davongetragen, weshalb man sie unter Beobachtung stellte. Ihre Nase war gebrochen, doch der junge Arzt versicherte ihr, das werde heilen und keine Narbe hinterlassen. Eine Platzwunde an ihrer Stirn musste mit zwölf Stichen genäht werden. Am Tag nach dem Unfall erkannte sie sich im Spiegel nicht wieder. Ihr Gesicht war geschwollen, die Haut übersät mit violetten, dunkelbraunen und schmutzig grünen Blutergüssen.
»Du hättest sterben können«, stellte ihre Mutter fest.
»Was hast du dir dabei gedacht, bei einem Betrunkenen einzusteigen?«, fragte ihr Vater.
Ihre Eltern sahen sich an und fragten sie nach Liam. Wer war er? Warum hatte sie in seinem Wagen gesessen?
Jude verzog das Gesicht. »Er ist bloß ein Junge, den ich kenne«, antwortete sie.
Bloß ein Junge. Ihr Junge. Sie versuchte ihn anzurufen, doch er ging nicht ran. Sie schrieb ihm eine Nachricht, etliche Nachrichten, in denen sie ihm erklärte, dass sie ihn dringend treffen müsse, worauf er antwortete, es sei alles ein bisschen kompliziert, aber sie solle sich seinetwegen keine Sorgen machen. Es gehe ihm gut. Wahrscheinlich müsse er nicht ins Gefängnis, sondern nur ein wenig gemeinnützige Arbeit leisten. »Reisepläne auf Eis«, schrieb er.
Gefängnis. Allein schon von dem Wort wurde ihr schlecht.
Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus schaute sie bei ihm zu Hause vorbei. Als die Tür aufschwang, empfand sie beim Anblick von Liam einen plötzlichen Anflug von Panik und Aufregung, doch dann wurde ihr klar, dass es gar nicht Liam war, sondern jemand, der wie Liam aussah, aber jünger war, weniger entwickelt und weniger selbstsicher. Er erklärte, er sei Liams Bruder, Dermot. Liam sei nicht da, niemand sei da. Abgesehen von dir, entgegnete Jude, woraufhin er errötete. Sie fragte, ob es Liam gut gehe. Dermot antwortete, ja, es gehe ihm gut, er sei nur ein bisschen angeschlagen.
Nachdenklich betrachtete sie diesen Jungen – wie alt er wohl war? Fünfzehn? Sechzehn? – und bat ihn dann, seinem Bruder auszurichten, sie wolle ihn sehen. Nein, verbesserte sie sich: Sie müsse ihn sehen. Mit zittriger Stimme fügte sie hinzu, so dürfe es nicht enden. Bitte, sagte sie. Bitte. Die Worte hingen zwischen ihnen in der Luft. Liams Bruder machte einen Moment den Eindruck, als wollte er etwas sagen, doch stattdessen nickte er nur. Sie wandte sich ab und ging.
Tagelang saß sie teilnahmslos zu Hause im Wohnzimmer und sah fern, trotz der Hitze in eine Decke gehüllt, während ihr Kopf immer noch pochte und ihre blauen Flecken sich erst in Blasslila und dann in Gelb verwandelten. Freunde kamen zu Besuch und taten durch aufgeregte Ausrufe kund, wie schrecklich sie fänden, was passiert sei. Sie versuchte zu lächeln und mit ihnen zu sprechen. Die Besucher brachten Körperlotionen und selbst gebackene Kekse. Rosie schenkte ihr eine riesige Topfpflanze, die für Judes Studentinnenbude gedacht war, aber innerhalb einer Woche einging.
Der Unfall war wie ein greller Albtraum, an den sie sich nur bruchstückhaft erinnern konnte. Liam kam ihr inzwischen vor wie eine Gestalt aus einem verblassenden Traum. Manchmal schreckte sie in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf hoch und stellte fest, dass sie weinte.
Schließlich holte sie sich ihre Prüfungsergebnisse ab, die noch besser waren als erwartet. Sie würde also tatsächlich nach Bristol gehen und Ärztin werden. Ihr Leben verlief immer noch in der richtigen Bahn.
Liams Leben lief immer noch nicht in der richtigen Bahn. Benny erzählte Jude, seine Ergebnisse seien nicht besonders. »Das war ihm aber schon vorher klar«, fügte er hinzu, als wäre das ein Trost. »Es macht ihm nicht viel aus. Du weißt ja, wie er ist.«
Wie war er?
Wochenlang musste sie ständig an ihn denken, bis sie es dann mit der Zeit leichter fand, es nicht mehr zu tun.
Es waren nur drei Monate ihres Lebens gewesen: drei intensive, schwindelerregende Monate, die ein Loch in ihr Leben gebrannt hatten.
Ein paar Tage vor ihrer Abreise nach Bristol sah sie ihn auf der Straße mit einem Mädchen. Die beiden bewegten sich von ihr weg, aber sie hätte ihn überall erkannt: die hochgewachsene Gestalt in zerrissenen Jeans, die lässige Art, wie er ging – leicht schlurfend, als könnte man nicht von ihm verlangen, die Füße zu heben –, das dunkle, widerspenstige Haar. Sie begann zu weinen. Dicke Tränen liefen ihr über die Wangen, an denen inzwischen keine Blutergüsse mehr zu sehen waren. Sie versuchte nicht, ihn einzuholen. Stattdessen wandte sie sich ab und ging in die andere Richtung.
Sie war davon überzeugt, ihn nie wiederzusehen.
1
Es war eine Routinenachtschicht gewesen. Jude war mehrfach in die Notaufnahme hinuntergerufen worden. Es hatte sich in allen vier Fällen um Frauen gehandelt, drei davon über achtzig, eine sogar über neunzig. Drei waren gestürzt, eine war bewusstlos eingeliefert worden. Zwei hatten einen sehr verwirrten Eindruck gemacht. Auf der Station war es ruhig, wenn auch nicht im wörtlichen Sinn. Eine Patientin mit schwerer Demenz rief ständig nach ihrer Mutter. Ein männlicher Patient wachte immer wieder auf und schrie in panischem Ton irgendetwas Unverständliches, schlief ein, erwachte erneut und schrie die gleichen angsterfüllten Worte. Jude hatte mit der diensthabenden Nachtschwester darüber beratschlagt, ob seine Medikamente anders dosiert werden mussten, dann aber beschlossen, die Dosis zu lassen, wie sie war.
Jahre zuvor hatte sie mal in einer Notaufnahme im Süden Londons gearbeitet. Freunde von ihr, die den Job auch schon gemacht hatten, meinten, sie hätten das Adrenalin genossen, die Unsicherheit, nicht zu wissen, was fünf Minuten später passieren würde. Jude hatte nie so empfunden. Sie spürte nicht viel Adrenalin, wenn sie Leute behandelte, die sich im Suff schlägerten, im Suff stürzten oder im Suff einen Autounfall hatten. Man flickte sie zusammen und schickte sie wieder weg. Diejenigen, die man selbst nicht zusammenflicken konnte, schickte man zu jemandem, der es konnte. Manchmal hatte man es schrecklicherweise auch mit übel zugerichteten Toten oder Sterbenden zu tun. Daran konnte sie sich nie gewöhnen.
Als sie sich am Ende für die Geriatrie entschied, reagierte ihr Freundeskreis überrascht. Fand sie das nicht deprimierend? Nein, fand sie nicht. Sie tat, was andere Ärzte auch taten: stellte Diagnosen, verschrieb Medikamente, ordnete Untersuchungen an. Zugleich aber kam sie sich vor wie eine Ärztin aus einem früheren Zeitalter, als man manchmal nichts anderes tun konnte, als bei seinen Patienten und Patientinnen zu sitzen, ihre Hand zu halten, mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören und für sie da zu sein. Hinter alledem – der Maske des Alters – waren sie genauso lustig und kompliziert und erledigt wie alle anderen auch. Jedes Mal, wenn sie es schaffte, jemanden in einem Zustand heimzuschicken, der ein klein wenig besser war als bei der Einlieferung, schmerzfrei vielleicht oder sogar in der Lage, ohne Hilfe zu gehen, fühlte sich das an wie ein Sieg.
Sie sah auf ihr Handy. Die vierundneunzigjährige Patientin sollte inzwischen beim Röntgen sein. Jude nahm sich vor, nach ihr zu sehen, ehe sie ging. Dann ärgerte sie sich über sich selbst und machte sich eine schriftliche Notiz. Mentale Notizen brachten nichts.
Sie warf einen Blick auf die große Wandtafel neben der Schwesternstation: nichts, worum sie sich nicht bereits gekümmert hatte. Sie ging zu der am Schreibtisch sitzenden Schwester und fragte sie, ob sich noch mal jemand von der Notaufnahme gemeldet habe.
Die Schwester schüttelte den Kopf. »Die sind so fürchterlich da unten. Die melden sich nie. Die rufen nie zurück.« Sie klopfte mit dem Finger auf die Schreibtischplatte. »Aber sobald sie was wollen …«
»Ich weiß«, bestätigte Jude. »Wem sagen Sie das.«
Sich gemeinsam über die Ineffizienz und die Arroganz anderer Stationen zu beklagen – das schweißte sie zusammen.
»Aber jemand anderer hat sich gemeldet«, erklärte die Schwester.
»Haben Sie die Nummer aufgeschrieben?«
»Nein, ich meine persönlich. Er war hier und wollte Sie sprechen.«
»Welche Station?«
»Ich glaube nicht, dass er hier im Krankenhaus arbeitet. Ich habe ihm gesagt, dass Sie beschäftigt sind. Er wollte unten warten.«
Jude starrte sie verblüfft an. Wer sollte sie in der Arbeit besuchen? So früh am Morgen?
»Seltsam. Ging es um etwas Wichtiges?«
Die Schwester schüttelte den Kopf.
»Ich glaube nicht. Er hat bloß gesagt, er wolle warten. Es klang nicht so dringend. Er ist unten im Haupteingang.«
Jude warf einen Blick auf die Uhr. Halb sieben. Noch eine halbe Stunde. Das war oft der stressigste Teil ihrer Schicht. Sie musste alle ihre üblichen Pflichten erfüllen, während es gleichzeitig die Übergabe an den nächsten Assistenzarzt vorzubereiten und schließlich durchzuführen galt. Manchmal kam es ihr so vor, als würde ihr irgendein Rachegott kurz vor Schluss noch einen richtig vertrackten Fall schicken. Die bewusstlose Patientin entpuppte sich als schwierig. Es handelte sich wahrscheinlich um einen Schlaganfall, aber die Frau hatte eine Vielzahl anderer Leiden. Nach einem verwirrenden und unbefriedigenden Gespräch mit der Begleitperson, einem nicht eindeutigen Untersuchungsergebnis und einer Reihe von Telefonaten blickte Jude hoch und stellte fest, dass es bereits zwanzig nach acht war.
Sie begab sich in das kleine Büro, in dem sie ihren Mantel, ihre Tasche und ihre Schlüssel aufbewahrte. Wie immer ließ sie sich dort einen Moment Zeit, um ihre Gedanken zu sammeln. Gab es etwas, das sie womöglich zu erledigen vergessen hatte? Ihr fiel nichts ein.
Sie zückte ihr Handy, warf einen Blick darauf und blinzelte. Ein schwacher Schimmer umgab das Gerät, fast als würde es leuchten. Manchmal lag das nur an ihrer Müdigkeit, in der Regel aber nicht. Für gewöhnlich war es das erste Anzeichen einer bevorstehenden Migräne. Wobei es fast nie während der Arbeit passierte. So, als wartete ihr Gehirn freundlicherweise, bis sie erledigt hatte, was zu tun war. Es würde ihr genug Zeit einräumen, um nach Hause zu kommen. Erst dann würden die Kopfschmerzen einsetzen. Manchmal halfen die Medikamente, wenn sie sie rechtzeitig einnahm. Sie begann ihre Nachrichten durchzusehen.
Sie und Nat hatten eine Hochzeit vorzubereiten. Oft wünschte sie, sie beide hätten einfach zum Standesamt gehen können, mit zwei Freunden als Trauzeugen. Aber Nat war der Meinung gewesen, es sei ein toller Grund für ein Fest, und seine Mutter würde es ihm nie verzeihen, wenn ihr Sohn keine anständige Hochzeitsfeier bekäme. Ab da war das Ganze angewachsen wie ein Pilzgeflecht. Erst hatten sie schon Monate gebraucht, um sich auf den richtigen Ort zu einigen, und nun, nachdem das geklärt war, ging es um die Bewirtung, die Blumen, die Daten und ihr Kleid. Die Migräne, die allmählich Fahrt aufnahm, sandte ein erstes kleines Aufblitzen von Schmerz aus, als sie an dieses Thema dachte. Sie trug normalerweise weder Kleider noch Schuhe mit hohen Absätzen, sondern Herrenanzüge aus karitativen Secondhandläden, Jumpsuits, Jeans, Wanderstiefel, Sandalen und Pumps: alles, was ihr das Gefühl gab, beweglich zu sein und schnell das Weite suchen zu können. Doch Nat zog die Nase kraus, als sie ihn darauf hinwies, und lachte dann verlegen, krampfhaft bemüht, es ins Scherzhafte zu ziehen. Er wünschte sie sich als richtige Braut, sah sie vor seinem geistigen Auge schon weich gezeichnet, bekleidet mit irgendetwas Hellem, Weiblichem, den Blick voller Zärtlichkeit auf ihn gerichtet, während sie »Ja, ich will« hauchte.
Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie sich darüber beklagte, und sei es nur sich selbst gegenüber. Schließlich übernahm Nat die ganze harte Arbeit. Hin und wieder legte er ihr etwas zur Entscheidung vor. Wollte Sie lieber dieses oder jenes? Dieses Menü? Diesen Wein? Diesen Tischschmuck?
Ihr Telefon klingelte, und sie wusste schon, wer es war, bevor sie einen Blick darauf warf. Wenn sie Nachtschichten hatte, war es, als lebten sie und Nat in unterschiedlichen Zeitzonen, obwohl sie zusammenwohnten. Sie kam dann erschöpft nach Hause, während er gerade in sein Büro in Lambeth aufbrach, wo er als Projektleiter im Gesundheitswesen arbeitete. Manchmal verpasste sie ihn sogar ganz.
»Guten Morgen«, sagte sie.
»Irgendwelche Dramen?«
»Bloß das Übliche.«
Die Ereignisse der Nacht verblassten bereits, so, als ob sie nach einem tiefen Schlaf erwachte und spürte, wie ihr die Erinnerungen an ihre Träume entglitten.
»Sollen wir uns zum Frühstück treffen? Ich kann in ein paar Minuten aufbrechen.«
»Wunderbar. Dann am üblichen Platz.«
Normalerweise verließ sie das Krankenhaus durch den Seiteneingang, doch als sie das Erdgeschoss erreichte, wandte sie sich um und steuerte auf den Haupteingang zu.
Im Eingangsbereich befanden sich etliche Leute. Einige standen in Grüppchen beisammen und unterhielten sich, andere saßen auf den Bänken, lasen, warteten.
»Du siehst anders aus«, sagte eine Stimme. »Aber trotzdem noch genau wie früher.«
Jude hatte ganz vergessen, dass jemand auf sie wartete.
Sie wandte den Kopf, und da war er: groß, etwa ihr Alter, dunkle, zerzauste Haare, Bart. Seine Augen wirkten fast schwarz. Zu einer ausgewaschenen Jeans trug er eine abgewetzte graue Jacke und um den Hals einen wild gemusterten Schal.
»Es war nicht leicht, dich aufzuspüren«, sagte er.
Sie erkannte ihn nicht.
Und dann dämmerte es ihr.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst«, antwortete sie, während sich auf ihrem Gesicht ein Lächeln ausbreitete.
Es war Liam.
2
Du bist Ärztin.« Liams sanftes Lächeln erweckte die Vergangenheit so heftig zum Leben, dass Jude davon ganz flau im Magen wurde.
Sie blickte sich um, als müsste sie sich erst vergewissern, dass es stimmte: dass sie tatsächlich Ärztin war und das hier tatsächlich ein Krankenhaus.
»Ja, ja, bin ich. Mehr oder weniger.«
»Das hast du dir doch immer gewünscht.«
Es war unmöglich, mit diesem Geist aus ihrer Vergangenheit Small Talk zu machen.
»Ich dachte nicht, dass ich dich jemals wiedersehe.«
»Ja, ich weiß«, antwortete er langsam. »Besser gesagt, so genau weiß ich es nicht. Aber es war kompliziert.«
Sie schaute ihn an und konnte den Blick nicht mehr von ihm abwenden. Eine passende Antwort fiel ihr nicht ein.
»Können wir einen Kaffee miteinander trinken?«, fragte er. »Es sei denn, du musst irgendwohin.«
»Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich muss ins Bett.«
»Dann vielleicht entkoffeinierten Kaffee.«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Nach einer Nachtschicht hält mich nichts wach. Ich trinke gerne einen Kaffee mit dir.«
Sie verließen das Krankenhaus und überquerten die Whitechapel Road. Jude führte ihn ein Stück in die Brick Lane hinein, zu einem Café, das erst kürzlich aufgemacht hatte, mit vielen weichen Sesseln und groben Holztischen. Plötzlich fiel ihr Nat ein, der im Begriff stand, Richtung Krankenhaus loszufahren, um sich mit ihr zu treffen. Hoffentlich war er noch nicht aufgebrochen. Sie holte ihr Handy heraus und schrieb ihm: Tut mir leid! Notfall. Frühstück klappt nicht. Bis heute Abend.xxxx
Sie saßen sich am Tisch gegenüber. Jude war ganz schummrig zumute, so seltsam kam ihr das Ganze vor.
»Möchtest du Frühstück?«, fragte sie. »Eier oder sonst was?«
Er schüttelte den Kopf und bestellte für sie beide Kaffee. Ihr Hunger hatte sich verflüchtigt. Während die junge Frau hinter dem Tresen die Getränke zubereitete, musterten Jude und Liam sich einfach nur wortlos. Das Schweigen fühlte sich nicht unangenehm oder peinlich an.
Als der Kaffee eintraf, zog Jude ein Päckchen aus der Tasche, nahm zwei rosarote Pillen heraus und spülte sie mit einem Schluck Kaffee hinunter. Liam sah sie fragend an.
»Ich bekomme eine Migräne. Das stoppt sie manchmal.«
»Früher hattest du das aber nicht, oder?«
»Nein, es begann kurz nach …« Sie brach ab. Nach dem Unfall. Damals hatte es angefangen. »Ich habe es oft. Die Farben sehen plötzlich seltsam aus, und dann muss ich ein paar Stunden ins Bett.«
»Wie auch immer, Glückwunsch«, sagte Liam und hob seine Kaffeetasse.
»Wozu?«
»Zu deiner bevorstehenden Hochzeit.«
»Woher weißt du das?«
»Jemand hat es mir erzählt. Als ich versucht habe, dich aufzuspüren.«
Jude lachte. »Mich aufzuspüren? Was bist du? Privatdetektiv?«
»Nur ein alter Freund.« Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee. »Ärztin. Genau wie du immer gesagt hast. Du hast es geschafft.«
Jude fühlte sich plötzlich atemlos. Sie war davon überzeugt gewesen, Liam nie wieder zu sehen. Trotzdem hatte sie sich im Lauf der Jahre oft vorgestellt, ihn zu treffen: zufällig, im Bus, auf der Straße, in einer Menschenmenge oder beim Wandern in den Clee Hills nahe ihrem Elternhaus in Shropshire. Denn es gab Dinge, die sie loswerden musste, schon seit über einem Jahrzehnt gern losgeworden wäre, auch wenn sie nun, da der Moment tatsächlich gekommen war, nicht recht wusste, wie sie anfangen sollte.
»Eigentlich hätte ich dich aufspüren sollen«, begann sie zögernd. »Ich weiß, dass du …« Sie hielt inne. »Ich habe es nie vergessen.«
Er runzelte die Stirn, als müsste er darüber erst nachdenken. Als er schließlich antwortete, wirkte er gar nicht zornig, ja nicht einmal traurig – nur nachdenklich, als spräche er über jemand anders.
»Ich habe damals ein paar Entscheidungen getroffen«, sagte er, »und nicht alle davon waren gut. Dir ist wahrscheinlich zu Ohren gekommen, dass ich zu allem Überfluss auch noch meine Abschlussprüfung vermasselt habe.«
»Das tut mir leid.«
»Schon in Ordnung. So was passiert. Inzwischen läuft es besser, zumindest im Großen und Ganzen. Ein, zwei Dinge muss ich noch klären, aber ansonsten geht es mir gut.« Er hielt einen Moment inne und lächelte dann – nicht ironisch und auch nicht so wie früher, wissend und verhalten, sondern auf eine Weise, die sein ganzes Gesicht verwandelte und ihn schlagartig jünger aussehen ließ. »Ich habe einen kleinen Sohn«, verkündete er. »Alfie. Er ist jetzt ein Jahr alt.«
Jude blinzelte. »Wow! Einen Sohn! Sieht er aus wie du?«
»Die Leute behaupten es. Armer kleiner Kerl.«
»Das ist so schön.« Am liebsten hätte sie losgeheult, wusste aber nicht, warum. Stattdessen lächelte sie.
»Tja, nun …«
Jude holte tief Luft. »Ich muss dir etwas sagen.«
»Schieß los.«
»Bevor ich es sage, musst du etwas wissen. Ich bin mit Nat zusammen und schätze mich glücklich, ihn zu haben, und wir wollen heiraten, aber das weißt du ja schon, außerdem wollen wir uns ein Haus kaufen.«
»Gut.« Sein Ton klang trocken.
Sie streckte eine Hand aus und griff nach der seinen, die sich warm anfühlte. Er schlang die Finger um ihre.
»Nein, hör zu, ich meine es ernst. Ich musste dir das vorher sagen, weil ich dir eigentlich etwas anderes sagen will.« Sie holte noch einmal tief Luft. »Ich habe dich damals so geliebt, Liam. Ich war völlig hin und weg. Absolut hingerissen. Ich konnte an nichts anderes mehr denken als an dich. Danach habe ich auch noch ewig an dich gedacht. Eigentlich jahrelang.«
Jude keuchte fast, nachdem sie das alles hervorgestoßen hatte. Damals hatte sie nie etwas Derartiges zu ihm gesagt. So etwas war ihr überhaupt noch nie über die Lippen gekommen. Sie musste an Nat denken und empfand einen Anflug von schlechtem Gewissen.
Liam schüttelte den Kopf. »Du hast mein Leben auch ziemlich auf den Kopf gestellt, musst du wissen.«
»Und dann hast du alles verloren. Nach dem Unfall.« Jude sprach jetzt sehr langsam und behutsam. »Rückblickend kommt es mir so irreal vor, wie eine Mischung aus Märchen und Albtraum. Da ist diese schreckliche Sache passiert, und am Ende habe ich alles bekommen, was ich mir wünschte, und du hast das meiste von dem, was du wolltest, verloren.« Jude sah Liam an, registrierte bei ihm aber keinerlei Reaktion. Sie konnte nicht sagen, was er empfand. »Hinterher hast du mich abgewiesen. Du wolltest mich nicht sehen. Ich hatte das Gefühl, dass du meinen Anblick nicht mehr ertragen konntest, nachdem wir das miteinander durchgemacht hatten. Ich bin dann wie in einen Tunnel eingetaucht und habe versucht, so zu tun, als wäre das alles nie passiert. Dafür schäme ich mich.«
»Das war vor zehn Jahren«, entgegnete Liam sanft.
»Elf«, stellte Jude richtig. »Mehr als elf.«
»Wir waren noch Kinder.«
»Ich weiß. Und jetzt sind wir erwachsen.«
Sie blickte auf ihren Kaffee hinunter. Sie hatte ihn nicht mal angerührt. Zögernd nippte sie daran. Er war kalt. Ohne sie zu fragen, griff Liam nach den beiden Kaffeetassen, trug sie hinüber zur Theke und kehrte kurz darauf mit zwei neuen zurück.
»Hier«, sagte er. »Trink ihn, bevor er auch wieder kalt wird.«
Jude nahm einen Schluck. Ihr Kopf dröhnte bereits leicht.
»Du hast mich noch gar nicht gefragt, warum ich wieder Kontakt mit dir aufgenommen habe.«
»Ich stehe unter Schock. Ich muss das erst verarbeiten. Also, warum hast du wieder Kontakt mit mir aufgenommen?«
Liam grinste. Plötzlich sah er genau aus wie als Teenager, als sie in ihn verliebt gewesen war, und sie spürte wieder jenes Gefühl in der Brust.
»Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust«, erklärte er. Seine Augen wirkten in dem Moment schwarz wie Schlehen.
»Einen Gefallen?«
»Ja.«
»Was für einen Gefallen?«
Er zog einen Zettel aus der Tasche und schob ihn über den Tisch. Sie griff danach. Es war eine Adresse: Springs Cottage, mit einer Postleitzahl, die sie nicht kannte, aber definitiv außerhalb von London lag.
»Was ist das?«
»Ich möchte, dass du am Samstag da hinfährst.«
Jude hatte erwartet, dass er vielleicht Geld wollte. Oder Hilfe auf der Suche nach einem Job. Etwas, das ihnen beiden peinlich wäre. Aber auf dieses Anliegen konnte sie sich keinen Reim machen.
»Das verstehe ich jetzt nicht. Du möchtest, dass ich zu diesem Cottage fahre? Warum? Wo ist das?«
»Daran ist nichts kompliziert. Ich habe es fürs Wochenende gemietet. Ich treffe dich dort am Samstagabend, und dann sage ich dir, um was für einen Gefallen es sich handelt. Es ist keine große Sache.«
»Du meinst, ich soll hinfahren und dort übernachten?«
»Ja.«
»Wo ist das?«
»In Norfolk.«
Jude wurde ganz schummrig zumute. Der Tisch schien von ihr wegzukippen. Sie wusste nicht, ob es an der Migräne lag oder daran, dass sie sich vollkommen verwirrt fühlte.
»Ich verstehe nicht, worauf du hinauswillst.«
Er lächelte, aber sein Blick wirkte dabei wachsam. »Es ist ganz einfach.«
»Warum ich?«
Liam zögerte einen Moment, ehe er antwortete.
»Du bist mir einfach eingefallen«, sagte er schließlich. »Ich hatte das Gefühl, dass du die einzige Person bist, die ich darum bitten könnte. Ich glaube, wir sind einander wichtig. Das werden wir immer sein.« Er beugte sich vor. »Aber versteh mich nicht falsch, Jude. Ich bitte dich nur um einen Gefallen. Du kannst einfach Nein sagen. Ich werde deswegen nicht sauer auf dich sein und es dir auch nicht zum Vorwurf machen. Ich trinke einfach meinen Kaffee aus, wir verabschieden uns, und du siehst mich nie wieder.«
Jude nahm einen Schluck von ihrem Kaffee.
»Jetzt ist er schon wieder kalt geworden.« Sie stellte die Tasse zurück auf die Untertasse und stieß ein seltsames kleines Lachen aus. »Es ist mir peinlich, dass ich das jetzt frage, aber … du bittest mich nicht um etwas Unrechtes, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich würde nie etwas Unrechtes von dir verlangen. Obwohl du es niemandem erzählen darfst. Nicht einmal deinem Nat. Niemandem.«
Sie sah ihm direkt ins Gesicht und fühlte sich dabei so heftig von Erinnerungen übermannt, dass ihr fast schwindlig davon wurde: Sie spürte die Hitze jenes Sommers, spürte, wie er sich angefühlt hatte, seine Berührung, und dann das Ende, jenes Kreischen und Knirschen von Metall.
»Dir ist klar, dass ich nicht Nein sagen kann, oder?«
»Das ist mir ganz und gar nicht klar.«
»Ich fahre am Samstag da hin und komme am Sonntag zurück?«
»Ja.«
»Norfolk?«
»Ja.«
»Und das ist alles?«
»Ja.«
»Einverstanden.«
3
Den ganzen Heimweg hielt Jude ihre Migräne im Zaum, wobei sie ihr Rad die letzten anderthalb Kilometer schob, als könnte ein Moment der Unachtsamkeit den Schmerz über ihr ausschütten wie eine kochend heiße Flüssigkeit. Der Morgen war neblig und windstill. Feuchtes Laub bildete unter ihren Füßen einen schleimigen Teppich. Über dem Olympiapark schien der blasse Himmel schimmernd zu pulsieren. Leute kamen aus dem Nebel auf sie zu und verschwanden wieder. Sie öffnete die Tür zu ihrer kleinen Wohnung, schleppte sich in die Küche, zog ihren Mantel aus und schenkte sich ein Glas Wasser ein.
Der Kaffee in der Kanne war noch leicht warm. Nat hatte Obst und Joghurt für sie stehen lassen – oder bloß nicht weggeräumt, nachdem er selbst gefrühstückt hatte. So oder so brachte sie im Moment einfach nichts hinunter, auch wenn sich ihr Magen leer anfühlte. Sie musste sich hinlegen, konnte sich dazu aber noch nicht aufraffen, sodass sie erst einmal den Kopf auf die Tischplatte sinken ließ und die Kühle des Holzes an ihrer Wange genoss. Durchs Fenster sah sie, dass eine Nachbarskatze im Garten saß, gleich neben dem Grill mit dem abgebrochenen Bein. Sie und Nat hatten darüber gesprochen, sich eine Katze zuzulegen, wenn sie in das Haus zogen, das sie zu kaufen im Begriff waren. Mit ein bisschen Glück – toi, toi, toi – würde es in der Vorweihnachtszeit so weit sein, auf jeden Fall vor ihrer Hochzeit im Januar.
Jude musste daran denken, wie Liam sie mit seinen dunklen Augen so eindringlich gemustert hatte: die Frau, zu der sie sich entwickelt hatte, eine Ärztin, die im Begriff war zu heiraten, im Begriff, sich eine Immobilie zuzulegen und vielleicht sogar eine Katze.
Ihr wurde übel von ihrer Migräne und den alten Erinnerungen, die jahrelang tief in ihrem Inneren vergraben gewesen waren.
Nachdem sie sich wie eine Blinde in ihr Schlafzimmer getastet hatte, zog sie die Vorhänge zu, schälte sich aus ihrer Kleidung und glitt ins Bett, wo sie zusammengerollt in der gnädigen Dunkelheit lag und darauf wartete, dass die Übelkeit nachließ.
Nat nannte sie eine Schlafkünstlerin. Nach Jahren unterschiedlicher Arbeitsschichten konnte sie sich überall und zu jeder Zeit hinlegen, die Augen schließen und innerhalb von Sekunden tief schlafen. An diesem Morgen aber schlief sie lange Zeit nicht ein. Ihre Augen pulsierten, und schemenhafte Gestalten geisterten durch ihren Kopf.
Liam Birch, mit seinen dunklen Augen und seinem Lächeln. Sie sah ihn mit achtzehn vor sich und dann so, wie er jetzt war. Er wirkte älter als dreißig, als hätte ihn das Leben ziemlich in die Mangel genommen. An einem seiner Schneidezähne fehlte ein Stück. Rund um die Augen wies seine Haut bereits erste Fältchen auf. Er hatte einen Bart und nikotingelbe Finger. Seine Jacke war alt – aber er hatte immer alte Sachen getragen, gerne in Secondhandläden nach Teilen gestöbert, die ihm ins Auge stachen. Er war immer noch attraktiv.
Und jetzt das. Es kam ihr fast komisch vor, wie ein Narrenstreich. Vielleicht war es das ja auch – eine Art Kinderspiel, mit genauen Anweisungen bezüglich Treffpunkt und Geheimhaltung. Und großem Indianerehrenwort. Sie würde seinen Wagen abholen, allein da hinauffahren, und wenn Liam dann kam, würde er ihr erklären, worum es bei dem Ganzen eigentlich ging, und das war’s dann.
Sie hatte versprochen, niemandem davon zu erzählen.
Was bedeutete, dass sie es auch Nat nicht erzählen durfte.
Was bedeutete, dass sie ihm eine Lüge auftischen musste.
»Wie sehen denn deine Pläne fürs Wochenende aus?«, fragte Nat. »Du hast doch frei, oder?«
Sie aßen gerade das würzige indische Gericht, Kokosnuss-Dhal, das sie nach ihren Nachtschichten häufig kochte. Die Migräne war inzwischen abgeklungen, und sie hatte einen Bärenhunger.
»Dee hat uns für Samstag eingeladen«, erklärte er. »Zu einer Art Party, und dann ist ja das Feuerwerk im Park.«
Jude versenkte ihre Gabel in dem cremigen Durcheinander auf ihrem Teller und starrte angestrengt darauf hinunter. Vor diesem Moment hatte sie sich gefürchtet. Sie war versucht, ihm eine Teilversion der Wahrheit zu erzählen. Ein Freund hatte sie um einen Gefallen gebeten. Keine große Sache. Doch als sie das Gespräch im Kopf durchzuspielen begann, kam nichts Gutes dabei heraus. Nat würde anfangen, Fragen zu stellen. Was, wenn er etwas dagegen hatte? Es war leichter zu lügen. Das machte es einfacher.
»Tut mir leid, ich kann nicht mit«, verkündete sie und überschritt dann eine Linie. »Ich habe gerade mit meiner Oma verabredet, dass ich sie besuche.« Ihre Großmutter war krank gewesen, und Jude hatte bereits von ihrem Vorhaben gesprochen, sie zu besuchen. Sie lebte in Gloucester. Daher klang das Ganze durchaus glaubwürdig, und Jude wusste, dass Nat keine Lust haben würde, sie zu begleiten.
»Möchtest du, dass ich mitkomme?«
»Nein«, antwortete sie schnell. Fast zu schnell. Sie sah, dass er sich bemühte, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. »Ich meine, das ist wirklich nett von dir, aber es wird nur ein kurzer Besuch, wodurch trotzdem dein Wochenende draufgehen würde – obwohl du doch die ganze Woche so hart gearbeitet hast. Wahrscheinlich werden wir bloß in alten Erinnerungen schwelgen.«
»Es macht dir wirklich nichts aus, allein zu fahren?«
»Nein, es macht mir wirklich nichts aus.«
»Dann werde ich wohl ohne dich klarkommen müssen«, meinte er leichthin.
Sie hob den Kopf und betrachtete ihn: seine grauen Augen, sein sympathisches, sauber rasiertes Gesicht, sein dunkelblondes, ordentlich kurz geschnittenes Haar, sein Leinenhemd. Er wirkte gepflegt, gelassen und vertrauenswürdig. Sie wusste, dass er, wenn sie das Gesicht an seinen Hals schmiegte, nach Sandelholz riechen würde.
So eine kleine Lüge war doch gar nicht so schwer.
4
Jude stand vor dem Bahnhof Blackhorse Road im Nieselregen und trank langsam den Kaffee, den sie sich geholt hatte. Menschen hasteten mit eingezogenem Kopf vorüber. Sie war viel zu früh gekommen, sodass sie nun ständig auf die Zeitanzeige ihres Handys sah. Es blies ein kalter Wind. Sie wünschte, sie hätte wärmere Sachen eingepackt.
Das war typisch für Liam, dachte sie: Als sie ihn damals kennengelernt hatte, war er auch immer zu spät gekommen, in gemütlichem Tempo, ohne jede Eile und ohne Entschuldigung, als könnte er einfach nicht anders.
Vielleicht würde er gar nicht kommen. Dann konnte sie wieder nach Hause fahren und so tun, als wäre das Ganze nie passiert. Bei der Vorstellung fühlte sie sich fast erleichtert. Gleichzeitig aber empfand sie einen Anflug von Enttäuschung oder sogar Bedauern.
Eine Hupe ertönte. Als sie den Kopf wandte, sah sie auf der anderen Straßenseite einen blauen Wagen seitlich ranfahren und im absoluten Halteverbot zum Stehen kommen. Es war ein altes Auto mit eingedellter Hintertür und allem Anschein nach kaum in besserem Zustand als der, in dem sie damals vor elf Jahren gesessen hatte. Liam stieg bei laufendem Motor aus.
Jude eilte hinüber.
»Bereit?«
»Ich schätze schon.«
»Ich habe dir die genaue Adresse aufgeschrieben. Sie steht auf dem Zettel im Getränkehalter. Diese Straße führt dich hinauf zur North Circular, sodass du in null Komma nichts auf der A12 bist, unterwegs nach Osten. Der Schlüssel hängt an einem Nagel unter dem Vordach.« Das Nieseln steigerte sich langsam zu richtigem, eisigem Regen. Er reichte ihr eine schlanke Brieftasche. »Der Tank ist fast leer.«
»Das kann ich doch übernehmen.«
Seine Miene verfinsterte sich.
»Du tust mir schon einen Gefallen. Da will ich nicht auch noch Almosen von dir. Versprich mir, dass du mit meiner Karte zahlst.«
Männlicher Stolz, dachte sie und empfand dabei einen Anflug von Mitgefühl, aber auch leichte Verärgerung.
»Meinetwegen.«
»Die PIN lautet 6613. Ich habe sie dir unter die Adresse geschrieben.«
Hinter ihnen ertönte eine Hupe. Liams Wagen blockierte die Fahrbahn. Ein Mann lehnte sich aus seinem Wagenfenster und schrie wütend. Liam zeigte ihm lässig den Stinkefinger. Der Mann setzte zu einem weiteren wütenden Schrei an, doch Liams Blick ließ ihn verstummen.
»Im Kofferraum liegt eine Tasche mit Zeug von mir. Stell sie ins Schlafzimmer, wenn du ankommst, ja?«
Er registrierte ihren Gesichtsausdruck und grinste. »Es gibt zwei Schlafzimmer«, sagte er, »du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.«
Sie wollte endlich losfahren. Eilig stieg sie ein, warf ihren Rucksack auf den Beifahrersitz, schnallte sich an und stellte den Rückspiegel ein. Liam hielt die Tür auf.
»Ich nehme einen Zug, der heute Abend um halb zehn in Ixley ankommt. Kannst du mich da abholen? Es sind vom Haus aus nur ein paar Kilometer.«
»Ixley«, widerholte Jude. »Halb zehn.«
»Vielleicht magst du ein bisschen was zu essen besorgen. Mit meiner Karte, denk dran. Im Dorf gibt es einen kleinen Laden. Dann können wir uns ein spätes Abendessen machen.«
»Ich sollte losfahren, bevor mich einer von denen rammt.«
Sie starrte zu ihm empor. Regentropfen funkelten in seinem dunklen Haar. Sie hatte das prickelnde Gefühl, dass sie ihn nur an sich zu ziehen und zu küssen bräuchte, um schlagartig zurück in die Vergangenheit katapultiert zu werden. Sie wäre wieder achtzehn, und dieses Mal würde ihre Zukunft anders verlaufen. Sie könnte es besser machen.
Stirnrunzelnd ließ sie sich in den Sitz zurücksinken.
»An der Sache ist doch nichts faul, oder, Liam?«
Er lächelte fröhlich. »Keine Sorge. Später erzähle ich dir alles. Wenn du dich dann unwohl damit fühlst, kannst du immer noch Nein sagen.«
Er beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. Rauchgeruch, Dreitagebart. Ein Fremder.
»Danke, Jude.«
»Bis heute Abend, halb zehn«, antwortete sie.
Endlich schloss er die Tür. Im Rückspiegel sah sie ihn davonschlendern.
5
Langsam kämpfte Jude sich mit dem klapprigen alten Honda aus London hinaus. Ihr Handy informierte sie darüber, dass die Fahrt zwei Stunden und fünfundfünfzig Minuten dauern würde, weil es auf der A12 staute. Vermutlich waren immer noch viele Leute unterwegs, um London fürs Wochenende zu entkommen. Während der Wagen in Schrittgeschwindigkeit vorwärts schlich, blickte sie immer wieder nervös auf die Tankanzeige, die sich gegen null bewegte. Was, wenn ihr das Benzin ausging? Sie hielt an der ersten Tankstelle, die sie erspähte, und benutzte brav Liams Karte. Bevor sie weiterfuhr, inspizierte sie das Innere des Wagens. Neben dem Beifahrersitz steckten ein paar leere Dosen, im Türfach Kaugummi, das Kerngehäuse eines Apfels und ein zerfledderter Straßenatlas, unter dem Armaturenbrett ein Wirrwarr aus Kabeln und eine halb volle Wasserflasche. Hinten entdeckte sie einen Kindersitz, einen einzelnen, winzig kleinen roten Gummistiefel und ein bereits zur Hälfe verspeistes Päckchen Gummibärchen. Alfie.
Jude fragte sich, wie es sich wohl mit Alfies Mutter verhielt. Lebte Liam mit ihr zusammen? War er verheiratet? Sah er seinen Sohn jeden Tag, brachte ihn abends ins Bett? Davon hatte er nichts erwähnt, eigentlich hatte er gar nichts über sich erzählt, war seinerseits aber über ihren Partner und ihren Beruf informiert. Er hatte ihr gesagt, er habe seine Abschlussprüfung vermasselt – was sie schon wusste und außerdem ewig zurücklag –, aber inzwischen laufe sein Leben gut. Im Großen und Ganzen, hatte er hinzugefügt, lediglich ein, zwei Dinge seien noch zu klären. Half sie ihm gerade dabei, eines dieser Dinge zu klären?
Es war nicht zu spät umzukehren. Einen Moment stellte sie es sich vor: die nächste Ausfahrt zu nehmen, nach Hause zu fahren, Nat zu umarmen und dann eine Runde laufen zu gehen, um den seltsamen Tag abzuschütteln. Das Ganze würde wie ein Traum von ihr abfallen. Doch natürlich fuhr sie weiter.
Denn wo hätte sie Liams Wagen lassen sollen? Sie hatte nicht nur keine Ahnung, wo er lebte, sondern auch keine Telefonnummer, keine Mailadresse, keinerlei Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Das wurde ihr erst jetzt so richtig bewusst.
Was hatte sie sich bloß dabei gedacht?
Der Wagen bewegte sich im Schneckentempo weiter, und es regnete.
Langsam wurde der Verkehr weniger. Vor ihr weitete sich die Landschaft, ebenso wie der graue Himmel. Während Jude mit dem Schalthebel des klapprigen Wagens kämpfte, richtete sie ihre Gedanken auf Pragmatisches. Sie musste an die Liste auf ihrem Nachttisch denken. Jeden Tag fügte sie neue Punkte hinzu und stricht die erledigten Aufgaben mit einer sauberen Linie durch. Ihr Hochzeitstermin war Ende Januar, was einige ihrer Freunde für eine ungemütliche Jahreszeit zum Heiraten hielten, doch Jude und Nat gefiel die Idee. Nat hatte jemanden aufgetrieben, der Hochzeitsfeiern in einer restaurierten Scheune in Shropshire ausrichtete, mit Blick über die Clee Hills, ganz in der Nähe ihres Elternhauses. Das Gebäude war schön, aufwendig gestaltet, komplex. Doch es musste noch so viel organisiert werden. All die Leute. Es würde Geschenke geben und Ansprachen. Jude konnte kaum glauben, dass es tatsächlich wahr werden sollte.
Es gelang ihr nicht, sich Liam vorzustellen, wie er Einladungen verschickte und sich einen schönen Anzug schneidern ließ – es sei denn, er fertigte ihn selbst an oder ließ ihn von jemandem machen, den er irgendwo kennengelernt hatte. Damals hatte er die Dinge einfach kommen und gehen lassen. Er hatte sie gehen lassen. Jude wusste, dass die Beziehung zwischen ihr und Liam nie gehalten hätte. Das war ihr von Anfang an klar gewesen. Sie beide unterschieden sich zu sehr, ihr Leben verlief in völlig unterschiedlichen Bahnen. Der Unfall hatte das Unvermeidliche nur beschleunigt. Aber wäre der Unfall nicht passiert und hätten sich ihre Wege nach einer Weile einfach getrennt, dann wäre Liam jetzt nur noch eine schöne, bittersüße Erinnerung – eine jugendliche Sommerliebe ohne diese Macht, sie in ihre Vergangenheit zurückzuziehen und alte Sehnsüchte zu wecken.
Während ihrer ersten Studienjahre hatte Jude durchaus Beziehungen gehabt: schöne, schlimme, kurze, lockere. Es war ihr immer bewusst gewesen, dass nichts dabei herauskommen würde. Später folgte eine längere männerfreie Phase, in der sie ausschließlich an ihre Arbeit dachte. Vor drei Jahren hatte sie dann bei einem Blind Date Nat kennengelernt, und es war gewesen, als hätte sie auf ihn gewartet: einen zuverlässigen, vertrauensvollen und vertrauenswürdigen Mann. Noch dazu war er witzig und auf eine offene Art liebevoll – und er ging ihr nicht auf die Nerven, was viele Leute taten. Er war immer aufmerksam. Selbst jetzt, während sie in Liams Wagen saß, konnte sie fast spüren, wie er ihr übers Haar strich, die Hände unter ihr Shirt schob. Sie konnte sich eine Zukunft mit ihm vorstellen.
Inzwischen fuhr sie eine schmale Straße entlang, durch einen Buchenwald, wo ein Teil der Bäume bereits kahl war und andere noch orangerot und goldgelb leuchteten. Dann ging es wieder hinaus in eine karge Landschaft: weite sumpfige Flächen, überspannt von einem grauen Himmel. Die ganze Sache kam ihr immer irrealer vor.
Sie verlangsamte das Tempo und blickte in kurzen Abständen auf ihr Handy, das sie eine noch schmalere Straße entlangführte, durch Schlamm und Schlaglöcher, vorbei an einem Feld, an dessen Rand sich erdige Haufen aus Zuckerrüben aneinanderreihten. In der Ferne bewegte sich ein Traktor wie ein Spielzeug über die matschige Fläche. Jude fuhr durch ein kleines Dorf, bestehend aus ein paar Steinhäusern, einem Postamt, einem Pub und einem winzigen Supermarkt. Es war zwanzig nach zwei. Ein Straßenschild wies geradeaus in Richtung Ixley, wo sie Liam am Abend abholen sollte, doch sie bog links ab, einen Hügel hinauf, dann wieder links, eine kurze Zufahrt entlang.
Springs Cottage.
Jude stellte den Motor ab, stieg aber nicht gleich aus, sondern ließ erst einmal die Stirn an das Seitenfenster sinken und wartete. Bei dem Cottage handelte es sich um ein kleines, kastenförmiges Gebäude mit weißem Anstrich, grauem Schieferdach und einem Kamin, bei dem ganz oben ein paar Ziegel fehlten. An einem Rosenstrauch, der die Wand hinaufwuchs, leuchteten noch ein paar hartnäckige gelbe Blüten. Seitlich des Häuschens stand eine riesige Kastanie, deren Äste schwer beladen wirkten, mit einem Wirrwarr aus Zweigen, die zu Nestern aufgehäuft waren. Jude entdeckte die dunklen Formen von Krähen und hörte dann auch ihr raues Krächzen.
Als sie schließlich die Autotür öffnete, schlug ihr kalte Luft entgegen. Der Wind frischte auf, zu ihren Füßen wirbelte Laub über den Boden.
Sie griff nach ihrem Rucksack und Liams Brieftasche und steuerte auf den Eingang zu. Tatsächlich hing unter dem Vordach ein Schlüssel an einem Nagel, durch einen Balken vor Blicken geschützt. Sie schloss auf und betrat zögernd das Haus. In der kleinen Diele legte sie ihren Rucksack ab. Es war kalt, und ein muffiger, abgestandener Geruch hing in der Luft. Wahrscheinlich kamen die Leute hauptsächlich im Sommer her, wenn sie lange Spaziergänge machen und im Meer schwimmen konnten, das etwa anderthalb Kilometer entfernt sein musste, nicht aber Anfang November, wenn alles in Regen und Matsch versank und raue Winde aus Richtung Osten heranfegten.
Die Küche war ein kleiner Raum mit rot gefliestem Boden und einem Holztisch, auf dem sich ein Kaktus und ein laminiertes Büchlein mit Instruktionen befanden. Jude öffnete die Schränke: Es gab von allem je vier Exemplare, große Teller, kleine Teller, Schüsseln, Gläser und Becher. Sie öffnete den Kühlschrank. Er sah sauber und leer aus.
Das Wohnzimmer war ebenfalls klein, ausgestattet mit einem ausladenden grauen Sofa, einem offenen Kamin, allerdings ohne Holz zum Einheizen, und einem großen Flachbildschirm-Fernseher. Das Fenster ging hinaus auf weite Sumpfflächen und hohe, schlanke Bäume, die sich am Horizont wie Tänzer wiegten. Da draußen muss das Meer sein, ging ihr durch den Kopf. Wieder warf sie einen Blick auf ihr Handy, um zu schauen, wie spät es schon war. Wenn sie sich beeilte, konnte sie noch einen Spaziergang machen, bevor es dunkel wurde.
Sie hatte eine Nachricht von Nat. Wie läuft es? Sie schickte ihm einen hochgereckten Daumen und ein Herz.
Über eine schmale Treppe gelangte sie nach oben, wo sich ein Badezimmer, ein nicht allzu großes Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein weiteres, winziges Schlafzimmer mit einem Einzelbett befanden. In Letzterem legte sie ihren Rucksack ab und hängte ihr Handy ans Ladegerät. Oben war es noch kälter als unten. Sie wünschte, sie hätte eine Wärmflasche mitgenommen.
Liams Gepäck fiel ihr ein. Sie eilte die Treppe wieder hinunter und nach draußen, um seine Reisetasche aus dem Kofferraum des Wagens zu holen. In den ersten Stock zurückgekehrt, legte sie die Tasche auf das Doppelbett.
Ihr blieben über sechs Stunden, bis Liams Zug eintraf. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal so viel unverplante Zeit gehabt hatte.
Sie fuhr mit Liams Wagen die schmale Straße weiter bis zur Küste und marschierte dort ein Stück, zwischen sumpfigem Heideland auf der einen Seite und morastigem Boden und kabbeligem, grauem Meer auf der anderen. Ihre Füße versanken in der nassen, zähen Erde. Binnen kürzester Zeit waren sowohl ihre Turnschuhe als auch der Saum ihrer Jeans durchnässt und schlammverschmiert. Der Wind, der vom Meer blies, attackierte sie mit heftigen Böen, und die Dämmerung setzte bereits ein. Trotzdem fühlte sie sich fast euphorisch. Sie genoss den rauen Wind im Gesicht und das Donnern der Wellen. Kein Mensch war zu sehen. Niemand außer Liam wusste, wo sie sich aufhielt. Bis sie wieder den Wagen erreichte, sah sie kaum noch, wo sie hintrat. Sie mochte diese Dunkelheit, die sie in der Stadt nie erlebte.
Auf dem Rückweg machte sie an dem kleinen Laden halt. Liam hatte sie gebeten, ein bisschen was zu essen einzukaufen. Aber was? Nachdem sie eine Weile an den Regalen entlanggewandert war, entschied sie sich für Zwiebeln, Pilze, Knoblauch und Reis. Sie würde ein einfaches Risotto zubereiten. Das bedeutete, dass sie auch Öl brauchte. Sie legte noch Parmesan in den Korb, außerdem eine Flasche Rotwein und Chips. In letzter Sekunde fielen ihr noch Salz und Brühwürfel ein.
Die Vorstellung, dort in der Küche zu sitzen und mit Liam eine Mahlzeit einzunehmen, beunruhigte sie.
Sie schrieb Nat eine Nachricht. Du fehlst mir.
Die Frau an der Kasse starrte sie neugierig an.
»Ich wohne im Springs Cottage«, erklärte Jude fröhlich.
»Das stand jetzt eine ganze Weile leer«, antwortete die Frau.
Jude versuchte die Heizung in Gang zu bringen, doch nur ein Heizkörper wurde warm. Sie spielte mit dem Gedanken, sich ein Bad einzulassen, aber der Stöpsel schien zu fehlen.
Draußen war es mittlerweile stockfinster. Nicht einmal vom Mond war etwas zu sehen. Aus den Dachrinnen plätscherte Wasser.
Sie hatte ein Buch dabei, konnte sich aber nicht darauf konzentrieren. Deswegen machte sie sich daran, das Risotto zuzubereiten. Anschließend schaltete sie sich durch die Fernsehprogramme und informierte sich auf ihrem Handy über die Neuigkeiten des Tages. Am liebsten hätte sie die Flasche Wein geöffnet, durfte aber nicht, weil sie ja noch Auto fahren musste.
Um zehn nach neun verließ sie das Haus, schloss die Tür ab, schob den Schlüssel in ihre Manteltasche und machte sich mit dem Wagen auf den Weg zum Bahnhof von Ixley. Die Scheinwerfer bildeten einen Tunnel aus Licht, der durch eine unbekannte Welt aus Wäldern, Feldern und Sumpfland führte. Kleine Kreaturen sausten über die Straße.
Plötzlich war ein Knall zu hören, und in der Ferne erblickte sie einen hellen Funken, der bogenförmig zum Himmel emporstieg und dann zu vielen winzigen Funken explodierte, welche wie Blütenblätter aus Licht herabrieselten, gefolgt von einem weiteren Knall. Sie verpasste die Nacht der Feuerwerke. Vor ihrem geistigen Auge sah sie ihren Freundeskreis im Park zusammenkommen, Raketen zünden und Glühwein trinken, während sie sich an einem Ort, von dem sie nie zuvor gehört hatte, mit einem Mann traf, den sie seit elf Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Der Parkplatz war leer. Der kleine Bahnhof wirkte völlig verlassen. Sie ließ sich in der kalten Dunkelheit auf einer der Bänke nieder und wartete. Dabei bemühte sie sich, nicht daran zu denken, was Liam zu ihr sagen würde und worin der Gefallen, den sie ihm tun sollte, wohl tatsächlich bestand. Sie wollte nicht darüber nachdenken, warum er ausgerechnet sie ausgewählt hatte statt jemanden aus seinem Freundeskreis. Doch je krampfhafter sie versuchte, nicht daran zu denken, desto mehr dachte sie daran. Was konnte sie für ihn tun, das niemand sonst konnte?
Sie legte sich selbst gegenüber ein Versprechen ab. Sobald Liam da war, würde sie ganz genau in Erfahrung bringen, was er von ihr wollte, und falls es etwas Unredliches war, würde sie es nicht tun – ganz egal, wie verpflichtet sie sich diesem Mann fühlte, den sie früher so geliebt hatte. Das wäre dann bestimmt sehr peinlich. Er wäre vermutlich böse auf sie, aber es gab eine Grenze, die sie nicht überschreiten würde.
Erwartete er, dass sie sich emotional wieder an ihn band? Wollte er gar eine sexuelle Beziehung? Sie war erleichtert darüber gewesen, dass es im Haus zwei separate Schlafzimmer gab. Außerdem hatte sie gleich klargestellt, dass sie verlobt war, emotional gebunden. Sie hatte daran doch keinen Zweifel gelassen, oder? Sie betrachtete es aus seinem Blickwinkel und dann aus ihrem eigenen. Liam war ihr Erster gewesen. Sie erinnerte sich noch gut an den Schock der Intimität. Es war ebenso erschreckend wie erregend gewesen. Sie hatte sich vor ihm so geöffnet, so entblößt. Mittlerweile wusste sie von Frauen, kannte sogar welche, die nach Jahren mit alten Ex-Freunden wieder etwas angefangen hatten. Bei manchen war es katastrophal ausgegangen, bei anderen nicht. Sie schob den Gedanken weg. Das war damals, und jetzt war jetzt. Im Jetzt war sie glücklich und in den Mann verliebt, den sie bald heiraten würde.
Liam war für sie inzwischen ein Fremder. Sie würde ihm diesen Gefallen tun, dabei aber nichts machen, was ihr widerstrebte, und dann in ihr Leben zurückkehren.
Die Gleise begannen auf diese typische Art zu summen. Ein Zug kam. Sie warf einen Blick auf ihr Telefon: neun Uhr vierundzwanzig. Ja, das war der richtige. Sie erhob sich, trat einen Schritt vor und spähte in Richtung London. In der Dunkelheit konnte sie bereits das Licht des nahenden Zuges ausmachen, auch wenn er noch erstaunlich weit entfernt wirkte. Nervös trat sie von einem Bein aufs andere. Sie fragte sich, ob Liam ebenfalls nervös war. Wahrscheinlich nicht. Er hatte das Ganze ja geplant, außerdem war er ihr in der Vergangenheit nie wegen irgendetwas nervös erschienen.
Das Summen der Gleise verstärkte sich. Auch das Rattern des Zuges selbst wurde mittlerweile lauter, das Licht an der Vorderseite größer. Als der Zug näher kam, konnte sie sogar die Gestalt des Fahrers erkennen, seine Silhouette, und wich reflexartig von der Bahnsteigkante zurück.
Die Bremsen kreischten. Während der Zug immer langsamer wurde, sah sie in den erleuchteten Fenstern die Umrisse von Fahrgästen. Schließlich stand er, doch es gingen keine Türen auf. Niemand stieg ein, niemand stieg aus. Dann, nach ein paar Minuten, war er wieder weg, und Jude schaute zu, wie die roten Rücklichter in der Dunkelheit verschwanden.
6
Jude war so verblüfft, dass es ein paar Momente dauerte, bis sie wieder klar denken konnte. Sie holte ihr Handy heraus und sah auf die Uhrzeit. Es bestand kein Zweifel. Der Zug war pünktlich eingetroffen, Liam aber nicht ausgestiegen. War es überhaupt der betreffende Zug gewesen? Vielleicht kam der richtige erst noch.