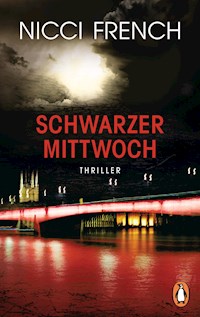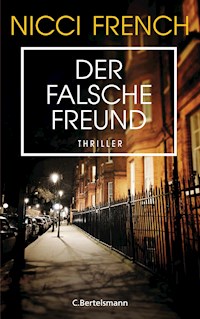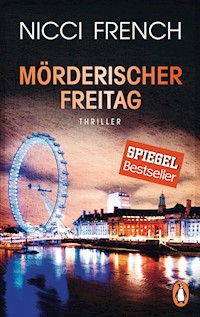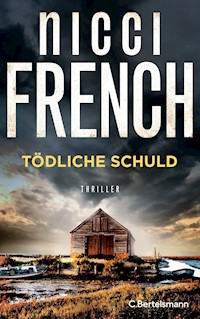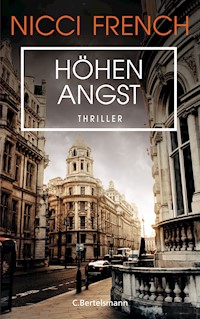2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ungemein spannend und unterhaltsam.« Deutschlandfunk Kultur
Als Neve Connolly in der Wohnung ihres Geliebten eintrifft, findet sie ihn mit einem Hammer erschlagen. Neve steht unter Schock, denn sie ist verheiratet und der Tote war ihr Chef. Aus Angst, dass ihre Affäre auffliegt, beseitigt sie all ihre Spuren. Was sie erst später bemerkt: Ihr Armband blieb zurück. Panisch fährt sie nachts noch einmal in die Wohnung - Schmuckstück und Hammer sind verschwunden. Es weiß also jemand von ihrem Geheimnis - ist es der Mörder? Neve beschließt, den Täter selbst zu stellen. Doch damit begibt sie sich und andere in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Als Neve Connolly, dreifache Mutter und langjährig verheiratet, ihren Geliebten erschlagen in seiner Wohnung auffindet, greift sie spontan zum Putzlappen und erst dann zum Telefon. Sie will ihre Spuren beseitigen, einen Skandal vermeiden – denn Saul ist auch ihr Boss. Doch in der Eile vergisst sie ihren Lieblingsschmuck. Zu ihrem Entsetzten entdeckt sie Armband und Tatwaffe kurz darauf bei der halbwüchsigen Mabel, ihrem Sorgenkind. Was weiß ihre Tochter? Ist sie die Täterin? Oder galt der Mord gar nicht Saul? Neve muss der Polizei zuvorkommen und begibt sich in höchste Gefahr … ein Thriller, der unter die Haut geht.
Autor
Nicci French – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit über 20 Jahren sorgen sie mit ihren außergewöhnlichen Psychothrillern international für Furore und verkauften weltweit über 8 Mio. Exemplare. Die beiden leben in Südengland. Zuletzt erschien die achtteilige Bestsellerserie um Frieda Klein.
NICCI FRENCH
WAS SIE NICHT WUSSTE
THRILLER
Deutsch von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Lying Room« bei Simon & Schuster UK Ltd.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019 Nicci French
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2019 bei C. Bertelsmann, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Plainpicture/Millennium/Nikolay Mirchev
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24116-2V004
www.penguin.de
Darum belüg’ ich sie, belügt sie mich …
SHAKESPEARE, Sonett 138
1 DIE VERABREDUNG
Als Neve die Jalousien hochzog, erwachte die Küche zum Leben wie eine noch leere Theaterbühne, in Erwartung des vertrauten Schauspiels. Neve blickte sich um. Es wirkte alles ein wenig schäbig: die verschrammten Sockelleisten, der Riss in der Wand. Fletcher und sie wollten schon seit Jahren etwas dagegen unternehmen. Die Tischplatte verunzierten Weinflecken und ein paar Brandspuren von Zigaretten, zwischen den Deckenlampen hingen Spinnweben. Außerdem hatten sie nach dem gestrigen Abendessen nicht richtig aufgeräumt, neben der Spüle türmte sich schmutziges Geschirr, und die Milch hatten sie auch nicht zurück in den Kühlschrank gestellt. Gestern Abend. Einen Moment gab sie sich der Erinnerung hin, dann verdrängte sie die Bilder. Nicht jetzt, dachte sie. Nicht hier.
Neve warf einen Blick auf die Uhr. Zehn nach sieben. Sie füllte ein Glas mit Wasser und trank es langsam aus. Schließlich band sie den Gürtel ihres Morgenmantels fester, holte tief Luft und wandte sich wieder dem Raum zu. Wie aufs Stichwort schwang die Tür auf.
»Guten Morgen!«, begrüßte sie ihren älteren Sohn betont fröhlich.
Rory blinzelte, murmelte etwas und nickte. Zu einer blauen Jeans trug er ein blaues T-Shirt und einen blauen Pulli. Er hatte ihre irische Blässe geerbt und würde einmal sehr groß werden. Auch das hatte er von ihr. Im Lauf des letzten Jahres war er ganze zehn Zentimeter gewachsen. Neve musste bei seinem Anblick oft an ein Gummiband denken, das bis zum Zerreißen gespannt war. Manchmal kam es ihr fast vor, als könnte sie ihn wachsen sehen. Seine Gliedmaßen erschienen ihr immer länger, seine Füße groß und platt, seine knochigen Gesichtszüge ausgezehrt.
»Super Farbkombi«, bemerkte sie. Am liebsten hätte sie einen Arm um ihn gelegt, hielt sich aber zurück. Neuerdings mochte er es nicht mehr so gern, wenn man ihn anfasste. Ihn zu umarmen war zu einer steifen, sperrigen Angelegenheit geworden. Bald wurde er elf. Nächstes Jahr würde er die höhere Schule besuchen und Uniform tragen.
Er ließ sich am Tisch nieder. Sie stellte ihm eine Packung Cornflakes und eine Schüssel hin und holte frische Milch aus dem Kühlschrank. Er aß zum Frühstück immer nur Cornflakes. Neve sah zu, wie er einen raschelnden Haufen Frühstücksflocken in die Schale rieseln ließ und anschließend mit Milch übergoss. Dann zog er sich ein Buch heran und schlug es auf. Oben hörte man laute Stimmen, eine Klospülung, eine knallende Tür. Mit Schreck dachte Neve an die Kleidung, die sie gestern Nacht noch schnell in die Waschmaschine gesteckt hatte. Eilig zog sie die feuchten Sachen heraus und legte sie in den Wäschekorb.
Inzwischen war es Viertel nach sieben.
»Guten Morgen!«, sagte Neve wieder betont fröhlich. Eine ihrer Aufgaben war seit jeher, den Tag anzukurbeln und die ganze Familie in Schwung zu bringen.
Diesmal war es Fletcher, der die Küche betrat, das Haar noch feucht vom Duschen, die Wangen frisch rasiert. Er sah sie kaum an, sondern starrte ein wenig abwesend in den Garten hinaus. Dafür war sie ihm sehr dankbar.
»Tee?«, fragte er.
Sie brauchte nicht zu antworten, denn morgens trank sie immer Tee. Fletcher trank immer Kaffee. Es war seine Aufgabe, sowohl Tee als auch Kaffee zu machen, die Spülmaschine auszuräumen und den Müll rauszutragen. Neves Aufgabe bestand darin, den Kindern das Frühstück herzurichten und dafür zu sorgen, dass sie es aßen, und ihre Pausenbrote einzupacken.
Sie schüttete Haferflocken in eine Pfanne, fügte Milch und eine kleine Prise Salz hinzu und stellte den Haferbrei dann zum Erhitzen auf den Ofen. Das alles tat sie ohne nachzudenken. Connor verspeiste zum Frühstück jeden Tag Porridge mit goldgelbem Sirup obendrauf. Fletcher aß Toast mit Marmelade.
Im Moment aber war ihr Mann noch anderweitig beschäftigt. Nachdem er kochendes Wasser über die Teebeutel gegossen hatte, trat er hinaus in den Flur und rief: »Connor! Frühstück!«
Geistesabwesend rührte Neve das Porridge um. Unter ihrem Löffel spürte sie, dass der Brei bereits fester wurde. Ihr eigener Körper dagegen fühlte sich seltsam weich an, als besäße sie keine Knochen mehr. Aus dem Garten fiel gedämpftes Herbstlicht herein. Einen Daumen an die Unterlippe gedrückt, schloss sie einen kurzen Moment die Augen.
Benommen registrierte sie, dass Fletcher dicht hinter ihr etwas sagte, und drehte sich um.
»Was hast du denn heute für Pläne?« Er stellte ihr eine Teetasse hin.
»Ich dachte, ich gehe in den Schrebergarten. Schließlich muss ich meine neue freie Zeit so gut wie möglich nutzen.«
Draußen sein, dachte sie voller Erleichterung, in der kühlen Morgenluft einen Spaten in die Erde rammen, Unkraut jäten, müde und schmutzig werden, mit Wasserblasen an den Händen und Erde unter den Nägeln – ohne an irgendetwas zu denken. Ein paar Wochen zuvor hatte sie den Sprung gewagt, nur noch Teilzeit zu arbeiten, obwohl sie genau wusste, dass es in fast jeder Hinsicht eine dumme Entscheidung war. Schließlich verdiente sie schon immer den Großteil des Lebensunterhalts für die Familie, und sie brauchten das Geld momentan dringender denn je. Mabel würde bald die Universität besuchen. Gleichzeitig schien alles, angefangen vom Boiler bis hin zum Dach, langsam den Geist aufzugeben. Die Regenrinnen mussten erneuert werden, und der kleine Raum hinter der Küche war feucht. Manchmal rechnete sie die Kosten zusammen, versuchte krampfhaft, auf ein anderes Resultat zu kommen, und besprach es dann mit Fletcher in möglichst sachlichem Ton, damit er sich ja nicht minderwertig fühlte, weil er so wenig verdiente. »Das hat sich halt einfach so ergeben«, sagte sie stets, wenn die Sprache darauf kam.
Ein paar Wochen zuvor war sie eines Abends durch den strömenden Regen nach Hause geradelt und – noch in ihrer gelben Regenjacke, der völlig durchnässten Hose und den vor Regenwasser schmatzenden Schuhen – in die Küche gestürmt, um das Abendessen zuzubereiten, als sie plötzlich dachte: Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe genug. Genug davon, immer in Eile zu sein, immer zu spät dran, immer mit dem Gefühl, etwas vergessen zu haben. Genug davon, bei geschäftlichen Besprechungen den Tränen nahe zu sein und nachts schweißgebadet aufzuwachen, den Kopf voller unerledigter Aufgaben, und hinter allem wie eine dunkle Wand ständig die gnadenlose, zermürbende Angst wegen Mabel zu spüren. Auf Teilzeit umzusteigen und nur noch dreieinhalb Tage die Woche zu arbeiten war ein Versuch, für sich selbst Raum – nur ein klein wenig Raum – zu schaffen, damit sie nicht endgültig verrückt wurde. Und schau, was daraus geworden ist, dachte sie.
Fletcher räumte gerade die Spülmaschine aus. Neve suchte im Kühlschrank nach etwas, das sie den Jungen als Pausenbrot mitgeben konnte. Inzwischen befand sich auch Connor im Raum, knuffig und rundgesichtig, mit Bürstenhaarschnitt und lauter Stimme. Er zog seine übliche Show ab, während sein dürrer älterer Bruder über ein Buch gebeugt saß, in dem es um Insekten ging. Nachdenklich betrachtete Neve ihre Söhne und ihren Mann. Einen Moment kamen sie ihr vor wie Aufziehpuppen, die ihr morgendliches Programm absolvierten, Tag für Tag das gleiche Ritual. Gemäß den Gewohnheiten, die sie im Lauf der Jahre entwickelt hatten, ohne es selbst zu merken, spielte jeder von ihnen die ihm zukommende Rolle.
Wir sehen uns. Der Satz glitt wie ein glatter, runder Stein durch ihre Gedanken – so deutlich, dass sie im ersten Moment dachte, er wäre laut ausgesprochen worden, und sich suchend im Raum umblickte. Fletcher runzelte gerade konzentriert die Stirn und presste die Zungenspitze an die Oberlippe, damit beschäftigt, das Toastbrot aufzuschneiden. Wir sehen uns.
Gedankenverloren wickelte Neve ein Stück Käse aus. Wie war es möglich, sich gleichzeitig so müde und so wach zu fühlen, so erbärmlich und so himmelhoch jauchzend? Normal, sei normal, ermahnte sie sich selbst.
»Wie hast du geschlafen?«, erkundigte sie sich bei Fletcher.
»Gut. Ich bin nicht mal wach geworden, als du reingekommen bist. Wie spät war es denn?«
»Keine Ahnung. Nicht allzu spät. Aber du hast geschlafen wie ein Toter.« Erschrocken über ihre Wortwahl, griff sie nach ihrem Tee und nahm einen großen Schluck.
»Nach Mitternacht«, sagte eine andere Stimme, kalt und scharf wie eine Messerklinge.
»Mabel! Du bist aber heute schon früh auf!«
Mabel stand in der Tür. Sie trug ein kurzes, braun-schwarz kariertes Kleid, eine gerippte Strumpfhose und schicke kleine Stiefeletten. Ihr braunes Haar, das sich weich lockte, wenn sie es offen trug, war an diesem Morgen zu festen Zöpfen geflochten, wodurch ihr Gesicht noch schmaler wirkte als sonst. »Ich bin schon seit Stunden wach«, verkündete sie. »Wahrscheinlich habe ich überhaupt nicht geschlafen. Wahrscheinlich war ich die ganze Nacht wach. Lass das!« Zornig funkelte sie Connor an, der gerade seine Hand in der Cornflakes-Packung vergrub und eine Handvoll herausschaufelte, um sie sich direkt in den Mund zu schieben. Er funkelte zurück. Sein Mund war zu voll für eine Antwort. »Jedenfalls«, fuhr sie an Neve gewandt fort, »habe ich dich heimkommen gehört. Nach Mitternacht.«
»Kein Wunder, dass ich müde bin«, antwortete Neve munter. Vielleicht zu munter. Sie verspürte schlagartig ein starkes Verlangen nach einer Zigarette, obwohl sie schon seit Jahren nicht mehr rauchte, mal abgesehen von ein paar heimlichen Ausnahmen auf Partys. Sie hatte aufgehört, als die Kinder kamen. Aufgehört mit den Zigaretten, den Alkoholexzessen, den durchtanzten Nächten mit anschließendem Fish-and-Chips-Frühstück. Sie stromerte auch nicht mehr tagelang mit ihrer Clique auf Märkten herum oder brach spontan mit Fletcher zu einem Wochenende am Meer auf, nach dem Motto, warum auch nicht? Trotzdem trauerte sie diesen Zeiten nicht nach, denn selbst jetzt noch – oder gerade jetzt, wo sie alles aufs Spiel setzte – liebte sie ihr Leben, ihre Kinder, ihren Mann. Aber warum sagte einem niemand, wie schwer das war? Wobei sie es einem natürlich doch sagten, man glaubte es nur nicht. Man bildete sich ein, es anders hinzubekommen, kostenlos, sorglos.
Mabel ließ sich am Tisch nieder. Fletcher stellte ihr eine Tasse Ingwertee mit Zitrone hin. Mabel trank zum Frühstück immer Kräutertee, und wenn es gut lief, aß sie dazu ein bisschen Obst, ein paar einzelne Blaubeeren und vielleicht noch ein Stück Mandarine, von dem sie vorher das ganze Weiße sorgfältig abzupfte. Doch an diesem Morgen gab es kein Obst. Neve bemühte sich krampfhaft, sie nicht zu beachten. Es schien ihr, als wäre sie schon seit Jahren damit beschäftigt, ihre Tochter zu beobachten und gleichzeitig zu versuchen, es nicht zu tun – immer angespannt, mit schmerzendem Herzen und einem dicken Kloß im Hals vor lauter Angst, immer bemüht, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Acht Tage noch, rief sie sich ins Gedächtnis, dann war Mabel weg, aber was würde sie selbst danach tun? Wer wäre sie ohne ihre Tochter?
»Wie war Tamsin drauf?«, erkundigte sich Fletcher.
»Ach, du weißt schon. Immer noch wütend. Sie hat sich ein bisschen betrunken«, erklärte Neve, während sie eilig mehrere Brotscheiben mit Butter bestrich. »Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, sie alleine zu lassen.«
Fletcher schaltete das Radio ein, um sich die Nachrichten um halb acht anzuhören. Während er sich mit seinem Marmeladentoast niederließ, starrte er wie gebannt auf sein Handy, die Zungenspitze an der Oberlippe. Connor sagte etwas von Fußball nach der Schule. Rory glitt von seinem Stuhl, immer noch lesend, ein Knochenhaufen mit dünnen Handgelenken. Er bräuchte dringend neue Klamotten, ging Neve durch den Kopf, und jede Menge gehaltvolle Suppen, Blattkohlgerichte und klebrigen Karamellpudding. Ihr Blick wanderte weiter zu Mabel, die kleine Schlucke von ihrem Tee nahm, dabei aber wachsam über den Rand der Tasse spähte. Ihre ordentlich geflochtenen Zöpfe umrahmten eine rebellische Miene.
Mit lautem Stuhlscharren sprang Connor auf, und gleichzeitig verkündete ein Piepen den Eingang einer Nachricht auf Neves Handy, das inmitten der Frühstücksreste für alle gut sichtbar auf dem Tisch lag.
Neve drehte sich um, warf einen Blick darauf und deckte es dann mit der flachen Hand ab.
»Geh und putz dir die Zähne«, sagte sie zu Connor. »Du willst doch nicht wieder zu spät kommen. Außerdem musst du noch das Meerschweinchen füttern.« Ihr war klar, dass er das nicht tun würde.
Sie nahm das Telefon vom Tisch und versenkte es in der Tasche ihres Morgenmantels.
Mabel glitt vom Stuhl. »Ich bin dann weg«, verkündete sie.
»Du musst weg?«
»Ist das ein Problem?«
»Wohin denn?« Die Frage war Neve rausgerutscht, ehe sie sich am Riemen reißen konnte, aber seit wann musste man eigentlich jedes Wort auf die Goldwaage legen? »Es ist noch ziemlich früh«, fügte sie hinzu. »Sei mal still, Connor, ich verstehe ja mein eigenes Wort nicht. Zähneputzen! Los jetzt!«
»Ziemlich früh wofür?«
»Keine Ahnung, vergiss es. Ignorier mich einfach. Ich bin müde. Wir sehen uns später, falls du da bist. Kommst du zum Abendessen?«
»Weiß ich noch nicht.«
Mabel stellte ihre Tasse ab und verließ den Raum. Die Haustür ging auf und zu. Abrupte Abgänge waren seit jeher ihre Stärke.
»Du siehst tatsächlich ein bisschen fertig aus«, bemerkte Fletcher. »Und dein Bluterguss färbt sich gelb.«
Neve hob eine Hand an ihre Wange, die sich geschwollen und wund anfühlte. Als sie ein paar Tage zuvor in der Dunkelheit nach Hause geradelt war, hatte sie jemand vom Fahrrad gestoßen oder war ihr zumindest vor den Reifen gestolpert – vielleicht ein Betrunkener oder einfach jemand, der wütend war auf die Welt. Sie hatte das unheimliche Gefühl gehabt, in Zeitlupe durch die Luft zu segeln, und dabei gedacht: Das wird wehtun. Bei ihrer Landung auf der Straße hatte sie sich die Wange böse aufgeschürft und die Jeans zerrissen.
Sie betrachtete ihren Ehemann: sein nackenlanges dunkles Haar, seinen sauber getrimmten Bart, die runde Brille und die wachen, aber traurig dreinblickenden braunen Augen dahinter. Neve entdeckte in seinem Gesicht kleine Fältchen, die ihr vorher noch nie aufgefallen waren, und den Ansatz einer wunden Stelle an seinem rechten Mundwinkel. Seine Miene wirkte etwas mürrisch, wie morgens meistens. In ihrer Tasche erwachte das Telefon vibrierend zum Leben.
»Das wird schon wieder. Ich gehe heute früh ins Bett.« Ihr fiel etwas ein. »Du weißt, dass wir morgen Abend Renatas Geburtstag feiern?«
»Gibt’s einen Feierabenddrink?«
»Eher eine Party.«
Fletcher stöhnte.
»Übermorgen Abend gehen wir auch aus«, fuhr Neve fort.
»Was ist denn da?«
»Eine Art Ehemaligentreffen. Jackie Dingsbums hat es organisiert, zusammen mit Tamsin.«
»Jackie wer?«
Neve überlegte einen Moment.
»Mir fällt der Nachname gerade nicht ein. Ach, doch, Cornfield. Jackie Cornfield. Sie hat auch mit uns studiert. Du erinnerst dich bestimmt an sie.«
»Dunkel. Aber warum müssen wir mit ihr was trinken gehen?«
»Weil alte Studienfreunde das eben so machen. Es kommt außerdem nicht nur sie, sondern unsere ganze Clique, und ein paar andere sind auch noch eingeladen.«
»Das wird ja eine Höllenwoche.« Er stand auf. »Ich treffe mich gleich mit jemandem wegen eines Jobs. Also dann, bis später.«
Neve gestattete sich, einen Moment über ihren Mann nachzudenken. Vielleicht hatte er wegen seines Termins so schlechte Laune. Fletcher war Illustrator. Zumindest sagte er das, wenn ihn jemand fragte, was er beruflich mache. Doch das Geld, das er verdiente, stammte hauptsächlich von seinen Aufträgen als Maler und Tapezierer – Arbeit, die er verachtete. Er hasste es, kein Geld zu verdienen, aber ebenso hasste er es, auf diese Art welches zu verdienen. Wenn er keinen Auftrag hatte, saß er manchmal den ganzen Tag in dem kleinen Raum, den sie zu seinem Atelier erklärt hatten, und brachte keinen einzigen Strich aufs Papier. Neve wusste das, und er wusste, dass sie es wusste. Manchmal saß auch Mabel in ihrem Zimmer oder lag im Bett, die Decke über den Kopf gezogen. An solchen Tagen gab sich Neve immer besondere Mühe, das Haus mit Fröhlichkeit zu füllen, indem sie Musik auflegte, alle Lichter anmachte, Kuchen oder Kekse backte, mit den Jungs Karten spielte oder sich bei Computerspielen auf der ganzen Linie schlagen ließ. Es war, als gäbe es bei ihr im Nacken einen Knopf: Ein Knopfdruck reichte, und schon verfiel sie in ihren Fröhliche-Mutter-Modus.
»Das wusste ich nicht. Hoffentlich läuft es gut.« Neve legte ihm eine Hand auf die Schulter. Sie waren fast gleich groß – Schulter an Schulter, auf Augenhöhe. Rory würde ebenfalls groß werden. Bei Connor konnte man es noch nicht sagen, aber Mabel war klein und zierlich, ihr aus der Art geschlagenes Kind.
Fletcher griff nach seiner Jacke und ging. Neve scheuchte Connor die Treppe hoch und rief ihm Anweisungen hinterher. Dann war sie wieder allein in der Küche. Um sie herum kehrte Ruhe ein. Sie fischte ihr Handy aus der Tasche und gab das Passwort ein, woraufhin auf dem Display der Text erschien: Ich habe bis Mittag frei. Komm, sobald du kannst. Der Absender war nicht ersichtlich, aber das spielte keine Rolle. Die Nachricht konnte nur von einem einzigen Menschen stammen.
Sie räumte das Frühstücksgeschirr in die Spülmaschine, wischte die Brösel vom Tisch und hängte die paar Wäschestücke in den Garten, wo der Wind den bunten Rock und die weiße Hemdbluse, bei der die beiden obersten Knöpfe fehlten, flattern ließ. Dann machte sie die Pausenbrote für die Jungen fertig: Käse und Tomate für Rory, Käse ohne Tomate für Connor, dazu für jeden einen Apfel und einen großen Haferkeks. Ziemlich fantasielos, fand sie, aber sie hatte gestern das Einkaufen vergessen. Gestern. Es kam ihr vor wie ein Traum – oder wie das einzig Wahre, neben dem alles andere verblasste und verschwamm. Sie schnipselte eine Nektarine in eine Schüssel, löffelte Joghurt darüber und ließ sich mit einer weiteren Tasse Tee am Tisch nieder, während oben im ersten Stock Wasser rauschte und irgendetwas Schweres auf den Boden knallte. Doch sie bekam keinen Bissen hinunter.
Um halb neun begleitete Neve Rory und Connor nach draußen und sah den beiden nach, wie sie die Straße entlangmarschierten – Seite an Seite, aber in verschiedenen Welten: Rory mit Ohrstöpseln und hochgezogenen Schultern, die Hände in den Taschen, während Connor, der neben ihm klein und kompakt wirkte, mit schwingendem Schulranzen dahinhüpfte, mal langsamer und dann wieder schneller.
Endlich war sie allein. Sie ging nach oben, zog ihren Morgenmantel aus, sah sich die Nachricht auf ihrem Handy noch einmal an und legte es dann mit dem Display nach unten aufs Bett. Anschließend duschte sie so heiß, dass sie das Wasser auf ihrer Haut wie Nadelstiche empfand, seifte sich von Kopf bis Fuß ein, wusch sich das Haar und machte sich hinterher ausnahmsweise die Mühe, es zu fönen, statt wie sonst bloß mit einem Handtuch durchzurubbeln. Sie putzte sich die Zähne länger als üblich und betrachtete dabei ihr Gesicht im Spiegel. Fletcher hatte recht, der Bluterguss verfärbte sich, was ihrem Gesicht ein gelbliches, ungesundes Aussehen verlieh. In zwei Wochen wurde sie sechsundvierzig. Nächstes Jahr würden sie und Fletcher ihren zwanzigsten Hochzeitstag feiern. Damals waren sie so jung gewesen, sie hatten es so eilig gehabt, sich des anderen und ihrer gemeinsamen Zukunft so sicher gefühlt. Jetzt tauchten erste Silberfäden in ihrem dunklen Haar auf, auch wenn niemand sonst diese bisher bemerkt hatte. In ihr Gesicht gruben sich winzige Fältchen ein. Wenn sie nachts neben Fletcher im Bett lag, hatte sie manchmal heiße Wallungen, die in ihrem ganzen Körper ein Gefühl von Schwere und Beklemmung auslösten, als ertränke sie in ihrer eigenen, innerlichen Flutwelle.
Sie sollte zum Schrebergarten fahren, würde es aber nicht tun. Ihr war klar, dass sie das eines Tages bereuen würde, wahrscheinlich schon sehr bald. Ein Teil von ihr – der Teil, der beobachtete und beurteilte – bereute es bereits jetzt.
Sie verteilte Lotion auf ihrem Körper, Creme auf ihrem Gesicht. Sie zog einen schwarzen Slip und einen neuen schwarzen BH an, von dem sie erst noch das Preisetikett entfernen musste. Dabei war ihr fast ein bisschen übel vor Verlangen, vor Gefahr, vor Schuld, vor Freiheit – vor dem Gefühl, sich selbst fremd zu sein. Sie schlüpfte in eine enge schwarze Jeans und ihre geliebten, abgewetzten Stiefeletten und stöberte dann durch ihre Schubladen, bis sie auf einen hellgrauen Pulli stieß, der sich auf ihrer Haut schön weich anfühlte. Dazu kleine Silberohrringe. Eine abgetragene Lederjacke, die sie fast schon ihr ganzes Erwachsenenleben besaß. Einen farbenfrohen Schal. Kein Make-up. Die ersten paar Male hatte sie sich geschminkt, aber jene Tage waren vorbei. Auf die Handgelenke und hinter die Ohren tupfte sie einen Hauch von Parfüm, einen intensiven, schweren Moschusduft. Obwohl es noch nicht einmal neun war, kam es ihr vor, als würde die Zeit nur so verfliegen. Eilig streifte sie ihren Armreif übers Handgelenk.
Schlüssel, Handy, Geldbörse. Sie schwang sich ihren neuen Lederrucksack, den sie noch nicht gewohnt war, über die Schultern. Er glänzte zu neu und hatte zu viele verschiedene Fächer, sodass in seinen Tiefen ständig irgendetwas verloren ging. Ihr alter hatte mehr als fünfzehn Jahre überdauert, bis ihn schließlich irgendjemand direkt vor ihrer Nase gestohlen hatte, während sie mit Renata und Tamsin beim Mittagessen saß. Ungeduldig hob sie ihr Rad von seiner Halterung in der Diele und schob es nach draußen auf den Gehweg, wo sie aufstieg und hinaus in den schönen, kühlen Morgen fuhr. Schlagartig wurde ihr ganz leicht ums Herz. Sie fühlte sich wie ein Vogel, der sich in die Lüfte erhob. Weg, nur schnell weg!
Sie war schon so oft aus Clapton in die Stadt und aus der Stadt zurück nach Clapton geradelt, dass sie die Strecke manchmal gar nicht mehr bewusst wahrnahm. Sie war sie in heißen Sommernächten in Shorts und T-Shirt gefahren, aber auch an kalten Tagen, bei strömendem Regen, mit so klammen Händen, dass sie kaum die Gangschaltung betätigen konnte. Sie war zu Geschäftsbesprechungen geradelt, zu Weihnachts- und Geburtstagsfeiern und zu Abschiedsfeten. Zu Märkten, zu Läden, zu Bestattungsinstituten. Manchmal hatte sie sich so müde gefühlt, dass sie fast auf dem Sattel eingeschlafen wäre, manchmal hellwach – an schönen, sonnigen Wintermorgen, wenn sie jedes Glitzern und jedes Geräusch aufmerksam wahrnahm. Sie war stocknüchtern geradelt, aber auch zugedröhnt und sturzbetrunken. Einmal, als sie definitiv das Gefühl hatte, dass die vorbeifahrenden Autos mit ihr sprachen, hatte sie sich dafür entschieden abzusteigen.
Jetzt erreichte sie gerade die Ecke von Hackney Downs. Zwei Männer marschierten mit Tennisschlägern die Straße entlang. Andere Leute schoben Kinderwagen. Sie selbst fuhr in die Stadt, um Ehebruch zu begehen, genau wie am Vorabend.
Weiter ging es durch London Fields, wo kleine Kinder Fangen spielten und Hunde hinter Stöckchen herliefen.
Gestern Nacht war sie ohne Licht nach Hause gefahren, benebelt von Wein und einer schmerzhaften Mischung aus Lust und Schuldgefühlen. Wie Mabel ihr säuerlich ins Gedächtnis gerufen hatte, war es nach Mitternacht gewesen, als sie leise die Tür aufgeschlossen, ihre Schuhe ausgezogen und sich auf Zehenspitzen die Treppe hinaufgeschlichen hatte. Im Bad hatte sie gelauscht, ob irgendetwas zu hören war, sich eilig ausgezogen und dann im Dunkeln wieder auf den Weg nach unten gemacht, um ihre Sachen gleich in die Waschmaschine zu stecken.
Der gestrige Abend war eine Art Abschiedsfeier gewesen: Er musste zu einer mehrtägigen Konferenz. Deswegen überraschte es sie, dass er an diesem Morgen Zeit hatte. Offenbar hatten sich ein paar freie Stunden ergeben. Es war so lange her, dass jemand sie derart begehrt hatte, mit einer solchen Dringlichkeit, dass jede Minute zählte.
Am Kanal gesellte sie sich zu all den anderen Radfahrern, die mit ihren schimmernden Helmen und neonfarbenen Jacken auf dem Weg ins hektische Stadtzentrum waren.
Als sie letzte Nacht im Dunkeln zu Fletcher ins Bett gekrochen war und er daraufhin die Position wechselte und im Schlaf irgendetwas murmelte, hatte sie sich gefragt, wie es möglich war, dass er nichts merkte. Wie konnte das sein? Eigentlich hätte er es selbst im Tiefschlaf spüren müssen. Es fühlte sich an, als trüge sie eine elektrische Ladung mit sich herum – als würde sie Funken sprühen, die zwangsläufig jedem in ihrer Nähe brennende Stiche zufügen mussten. Sie war immer der Meinung gewesen, wenn einer von ihnen eine Affäre hätte, würde dieser Verrat ihre Ehe explosionsartig zerstören und das Leben, das sie sich im Lauf der Jahre mühevoll aufgebaut hatten, in tausend Stücke zerbersten lassen. Doch nun hinterging sie Fletcher Tag für Tag, und nichts passierte. Er schlief nachts immer noch friedlich neben ihr und stand am Morgen mit ihr auf. Die Jungs gingen zur Schule und kamen zurück. Mabel verblüffte die Familie nach wie vor mit ihren Launen, die zwischen charmanter Freundlichkeit und Zorn hin und her schwankten. Neve bezwang weiterhin das Chaos ihres Haushalts, fuhr zur Arbeit, traf ihre Freunde, bezahlte die Rechnungen. Das Leben ging seinen gewohnten Gang. Vielleicht, dachte sie, war das wie bei einem alten Gebäude, das abgerissen wurde, aber trotzdem noch eine Weile seine Form behielt, obwohl der Knopf für die Sprengung schon gedrückt worden war – bis es schließlich erbebte und seine Konturen sich langsam aufzulösen begannen, ehe es mit lautem Krachen in sich zusammenstürzte.
Während Neve den Treidelpfad entlangradelte, bemühte sie sich, möglichst klar zu denken, und sei es nur, um nicht im Kanal zu landen. Sie hatte das schon einmal bei einem anderen Radfahrer miterlebt. Zwar wusste sie nicht, ob der Betroffene gestoßen worden war oder jemandem ausweichen wollte oder einfach nur nicht aufgepasst und eine Kurve übersehen hatte, aber sie war Zeugin des Nachspiels geworden: Ein Mann im Anzug hatte bis zu den Knien im Wasser gestanden, eine Hand um den Lenker seines Fahrrads geklammert, eine Hand an der Uferböschung. Sie war mit mehreren anderen stehen geblieben, um ihn und sein Rad an Land zu ziehen, während er sich die ganze Zeit entschuldigte. Alle sagten, das sei nicht nötig, aber er entschuldigte sich weiter, bei wem auch immer, für was auch immer. Ihr war vor allem im Gedächtnis geblieben, dass es sie überrascht hatte, wie seicht das Wasser dort war. Sie hatte immer gedacht, es wäre viel tiefer.
Nun bog sie wieder vom Kanal ab, radelte durch schicke kleine Straßen, überquerte die City Road, fuhr an Sadler’s Wells entlang und von dort weiter auf die Theobalds Road. Sie erhaschte einen Blick auf die großen Platanen am Gray’s Inn. Eine Welle der Vorfreude durchströmte sie, begleitet von dem leicht bangen Gefühl, dass niemand außer ihm wusste, wo sie sich aufhielt. In den letzten paar Wochen hatte sie ein fremdes Land betreten, ein Land, in dem sich alles anders anfühlte, die gewohnten Regeln nicht mehr galten. Ihr war absolut klar, dass das, was sie tat, falsch war. Sie betrog Fletcher, aber sie würde nicht sich selbst betrügen.
Sie musste sich konzentrieren, während sie den Red Lion Square passierte, an Lastwagen, Bussen und Baustellen vorbeifuhr und Unmengen von Abgasen einatmete, die sie zum Husten brachten. An der Ampel wartete sie neben einem Radfahrer, der Sandwiches auslieferte. Als der Lastwagen hinter ihnen den Motor aufheulen ließ, wechselten sie einen genervten Blick: der Albtraum von High Holborn. Die Ampel schaltete auf Grün, ein Taxi kam auf sie zugeschossen und verfehlte sie nur knapp, dann hatte sie es endlich über den Kingsway geschafft. Sie fuhr seitlich ran, stieg ab und schob ihr Rad auf dem Gehweg die Drury Lane entlang, bis sie es schließlich an einen Pfosten kettete. Im Fenster einer Sandwichbar überprüfte sie ihr Spiegelbild.
Das schmucklose Ziegelgebäude in der kleinen Seitenstraße musste irgendwann mal ein Lagerhaus gewesen sein, doch mittlerweile hatte man es, genau wie alles andere, in Wohnraum umgewandelt. Neve tippte den Code ein und eilte die Treppe hoch. Sie zückte ihre Geldbörse, fischte den hinter einer Kreditkarte versteckten Schlüssel heraus, öffnete die Tür und trat ein.
»Hallo!«, rief sie.
Es kam keine Antwort.
»Saul.«
Noch immer keine Antwort. Vielleicht war er kurz unterwegs, um eine Kleinigkeit zu besorgen, Kaffee oder Milch. Es war halb zehn. Sie zog ihre Jacke aus und hängte sie an den Haken neben der Eingangstür.
Sie eilte den kleinen Gang entlang und betrat das Wohnzimmer. Schlagartig brach zu vieles über sie herein, als würde sie gleichzeitig von gleißendem Licht geblendet, von einer Explosion betäubt und zusätzlich in den Magen geboxt. Sie wich davor zurück, bis sie hinter sich die Wand spürte, die sie aufrecht hielt.
Er lag auf dem Rücken, und er war tot. Irgendwie verstand sie erst jetzt, beim Anblick dieser offenen Augen, zum ersten Mal richtig, was tot sein hieß. Das waren keine starrenden Augen mehr. Es waren nur noch leblose Dinge, offen und entblößt. Sein Mund stand ebenfalls offen, wie zu einem Ausdruck unendlicher Überraschung erstarrt. Sein Kopf war umrahmt von einer dunkelroten Blutlache. Nicht nur sein Gesicht wirkte tot, sondern auch jeder einzelne Teil seines Körpers. Die Gliedmaßen nahmen unnatürliche Winkel ein. Der rechte Ellbogen war unter dem Körper eingeklemmt, wodurch seine Hand nach oben ragte, als wäre er gerade im Begriff, sich umzudrehen. Es sah unbequem aus, und Neve verspürte den Drang, es ihm bequemer zu machen, indem sie seinen Arm befreite, wie sie es manchmal getan hatte, wenn sie ineinander verschlungen, schweißgebadet und atemlos im Bett lagen und sie ihm half, seine Hand unter ihrem nackten Rücken herauszuziehen.
Sein grauer Anzug war vorne hochgeschoben, sodass man seinen Gürtel und den unteren Teil seines weißen Hemds sah. Das linke Bein war leicht angewinkelt. Zwischen Hosensaum und Schuh lugte ein Stück einer unglaublich knalligen Socke hervor, leuchtend rot und gelb. Sie kannte diese Socken. Einmal war sie mit ihm regelrecht ins Bett getaumelt, vor Leidenschaft blind und des Denkens nicht mehr fähig. Als sie hinterher quer über ihm lag, hatte sie ihn zum Lachen gebracht, indem sie ihm mit einiger Verspätung die Socken auszog.
Sie blickte sich im Raum um. Am hinteren Ende, weg von der Straße, stand ein kleiner Esstisch. Einer der Stühle war umgefallen. Vor ihrem geistigen Auge glaubte sie zu sehen, was passiert war: Er hatte sich aus irgendeinem Grund auf den Stuhl gestellt – um ein Bild aufzuhängen, eine Glühbirne auszuwechseln? – und war ausgerutscht, samt dem Stuhl umgekippt und mit dem Kopf gegen die Tischkante geknallt, woraufhin er vergeblich versucht hatte, sich aufzurichten, bis er am Ende wieder nach hinten gesunken und verblutet war.
Einen Moment lang dachte sie: Was für eine schreckliche, dumme Art zu sterben. Dann entdeckte sie etwas anderes, das ebenfalls auf dem Boden lag, aber nicht in seiner Reichweite, sondern näher bei ihr, nicht weit von der Fensterfront entfernt, die auf die Straße hinausging. Es handelte sich um einen Hammer, und zwar einen großen. Der Griff war mit blauem Kunststoff ummantelt, der Schaft aus silbrig schimmerndem Stahl. Der Kopf aber glänzte dunkel und feucht. Sie beugte sich hinunter, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Das war eindeutig Blut. Sie trat ein paar Schritte auf den Leichnam zu, wich jedoch gleich wieder zurück. Die andere Seite seines Kopfes – diejenige, die sie vorher nicht hatte sehen können – war gar nicht mehr richtig vorhanden. Der Schädel war eingeschlagen, nur noch dunkler Matsch. Sie konnte Knochensplitter erkennen.
Als sie sich wieder aufrichtete, verspürte sie ein starkes Schwindelgefühl, als würde sie gleich umfallen oder sich übergeben. Sie atmete ein paarmal tief ein, um sich zu fangen.
Ihr Blick wanderte zum Hammer und dann erneut zur Leiche. Sauls Leiche. Was für ein schlimmer Gedanke. Sie konnte es noch nicht begreifen, doch dann kam ihr langsam ein weiterer Gedanke, der sich verfestigte und immer mehr Gestalt annahm. Es handelte sich um einen Mord. Saul war ermordet worden. Sie formulierte den Satz anders: Jemand hatte Saul ermordet. Seine Nachricht an sie – wann war die gekommen? Vor einer Stunde. Nein, inzwischen war es wohl eher zwei Stunden her. Irgendwann danach war er ermordet worden.
Sie zog ihr Telefon heraus, um den Notruf zu wählen. Noch nie war es ihr so schwergefallen, eine Nummer zu tippen. Ihre Finger zitterten über der Tastatur. Dann erstarrte sie plötzlich. Ihr Blick wanderte zum Tisch, auf dem noch die Reste des Essens vom Vorabend standen, des Abendessens, das sie gemeinsam eingenommen hatten. Teller, Besteck, eine noch halb volle Salatschüssel. Aber keine Weinflasche und auch keine Gläser. Sie brauchte nicht nach ihnen zu suchen, denn sie wusste, wo sie sich befanden. Benommen trat sie wieder auf den Gang und ging die paar Schritte, die sie gestern zusammen, ineinander verschlungen und mit den Gläsern und der halb vollen Weinflasche in den Händen, getaumelt waren. Als sie jetzt die Schlafzimmertür öffnete, schlug ihr ein Duft entgegen, der Duft ihres eigenen Parfüms, unterlegt von anderen Gerüchen, die von menschlichen Körpern stammten.
Das Bett war nicht gemacht. Auf beiden Seiten stand je ein Glas. Die leere Flasche lag auf dem Teppich.
In der Ecke gab es einen kleinen Sessel, und zum ersten Mal, seit sie die Wohnung betreten hatte, setzte sie sich und zwang sich nachzudenken: nicht über sich selbst und auch nicht über Saul, den sie geliebt hatte oder in den sie zumindest verliebt gewesen war und der nun tot im Wohnzimmer lag, sodass sie ihn nie wieder treffen oder im Arm halten würde. Nein. Sie dachte an Mabel, an die schrecklichen Jahre, die sie hinter sich, all die Dinge, die sie durchgemacht hatte. Sie war so ein eifriges kleines Mädchen gewesen, optimistisch und verletzlich, aber in ihren Teenagerjahren hatte sich das geändert. Langsam war ein Schatten über das Haus gefallen und die ganze Familie von Angst ergriffen worden. Vielleicht waren die Drogen der Grund gewesen oder der Junge, an den Mabel ihr Herz verloren hatte, die Qual der ersten Liebe. Vielleicht hatte es auch einfach nur daran gelegen, dass sie ein Teenager war, chaotisch und voller Sehnsucht. Als Neve vorhin dort gestanden hatte, mit dem Telefon in der Hand, waren ihr jene Zeiten eingefallen: Mabel, in einer Ecke ihres Zimmers kauernd, die Knie bis unters Kinn gezogen, eine Lache aus Erbrochenem neben sich, den glasigen Blick auf Neve gerichtet. Mabel, die nicht nach Hause kam, oder erst im Morgengrauen, mit verschmiertem Lippenstift und zerrissener Kleidung. Mabel in jener schrecklichen Nacht, im Krankenhaus, mit Schläuchen im Arm und fast schon gelbem Gesicht. Es hatte Tage gegeben, an denen Neve und Fletcher befürchteten, sie würde nicht überleben. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, begann Neves Herz wie wild zu schlagen. Doch sie hatte überlebt. Was würde passieren, wenn sie erfuhr, dass ihre Mutter eine Affäre gehabt hatte? Dass ihr geliebter Vater betrogen worden war? Würde dann alles auseinanderbrechen? Das Leben, das sie so mühsam wieder zusammengekittet hatten?
Neve stand auf, kehrte ins andere Zimmer zurück und betrachtete Sauls auf dem Boden liegende Leiche.
Er war tot. Ermordet. Aber das hatte nichts mit ihr oder ihnen beiden zu tun. Was auch immer hier passiert war, hatte damit nichts zu tun. Sie warf einen Blick auf die Uhr, weil ihr klar wurde, dass sie eine Entscheidung treffen und dann handeln musste. Die Jalousien an den Fenstern, die zur Straße hinausgingen, waren geschlossen. Von dem Büro auf der anderen Straßenseite sah niemand herein.
Sie traf ihre Entscheidung.
Eins nach dem anderen. Im Schlafzimmer zog sie das Bett ab und rollte die Bettwäsche zu einem Bündel zusammen, das sie mit ins Bad nahm, wo sie die noch feuchten Handtücher vom Vorabend einsammelte. Nachdem sie auch noch das kleine Handtuch aus der Toilette geholt hatte, schob sie alles in die Waschmaschine, die in der Küche stand. Fehlte noch etwas? Ihr fiel nichts ein. Sie wählte den Schnellwaschgang: achtundzwanzig Minuten.
Sie streifte ihren Armreif ab, legte ihn neben dem Spülbecken auf die Arbeitsfläche, fischte unter der Spüle ein Paar Küchenhandschuhe heraus und zog sie an. Dann pendelte sie ein paarmal zwischen Küche und Esstisch hin und her, bis sie das ganze Geschirr abgeräumt hatte, und holte anschließend noch die Weingläser und die leere Flasche aus dem Schlafzimmer. Nachdem sie Teller, Gläser und Besteck in die Spülmaschine geräumt hatte, ließ sie den Blick über die Flächen in der Küche schweifen. Hatte sie irgendetwas vergessen? Sie beschloss, noch einmal eine Runde durch die Wohnung zu drehen. Im Bad stand das Glas mit den beiden Zahnbürsten. Blöderweise war sie sich plötzlich nicht mehr sicher, welche von beiden sie mitgebracht hatte. Deswegen nahm sie alle beide mit hinüber in die Küche, um sie dort zu entsorgen. Vorher aber schloss sie die Spülmaschine und stellte ebenfalls den kürzesten Waschgang ein: vierunddreißig Minuten. Die größeren Sachen wie die Salatschüssel, das Salatbesteck und eine Bratpfanne spülte sie im Becken. Nachdem sie alles gründlich geschrubbt hatte, stellte sie es zum Trocknen aufs Abtropfbrett.
Das war erst der Anfang.
Sie nahm die schwarze Mülltüte aus dem Küchenabfalleimer, die etwa zu einem Viertel gefüllt war, und warf die beiden Zahnbürsten hinein. Während sie so in der Küche stand, mit der Mülltüte in der Hand, spürte sie plötzlich einen dumpfen Schmerz in der Brust, der sich auszubreiten begann wie ein leises Summen: hinauf in ihren Hals, ihre Ohren, ihren Kopf. Sie zwang sich nachzudenken. Sie musste das systematisch machen, Raum für Raum, um sicherzustellen, dass sie nichts vergaß. Es galt, jede noch so kleine Spur von ihr zu entfernen. Saul war tot, aber Mabel lebte. Daran musste sie sich festhalten.
Sie nahm unter der Spüle einen zweiten Plastiksack heraus, für die Sachen, die sie mitnehmen würde, und begann dort, wo es am einfachsten war: im Bad. Vorher jedoch zog sie ihren weichen Pulli aus und deponierte ihn in der Diele, weil sie das dumpfe Gefühl hatte, dass sie keine Fasern in der Wohnung verbreiten sollte. Im Badschränkchen lag ein Päckchen Kondome. Sie ließ es in die Mülltüte fallen. Ihre Handcreme, ihre Migränetabletten und die kleine runde Parfümflasche, die würde sie behalten. Die Wattebausche und die halb volle Flasche Shampoo, die auf dem Rand der Badewanne stand, kamen in die Mülltüte. Als Nächstes fiel ihr Blick auf den Stummel der Kerze, die Saul und sie angezündet hatten, um sich dann in dem flackernden Licht zusammen in das warme Wasser zu legen. Sie blinzelte die Erinnerung weg. Dafür war später Zeit. Nicht jetzt. In die Mülltüte damit.
Sie sprühte Reinigungsmittel in die Wanne, schrubbte und spülte sie gründlich. Anschließend sprühte sie auch noch unter die Wanne. Wischte die Wasserhähne ab. Warf die Nagelfeile und die Seife weg, nur sicherheitshalber. Sprühte und schrubbte das Waschbecken. Was hatte sie alles angefasst? Sie versuchte sich zu erinnern. Hatte sie eine Hand an den kleinen Spiegel gelegt, in dem sie jetzt ihr Gesicht betrachtete, erschrocken über den Ernst ihrer bleichen Miene, den geschwollenen Bluterguss und die gruselige Absurdität des neuen schwarzen BHs? Sie besprühte das Glas, bis ihr Spiegelbild nur noch ein verschwommener Fleck war.
Dann kam das Schlafzimmer an die Reihe. Sie nahm die beiden Plastiksäcke mit hinüber und blieb einen Moment mit hängenden Schultern stehen. Traurig fragte sie sich, ob das alles wirklich real war. Danach griff sie unter die Jalousie und öffnete das Fenster weit. Dieser Raum brauchte dringend frische Luft, ein bisschen Wind, der die Gerüche der Nacht hinauswehte. Neben ihrer Seite des Bettes entdeckte sie noch ein leeres Wasserglas – als ob sie ihre jeweiligen Seiten gehabt hätten wie ein altes, eingespieltes Paar. Sie trug das Glas in die Küche, spülte es, stellte es auf das Abtropfbrett und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Sie spähte unter das Bett. Dort lagen ein Papiertaschentuch, eine alte Zugfahrkarte, die Quittung für ein Essen, das sie sich letzte Woche hatten kommen lassen, ein Stift ohne Kappe. In den Müll damit.
Jeder neue Gegenstand versetzte ihr einen kleinen, scharfen Stich der Erinnerung. Neve fühlte sich, als würde ihr Körper von allen Seiten mit Nadeln traktiert. Neben Sauls Bettseite lehnte eine Postkarte mit einem Bild von Modigliani. Sie hatte ihm die Karte geschenkt, weil sie das Bild seit jeher besonders gerne mochte. Auf eine Widmung hatte sie verzichtet. Sie schrieben sich nichts. Warum auch? Sie hatten sich fast täglich gesehen, waren aneinander vorbeigegangen und hatten dabei so getan, als würden sie in eine andere Richtung sehen und sich nicht bemerken. Warum war ihnen niemand auf die Schliche gekommen? Sie würde die Karte behalten, genauso wie das Lipgloss, das Deo und ihre Reservestrumpfhose. In Sauls Kleiderschrank, wo ein paar von seinen Hemden neben einem einzelnen guten Anzug hingen, entdeckte sie ein Lieblings-T-Shirt von sich. Sie konnte sich gar nicht daran erinnern, es in seiner Gegenwart getragen zu haben, aber es musste auf jeden Fall zurück nach Hause. Sie ging in die Knie, um sicherzustellen, dass nichts unter die Kommode gerollt war. In dem Moment hörte sie ein leises Geräusch. Sie erstarrte, wagte kaum mehr zu atmen. Ihr ganzer Körper war vor Angst wie gelähmt. Jemand befand sich in der Wohnung, bewegte sich leise durch die Räume. Doch dann erstarb das Geräusch. Sie spürte, wie sich ihre Muskeln schlagartig entspannten, als sie begriff, dass es nur der Wind war, der hereinblies und dabei ab und zu die Jalousie bewegte. Erleichtert machte sie sich wieder auf die Jagd: Sie war sicher, dass sie irgendwo ein bisschen Unterwäsche deponiert hatte, doch obwohl sie überall nachsah – in jeder Schublade, unter den Kissen, ja sogar unter der Matratze –, fand sie nichts.
In der Küche zeigte der Geschirrspüler noch sieben Minuten Restlaufzeit an, und die Waschmaschine zwei. Neve starrte auf das kleine rote Licht, als könnte sie das Gerät mit purer Willenskraft dazu bewegen, schneller fertig zu werden. Ungeduldig beobachtete sie durch das runde Fenster, wie sich die ineinander verschlungenen Laken und Handtücher drehten. Die Maschine erschauderte leicht. Noch eine Minute. Sie verstaute die Bratpfanne, die Salatschüssel und das Salatbesteck. Wann würde ihn jemand vermissen? Wann würde jemand auftauchen, um nach ihm zu sehen? Allein schon der Gedanke, es könnte an der Tür klopfen, ließ sie in Angstschweiß ausbrechen.
Die Waschmaschine gab ein schrilles Piepen von sich. Neve riss die Tür auf, zerrte die nassen Laken und Handtücher heraus, stopfte sie in den Trockner, stellte die Zeit ein und hörte, wie das Gerät ansprang. Dabei musste sie an ihre eigenen Sachen von letzter Nacht denken, die sich daheim an der Wäscheleine im Wind blähten.
Sie entdeckte ihre Fahrradlampen draußen auf dem Fensterbrett in der Diele, neben einem Preis, der Saul erst letzte Woche für »Innovation im Management« verliehen worden war. Es handelte sich um einen modernistischen Block aus grobem Stein, in den sein Name eingraviert war. Saul hatte gesagt, der einzige Ort, wo der hinkönne, sei das Klo, aber nicht einmal bis dorthin hatte es das Ding geschafft. Sie griff nach den Fahrradlampen und ließ sie in die Tüte fallen.
Nun war das Wohnzimmer an der Reihe. Da lag er. Er, Saul. Saul lag dort mit seinem eingeschlagenen Schädel und den leeren Augen. Trotzdem musste sie da rein. Sie holte tief Luft und betrat den Raum. Zuerst bemühte sie sich, nicht hinzusehen, doch irgendwie machte es das noch schlimmer. Sie spürte ihn dort, diese dunkle Masse aus Blut und Körper, immer noch kompakt, auch wenn er bestimmt schon kalt wurde. Plötzlich hatte sie den Wunsch, ihn zu berühren, allerdings nicht mit Gummihandschuhen wie eine Pathologin, die an der Leiche herumhantierte – aber auch nicht ohne, wie seine Geliebte, die ihre Spuren auf seiner Haut hinterließ. Sie starrte auf ihn hinunter, den Körper, der er gewesen war. Einen kurzen Moment ließ sie vor ihrem geistigen Auge eine andere Version der Geschichte ablaufen: Saul öffnete ihr die Tür in seinem grauen Anzug und seinem weißen Hemd, griff nach ihrer Hand, zog sie nach drinnen, schloss die Tür, begrüßte sie mit seinem typischen Lächeln und wurde dann ernst. Ihnen war beiden klar gewesen, welchen Schaden sie anrichteten – dabei war Neve eigentlich gar nicht die Sorte Frau, die ihren Lieben schadete, zumindest nicht auf diese Weise. Sie war die Ehefrau, die Mutter, das Arbeitstier, die gute Freundin, mit Silberfäden im Haar und ersten kleinen Fältchen im Gesicht.
Schließlich wandte sie sich ab. Ihr Blick fiel auf eine Zeichnung, die sie hier angefertigt hatte, als sie Saul mal erzählte, was sie in ihrem Schrebergarten alles anbaute. Während sie sprach, hatte sie kleine Skizzen von den verschiedenen Gemüsesorten gemacht: mit Bleistift schnell hingekritzelte Zucchini, Kürbisse, Knoblauchknollen, grüne Bohnen, Mangold, Rote Bete. Sie knüllte das Blatt zusammen und warf es in die Mülltüte. Als Nächstes entdeckte sie einen Band mit Kurzgeschichten von Frauen, den sie hiergelassen hatte und wieder mit nach Hause nehmen würde. In der Küche rumpelte der Trockner vor sich hin. Sie wanderte weiter im Raum herum, sammelte Dinge ein, blätterte durch Bücher, schaute unter Sofakissen und betrachtete dann einen Moment den Stapel Arbeitsunterlagen auf dem Tisch: Aktenmappen, zusammengeheftete Rechnungen, von der Firma Redfern herausgegebene Broschüren.
Schlagartig fiel ihr das Gedicht ein, das sie für ihn aufgeschrieben hatte, weil er sie gedrängt hatte, ihr doch etwas von sich zu geben, das er mit sich herumtragen konnte. Er hatte das halb ernst und halb scherzhaft gesagt, durchaus mit Leidenschaft, aber auch mit einer Portion Pathos, sodass ihr, obwohl es noch in die erste Phase heftiger Verliebtheit fiel, durch den Kopf ging: Das macht er nicht zum ersten Mal. Sie hatte ihn nie danach gefragt. Es spielte keine Rolle. Lachend hatte sie ihm das einzige Gedicht aufgeschrieben, das sie auswendig konnte, weil sie es gerne auf Partys zum Besten gab, meist in ziemlich beschwipstem Zustand. Einst hat Jenny mich geküsst, von ihrem Stuhl sie aufgesprungen ist … Jenny war Neves zweiter Vorname, deswegen hatte sie immer das Gefühl gehabt, es sei ihr persönliches Gedicht. Wo konnte es jetzt sein?
Sie ging hinaus in die Diele, wo sie seinen Mantel und seine Brieftasche vorfand. Die Gummihandschuhe machten die Suche schwierig, aber sie wagte nicht, sie auszuziehen, sondern arbeitete sich mit ungeschickten Fingern durch den ganzen Inhalt, bis sie sicher war, dass dazwischen kein Gedicht steckte. Dann kam ihr ein schrecklicher Gedanke: Vielleicht trug er es am Leib, in seinen Taschen. Nachdem sie in den Raum zurückgekehrt war, kniete sie sich neben den Leichnam, wobei sie die Augen halb zusammenkniff, um die Wunde nicht so klar sehen zu müssen, und zwang sich, seine Taschen abzutasten und dann die Hände hineinzuschieben, erst in die Jacken- und dann in die Hosentaschen. Sein Körper bewegte sich unter ihren zögernden Händen. Wurde er wirklich schon kalt? Wurden seine Gliedmaßen steif und sein Blut fest? Kein Gedicht. Vielleicht bewahrte er es zu Hause auf, in einem Versteck? Die Polizei würde es finden und sowohl seiner Frau als auch den Leuten in der Arbeit zeigen und alle fragen: Erkennen Sie die Handschrift? Oder vielleicht war es in seiner Schreibtischschublade im Büro. Dort würden sie es ebenfalls finden, und alle, mit denen sie zusammenarbeitete, würden es erfahren. Und auch Fletcher. Und dann …
Sie richtete sich auf. Vielleicht hatte er es doch nicht aufbewahrt.
Etwas anderes fiel ihr ein. Sein Handy. Wo war es? Sie blickte sich hektisch um. Diese Wohnung diente ihm nur als kleiner Stützpunkt, wo er bleiben konnte, wenn er bis spätabends arbeitete oder früh anfing. Da gab es nicht viel: Ein Bücherregal, einen Stapel Arbeitsunterlagen, einen schwach bestückten Kühlschrank mit einem Gefrierfach, das nur Eiswürfel enthielt, ein bisschen Kleidung zum Wechseln. Bei Neve zu Hause war es leicht, etwas aus den Augen zu verlieren, weil sich dort im Lauf der Jahre eine Unmenge von Gerümpel angesammelt hatte, aber hier war das schwierig. Neve wurde bewusst, dass sie noch gar nicht richtig klar denken konnte, sondern sich verhielt wie eine Betrunkene, die sich krampfhaft daran zu erinnern versuchte, wie man sich benahm, wenn man nüchtern war. Bei diesem Gedanken schoss eine Welle der Panik durch ihren Körper. Ihre Bewegungen wurden fahrig, ihre Hände zitterten. Sie hörte das Blut in ihren Ohren rauschen. Die ganze Zeit war sie im Schneckentempo durch die Räume gewandert, dabei musste sie hier raus, und zwar so schnell wie möglich. Jede Sekunde zählte. Was blieb noch zu tun? Die Wäsche, ja. Sie rannte praktisch in die Küche und riss den Trockner auf. Die Bettwäsche war noch feucht. Mit einem leisen Wimmern stellte sie weitere zehn Minuten ein.
Die Spülmaschine. Sie öffnete sie und nahm die Teller heraus, das Besteck, die Tassen und Gläser. Ein Glas knallte zu Boden. Sie hob die Bruchstücke auf und spürte, wie ihr ein Splitter durch den Gummihandschuh in den Daumen schnitt. Sie fegte die restlichen Scherben auf und warf sie in die Mülltüte.
Was hatte sie übersehen? Obwohl in der Küche alles makellos wirkte, war sie plötzlich davon überzeugt, einen Fehler zu machen, und zwar einen so großen, dass sie ihn einfach nicht wahrnahm. Ratlos ging sie noch einmal ins Wohnzimmer und blickte auf Saul hinab, als wäre er der Fehler. Sein Gesicht begann sich zu verändern, eine dunklere Farbe anzunehmen. Sie hatte das Gefühl, es nicht länger ertragen zu können. Trotzdem war sie nun mal hier und tat weiter, was getan werden musste.
Nachdem sie in die Küche zurückgekehrt war, nahm sie die Wäsche aus dem Trockner, immer noch ein bisschen feucht, aber das musste reichen. Sie brauchte viel zu lange, um den Bezug über die Bettdecke zu ziehen, die sich störrisch widersetzte, indem sie sich ständig verdrehte und bauschte.
Endlich war es geschafft. Sie zog die Handschuhe aus, steckte sie in die Mülltüte und verknotete diese. Saul hatte ihr mal erzählt, dass die Müllabfuhr in dieser Gegend täglich kam, sogar an Weihnachten. Bereits im Begriff, die Tür zu öffnen, wurde ihr bewusst, dass sie noch im BH dastand. Sie musste fast lachen – oder vielleicht war es auch eher der Drang, sich zu übergeben, hier auf den Holzboden der frisch desinfizierten Wohnung, wo der Geruch nach Parfüm und Sex inzwischen überlagert war vom beißenden Geruch nach Reinigungsmitteln und Bleiche. Sie schlüpfte in Pulli und Jacke und band sich zum Schluss den Schal um. Dabei saugte sie einen Moment nachdenklich an der Stelle, wo sie sich mit der Glasscherbe in den Finger geschnitten hatte. Ihr ging durch den Kopf, wie leicht es passieren konnte, dass sie im Gehen Blut an die Tür schmierte. Ihre Hände kamen ihr plötzlich vor, als gehörten sie gar nicht mehr richtig zu ihr, und ihr Gesicht spannte, als wäre ihr eine Maske aus Gummi auf die Haut gepresst worden. Vorsichtig öffnete sie die Tür einen Spalt weit und lauschte, ob etwas zu hören war, ehe sie schließlich hinaustrat und die Tür hinter sich zuzog.
Erneut überfiel sie das Gefühl, dass sie etwas ganz Entscheidendes vergessen hatte. Bereits im Gehen begriffen, hielt sie mitten in der Bewegung inne. Das Gefühl verflüchtigte sich nicht. Sie wandte sich wieder der Tür zu, beugte sich hinunter und spähte durch den kleinen Briefschlitz, konnte aber nichts sehen. Also holte sie den Schlüssel erneut heraus, schaffte es, die Tür aufzusperren, ohne ihn fallen zu lassen, und betrat noch einmal die Wohnung. Auf dem Küchenboden lag der Plastikbeutel mit all ihren Habseligkeiten. Beinahe hätte sie ihn dort zurückgelassen, samt Parfüm, Buch, T-Shirt und Strumpfhose. Sie griff danach, stopfte ihn tief in ihren Lederrucksack und ging dann hinüber, um einen letzten Blick auf Saul zu werfen. Es kam ihr vor, als wäre sein Körper geschrumpft oder der Raum größer geworden. War das wirklich einmal Saul gewesen? Während sie auf ihn hinunterstarrte, schien er kleiner und kleiner zu werden.
»Leb wohl«, sagte sie laut, aber ihre Stimme klang dabei blechern und künstlich. Die Wohnung war erfüllt von Geräuschen: leisem Rascheln und Knarren, dem Hallen eines Rohres. Neve spürte einen Luftzug und erschauderte vor Schreck, doch als sie sich umdrehte, war da niemand.
Draußen auf dem Gehweg schlug die Tüte mit dem Müll gegen Neves Seite, während sie zunächst versuchte, das Gebäude im Laufschritt hinter sich zu lassen. Aber ihre Beine fühlten sich an wie aus Pudding, und jeder Atemzug erschien ihr mühsam und schmerzhaft, als wäre die Luft zu dünn, sodass sie nicht genug in die Lungen bekam. Also verlangsamte sie ihr Tempo und bemühte sich, möglichst ruhig und normal dahinzumarschieren. Die Sonne schien ihr direkt in die Augen, und sie hatte den Eindruck, als wäre nichts mehr real: Die kleine Wohnung, die sie gerade verlassen hatte, war nicht real, sondern eine Theaterkulisse, in der ein gewaltsamer Tod inszeniert worden war. Die Straße vor ihr, die im goldenen Sonnenlicht flirrte und immer wieder ihre Konturen verlor, war auch nicht real. Ihre Affäre mit Saul war nur der Fiebertraum einer Frau in den Vierzigern, die den Trott ihres Familienlebens satthatte.
Vor einem türkischen Restaurant legte sie die Mülltüte auf einen Haufen identischer Tüten. Was jetzt? Sie warf einen Blick auf die Uhr: zwanzig vor elf. Einen Moment konnte sie sich nicht daran erinnern, wo sie ihr Fahrrad abgestellt hatte. Ach ja, in der Drury Lane. Also begab sie sich dorthin, und zwar ganz langsam, in ihrer neuen Unterwasserweltgeschwindigkeit. Als sie auf ihr Rad stieg, musste sie plötzlich an die Überwachungskameras denken, von denen es immer hieß, man könne ihnen nicht entkommen. Vielleicht war sie bereits gefilmt worden, sodass bald ein paar Kriminalbeamte auf körnigen Bildern verfolgen würden, wie sie kurz vor halb zehn das Gebäude betrat und es kurz nach halb elf wieder verließ. All die Mühe wäre dann umsonst gewesen. Benommen zog sie sich den Schal über die untere Gesichtshälfte und fuhr los. Schwankend und halb blind schlängelte sie sich zwischen stehenden Autos hindurch.
Als sie den Treidelpfad am Kanal erreichte, bremste sie und stieg ab. Der Gedanke, einfach nach Hause zu radeln, war ihr unerträglich, denn was sollte sie im schäbigen Durcheinander ihres Familienlebens jetzt anfangen? Womöglich würde sie auf Fletcher treffen, oder Mabel, oder sogar beide, und dann so tun müssen, als wäre nichts passiert. Sie wäre gezwungen, ihren üblichen Text zu stammeln und sich selbst zu spielen. Dazu fühlte sie sich noch nicht in der Lage. Ihr dämmerte, dass sie über diese Geschichte nie hinwegkommen würde. Hätte sie einfach nur eine vorübergehende Affäre gehabt, entstanden aus einer Midlife-Crisis, dann hätte sie das durchstehen können, wenn auch vielleicht mit Schuldgefühlen, aber letztendlich unbeschadet. Ganz allmählich hätte das Leben um sie herum wieder seine alte Form angenommen. Es wäre der Tag gekommen, an dem die Erinnerung ihre gefährlich scharfen Kanten verloren hätte, bis am Ende nur noch ein weiches, verschwommenes Etwas übrig geblieben wäre, vermischt mit den unzähligen anderen Erinnerungen in ihrem Kopf. Dieses Ereignis aber veränderte alles, machte es einschneidender und bedrohlicher. Aus einer Affäre war ein Todesfall geworden. Ein Mordfall.
Am Wasser gab es ein kleines Café. Neve kettete ihr Fahrrad an einen dafür vorgesehenen Ständer und ging hinein. Der einzige andere Gast war eine junge Frau mit einem braunen Pferdeschwanz, der ihr fast bis zur Taille reichte. Sie hatte einen Kinderwagen vor sich stehen. Einen verrückten Moment lang dachte Neve, das Baby wäre Mabel. In ihrem Kopf glitt alles auf unmögliche Weise ineinander. Das Baby sah tatsächlich aus wie Mabel damals: klein und kahl, mit einem seltsamen Ausdruck auf dem runden Gesicht. Sie war so ein braves Baby gewesen, so ein rätselhaft ruhiger Säugling. Fletcher und Neve hatten sich gegenseitig zu ihrer Leistung als Eltern beglückwünscht.
Sie holte sich an der Theke einen Tee, einen Earl Grey, und trug ihn hinüber zu einem Platz an dem langen, niedrigen Fenster. Während sie sich dort niederließ, joggte draußen gerade ein stämmiger Mann vorbei, im Schneckentempo und mit äußerst missmutiger Miene. Neve legte beide Hände um ihre Tasse, weil sie die Wärme als tröstlich empfand, und trank einen kleinen Schluck. Die Anspannung in ihrer Brust ließ ein klein wenig nach. Sie starrte hinaus in die Welt, ohne sie wirklich wahrzunehmen.
Neve hatte Saul neun Monate zuvor kennengelernt, als die große, erfolgreiche Firma, die er leitete, die kleine, erfolglose übernahm, die sie und ihre drei Freunde mit Ende zwanzig gegründet hatten, nicht lange nach Abschluss ihres Kunststudiums. Seine Firma hieß Redfern Publishing, ihre Sans Serif. Unter diesem Namen hatten sie Layout und Druck für Programmhefte gemacht, Umschläge für Gedichtbände entworfen und kleine Geschenkbücher herausgebracht, meist in sehr geringer Auflage, aber schön gestaltet, mit dicken, rauen Seiten, sorgfältig ausgewählten Schriften und marmorierten Umschlaginnenseiten. Auch Plakate für Musikfeste und Lyriklesungen hatten sie im Programm gehabt. Bei Redfern arbeiteten sie weiterhin für einige ihrer alten Kunden, machten aber auch die Grafik für Konferenzbroschüren und Wirtschaftsmagazine. Gary sagte immer, sie hätten sich eingebildet, sie könnten die Welt erobern, doch nun habe die Welt sie erobert. In Wirklichkeit waren sie alle erleichtert gewesen, als sie sich endlich eingestanden, dass ihre glorreichen, aber nervenaufreibenden Tage vorbei waren und sie endlich Angestellte sein konnten, mit regelmäßigem Einkommen, festen Arbeitszeiten und Aussicht auf Rente.
Neve wäre es lieber gewesen, sie hätte sich an ihre erste Begegnung mit Saul erinnern können. Sie fand, ihr Kennenlernen hätte etwas Besonderes sein sollen – besonders romantisch oder lustig. Aber zu der Zeit war so viel anderes passiert. Fletcher und sie erreichten damals gerade das Ende ihrer zwei schrecklichen Krisenjahre mit Mabel, in denen sie mit ansehen mussten, wie ihre Tochter zerbrach, und dann mit vereinten Kräften versuchten, sie wieder zusammenzusetzen. Das war ihnen auch mehr oder weniger gelungen, oder eigentlich Mabel selbst, aber noch immer fühlte es sich an, als könnte sie jeden Moment wieder zu Bruch gehen.
Dann war da noch der aufwendige berufliche Umzug, aus einem maroden Altbau nahe der Seven Sisters Road in ein schönes, schimmerndes Gebäude neben dem Kreisverkehr an der Old Street. Natürlich gab es dabei eine Menge emotionale Altlasten zu bewältigen, aber auch Lasten im wörtlichen Sinn, Unmengen von Zeug, das sie im Lauf der Jahre angehäuft hatten: Schränke voller Briefe, Dokumente, Originalentwürfe und sonstiger künstlerischer Arbeiten. Zum Teil handelte es sich dabei um schöne Sachen, die es wirklich verdient hatten, gerahmt zu werden, zum Teil um finanzielle Belege, die aufbewahrt werden mussten, aber auch um sentimentale Erinnerungen an alte Zeiten und zu einem großen Teil einfach um Müll. Das Problem war zu entscheiden, was in welche Kategorie gehörte. Sie empfanden es nicht bloß als geschäftliche Übernahme. Sie verließen ihre berufliche Heimat, zogen in eine neue Umgebung und erlitten eine Art kollektiven Nervenzusammenbruch, und das alles gleichzeitig.
In dieser Phase war Saul nur ein Anzugträger unter vielen gewesen. Vor dem Bürowechsel hatten Neve und ihre drei Freunde etliche Gesprächstermine gehabt, mit einzelnen oder gleich mehreren Herren im Anzug, die strittige Fragen mit ihnen diskutierten oder ihnen Vorträge hielten, Vorhaltungen machten oder Anweisungen erteilten. Bestimmt war Saul manchmal dabei gewesen, aber Neve erinnerte sich nur verschwommen an diese ganze Zeit und konnte beim besten Willen nicht mehr sagen, in welchen der vielen Anzüge er gesteckt hatte und in welchen nicht.
Nachdem ihr Wechsel in die Old Street dann über die Bühne war, gehörte Saul einfach zu den Leuten, die sie tagtäglich trafen, genau wie die abweisende Frau im Büro neben dem ihren oder die diversen Herren und Damen im Empfangsbereich oder an der Kaffeemaschine.
Doch nun, während Neve in großen Schlucken ihren Tee trank und sich dabei den Mund verbrannte – vielleicht, um sich auf diese Weise zurück ins Leben zu katapultieren –, konnte sie nicht aufhören, an ihre erste richtige Begegnung mit ihm zu denken. Sie hatte an dem Abend Überstunden gemacht und war allein im Büro gesessen, als sie hinter sich plötzlich eine Stimme hörte.
»Sie sollten nach Hause gehen.«
Neve blickte sich um. Er lehnte in der Tür.
»Ist das eine Anweisung?«
Er trat in den Raum. »Ich war schon immer der Meinung, dass man bis sechs alles geschafft haben sollte«, erklärte er.
Zum ersten Mal betrachtete sie ihn bewusst. Er war groß, hatte dunkles, kurz geschnittenes Haar mit einem Hauch von Silber und trug einen Anzug in einem ganz hellen Grau, dessen Stoff leicht schimmerte. Ihr ging durch den Kopf, dass er so gar nicht ihr Typ war. Daran konnte sie sich noch erinnern. Sie war immer auf die Außenseiter abgefahren, die Verlorenen, die Gequälten. Saul passte da überhaupt nicht ins Bild. Wobei er schöne Augen besaß. Graublau. Damals hatte sein Blick leicht amüsiert gewirkt. Nun, im Café, sah sie diese Augen vor sich, wie sie zur Zimmerdecke starrten. Rasch verdrängte sie das Bild und rief sich wieder ihre erste Begegnung ins Gedächtnis.