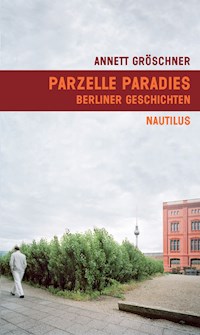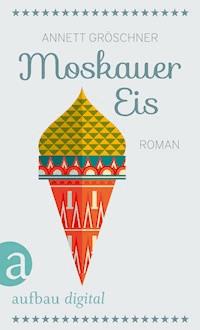
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 26-jährige Annja Kobe wird im Winter 1991 in ihre Heimatstadt Magdeburg gerufen, weil ihre Großmutter im Sterben liegt. Ihr Vater, der sich um seine Mutter kümmern sollte, ist verschwunden. Annja geht in die Wohnung ihres Vaters und findet ihn tiefgefroren in seiner eigenen Kühltruhe. Als Mitglied einer Familie von manischen Gefrierforschern – schon ihr Großvater war Kälteingenieur – ist sie zwar erschrocken, ihren Vater in gefrorenem Zustand zu finden, aber eigentlich nicht besonders verwundert darüber. Das Überraschende aber ist, dass die Truhe an keine Steckdose angeschlossen ist. Bis zum Tod ihrer geistig verwirrten Großmutter sucht Annja nach den Hintergründen dieses Gefriervorganges, den sie sich wissenschaftlich nicht erklären kann. Die einzige mögliche Zeugin, die Kollegin des Vaters, Luise Gladbeck, ist wenige Tage zuvor gestorben ...
Ein humorvolles und ironisches Buch über eine Insel in der Elbe voller skurriler Leute, einen zurückgezogenen Nationalpreis, die Hauptsätze der Thermodynamik, Alpträume, Gefrierfleischverluste, Sportfanatiker, Sekretärinnen, eine Kühltruhe, die auch nach 30 Jahren noch funktioniert, und mehr als zehn Kugeln Eiskrem.
»Zum Dahinschmelzen« TAZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Über Annett Gröschner
Annett Gröschner wurde 1964 in Magdeburg geboren. Sie veröffentlichte Gedichte, Reportagen, Dokumentarliteratur sowie drei Rundfunkfeatures. Annett Gröschner lebt als freie Journalistin in Berlin.
Informationen zum Buch
»Zum Dahinschmelzen« TAZ
Tiefgefroren liegt Anjas Vater in der eigenen Kühltruhe, die er vor 30 Jahren mitentwickelte. Wie und warum ist er da hineingekommen? Und was soll seine Tochter mit der Leiche anstellen? Anjas Ermittlungen werden zu einer Reise in die Geschichte ihrer Familie, einer Familie von manischen Gefrierforschern und Kühlanlagenkonstrukteuren.
Eine eiskalte und komische Geschichte über den Kalten Krieg und die DDR.
Die 26-jährige Annja Kobe wird im Winter 1991 in ihre Heimatstadt Magdeburg gerufen, weil ihre Großmutter im Sterben liegt. Ihr Vater, der sich um seine Mutter kümmern sollte, ist verschwunden. Als Annja in die Wohnung ihres Vaters in einem Hochhaus auf einer Insel mitten in der Elbe geht, findet sie ihn tiefgefroren in seiner eigenen Kühltruhe. Als Mitglied einer Familie von manischen Gefrierforschern – schon ihr Großvater war Kälteingenieur – ist sie zwar erschrocken, ihren Vater in gefrorenem Zustand zu finden, aber eigentlich nicht besonders verwundert darüber. Das Überraschende aber ist, dass die Truhe an keine Steckdose angeschlossen ist. Bis zum Tod ihrer geistig verwirrten Großmutter sucht Annja nach den Hintergründen dieses Gefriervorganges, den sie sich wissenschaftlich nicht erklären kann. Die einzige mögliche Zeugin, die Kollegin des Vaters, Luise Gladbeck, ist wenige Tage zuvor gestorben. Die Suche wird zu einer Reise in die Geschichte der Familie Kobe, in der die Begeisterung rund um den Gefrierpunkt über drei Generationen vererbt worden ist. – Ein in ironischem Ton geschriebenes Buch über eine Insel in der Elbe voller skurriler Leute, einen zurückgezogenen Nationalpreis, die Hauptsätze der Thermodynamik, Alpträume, Gefrierfleischverluste, Sportfanatiker, Sekretärinnen, eine Kühltruhe, die auch nach 30 Jahren noch funktioniert, und mehr als zehn Kugeln Eiskrem.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Annett Gröschner
Moskauer Eis
Roman
Inhaltsübersicht
Über Annett Gröschner
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Prolog im eiskalten Arbeitszimmer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Zweiter Teil
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Dritter Teil
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Vierter Teil
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Anhang
Protokoll
Impressum
Für meinen Vater, dem es nicht gelang zu erfrieren
Erster Teil
Prolog im eiskalten Arbeitszimmer
Eines Tages sind wir aufgewacht, und es hatte sich nichts verändert. Wir waren im Wartestand. Wir warteten seit unserer Geburt. Auf den Bus, auf ein Auto, auf ein Kind. Wir warteten auf eine Wohnung, einen Brief, auf eine Aufforderung, uns um sieben im Polizeipräsidium einzufinden. Einige warteten auf einen Zettel, der sie berechtigte, das Land auf Dauer zu verlassen. Andere warteten auf eine winzige Veränderung, auf einen Bombenanschlag, auf den Tod eines Generalsekretärs. Auf ein Westpaket. Auf ein Substantiv, das Liebe hieß, oder ein anderes Surrogat, das sie für Momente den Wartestand vergessen ließ. Mein Vater wartete auf die Zuteilung eines Stückes Kupfer, um damit seine Erfindung zu vollenden. Wir warteten auf ein gutes Buch, auf ein Studium, einen Vorwand, die Stadt zu wechseln. Wir warteten auf einen Paß, der nie ankam, auf eine Freundin, die überm Warten gestorben war. Wir warteten, daß auch wir eines Tages sterben würden. Die Tage vergingen langsam darüber. Godot kam nicht um neun, nicht um zehn. Auch um elf war er noch nicht da. Wir schlugen die Zeit mit Lesen tot. Wir lasen alles, was uns unter die Augen kam. Fahrpläne von Schnellzügen, die nicht länger als zehn Stunden brauchten, um von Nord nach Süd das Land zu durchfahren. Pläne von Flugzeugen, die in Länder flogen, für die wir kein Visum bekamen, auf die Druckgenehmigungsnummer des Schulzeichenblocks, den neuesten Artikel über die Bedeutung der Vakuum- Gefriertrocknung. Wir warteten auf eine winzige Wendung, einen leichten Tanzschritt vielleicht oder einen Sprung, der den Weltrekord bringen würde. Mit uns warteten die Bäume, die wuchsen oder die Luft nicht vertrugen und ihre Blätter vorzeitig verloren. Mit uns warteten die Vögel, die im Herbst im Lande blieben, aber auch die Raubtiere in ihren Käfigen warteten, daß einer der Wärter das Tor öffnen würde. Mit uns warteten die Utopien, die Sessel und die Maschinen. Ein Stillstand in Raum und Zeit. Wir konnten schwer nachprüfen, ob die Erde wirklich rund ist, nur wenn wir tagelang an unserem Meer saßen, sahen wir bei klarem Wetter, daß am Horizont zuerst die Aufbauten der Schiffe zu sehen waren, ehe der Rumpf langsam über der Wasserlinie auftauchte. Das war, so sagte man uns im Geographieunterricht, der Beweis für die Kugelform der Erde. Wir hielten uns nie bei einzelnen Ländern unbekannter Form und Farbe auf, wir wanderten schnell weiter im Buch, um keine Sehnsucht entstehen zu lassen, kein Verbleiben auf Seite 20 bei den Geysiren oder in der Savanne, wir kamen, weil die Erde eben rund war, im Laufe des Jahres wieder zur glazialen Serie zurück, die man bei Exkursionen auf ihre Vollständigkeit untersuchen konnte. Die Horizonte waren abgesteckt. Die Sonne ging im Osten auf und im Westen unter, und die Prinzessin des Sonnenuntergangs sollte so schön sein, daß die Augen blind werden würden im Augenblick des Betrachtens. Aber sie zeigte sich uns nie. Uns konnte nichts passieren, wir waren sicher. Wir kannten alle Schritte auswendig. Wir kannten unsere Gesichter auswendig. Wir konnten uns nicht aus dem Weg gehen, weil er immer einen Kreis beschrieb, an irgendeiner Stelle trafen wir wieder aufeinander. Die Uhren gingen langsam und in abgesteckten Bahnen. Wir waren Seiltänzer, und unter uns spannte sich ein Netz von Sicherheiten, das undurchlässig schien, aber manchmal stürzte jemand vor oder hinter uns, verschwand zwischen den Maschen und tauchte erst nach Tagen wieder auf, mit verschlossenem Gesicht. Wir träumten manchmal von Ausbrüchen, von einem vermauerten U-Bahn-Eingang, der plötzlich offen war und bereit, uns aufzunehmen für eine Reise ins Unbekannte, von einer S-Bahn, die ein anderes Gleis wählte und geradeaus fuhr, statt am Prellbock zu halten. Und mittendrin wachten wir auf, weil es nur ein Traum sein konnte, denn wir hatten nichts vorzuweisen an der Grenze, kein Papier unserer Identität. Im Traum war uns unser Name nicht eingefallen.
Aber plötzlich war da wirklich ein Ausgang. Ein winziges Loch in einem Stacheldrahtzaun, das wie ein Sog wirkte. Erst fiel es kaum auf, daß jemand von uns fehlte. Daß die Straßenbahn ihren Fahrplan nicht einhielt. Daß eine Gaststätte länger wegen Urlaub geschlossen blieb. Daß man länger nach Dokumenten anstand. Verabredungen wurden nicht eingehalten, und manchmal ertappte man sich dabei, daß man verwundert war, daß jemand, den man schon gar nicht mehr erwartet hatte, plötzlich wieder in der Tür stand. Züge wurden angehalten, weil es die Angst gab, auf den letzten nicht mehr aufspringen zu können. Irgendwann müßte doch Schluß sein mit dieser Unordnung. Die würden doch diesen Zug nicht so lange fahren lassen, bis auch der letzte gegangen war ins Offene, das wir nur über Wellen kannten, die nicht aufzuhalten waren, nicht durch Störsender und nicht durch abgebrochene Antennen. Aber auch die Züge waren nicht aufzuhalten, es war plötzlich gar nichts mehr aufzuhalten, eine Talsperre war gebrochen, und es war nicht abzusehen, ob wir auf der Seite standen, die durch die Wassermassen überflutet werden würde, oder auf der trockenen. Plötzlich gingen die Uhren schneller. Der verzweifelte Versuch der Zeitverwalter, sie anzuhalten, scheiterte kläglich. Die Zeiger rasten fortan und zogen den Raum mit, der sich zunehmend erweiterte. Plötzlich war alles nach allen Seiten offen. Der gerade Weg von der Geburt zum Tod verzweigte sich. Es war, als hätte jemand einen Filmprojektor auf Schnelldurchlauf gestellt, als wäre die Erde aus ihrer Bahn geraten und würde sich schneller um die Sonne drehen. In einem Jahr lebten wir zehn, vielleicht dreißig Jahre, die Spuren hinterließen auf unseren Gesichtern. Der Macht fiel die Maske vom Gesicht, ein Mosaik aus Sicherheiten, Zäunen und leichten Gewehren, Brieföffnern und großen Schlüsselbunden. Und es zeigte sich, was wir in unseren Witzen schon formuliert hatten, ohne es wirklich zu wissen, unter den Masken saß ein Häufchen Elend. Aber wer sollte nun Macht werden? Die in der Küche laut Revolution gesagt hatten, waren sich uneinig. Sie waren sich schon vorher uneinig gewesen, es gab ja so viele Küchen, in denen das Wörtchen Revolution gefallen war, und jede Küche hatte etwas anderes darunter verstanden. Wir hatten uns so wunderbar im Warten eingerichtet, ohne jemals einen Gedanken daran zu verschwenden, daß man etwas tun müsse, irgendwann.
Aber die plötzlich rasende Zeit hatte etwas Lebendiges, nur daß wir ständig in Konflikt kamen mit Leuten, deren Uhren nach den alten abendländischen Gesetzen gingen. Sie verstanden nicht, daß drei Wochen bei uns drei Jahre bei ihnen waren. Wir nahmen die Veränderung nicht so ernst, als daß wir neue Kalender einführten, und vielleicht war das ein erstes Zeichen dafür, daß es gar keine Revolution gewesen war, nicht mal ein Aufstand, eigentlich nur eine Arrestierung für 26 Stunden, in der die Inquisition kurz ihre Instrumente gezeigt hatte, die wenig später als Ausstellungsstücke in den Museen präsentiert wurden.
Der letzte verzweifelte Versuch der Macht, von sich abzulenken, war ein Geschenk an uns. Wir durften gehen, wohin wir wollten. Wir gingen und schauten Schaufenster an. Und aus den Türen der Läden traten die Berater und machten Offerten an die Zögernden: Kommt, werft eure Geschichte ab. Und die, die immer gewartet hatten, konnten jetzt keine Minute länger verweilen. Sie wollten leben, wie sie sich Leben immer vorgestellt hatten, und das hieß, das richtige Geld haben, feste Scheine, schwere Münzen, die unsere alten Portemonnaies kaputtmachten. Über Nacht wechselten die Schaufenster unserer Straßen die Dekoration, und in dieser Nacht gingen wir schweigend von Laden zu Laden und staunten. Dieser Überfluß hier? In unserer Straße? Und nicht warten müssen? Es war eine so große Stille über den Städten, daß die Hellseher sagten: Es kann nur Sturm geben. Wir tauschten das Geld gegen unsere Geschichte, mehr hatten wir nicht. Sie nahmen sie und machten große Scheiterhaufen. Wir durften sie selbst anzünden mit unseren neuen Feuerzeugen. Einige ganz Eifrige fielen hinein und wurden nicht mehr gesehen …
1. Kapitel
Aal
Wegen des hohen Fettgehaltes ist eine Lagerung über sechs Monate Dauer nur bei Temperaturen unter –20 °C möglich. Gefrierpunkt des Blutes: –0,57 °C
Ich vertreibe mir die Zeit mit Großmutters Schreibmaschine. Die ist so schwer, daß sie mir beinahe auf die Füße gefallen wäre, als ich sie im Schlafzimmer vom Kleiderschrank geholt habe. Ich mußte sie erst einmal abstauben. In die Rolle war ein Briefbogen des Institutes eingespannt. Großmutter hatte nichts weiter als das Datum 7. 10. 71 getippt. Zwanzig Jahre hat sie die Maschine nicht benutzt.
Kein Wunder, daß mir nur Sätze über das Warten einfallen. Ich sitze seit drei Tagen in Großmutters Wohnung herum. Und warte, daß irgend etwas passiert. Daß Großmutter stirbt. Oder daß Vater ins Zimmer tritt und sagt: »Entschuldige meine Verspätung, ich bin aufgehalten worden.« Im Krankenhaus wollten sie Großmutter nicht mehr behalten. »Das ist ein Pflegefall, dafür sind wir nicht zuständig. Und benehmen kann sie sich auch nicht. Zieht sich immer nackt aus. Schreit herum. Singt mitten in der Nacht Weihnachtslieder. Wir können nicht jeden Tag eine andere Patientin neben Ihre Großmutter legen.« Großmutter hat nie herumgeschrien. Sie schämte sich immer, ihren Körper zu zeigen. Seit ich mich erinnern kann, ging sie ins Bad, um sich auszuziehen, und schloß ab. Ich war mißtrauisch. Ich kannte dieses Krankenhaus. Es war ein Grund dafür, daß ich diese Stadt verlassen hatte. Ich suchte immer nach dem Gesicht einer Ärztin, die mich bis in meine Träume verfolgte. Aber sie war nicht mehr dort. Oder ich fand sie nicht. An der Tür, hinter der sie damals saß, war ein anderes Schild. Der Chefarzt übte sich in der neuen unverbindlichen Freundlichkeit. »Sehen Sie mal, Frau Kobe, unsere Betten sind knapp. Ihre Großmutter gehört in ein Pflegeheim.«
»Wieviel Zeit geben Sie ihr?« fragte ich.
»Unbestimmt. Sie hat das Herz einer Sechzigjährigen. Vielleicht erlebt sie das Frühjahr noch. Solange sie ißt. Nicht stürzt. Der Verdacht auf Thrombose hat sich nicht bestätigt. Es gibt keinen Grund mehr, sie hierzubehalten. Mittwoch schreibe ich die Entlassungspapiere. Hat mich gefreut. Auf Wiedersehen.«
Ich verhielt mich, wie ich mich immer verhalten hatte. Ich fragte nicht weiter. Bat ihn nicht um Hilfe. Sagte nicht: »Hören Sie mal, mich verbindet mit dieser Stadt kein Stein mehr, was kann ich dafür, daß es meine Großmutter hierherverschlagen hat und mein Vater nicht die Kraft hatte, woanders hinzugehen. Wollen Sie mich zwingen, bis zum Frühjahr hierzubleiben?« Als hätte er es geahnt, gab er mir noch die Liste der Pflegeheime mit. Ich wollte nicht, daß Großmutter in ein Pflegeheim kommt. Das konnte ich ihr nicht antun. Sie hatte sich jahrelang um mich gekümmert. Sie haßte alte Leute.
Ich habe es mir zwei Tage überlegt und sie dann nach Hause geholt. Vorher habe ich Vaters Kühltruhe in Großmutters Wohnung fahren lassen. Die Transportarbeiter waren ein bißchen erstaunt, daß die Truhe so schwer ist. Aber ich merkte an der Art, wie sie sich ausdrückten, daß sie nicht von hier waren, und ich konnte ihnen überzeugend erklären, daß die DDR ein rückständiges Land war, das seine Ressourcen nicht optimal zu nutzen wußte. Sie haben mir angeboten, das Ding gleich auf den Schrottplatz fahren zu lassen, gegen einen kleinen Aufpreis, versteht sich. Aber das konnte ich meinem Vater nicht antun. Diese Truhe war das Fortschrittlichste, was die DDR um 1960 zu bieten hatte. Und sie läuft immer noch. Ich habe sie in die Küche tragen lassen und den Männern ein Trinkgeld gegeben. Als sie schon am Weggehen waren, hat sich einer von ihnen noch einmal umgedreht und den Stecker in die Steckdose gesteckt. Ich sah wohl so aus, als ob ich das nicht selber könnte. Ich habe den Stecker wieder herausgezogen. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Mein Gefühl sagt ja, mein Verstand ist entschieden dagegen.
Großmutter schlief, als sie nach oben getragen wurde. Als die Krankenpfleger sie in ihr Bett legten, fragte sie mit geschlossenen Augen: »Bin ich wieder in Erfurt?«
»Nein«, sagte ich, »wir sind in Magdeburg in deiner Wohnung. Es ist alles in Ordnung, schlaf weiter.« Großmutter faltete die Hände und rief mit zahnlosem Mund: »Paul, mein Paul, daß ich das noch erleben darf, bist du wieder zu Hause. Wo warst du denn so lange, ich habe dich überall gesucht. Na, da steckt wohl wieder eine Sekretärin dahinter? Das kennen wir ja schon. Ist es die zweiundzwanzigste oder dreiundzwanzigste, mein Gott, ich habe vergessen, wie viele es waren, ich habe doch immer mitgezählt. Aber diesmal ist Schluß, das kann ich dir sagen. Ich habe dein Bruchband schon vor zehn Jahren weggeschmissen, damit du es weißt. Gibs doch zu, dich hat keine mehr gewollt, und jetzt kommst du wieder, weil du denkst, ich tröste dich. Nee, nee. Aber so lange wegbleiben.« Ihr Ausbruch irritierte mich, denn offensichtlich hat sie vergessen, wer ich bin. Über Großvaters Ausflüge hatte Großmutter früher selten ein Wort verloren. Sie mußte erst verrückt werden, um sich einzugestehen, daß ihr Ehemann ein Frauenheld war. Ich weiß nicht, ob es gut ist, daß sie mich für Paul hält. Vielleicht kommt sie auf den Gedanken, mich mit ihrem schärfsten Küchenmesser zu tranchieren und in der Kühltruhe nach allen Regeln von Pauls Kunst einzufrieren: Erst ein bißchen blanchieren, damit sich das Aroma besser entfaltet nach dem Auftauen, und dann fein säuberlich in Hausfrauenportionen geteilt in der Truhe plazieren. Dann hat sie noch Essen für zehn Jahre, bei den kleinen Portionen, die sie noch braucht. Aber Großmutter macht nicht den Eindruck, als könnte sie sich noch selbst ein Essen zubereiten. Seit zwei Tagen dämmert sie nur noch vor sich hin.
2. Kapitel
Absolute Temperatur
Das Telefon, das an seinem alten Platz im Arbeitszimmer meines Großvaters steht, ist tot. Auf dem Schreibtisch liegt ein Brief, in dem meinem Großvater mitgeteilt wird, daß sein Telefonanschluß zum 1. Dezember 1991 gekündigt werde, da er als ehemaliger Inhaber eines Einzelvertrages mit der DDR-Regierung aus heutiger Sicht unrechtmäßig in den Genuß eines Telefons gekommen sei. Er solle Verständnis dafür haben, daß man es ihm wegnehmen müsse. Die Anschlüsse der Stadt reichten nicht aus, um alle neuen Repräsentanten mit Telefon zu versorgen.
Großvater ist seit zwölf Jahren tot.
Jeden Abend rief Großmutter bei Vater an, weil sie seit Großvaters Tod niemanden hatte, mit dem sie reden konnte. Vater sagte nicht mehr als »Ja« oder »Nein«, denn Großmutter wollte eigentlich nur wissen, ob wir noch lebten.
Ich war ganz froh, daß ich in Berlin kein Telefon besaß, sonst hätte sie auch mich mit ihren Anrufen verfolgt. Einmal in der Woche klemmte ich mich in eine Telefonzelle und wählte ihre Nummer. Großmutter fragte, wie es mir ginge, ich antwortete einsilbig wie Vater, und sie redete von den Hauptdarstellerinnen der Fernsehserien, als wäre sie mit ihnen befreundet.
Das letzte Mal, es muß Mitte November gewesen sein, waren fast alle öffentlichen Fernsprecher im Umkreis meiner Wohnung kaputt. Die einen hatten Unbekannte offensichtlich mutwillig zerstört, die anderen konnten die Umstellung auf das schwerere Geld nicht vertragen, und ich mußte lange herumlaufen, bis ich ein funktionierendes Telefon fand, vor dem eine lange Schlange stand.
»Weißt du«, sagte Großmutter, als ich endlich an der Reihe war, »ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich habe nun wirklich alles hinter mich gebracht, die Kaiserzeit, die zwanziger Jahre mit ihrem Durcheinander, die Hitlerzeit, die DDR, und jetzt das. Und das einzige, was mir gefällt, ist, daß die Kaffeepreise gesunken sind. Die Mauer hätte ruhig stehenbleiben können, man weiß ja nie, wo ihr euch gerade herumtreibt.«
»Wieso, ich bin doch in Berlin.«
»Berlin, Berlin, das gefällt mir erst recht nicht. Wird man da nicht mittlerweile am hellichten Tage überfallen?«
»Ist mir noch nicht aufgefallen, Omi.«
»Den ganzen Tag muß ich mir Sorgen machen. Manchmal kann ich bis morgens nicht einschlafen. Und dein Vater erzählt mir gar nichts.«
»Das hat er früher auch nicht gemacht.«
»Aber irgendwas ist mit dem Institut, das spüre ich. Sie machen doch jetzt alles kaputt. Hier im Haus sind schon fünf arbeitslos.«
Ich warf mein letztes Geld in den Schlitz des Apparates. Von außen wurde wütend gegen die Tür geklopft. Die Schlange war inzwischen noch länger geworden. Ich sagte Großmutter, daß ich Schluß machen müsse und ganz bestimmt zu Weihnachten käme, aber sie sagte: »Wer weiß, ob ich da noch lebe. Irgendwie ist es jetzt auch genug.« Ich wollte noch sagen, daß sie Vater und mich bestimmt noch überleben würde, aber in dem Moment, als Großmutter ihren Satz beendet hatte, wurde das Gespräch unterbrochen, und es war nur noch ein Besetztzeichen in der Leitung.
Zwei Tage später erreichte mich ein Brief meines Vaters. Er war schwerer als üblich, und ich hatte ihn in der Post gegen die Zahlung eines Nachportos auslösen müssen. Darin lag in Pappe gewickelt der Schlüssel zu seiner Wohnung und eine kurze Notiz. »Liebe Annja, hiermit schicke ich Dir den Wohnungsschlüssel. Damit Du, wenn Du mal nach Magdeburg kommst, nicht vor verschlossener Tür stehst. Dein Papa.« Ich war überrascht, denn Vater hatte ihn mir, als ich auszog, abgenommen, aus Angst, ich könnte ihn verlieren. Als ich noch bei ihm wohnte, kontrollierte er an jedem Abend vor dem Schlafengehen, ob auch alle Schlüssel am Brett hingen. Manchmal wachte ich nachts von einem Geräusch im Flur auf, und immer war es Vater, der die Klinke der Wohnungstür herunterdrückte, weil er sich nicht sicher war, ob er nicht vergessen hatte, die Tür abzuschließen. Eines Tages konnte ich meinen Schlüssel nicht finden. Bis zum Arbeitsschluß meines Vaters lief ich ziellos über die Insel, bis ich sah, wie er das Institut verließ und nach Hause ging. Am Abend kam er in mein Zimmer und sagte: »Annja, du hast vergessen, den Schlüssel ans Brett zu hängen. Gib ihn mir.« Es hatte keinen Sinn, sich eine Ausrede einfallen zu lassen. Ich mußte meinen ganzen Tagesablauf herbeten, alle Taschen auskippen, die Wohnung glich nach dem Suchen einem Schlachtfeld, wir liefen meinen Schulweg hin und zurück, suchten in Rinnsteinen, in Heuhaufen und zwischen Straßenbahnschienen. Vater ließ sich am nächsten Tag im Fundbüro alle Schlüssel zeigen, aber meiner war nicht dabei. Es war ungewöhnlich, daß er ihn nicht wiederfand, schließlich fand er auch Sachen, die er gar nicht gesucht hatte, aber dieser Schlüssel blieb verschwunden. Vater lief zwei Wochen lang nachts wie ein Tiger durch den Flur und wartete auf den Einbrecher, der nicht kam. Der auch gar nicht kommen konnte. Mir war eingefallen, daß der Schlüssel nur im Turnbeutel gewesen sein konnte, und der war beim Balancieren auf dem Geländer der Anna-Ebert-Brücke ins Wasser gefallen.
Ich bekam nur unter der Bedingung einen neuen, daß ich ihn fortan jeden Abend bei Vater abgab. Er legte ihn in die kleine Schatulle, in der er auch seinen Ehering aufbewahrte, und händigte ihn mir morgens wieder aus. Manchmal fand er auch Ausflüchte, ihn mir zu verweigern: »Ich bin auf jeden Fall um drei wieder zu Hause.« Oder: »Heute kommt Fußball, kannst auch spät kommen, ich bin noch wach«, bis es mir reichte und ich heimlich einen nachmachen ließ, den ich auch nach stundenlangen Diskussionen nicht herausgab.
Ich fragte mich, was Vater mit dem Brief bezweckt haben konnte, und war beunruhigt, als mir bei meinem Telefonat mit dem Krankenhaus gesagt wurde, mein Vater wäre nicht erreichbar gewesen.
3. Kapitel
Ammoniak
Schmelzpunkt.
Der Schmelzpunkt liegt zwischen –77,3 und –77,73 °C.
Am 30. November hatte ich das Telegramm des Krankenhauses in meinem Briefkasten gefunden. Nach dem Telefonat mit dem Arzt war ich ins Auto gestiegen und in Richtung Magdeburg losgefahren. Lange würde die Reise nicht dauern. Mein Vater würde sich wieder anfinden, wahrscheinlich war er nur auf einer Dienstreise und hatte vergessen, Großmutter Bescheid zu sagen. Ich würde alles Notwendige regeln, die Sache nach Vaters Rückkehr in seine Hände legen und wieder nach Berlin zurückfahren. Ich hatte niemandem erzählt, wo ich hinfuhr, es lohnte sich einfach nicht. Am 16. Dezember war ich um 9 Uhr ins Arbeitsamt bestellt. Bis dahin würde ich längst wieder zurück sein.
Hinter Michendorf geriet ich in dichten Nebel und konnte nur noch Schritt fahren. Über Verkehrsfunk wurde gewarnt, daß kurz hinter der Abfahrt Burg- Ost ein Kühlschrank auf der Autobahn liege. Als ich nach vier Stunden Ziesar erreichte, stand der Verkehr still. Man konnte die Hand nicht mehr vor Augen sehen, und es dauerte ewig, bis das Blaulicht, das gespenstisch durch den Nebel flimmerte, an mir vorbei war. Ich verbrachte den Rest der Nacht in der Autobahnraststätte zwischen lauter Gestrandeten; eine bunte Mischung aus Familien, Truck-Fahrern und alleinreisenden Männern, bis die drei bei dem Auffahrunfall Getöteten samt ihren Wracks weggeschafft waren.
Die Raststätte leerte sich. Ich drückte die Kippe aus und folgte den anderen. Über den Unfall sprach niemand. Die letzten zwei Jahre hatten bewiesen, daß man sich an alles gewöhnen konnte. An anderes Geld, einen anderen Staat, an eine gehäufte Anzahl von Toten im Straßenverkehr. Kurz vor Burg- Ost mußte ich an den Kühlschrank auf der Straße denken. Aber der Verkehr floß ohne weitere Unterbrechung an der Autobahnabfahrt vorbei. Daß ich schließlich die Elbe überquerte, konnte ich nur am Geräusch der Räder erkennen, die über eine lange Brücke fuhren. Der Fluß war nicht zu sehen, aber ich roch ihn durch die geschlossenen Fenster und erinnerte mich an eine Gewißheit aus meiner Kindheit – wenn der Zug über den Fluß fährt, bist du gleich zu Hause.
Es dämmerte schon, als ich im Krankenhaus ankam. Der Arzt hatte seinen Dienst längst beendet und würde an diesem Tag nicht mehr kommen. Ich sollte mich bis morgen gedulden. Großmutter schlief, die Decke hatte sie aus dem Bett geworfen. Vor mir lag ein Bündel aus Knochen, das ich fast nicht erkannte. Ihr Nachthemd hatte sie sich ausgezogen und die Windel war ihr bis in die Kniekehlen gerutscht. Ihre Brüste waren nur noch zwei winzige schrumplige Hautsäcke. Ich deckte Großmutter vorsichtig zu, weil es mir unangenehm war, sie so sehen zu müssen.
Dann verließ ich das Zimmer und fuhr auf die Insel in Vaters Wohnung. Vielleicht hatte er eine Nachricht hinterlassen. Ich weiß nicht, warum ich so ein klammes Gefühl hatte, als ich in den Fahrstuhl stieg und auf die 18 drückte.
Die Wohnung war aufgeräumt, nirgendwo lag ein Zettel, aber ich suchte nicht lange, weil mich eine bleierne Müdigkeit überfiel. Ich schlief sofort ein.
Ich träumte, ich sei Medizinstudentin und solle einen Schädel sezieren. Es war obligatorischer Teil des Studiums, dem man sich nicht entziehen konnte, wollte man eines Tages den Abschluß machen. Vor der Tür des Anatomischen Institutes stand ein alter Wachmann. Er gab mir den Schädel und sagte scherzhaft: »Nicht fallen lassen.« Ich ging einen langen Weg nach Hause und hatte plötzlich das Bedürfnis, ihn noch auf der Straße auszupacken.
Ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Ich wickelte während des Gehens den Schädel aus dem Zeitungspapier. Als ich in Höhe meines Hauses war, hatte ich endlich alle Zeitungspapierschichten entfernt. Und hielt den Kopf meines Vaters in der Hand.
Voller Panik wickelte ich das Papier wieder um den Schädel, aber es kam mir vor, als wäre der Bogen zu kurz, um den Kopf vollständig zu bedecken – mal fehlte ein Stück am Haaransatz, mal schaute die Nase unter dem Papier hervor. Ich wollte den Schädel fallen lassen, aber er klebte wie ein tiefgefrorener Eisblock an meinen Händen. Ich schaute mich ängstlich um, ob mich jemand gesehen haben könnte, aber die Straße war menschenleer, und auch die Gardinen bewegten sich nicht.
Ich war in einem fürchterlichen Zwiespalt: Sezierte ich den Schädel nicht, wäre mein Studium vorbei, sezierte ich ihn, tat ich etwas, was ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Ich fand einen Kompromiß; ich schaute das Gesicht nicht an, ich sezierte den Kopf meines Vaters von hinten und mit einem Tränenschleier vor den Augen. Wenn ich einen Schnitt ansetzte, kam kein Blut, sondern eine graue Flüssigkeit, die mich an das Wasser der Elbe erinnerte. Als ich den Schädel schließlich doch umdrehte, weil ich mir nicht mehr sicher war, daß er zu meinem Vater gehörte, war das Gesicht ausgelöscht.
Ich stand auf und ging zum Fenster. Es begann schon wieder dunkel zu werden. Nebliger Dunst hing über den beiden Elbarmen, die sich an der Spitze der Insel zu einem Strom vereinigten, der zu dieser Jahreszeit in träger Gelassenheit Richtung Hamburg floß. Im Winterhafen lagen die Schiffe und warteten auf das Frühjahr. In dem alten grauen Haus neben dem Hafen hatten wir bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr gewohnt. Neben Fräulein Gries. Wegen ihres Hundes Kalif hatte ich schon als Kind schlechte Träume.
Mein erster, immer wiederkehrender Traum war der, daß ich auf der Uferseite der Elbstraße entlangging und Kalif mir entgegenkam. Beim ersten Mal fraß er mich nur auf, und ich erwachte. Beim zweiten Mal lag ich unzerkaut in seinem Bauch und gruselte mich, weil es so dunkel war. Nachdem dieser zweite Traum so oft wiedergekehrt war, daß ich nicht mehr einschlafen konnte, faßte ich, während ich im Bauch Kalifs lag, den Entschluß, mit aller Kraft durch den Arsch des Hundes wieder ins Freie zu gelangen. Es war ein wunderbares Glücksgefühl, als ich beim Herauskriechen die Johanniskirche am Westufer erkannte.
Die Kosmetikerin Gries betrieb in ihrer Wohnung eine kleine Praxis, die meine Mutter einmal im Monat aufsuchte. Fräulein Gries schwor auf Gurkenmasken, um die Gesichtshaut meiner Mutter straffer und jünger erscheinen zu lassen. Wenn im Winter keine Gurken zu bekommen waren, brachte Vater manchmal Mutter zuliebe eine aus der Versuchsanordnung zur Kältelagerung von Gemüse mit. Den Quark rührte Fräulein Gries selbst an. Quark gab es schließlich immer. Ich durfte zusehen, wie das Gesicht meiner Mutter unter Gurkenscheiben verschwand, und hatte die Aufgabe, nach 20 Minuten Scheibe um Scheibe aufzuessen, denn nach Meinung von Fräulein Gries hatten sie noch ausreichend Vitamine. Dabei wurde ich argwöhnisch von Kalif bewacht, der nur durch gutes Zureden von Fräulein Gries davon abgehalten werden konnte, es mir nachzutun. Denn Kalif leckte mit Inbrunst Gesichter ab, am liebsten meins, weil ich noch so klein, der Hund aber so groß war, daß wir uns Auge in Auge gegenüberstanden, wenn wir uns begegneten. Dabei verströmte er einen üblen Geruch und stieß einen wohligen Schmatzlaut aus. Ich mußte stocksteif verharren, bis er fertig war. Fräulein Gries war der Meinung, daß es eine große Ehre sei, von ihrem Kalifen abgeleckt zu werden. »Das macht er nicht mal mit mir«, sagte sie. Dafür schenkte sie mir Ketten, aus dem Westen, wie sie betonte, die mir aber gar nicht gefielen. Ich bekam schnell heraus, daß diese Ketten aus Papierschnipseln gebastelt waren, die man auseinanderfalten konnte. Einmal hatte ich drei Tage zu tun, bis ich eine Seite einer Illustrierten zusammengepuzzelt hatte, auf die zwei Reportagen gedruckt waren. Eine über die Gattin des Schahs von Persien, besser gesagt über die 197 Paar Schuhe, die sie besaß, und eine über einen Mann aus Gelsenkirchen, der so arm war, daß er sich keinen Dynamo für sein Fahrrad leisten konnte und deshalb in der Nacht von einem Auto überfahren wurde und noch am Unfallort starb. Ich schaute erst einmal in meinem Atlas nach, wo der Iran und wo Gelsenkirchen lagen. Gelsenkirchen fand ich nicht, den Iran unter der Sowjetunion.
Fräulein Gries war ein bißchen wie Farah Diba und Kalif wie der Schah von Persien, denn auch der wurde von seiner Frau über alles geliebt. Fräulein Gries betonte immer, daß sie die Arbeit als selbständige Kosmetikerin nur für Kalif und ihre alte Mutter tun würde, die in der weitläufigen Wohnung im hintersten Zimmer hauste, währenddessen Kalif auf alte Art den Herrn im Hause mimte. Er hatte Mutter Gries einmal gebissen, so daß sie sich nur in der Wohnung bewegte, wenn der Hund mit Fräulein Gries auf Spaziergang war.
Eines Tages mußte Fräulein Gries ihre Praxis schließen, weil sie nicht Mitglied der Produktionsgenossenschaft Handwerk werden wollte. Sie konnte auch nicht mehr dorthin, wo die Perlenketten herkamen, und so schraubte sie das Schild »Gertrud Gries, staatl. gepr. Kosmetikerin, Termine nach Vereinbarung« ab und machte gar nichts mehr. Manchmal traf ich sie noch auf der Treppe, und jedesmal, wenn ich sie sah, sagte sie: »Deine Akne, mein Kind, wäre ein großes Geschäft für mich geworden. Aber wenn dieser Staat mich nicht will, dann mußt du eben alleine damit fertigwerden. Aber drück ja mit deinen dreckigen Fingernägeln die Pickel nicht aus.«
Kalif lief ihr zu dieser Zeit nur noch schwerfällig hinterher.
Bald darauf starb Mutter Gries. Die Kondolenzbezeugungen nahm Fräulein Gries mit stoischer Ruhe entgegen, nach einer Woche in Schwarz war es so, als habe es Mutter Gries nie gegeben. Ein Jahr später aber kam der Tag, an dem das Haus zu frühester Stunde mit Klagelauten geweckt wurde. Kalif war gestorben, und das Fräulein stand im Morgenmantel an unserer Tür.
»Herr Kobe, Herr Kobe, ich gebe Ihnen alles was ich hab, wenn Sie meinen Kalifen einfrieren.«
Vater wußte gar nicht, wie ihm geschah, er sah nur den toten Hund, unter dessen Last das Fräulein fast zusammenbrach, aber er wies das Ansinnen kühl zurück.
»Meine Kühleinrichtung, Fräulein Gries, ist für Lebensmittelversuchsanordnungen, nicht für tote Hunde.«
»Aber woher soll ich denn so schnell eine Kühltruhe bekommen, es gibt doch nur diese kleinen Gefrierschränke. Wenn ich meinen Kalifen nicht jeden Tag sehen kann, dann sterbe ich.«
»Versuchen Sie es doch mal in Moskau, die haben Erfahrungen mit dem Einbalsamieren«, sagte Vater und schloß die Tür.
»Jetzt ist sie verrückt geworden«, stöhnte er und mußte erst einmal die Flasche mit dem Doppelkorn aus der Kühltruhe holen, »ich glaube, wir müssen einen Arzt anrufen.«
Wir ließen es aber vorerst bleiben, denn wer wollte schon einen Menschen der Psychiatrie ausliefern, und vielleicht würde sich das Fräulein ja schon nach ein paar Stunden beruhigt haben. Aber nach drei Tagen konnte niemand im Haus mehr das Brüllen, Klagen, Wimmern und Schreien ertragen, und Vater benachrichtigte einen Arzt, der das Fräulein aus der Umklammerung mit der aufgebahrten, schon leicht riechenden Hundeleiche löste und zur Beobachtung in die Bezirksirrenanstalt einlieferte. Der Hund wurde der Kreistierverwertungsanstalt übergeben, wovon wir Fräulein Gries nichts sagen sollten. Sie kam nach drei Tagen mit glasigen Augen zurück und war stumm. Eine Woche später sah jemand, wie sie auf der Elbe trieb, das weiße Kleid wie einen Ballon gebläht, bis sie von einem Strudel nach unten gezogen wurde. Die Feuerwehr holte sie aus dem Fluß, das Kleid war jetzt grau und fleckig, Fräulein Gries allerdings lebte. Sie hatte wie alle Inselbewohner ausreichend schwimmen gelernt und war nicht intelligent genug, trotzdem zu ertrinken. Nachdem sie etwas länger in der Anstalt zugebracht hatte, zog sie aus Scham von der Insel weg, aber manchmal sah ich sie von weitem im Stadtpark mit einem jungen Boxer, den sie Pascha rief und der sogleich kam und ihr das Gesicht ableckte, bis sie kleine spitze Schreie ausstieß.
Rechts unter mir stand das Kälteinstitut, ein schmuckloser Neubau aus zwei mit einem korridorartigen Übergang verbundenen Flügeln. Hinter keinem der Fenster brannte Licht. In diesem Jahr waren es dreißig Jahre, die Vater Tag für Tag dort hinging. Sogar am Sonntag ließ er sich häufiger als seine Kollegen zum Kontrollgang einteilen. Manchmal nahm er mich mit, und dann wandelten wir durch die verlassenen und nach Ammoniak riechenden Gänge. In den Vitrinen lagen die gefriergetrockneten Erdbeeren und verpulverten von Woche zu Woche mehr, auch die Verpackungen der Feinfrosterzeugnisse verloren mit den Jahren ihre Farbe. Wir gingen in Vaters Zimmer, und ich durfte die Fische im Aquarium füttern, während Vater aus seinem Schreibtischfach einen Schlüssel holte, um die Kühlzellen auf ihre Temperatur zu kontrollieren. Es faszinierte mich, wenn Vater an dem großen Schwungrad mit den Eisenzähnen drehte, bis die Tür sich lautlos öffnete und ein trockener Kältenebel ihn einhüllte. In den Kühlzellen standen hohe Regale, in denen Gemüse in kleinen Beuteln lagerte. Die Erbsen und Möhren sahen aus, als würden sie schlafen. Ich mußte immer die Tür festhalten, damit sie nicht zuschlug, während Vater das Thermometer ablas. Ich tat das gewissenhaft, bis mir der Arm erlahmte und ich mir vorstellte, was passieren würde, wenn ich losließ und die Tür zuschlug und niemand meinen Hilferuf hörte, während Vater in der Kühlzelle langsam gefror. Aber jedesmal kam er rechtzeitig wieder zurück, schloß die Tür und drehte am Rad. Zu Hause wartete Mutter mit dem Essen auf uns.
Von meinem Zimmer aus konnte ich gut erkennen, ob Vater noch im Institut war. Oft ging das Licht dort unten erst kurz vor Mitternacht aus, und manchmal dachte ich, wenn es mich nicht gäbe, hätte er längst keine Wohnung mehr. An diesem Tag war kein Licht, ich wäre sonst runtergegangen und hätte mich durch die Büsche geschlagen und von außen ans Fenster geklopft. Er hätte aufgemacht, und ich hätte mit meiner Kleinmädchenstimme gefragt, ob er Stieleis für mich und meine Freunde habe, und er hätte geantwortet, Stieleis gebe es schon lange nicht mehr, aber vielleicht würden wir ja auch ein Halbgefrorenes nehmen.
Ich bekam Hunger und ging in die Küche. Ich drückte auf den Lichtschalter, aber nichts passierte. Ich hoffte noch einen Moment, daß im ganzen Haus der Strom ausgefallen wäre. Als ich die Wohnungstür öffnete, sah ich, daß im Flur Licht brannte. In diesem Moment wurde mir mulmig. Ich tastete nach dem Sicherungskasten und drehte die Hauptsicherung wieder rein. Das Licht in der Küche ging von alleine an, und ich sah zuerst den abgetauten Kühlschrank, dessen Tür offenstand. Vater hatte immer sehr viel Wert auf das exakte Abtauen von Kühlschränken gelegt, und wenn er in einem anderen Haushalt war, prüfte er jedesmal heimlich, ob sich am Verdampfer keine Eisschicht gebildet hatte. Die meisten sahen ihren Kühlschrank als Selbstverständlichkeit an. Man steckte den Stecker in die Dose und fertig. Vater versuchte ihnen so beiläufig wie möglich beizubringen, daß mehr als fünf Millimeter Eis am Verdampfer kein Nachweis für das ordnungsgemäße Funktionieren des Kühlschrankes seien. Im Gegenteil, das Eis sei nicht dazu da, die Speisen zu kühlen, sondern ein sicheres Zeichen dafür, daß sich zuviel Feuchtigkeit im Schrank befinde. Er hielt dann immer noch einen kleinen Vortrag, daß die Speisen erst abkühlen müßten, bevor man sie mit einem Deckel verschlossen in den Kühlschrank stellt. Manchmal erklärte er noch die Funktion von Kompressionskälteanlagen, bei denen bei Kältebedarf der Motor immer angehe und eine Weile brumme, bis das vibrierende Brummen in ein belegtes Röcheln übergehe, das abrupt abbreche.
»Und wenn der Motor des Kühlschranks immer brummt, was bei diesem hier der Fall sein müßte, dann zeigt das an, daß viel zuviel Energie verbraucht wird, um die erforderliche Temperatur zu halten. Dann kann man theoretisch auch gleich die Tür auflassen.« Die meisten so Zurechtgewiesenen sagten: »Aha« oder »Schön, daß uns das mal einer erklärt« oder zuckten nur mit den Schultern, denn die Energiepreise fielen ohnehin kaum ins Gewicht.
Ich schaute nach, ob Vater überall die Stecker herausgezogen hatte. Selbst der der Stehlampe war einen Meter von der Steckdose entfernt, so als hätte Vater Angst gehabt, er könnte von alleine wieder in die Dose springen. Das war nichts, was mich hätte stutzig machen müssen. Es war ein Zeichen dafür, daß Vater länger als drei Tage verreist war. Mich beunruhigte nur, daß er die Hauptsicherung herausgedreht hatte. Das hatte er nie gemacht, denn die Kühltruhe brauchte auch in seiner Abwesenheit Strom. Sie stand in einem Abstellraum, in den man nur über den Hausflur gelangte. Vater hatte, als wir einzogen, die Gefriergemeinschaft der Hochhausetage gegründet. Alle unsere Nachbarn konnten nach einer kleinen Belehrung über das Gefrieren im Haushalt, die im Hausflur stattgefunden hatte, ihre Kleingartenernte in unserer Kühltruhe einfrieren, wobei sie kleine Schildchen an den Verschlußbändchen ihrer Plastetüten befestigten, auf denen Dräger, Erdbeeren 4/80, oder Deutschmann, Grünkohl, 12/81, stand. Ab und an überprüfte Vater, ob die Nachbarn auch die Lagerzeit ihrer Feinfrosterzeugnisse einhielten. Wenn sie abgelaufen war, klingelte er an der jeweiligen Wohnungstür und bat, die Lebensmittel aus der Kühltruhe zu entfernen und zu verzehren, da er sonst für den guten Geschmack nicht mehr garantieren könne. Nach und nach überzeugte er die Hausbewohner von den Vorzügen der Gefriertechnologie gegenüber anderen Arten der Konservierung, bis sich einer nach dem anderen einen Gefrierschrank kaufte und wir die Kühltruhe wieder für uns alleine hatten.
Bei meinem letzten Besuch hatte ich Vater gefragt, warum er die Truhe nicht endlich verschrotten lasse. Die Strompreise waren erheblich gestiegen. Er meinte, er mache einen Langzeitversuch. Die Truhe sei jetzt bald dreißig Jahre alt und noch nicht einmal kaputt gewesen. Er würde gerne wissen, wie lange sie noch halte. Damit wolle er beweisen, daß man in der DDR sorgsamer mit bestimmten Ressourcen der Erde umgegangen sei, währenddessen das Wesen der kapitalistischen Marktwirtschaft die Hersteller dazu zwinge, Sollbruchstellen in die Kühlgeräte einzubauen, um den Warenfluß in Gang zu halten. Ich hatte damals gefragt, ob er als letzter Revolutionär in den Anhang der Annalen des Sozialismus eingehen wolle, aber er hatte geantwortet, er bringe nur seine Arbeit zu Ende.
Ich fand den Schlüssel an der gewohnten Stelle und ging über den Flur zum Abstellraum. Ich schloß die Tür auf – und da stand sie. Ich atmete auf.
Beim zweiten Blick merkte ich, daß etwas nicht stimmte. Der Deckel war geschlossen, und der Stecker lag darauf. Das paßte nicht zusammen. Vater würde bei diesem Anblick sofort den Finger heben und sagen: »Wenn keine Luft an ein abgetautes Kühlgerät kommt, dann können sich im Inneren Mikroben ausbreiten, die unangenehme Gerüche erzeugen. Deshalb beim Abtauvorgang nie Deckel oder Tür schließen.« Es mußte jemand im Abstellraum gewesen sein, der nichts von Kältetechnik verstand. Vielleicht hatte jemand eine tote Katze in der Truhe deponiert, die mich, wenn ich den Deckel öffnete, mit aufgerissenem Maul aus ihren toten Augen anstarren würde.
Trotzdem war meine Neugier stärker. Ich öffnete den Deckel – und schrie auf.
In der Truhe lag mein Vater.
Ich schmiß den Deckel sofort wieder zu. Vielleicht war es eine Einbildung, vielleicht hatte ich mich getäuscht, weil außer dem Licht des Flurs, das schwach durch den Türspalt fiel, der ganze Raum dunkel war. Ich schloß die Tür, machte das Licht an und öffnete den Deckel erneut. Das erste, was ich wahrnahm, war, daß es nach Ammoniak und nicht nach verdorbenem Fleisch roch. Das zweite, daß es wirklich mein Vater war, das dritte, daß er ganz friedlich aussah, das vierte war meine Hand, die sein Gesicht berührte – es war steinhart und eiskalt. Als seine Tochter wußte ich, daß das, was ich sah, ein Schnellgefriervorgang gewesen sein mußte, denn die Eiskristalle waren fein und kaum sichtbar. Das fünfte war eine Mischung aus Entsetzen und vorschriftsmäßigem Verhalten. Ich warf die Truhe wieder zu, zum einen, weil man Tiefgefrorenes nicht zu lange normalen Temperaturen aussetzen sollte, zum anderen, weil ich nicht glauben wollte, was ich da sah. Mein erster Gedanke war: Warum? Der zweite: Wer hat das gemacht?
Ich löschte das Licht und schloß die Tür ab. Meine Hände zitterten. Im selben Augenblick trat Frau Deutschmann aus ihrer Wohnungstür.
»Ach, das Fräulein Kobe, daß man Sie auch mal wieder sieht.«
Ich muß sie angesehen haben wie eine, die gerade eine Leiche versteckt hat.
»Ist alles in Ordnung«, fragte Frau Deutschmann besorgt, »ich habe Ihren Vater schon ein paar Tage nicht mehr gesehen.«
Ich nahm mich zusammen und versuchte so beiläufig wie möglich zu sagen: »Hat er Ihnen nicht erzählt, daß er auf Grönland ist? Eine wissenschaftliche Expedition, das hat er sich schon sein ganzes Leben gewünscht, aber Sie wissen ja, wie das zu DDR-Zeiten war – man hat ihn nicht fahren lassen. Und ich sehe jetzt nach dem Rechten.«
»Ach nein, das freut mich ja für Ihren Vater. Und wann kommt er wieder?«
»Sein Vertrag läuft erst mal ein halbes Jahr, kann aber wohl verlängert werden.«
»Ach Gott, da ist doch so eine Kälte. Das wär’ mir nichts. Da fliege ich doch lieber nach Spanien.«
»Wem sagen Sie das. Aber mein Vater ist eben Kälte gewöhnt. Der hält es in der Hitze keine Stunde aus.«
Ich verabschiedete mich schnell und warf die Wohnungstür etwas zu heftig hinter mir zu.
Ich nahm meine Sachen und verließ die Wohnung. Am Fahrstuhl trat ich von einem Bein aufs andere, aber er kam nicht. Bei jedem Geräusch aus Richtung Flur drehte ich mich ängstlich um, als sei Vater dabei, mir seine gefrorene Hand auf die Schulter zu legen, oder als käme Frau Deutschmann aus ihrer Tür, um mir mit einem triumphierenden Unterton in der Stimme zu sagen: »Übrigens, die Polizei wartet unten schon auf Sie.« Ich rannte die achtzehn Treppen hinunter, als sei ich auf der Flucht vor etwas, das ich nicht in meinem Kosmos unterbringen konnte.
Im Auto legte ich den Kopf auf das Lenkrad und heulte. Es gab nur eine rationale Erklärung: In Wirklichkeit träumte ich immer noch auf meinem Bett in Vaters Wohnung.
4. Kapitel
Anstrich im Kühlraum und der Kühlmöbel
Geruchsbildung
Farbe auf Leinöl- und Firnisbasis darf für Innenanstrich nicht verwendet werden, da diese Stoffe einen Nährboden für Kulturen abgeben und damit zu Geruchsbildung führen. Am besten eignen sich Farben auf Kautschukbasis.
Im Prinzip konnte man alles einfrieren, Muttermilch, Tote, Erbsen, Bohnen, Spargel, die ganze DDR-Landwirtschaft, Fleischwirtschaft, Marmor, Stahl und Eisen, Akten, überhaupt hätte man die ganze ehemalige DDR mit einer Kühlzelle überbauen und sie konservieren können. Aber daß ein Mensch in seiner eigenen Kühltruhe einfror und sich ohne Zuführung äußerer Energie gefrierlagerte, das hatte ich noch nie gehört.
Am nächsten Morgen fuhr ich ins Krankenhaus, um mit dem Arzt zu reden. Danach wußte ich, daß es mit dem Termin auf dem Arbeitsamt nichts werden würde. Auf meinem Konto waren noch 300 Mark. Ich hob sie ab. Dann suchte ich im Telefonbuch die Nummer einer Transportfirma heraus und bestellte einen Lieferwagen mit vier Männern zur Wohnung meines Vaters. Bevor sie kamen, schlich ich mich zum Abstellraum und schloß vorsichtig die Tür hinter mir. Auf dem Flur blieb es still. Der Karton mit der Aufschrift »Alles fürs Fahrrad« stand an seinem alten Platz auf dem Regal neben der Truhe. Das Verfallsdatum der Gummilösung war schon um fünf Jahre überschritten, aber ich hoffte, daß sie wenigstens noch zwei Stunden kleben würde.
Ich fürchtete mich, den Deckel der Truhe zu öffnen. Ich schloß die Augen und stellte mir vor, ich säße im Kino und schaute einen Thriller.
Neben mir sitzen Leute, die an ihrem Popcorn knabbern. Einer hat gerade mit dem Fuß seine abgestellte halbvolle Bierflasche umgestoßen. Vor mir auf der Leinwand steht die Heldin des Films (wahrscheinlich wird sie am Ende als einzige überleben) in einem kleinen fensterlosen Raum und hält eine Tube Gummilösung in der linken Hand. (Ein paar Geigen fiedeln bedrohlich.) Der Raum ist stockdunkel, nur ihr Gesicht hebt sich ab. Es sieht ängstlich aus und wirkt gehetzt, als werde die Frau verfolgt. (Es kommen noch ein paar Geigentöne mehr hinzu.) Man sieht, wie ein Schlüssel von innen ins Schloß gesteckt wird. Die Hände zittern, die Heldin muß die Gummilösung auf dem Truhenrand ablegen und den Schaft des Schlüssels mit beiden Händen in das Loch führen. (Ein kurzer schriller Trompetenton kommt zu den wimmernden Geigen hinzu.) Die Tür ist nun verschlossen, und die Heldin greift etwas fahrig in die Hosentasche, um das Tatwerkzeug hervorzuholen. (Ein kurzer Aufschrei einer Geige.) Dabei läßt sie die Tube fallen, hebt sie auf und lauscht. (Generalpause der Instrumente, das Geräusch eines etwas zu schnell klopfenden Herzens.) Ich sehe, wie die Frau mit der linken Hand vorsichtig den Deckel einer riesigen Truhe öffnet. (Die Geigen schreien auf, und das restliche Orchester folgt ihnen mit ohrenbetäubendem Lärm.) Die Musik ist das Zeichen für mich, die Augen zu Schlitzen zu verengen, um sie schneller schließen zu können, falls sich etwas Grauenerregendes unter dem Deckel verbergen sollte. Ich sehe durch die Wimpern die Gestalt eines Mannes in der Truhe, und es kommt mir vor, als lächle er. (Die Hälfte des Orchesters legt eine Pause ein.) Die Heldin konzentriert sich auf das Dichtungsgummi des Truhendeckels, den sie rundherum mit Gummilösung einstreicht, wobei sie sich, am äußersten Winkel angelangt, weit über die Truhe strecken muß und dabei die Gestalt in der Truhe für die Kamera fast unsichtbar macht. Aber jetzt, was passiert jetzt? (Ein Cello unterbricht mit einem schneidenden Ton die leise vor sich hinsäuselnden Geigen.) Die Heldin rutscht ab und muß sich mit einer Hand auf dem leblosen Körper abstützen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Schnell lege ich beide Hände auf die Augen. Ich habe genug.
Vaters Arm war eklig kalt und hart und schnellte nach dem Zusammenstoß nach oben, so daß er über den Rand der Truhe ragte. Ich mußte an das Märchen vom eigensinnigen Kind denken, das Mutter gern auf einen Satz verkürzte: »Wenn du nicht hörst, dann wächst dir die Hand aus dem Grab, und ich muß mit der Rute draufschlagen, damit du Ruhe unter der Erde hast.« Ich nahm das Rohr des Staubsaugers, das neben der Truhe in der Ecke stand, und schlug damit auf Vaters Arm. Es gab ein knackendes Geräusch, der Arm fiel in die Truhe zurück, und ich klappte den Deckel zu. Dann setzte ich mich auf die Truhe und wartete, daß die Gummilösung klebte. Noch eine halbe Stunde später, in der Wohnung, zitterten mir die Knie. Ich schaffte es gerade noch bis zur Hausbar in der Schrankwand und holte mir die erstbeste Flasche heraus. Es war Boonekamp, aber das merkte ich erst, als sich etwas in mir weigerte, den Schluck die Kehle herunterzubefördern. Ich verschluckte mich und wäre fast erstickt. Ich stellte mir, nach Luft ringend, vor, wie die Nachbarn nach einiger Zeit unsere Leichen finden würden. Mich im Wohnzimmer, völlig zerfallen, vielleicht schon skelettiert neben der geöffneten Hausbar, und Vater, rosig wie am ersten Tag, in seiner Truhe.
Als ich mich einigermaßen erholt hatte, nahm ich noch einen Schluck. Er schmeckte schon viel besser. Nach dem sechsten Schluck fing ich an, in den Schränken zu wühlen. Ich suchte nach Schriftstücken, die etwas mit Vaters Gefriervorgang zu tun haben könnten, aber ich blieb bei den Fotoalben hängen. Ich suchte nach diesem seltsam entspannten Gesichtsausdruck, den ich auf Vaters tiefgefrorenem Gesicht gesehen zu haben glaubte. Das erste Foto war aus den fünfziger Jahren. Vater hatte in Schönschrift »Die Jugend von Klaus Kobe« auf das Vorsatzpapier geschrieben. Vater mit seinem Bruder vor Trümmern, Vater mit dem Fahrrad in Thüringen, Vater im Fußballtor. Er wirkte in seiner Torwartkluft sehr lang und dünn, und ich hatte beim Anblick der Fotos den Eindruck, er sei in den letzten Jahren kleiner geworden.
Es gab ein paar Fotos aus der Studienzeit. Vater auf dem Bahnhof in Halle, Vater mit Blumen und einer Mappe in der Hand. Unter das Foto hatte er »Studienabschluß 1961« geschrieben. Auf allen Fotos schaute Vater ernst. Kurz darauf hatte er meiner Mutter unter recht ungünstigen Bedingungen einen Heiratsantrag gemacht.
5. Kapitel
Apfel
Frischlagerung. Eine kritiklose Lagerung der Äpfel bei einer Temperatur in der Nähe von 0 °C ist nicht ratsam.
Seit einer halben Stunde stand Barbara in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter in der großen Halle des Hauptbahnhofes. Der Reichsbahnbeamte ließ sich Zeit und schob bedächtig den Wagen seines Fahrkartenautomaten hin und her, als wolle er für den Druck jeder einzelnen kleinen Pappkarte seine Hand ins Feuer legen. Für Barbara zählte nur, daß in ihrem Fall Berlin und das heutige Datum darauf stünde. Im Hintergrund marschierte eine Hundertschaft russischer Soldaten durch die Halle, und die Frau hinter ihr sagte: »Ich habe das Gefühl, irgend etwas braut sich zusammen, sonst kommen die nie tagsüber hier rein.« Wie jeden Samstag war Barbara auch heute morgen Schwimmen gegangen. Danach hatte sie sich das Haar auf große Wickler gedreht, das Kopftuch umgebunden und war mit dem Fahrrad die sechs Kilometer bis zum Labor gefahren. Vor ein paar Wochen noch war sie auf diesem Weg von fünf anderen kichernden Frauen durch die immer noch an vielen Ecken zertrümmerte Stadt zur Arbeit begleitet worden. Aber zwei hatten geheiratet und aufgehört zu arbeiten und drei auf die Annonce eines führenden westdeutschen Chemieunternehmens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geantwortet, die Barbara bei ihrem letzten Besuch in Westberlin über die Sektorengrenze geschmuggelt hatte. Nach dem Besuch in einem der Grenzkinos, in denen man nur den östlichen Personalausweis vorzeigen mußte und gegen Ostgeld hineinkam, war sie zum Kudamm gefahren und hatte eines der Schuhgeschäfte aufgesucht. Die neuen Schuhe behielt sie gleich an, die alten warf sie in den Papierkorb vor dem Café Kranzler, denn sie hatte Angst, an der Grenze mit zwei Paar Schuhen erwischt zu werden. Dann setzte sie sich in das Café und nahm bei einer Tasse Bohnenkaffee Abschied von ihren alten Schuhen. Als Kriegskind konnte sie sich nur schwer von irgendeinem Gegenstand trennen, denn sie hatte an einem Januartag 1945 ihre Puppe, ihr Bett und drei Paar Schuhe dem Feuer überlassen müssen, und die waren mit der Zeit in ihrer Erinnerung immer wertvoller geworden.
Die Freundinnen hatten nach ihrer Flucht eine Postkarte aus Leverkusen geschrieben, auf der sie mitteilten, daß sie gut angekommen seien. So oft Barbara die Karte auch las, sie konnte keine versteckte Botschaft zwischen den Zeilen finden, die sie zum Nachkommen ermunterte.
Der Ort schien sauber, obwohl ihm auf den ersten Blick jeder Reiz fehlte. Aber man sah wenigstens keine Trümmer. Vor zwei Wochen noch war sie sich sicher gewesen, daß sie ihre Mutter mit den vielen Geschwistern nicht alleinlassen konnte. Aber Tag für Tag wurden es weniger Leute im Labor, und manchmal saß Barbara abends weinend in der Küche, weil sie nach der Arbeit völlig erschöpft war, denn die Arbeit, die vor ein paar Wochen noch vier Frauen gemacht hatten, blieb nun an ihr hängen. Sie wußte, daß sie, wenn es sein mußte, auch für zehn arbeiten konnte, aber sie wollte wenigstens wissen, warum sie das tat. Die Rohstoffe für die Farbherstellung wurden immer schlechter oder blieben tagelang aus. Manchmal konnte sie Indigo nicht mehr von Taubenblau unterscheiden, alles wurde zu einem schmutzigen Pastell.
Vor einer Woche hatte sie in der Küche gesessen und die Strümpfe ihrer kleineren Geschwister gestopft, als ihre Mutter fast beiläufig sagte: »Wegen uns brauchst du nicht zu bleiben, wir kommen schon klar.« Zuerst würde sie nach Ostberlin zu Tante Hedwig fahren. Die würde die wichtigen Papiere unter ihren Hängebrüsten in den Westen transportieren, wie sie es immer mit dem Geld machte, wenn sie gemeinsam einkaufen gingen. Barbara hatte nur Sommerkleider eingepackt, die bei einer Kontrolle nicht auffallen würden. Bis zum Herbst würde sie sich längst einen Wintermantel verdient haben. In den Tagen vor ihrer Abreise war sie nach der Arbeit ziellos durch die Stadt gelaufen. Jedesmal hatte sie sich am Ufer der Elbe wiedergefunden. Auch dort, wo sie hinging, würde es Flüsse geben, an denen sie spazierengehen könnte. Hinter ihr hatte die Stadt gelegen, ein riesiges enttrümmertes Feld, von ein paar Kränen durchschnitten.
Barbara trat von einem Fuß auf den anderen. In zehn Minuten fuhr ihr Zug. Der Mann vor ihr war unschlüssig, wohin er eigentlich wollte. »Mein Herr«, sagte der Reichsbahnbeamte, »Sie können von hier, wie Sie sicherlich wissen, in drei Himmelsrichtungen fahren. Für die vierte bin ich nicht zuständig.«
»Käs dich aus«, sagte Barbara, »du mußt doch wissen, wo du hinwillst.«
»Welcher Zug fährt denn als nächster?« fragte der Mann den Schalterbeamten.
»Wenn Sie sich beeilen, schaffen Sie noch den D 647 nach Berlin.«
»Eine einfache Fahrt bitte.«
Der Fahrkartenverkäufer schob bedächtig den Wagen seiner Maschine auf Berlin. Es war ein Glück für Klaus, daß es zu diesem Zwischenfall gekommen war. Er hatte am Morgen einen Bekannten aus einem der Gewächshäuser am Rande der Stadt bekniet, ihm 25 Rosen zu verkaufen. Nur gegen das Versprechen, ihm am Montag einen Karton gefrorenes Mischgemüse mitzubringen, hatte der sich schließlich breitschlagen lassen und ihm einen Hochzeitsstrauß verkauft. Klaus wußte, daß nicht mehr viel Zeit blieb, er kannte den Reichsbahnfahrplan auswendig. Barbara hatte ihm gestern fast beiläufig beim Tanz im Kristallpalast mitgeteilt, daß sie nach Berlin fahre und es sein könne, daß sie sich so schnell nicht wiedersähen. Sie kannten sich erst seit zwei Wochen. Klaus hatte sich noch nicht getraut, sie zu küssen, aber er wußte, daß er diese Frau wollte und keine andere.
Er hatte vor dem Bahnhof zehn Minuten verloren, weil die Eingangstür von Militärpolizei versperrt war. Sie ließ eine Hundertschaft russischer Soldaten hinein, die geschlossen in den für Zivilisten gesperrten Wartesaal marschierte. Klaus rannte unter den Brücken hindurch bis zum Seiteneingang und stand außer Atem in der Wartehalle, als Barbara sich gegen den Schalter lehnte. Der Reichsbahnangestellte starrte wie gebannt rechts an ihr vorbei auf den Fußboden der Halle. Sie folgte seinem Blick und sah Klaus, wie er mit einem riesigen Rosenstrauß vor ihr kniete und sie mit Augen ansah, die Barbara an die eines treuen Hundes erinnerten.
»Bitte bleib«, sagte er, »ich will dich heiraten. Ich liebe dich. Ich verspreche dir eine angenehme Zukunft. Ich habe mein Studium beendet und arbeite in einer Forschungseinrichtung. Nebenbei arbeite ich an einer Doktorarbeit.«
»Hier«, sagte er noch und überreichte ihr etwas unbeholfen die Rosen. Barbara schaute sich um, ob noch jemand außer dem Schalterangestellten die Szene gesehen hatte. Um sich herum sah sie staunende Gesichter, selbst ein paar russische Soldaten waren stehengeblieben und wurden von einem Offizier in Richtung Militärwartehalle abgedrängt.