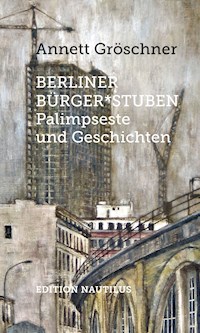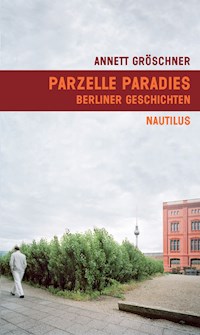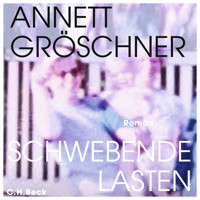
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht weniger als ein ganzes Leben erzählt Annett Gröschner mit der Geschichte der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna Krause - mit einer Wucht und Poesie, wie sie nur dort entstehen können, wo die Literatur wirklichkeitssatt ist. Hanna Krause war Blumenbinderin, bevor das Leben sie zur Kranführerin machte. Sie hat zwei Revolutionen, zwei Diktaturen, einen Aufstand, zwei Weltkriege und zwei Niederlagen, zwei Demokratien, den Kaiser und andere Führer, gute und schlechte Zeiten erlebt, hat sechs Kinder geboren und zwei davon nicht begraben können, was ihr naheging bis zum Lebensende. Hatte später, nachdem ihr Blumenladen längst Geschichte war, von einem Kran in der Halle eines Schwermaschinenbaubetriebes in Magdeburg einen guten Überblick auf die Beziehungen der Menschen zehn Meter unter ihr und starb rechtzeitig, bevor sie die Welt nicht mehr verstand. Hanna Krause blieb bis zu ihrem Tod eine, die das Leben nimmt, wie es kommt. Ihr einziges Credo: anständig bleiben. Annett Gröschners Roman erzählt die Geschichte eines Jahrhunderts in einem einzigen Leben und gibt, mit Hanna, denen ein Gesicht, die zu oft unsichtbar bleiben. Ein Roman über das Ende des Industriezeitalters und seiner Heldinnen im Osten Deutschlands – und über eine gewöhnliche Frau in diesem unfassbaren 20. Jahrhundert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Annett Gröschner
Schwebende Lasten
Roman
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
1: Blaustern
2: Studentenblume
3: Narzisse
4: Anemone
5: Ringelblume
6: Libelle
7: Alpenveilchen
8: Fliege
9: Vergissmeinnicht
10: Schachblume
11: Pfingstrose
12: Schwertlilie
13: Gelbe Fritillaria
14: Rosa Multiflora
15: Akelei
16: Raupe
17: Ackermohn
18: Gartentulpe
19: Hornveilchen
20: Traubenhyazinthe
21: Nelke
22: Maiglöckchen
23: Adonisröschen
24: Schneckenhaus
25: Zwergsonnenblume
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Ma
Dies ist die Geschichte der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna Krause, die zwei Revolutionen, zwei Diktaturen, einen Aufstand, zwei Weltkriege und zwei Niederlagen, zwei Demokratien, den Kaiser und andere Führer, gute und schlechte Zeiten erlebt hat, die bis auf ein paar Monate im Berlin der frühen 1930er Jahre nie aus Magdeburg herauskam, sechs Kinder geboren hat und zwei davon nicht begraben konnte, was ihr naheging bis zum Lebensende. Die unter einer Kirche verschüttet und jeglicher Güter beraubt wurde, die ihren einbeinigen und im Alter stummen Mann Karl, der nach der Schicht im Stahlwerk in die Kneipe musste, weil er kein Flaschenbier vertrug und gerne Skat spielte, auf dem Rücken durch die Welt trug und die jede Woche sechs Haufen dreckige Wäsche vor ihren Füßen hatte. Die später, nachdem ihr Blumenladen im Knattergebirge genannten Armenviertel der Stadt längst Geschichte war, von einem Kran in der Halle eines Schwermaschinenbaubetriebes einen guten Überblick auf die Beziehungen der Menschen unter ihr hatte und die rechtzeitig starb, bevor sie die Welt nicht mehr verstand.
1
Blaustern
Auch als Szilla bekannt. Manche sagen Meerzwiebel wegen der blauen Farbe. Bei uns ist der zweiblättrige Blaustern verbreitet. Blüht früh, vor allem in Parks. Zwiebelpflanze. Gehört zur Familie der Liliengewächse, wird nicht höher als 20 Zentimeter. Die Blüten bilden Trauben, nicht duftend. Beim Anbau wichtig: Boden aus Sand für die Durchlässigkeit und Torf für längeres Halten der Feuchtigkeit. Achtung: Die Pflanze ist giftig, verursacht Übelkeit, Erbrechen und Herzprobleme.
Die Straßenbahn stand schon eine ganze Weile auf der Scharnweberstraße, gleich hinter der Kreuzung Weichselstraße. Draußen waren Schneeschieber zu hören, die auf dem Pflaster der Fahrbahn kratzten. Hanna hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, damit das Geräusch nicht mehr an ihrem Schädel schabte, aber ihre Hände durften die Hundeleine nicht loslassen. Vor der Bahn machten sich fünf Männer zu schaffen, Hanna musste sich auf Zehenspitzen stellen, um sie zu sehen. In aller Seelenruhe räumten sie die Schienen von Schnee und Eis frei. Die BVG, das merk, Berliner, ist im Verkehr dein erster Diener. Hanna hatte es eilig, wie es in Berlin alle immer eilig hatten, außer denen, die von der Stadt bezahlt wurden, um sie am Laufen zu halten. Vielleicht kam Hanna das Leben hier deshalb so überstürzt vor. Vor allem zwischen dem dritten Advent und Weihnachten, nachdem sie aus Magdeburg zurückgekehrt war, mitten hinein in den Weihnachtstrubel auf der Frankfurter Allee, der die Menschenmenge bis in die Seitenstraßen hineindrückte. Jetzt, Anfang Januar, war die Hektik wieder einer routinierten Eile gewichen.
Hanna fiel ein, dass sie vergessen hatte, die Neujahrskarte an Rose in den Briefkasten zu werfen. Hatte sie wenigstens das Datum korrekt geschrieben? Sie holte die Karte aus der Handtasche und sah, dass dort 3. 1. 32 stand. Sie überlegte, ob sie aus der 2 eine 3 machen sollte. Aber dann würde der Fehler ihrer Schwester wahrscheinlich erst recht auffallen. Früher hatte Hanna immer eine Kopfnuss bekommen, wenn sie im Januar das Datum auf den Lieferscheinen korrigieren musste. Rose schimpfte jedes Mal – warum ließ sie Hanna überhaupt noch in die Schule gehen, wenn sie nicht mal das Datum richtig schreiben konnte. Rose fiel es selbst schwer, deswegen war Hanna seit ihrem zwölften Lebensjahr für den Schreibkram im Laden zuständig gewesen. Manchmal fragte sie sich, ob Rose überhaupt je richtig schreiben gelernt hatte. Als Königin der Blumen, wie ihr Mann Walter sie nannte, mit einem Geschäft gleich neben der Landesfrauenklinik, hatte sie es nicht nötig, für die Abrechnungen gab es ja ihren Mann und Hanna. Eigentlich war ein Blumenladen gleich neben einer Entbindungsstation wie ein Fünfer im Lotto, aber die Geschäfte liefen wegen der unaufhörlichen Krisen nicht mehr so gut, weswegen Rose Hanna als Haushaltshilfe zu Margarete nach Berlin geschickt hatte. In einem anderen Magdeburger Blumengeschäft wäre Hanna nur unliebsame Konkurrenz gewesen.
Rose und Margarete waren Hannas Halbschwestern. Halbe Schwestern nannte Hanna sie. Im Gegensatz zu ihrer knapp zwei Jahre älteren ganzen Schwester Liese.
Ihre halbe Schwester Margarete lebte mit ihrem Mann Heinrich in einer weitläufigen Wohnung in der Weichselstraße, gleich an der Frankfurter Allee, Vorderhaus, 1. Stock. Margarete sagte Beletage, was bei ihr immer wie Belle Tasch klang und Hanna an den Boxerhund mit seiner taschengroßen zerknautschten Schnauze denken ließ, der sie begleitete, zum Ärger der Schaffnerin, die ihn im Weg sah, dabei hatte Hanna den Hundekörper unter den Sitz geschoben und seinen Kopf, die Leine kurz gehalten, mit ihren Füßen eingeklemmt. Schwager Heinrich sagte zum ersten Stock Piano nobile, aber der hatte schließlich eine großbürgerliche Bildung genossen, während Margarete nur in die Sudenburger Volksschule gegangen war.
Hanna mochte keine Hunde. Der Boxer wusste das. Aber sie hatten sich schnell arrangiert, was blieb ihnen auch anderes übrig. Eigentlich sollte sie den Weg nach Lichtenberg zu Fuß zurücklegen. Heute im Schnee war es ihr und dem Hund jedoch zu mühsam, deshalb hatte sie die Straßenbahn genommen und den Fahrschein von ihrem Taschengeld bezahlt.
Der Boxer hieß Harald, aber Hanna sagte nur Gurke zu ihm, inzwischen hörte er auf diesen Namen. Seit Ende Oktober lag er abends auf ihren Füßen und wärmte sie, und Hanna ließ es zu. Für Margarete und Heinrich war der Hund Kindersatz. Margarete konnte nicht verstehen, was Hanna gegen Haustiere hatte. Dafür gab es Gründe. Einmal hatte Hanna heimlich eine junge Katze hinter den Gewächshäusern der Blumenhandlung großgezogen. Aber Walter bekam es mit und schmiss das Tier in die Regentonne, wo es ertrank. Die traurigen Augen der Katze verfolgten Hanna bis heute in ihren Träumen. Sie hatte damals nicht geweint. Sie weinte überhaupt nur ganz selten. Es blieb auch keine Zeit dafür. Wie alt war sie gewesen? Zehn? Elf. Von hinten brüllte ihr einer ins Ohr: «Sie da, Kleene, mit die Töle. Sag’n Se ma det Vieh, det ett von meene Füße uffstehn soll.» Hanna beugte sich nach unten und sah durch ihre Beine, dass der Hund unter dem Sitz entschlüpft war. Sie zog seinen Kopf mit der Leine zu sich und schimpfte: «Ungezogenes Biest.» Der Hund schaute sie gleichgültig an. Dann wollte sie sich bei dem Mann entschuldigen, aber der saß schon nicht mehr an seinem Platz.
Hanna war anfangs todunglücklich über die Wendung ihres Lebens, hatte sie sich doch wohlgefühlt im Hinterzimmer des Blumenladens, wo sie sich immer neue Gebinde und Gestecke ausdachte, die Rose dann als ihre eigenen Kreationen verkaufte. Weinen und Betteln, sie wolle auch zum halben Lohn arbeiten, halfen nicht. Sie durfte sich bei Defaka auf der Otto-von-Guericke-Straße einen Koffer aussuchen und Rose plättete ihr die Kleider auf. «Wir haben alles für dich und Liese gemacht.» Hanna schwieg und schluckte ihre Widerworte herunter. Sie wollte ja dankbar sein.
Rose und Walter hatten sie und Liese nach dem plötzlichen Tod der Mutter an Kindes statt aufgezogen, obwohl Rose nur sechzehn Jahre älter war als ihre Halbschwester Liese. Im Gegensatz zu Hanna grübelte Liese nie und konnte die Leute bequatschen. Wenn Kunden den Blumenladen in der Absicht betreten hatten, rote Rosen zu kaufen, gingen sie mit Margeriten, weil Liese ihnen einredete, Rosen seien überschätzt und die Feingliedrigkeit der Margeriten unterstreiche ihren Charakter als Schenkende viel besser. Ihrer großen Schwester war das nicht recht, weil Rosen mehr Geld einbrachten und Liese vorlaut war, insbesondere zu den Kundinnen. Hanna fragte sich, wie Liese es immer schaffte, weniger Schläge für viel größere Vergehen zu bekommen. Vor vier Jahren hatte sie einen Herrenschneider geheiratet, der in der Nähe des Blumenladens sein Atelier betrieb.
Hanna sah ihre frühe Kindheit nur schemenhaft, wie durch eine Milchglasscheibe, hinter der sich Personen bewegten, deren Gesicht sie nicht erkennen konnte. Der Vater wie weggewischt, nur der Name Borkowski war von ihm geblieben, die Erinnerung an die Mutter stets vage, ihr Gesicht von wilden blonden Haaren umrahmt. Hanna sah sie in der dunklen Küche mit einem Brief in der Hand, erst ihren Blick darauf, dann ungläubiges Staunen, schließlich ein Freudenschrei und im selben Moment sank die Mutter zu Boden, ohne jede Möglichkeit, sie aufzufangen. Hanna hätte sie ohnehin nicht halten können. Sie war gerade vier geworden.
Mit dem zweifach geknickten Brief in der Hand lag die Mutter in der Küche und wachte nicht wieder auf, sosehr Hanna auch rüttelte. Der Schlag hatte sie getroffen. Wo war eigentlich Liese an dem Tag gewesen?
Den Duft des Rosenparfüms, das ihre Mutter zu jedem besonderen Anlass hinter den Ohrläppchen verrieb, hatte Hanna bis heute in der Nase. Immer wenn dieser Duft am Körper einer Frau an ihr vorüberwehte, stiegen ihr die Tränen hoch. Weinen musste sie nie, die Tränen blieben auf halbem Wege stecken.
Sie besaß kein Foto ihrer Eltern, weder gemeinsam noch einzeln. Von Rose und Walter wurde Hannas und Lieses Vater nur der Polacke genannt. «Polackinnen» riefen auch die Nachbarskinder Hanna und Liese hinterher und ließen sie nicht mitmachen beim Murmeln oder Versteckspielen. Wenn die anderen das Schimpfwort aussprachen, fiel ihnen immer ein Quäntchen Spucke aus dem Mund. Hanna fand das faszinierend, die Spucke schwebte kurz in der Luft, ehe sich entschied, ob das Klümpchen nach oben oder nach unten fliegen würde oder, nicht selten, in Hannas Gesicht. Liese passierte nie etwas, weil sie schneller rannte und Hannas Hand immer rechtzeitig losließ. Die Kinder holten Hanna bald ein. Ganz zerzaust kam sie nach Hause, und manchmal geriet die Mutter, als sie noch lebte, darüber so sehr in Wut, dass sie sie schüttelte oder ihr eine Ohrfeige verpasste, die ihren Kopf derart zur Seite fliegen ließ, dass der Hals hinterher mehr schmerzte als die Wange. «Wehr dich gefälligst.» Liese dagegen war wie Giersch, sie gedieh überall und stellte sich, wenn jemand auf sie trat, schnell wieder auf.
Der Vater hatte die Familie verlassen, bevor Hanna sich an ihn hätte erinnern können. Als Kind hat sie sich ihn wie eine Ausschneidepuppe zurechtgemacht. Mal kleidete sie ihn in elegante Anzüge, Dreiteiler mit Weste, in der eine Taschenuhr mit langer Kette versteckt war, mal trug er einen Hut mit breiter Krempe, Rüschenhemd und Pumphose wie der Mann in der Zigarilloreklame.
Von ihrem Vater waren nur zwei Wörter übriggeblieben, die kein anderer verwendete. Sie glaubte, dass es Polnisch war. Prosze und Cmientarz. Sie nahm sich vor, gegen das Verbot Margaretes, einem der Polen, die in der Gegend ihre Haustürgeschäfte machten, die Tür zu öffnen und nach der Bedeutung dieser beiden Wörter zu fragen. Aber was, wenn sie eine beleidigende oder sogar schlüpfrige Bedeutung hatten und Hanna sich blamierte oder in Gefahr brachte?
Die knapp zweistündige Fahrt nach Berlin war Hannas erste Reise mit dem Zug gewesen. Sie steckte den Kopf aus dem Fenster und ließ sich vom Rauch der Lokomotive einnebeln, die sie alle durch Dörfer und Städte zog, bis sie schließlich in den Potsdamer Bahnhof von Berlin einfuhren. Hanna hatte noch nie einen Kopfbahnhof gesehen, sie bekam Angst, die Lokomotive könnte durch das Eingangstor rauschen, und zog sich schnell ins Abteil zurück. Der Zug ruckte und stand. Das Erste, was Hanna ins Auge fiel, als sie auf den Bahnhofsvorplatz trat, waren die Blumenfrauen. Sie boten kleine Asternsträuße an, in vielen Farben, und so dicht gebunden, wie Hanna es noch nie gesehen hatte. Sie nahm sich vor, ein paar Monate später wieder herzukommen, um die Frühlingssträuße zu sehen und sich vielleicht etwas für Roses Laden abzugucken.
Margarete war nicht am Bahnsteig, obwohl sie es telegrafisch angekündigt hatte.
Natürlich verriet ihr Margarete den Grund nicht, das bekam Hanna erst später heraus. Sie hatte das Schäferstündchen bei ihrem Gynäkologen überzogen. Jeden Dienstag ging Margarete zu ihm nach Lichtenberg, weil sie ein Frauenleiden hatte. «Mein Frauenleiden», sagte sie, als handelte es sich um einen besonders schönen Schmuck, dabei war es nichts weiter als eine langwierige Therapie gegen Kinderlosigkeit, die Dr. med. Friedrich Salinger in der Möllendorffstraße behandelte.
Hanna musste sich alleine vom Potsdamer Bahnhof zur Weichselstraße durchschlagen, ihre erste Lektion in Sachen Großstadt, zumal es in Berlin mehrere Weichselstraßen gab. «Jede andere Provinzmaus», erzählte sie später ihren Töchtern, «wäre in Ohnmacht gefallen bei diesem Gewusel und nie angekommen, aber ich wusste den Postbezirk und habe mich durchgefragt, erst zum Alex, dann zur Frankfurter Allee. Später habe ich erfahren, dass ich auch anders hätte fahren können, quer durchs Gemüse mit der Straßenbahn, aber ich brauchte ein Wort, an dem ich mich festhalten konnte, und das war Alexanderplatz. Meine erste U-Bahn-Fahrt und das halbe Geld gleich weg. Und dieser dunkle Tunnel rechts und links, endlos, ich bin fast gestorben vor Angst.»
Auch die halbe Schwester Margarete war in den Zug nach Berlin gesetzt worden, von der Mutter, nach Neujahr 1914, Hanna war drei Monate alt, das Geld war knapp und der neue Mann der Mutter mochte die Stieftöchter nicht. So wurde man in der Provinz unnütze Esser los. Im Gegensatz zu Hanna fuhr Margarete ins Blaue. Am Schlesischen Bahnhof meldete sie sich bei einer Agentur, die sie in die Fruchtstraße als Dienstmädchen zu ihrer zukünftigen Schwiegermutter schickte, Prinzipalin eines Sauerkrautunternehmens, die fünf Jahre später an der Spanischen Grippe starb. Danach waren für Margarete zwei Kriege ausgestanden, der mit der Alten und der Große. Fortan durfte niemand sie mehr Grete oder gar Gretel nennen und Heinrich konnte sie endlich heiraten. Er war der einzige Sohn, das hatte ihn an der Heimatfront unabkömmlich gemacht – das Volk brauchte Sauerkraut, wenn es schon keine Butter gab. Und was noch wichtiger war: Als Besitzer eines kriegswichtigen Betriebes konnte er sich herausnehmen, was anderen nicht vergönnt war, eine Liebesheirat mit einer Magdeburgerin aus armen Verhältnissen. Wenn sie wenigstens aus Griechenland oder Münchnerin gewesen wäre!
Statt Sauerkohlfabrik bevorzugte Heinrich Hoffrichter die Bezeichnung «Fabrik für Gemüsekonserven». Margarete hatte den Namen Gute Hoffnung für die Sauren Gurken im Glas kreiert, die nach dem Krieg zum Verkaufsschlager wurden, Schwangerenkompott sagten die Leute dazu. Sie selbst wurde die nächsten zehn Jahre nicht schwanger, so viele Gurken sie auch aß. Eigentlich tat sie auch nur so, Gurken und Sauerkraut waren ihr ein Graus, sie hatte sie in ihrer Kindheit zu oft essen müssen, weil nach dem Tod des Vaters kein Geld im Haus war. Ein Schokoladenfabrikant hätte ihr mehr gelegen.
Anfangs wohnte das Ehepaar Hoffrichter in der Fruchtstraße im Vorderhaus des zwischen Wohnhäusern versteckten Fabrikgeländes, aber Margarete vertrug den Geruch von Saurem, der an manchen Tagen sehr dicht über der Straße hing, nicht, er machte sie schwermütig. In ihren schönen Kleidern lag sie auf dem Kanapee und litt, überhaupt war sie eine hervorragende Hysteriedarstellerin, manchmal staunte sie selbst darüber, wie gut ihr das gelang, bis Heinrich endlich eine Wohnung in der Weichselstraße fand und dazu gleich noch den Gynäkologen Friedrich Salinger. Lieber als die Beletagewohnung wäre Margarete eine Villa gewesen, aber Heinrich hasste Statusobjekte. Er galt als Revolutionär, weil er das Dienstmädchen der Familie geheiratet hatte und seine Arbeitskräfte mit Prämien, Betriebsrenten und Waschräumen bei Laune hielt.
Als Margarete das Verhältnis mit ihrem Gynäkologen von einem einmaligen Ausrutscher zur Serienreife brachte, brauchte sie jemanden für den Hund, denn Salinger vertrug Hundehaare nicht, er musste davon immer niesen, für einen Gynäkologen war das geschäftsschädigend. Außerdem war das Mädchen, das bisher den Hoffrichterschen Haushalt geführt hatte, schwanger, und Schwangere konnte Margarete nicht ertragen. Rose, der sie in einem Brief von der schwierigen Suche nach einem neuen Hausmädchen berichtet hatte, schrieb umgehend zurück: «Nimm Hanna, ich kann sie grad nicht gebrauchen, die Geschäfte gehen schlecht.»
Margarete und ihr Gurkenkaiser, wie Rose ihn scherzhaft und ein wenig abfällig nannte, waren die Einzigen weit und breit, die ohne Einbußen durch Inflation und Wirtschaftskrise gekommen waren. Sauerkohl und Gurken gingen immer.
Offiziell wurde Margarete bei ihren Arztbesuchen von Hanna und dem Hund begleitet, in Wirklichkeit ging Margarete vor und Hanna holte sie zwei Stunden später in Begleitung des Hundes ab. Das fiel niemandem auf, denn Heinrich war den ganzen Tag in der Fabrik. Hanna musste manchmal dorthin, um ihm das Frühstück oder Papiere zu bringen, die er zu Hause auf der Ablage im Flur vergessen hatte.
Die Fruchtstraße ging von der Frankfurter Straße ab, zwei Haltestellen mit der U-Bahn, von der Samariterstraße bis zur Memelstraße. Zu Fuß zwanzig Minuten, wenn der Hund mitmusste. Hanna hatte schnell gelernt, sich in Berlin zu bewegen, auch wenn sie nicht viel weiter kam als bis zum Alexanderplatz. Wie hatte Margarete neulich gesagt: «Behände wie eine Berlinerin und nicht mehr so ein Bördetrampel wie vor einem Jahr. Hast eine richtige Taille gekriegt.»
Manchmal lud Heinrich Margarete und Hanna ins Rosetheater ein. Sie mussten nur durch die Hinterhöfe neben der Sauerkrautfabrik, so viele, dass Hanna alleine nicht zurückgefunden hätte, schon gar nicht nachts. Die Höfe ihrer Kindheit in Magdeburg-Buckau waren Gartengrundstücke dagegen. Hanna liebte Theatervorstellungen mehr als das Kino. Die Räuber hatten sie gesehen und Franz Lehars Lustige Witwe mit guter Sicht aus der Loge. Heinrich war vor allem von den Leuten im hinteren Parkett fasziniert, die so fröhlich mitgingen, während Margarete am Opernglas klebte, dabei hatte sie gute Augen.
Eine Woche vor Totensonntag war Hanna von Rose per Telegramm nach Magdeburg zurückbeordert worden, um bei der Herstellung der Trauerkränze und später der Adventsgestecke zu helfen. «Damit du nicht aus der Übung kommst», wie Rose mit einem leicht sarkastischen Unterton sagte.
Manchmal blieb Hanna, wenn sie aus Heinrichs Büro kam, kurz beim Blumenladen auf der Frankfurter Allee stehen und schaute sich die Zusammenstellung der Sträuße an, die im Schaufenster standen. Als sie dann im Dezember anfing, die Blumen genau so zu binden, sagte Rose, sie könne sich ihre Berliner Allüren abschminken, genau wie ihr Gesicht, hier solle sie die Sträuße gefälligst so machen, wie sie es bei ihr gelernt hatte. Hanna schwieg. Rose band die Sträuße immer noch, wie Hanna es sich vorvorvorletzte Saison ausgedacht hatte.
Nach ein paar Tagen wurde Hanna barsch angewiesen, sich bei der Arbeit im Laden ein Kopftuch umzubinden, denn nach Roses Meinung hielt die Kurzhaarfrisur, die sie sich kürzlich auf der Frankfurter Allee nach einem aus Salingers Wartezimmerillustrierten heimlich herausgerissenen Foto hatte schneiden lassen, die Leute davon ab, den Laden zu betreten. Dabei war es genau umgekehrt. Die Leute kamen, um sich das anzusehen, manche kriegten den Mund gar nicht mehr zu, und bald sah Hanna ein paar Mädchen mit ähnlichen Frisuren herumlaufen. Nur die älteren Stammkundinnen zerrissen sich die Mäuler, bis Rose Hanna ins Hinterzimmer verbannte, wo sie den Hass auf ihre halbe Schwester in die Totensonntagsgestecke band. Und manchmal auch in die Hochzeitssträuße, aber da nur mit schlechtem Gewissen. Und nie in die Sträuße für den Tagesgebrauch, was vor allem hieß, für Wöchnerinnen. Niemals wollte Hanna an Kindbettfieber sterben. Dann lieber gar keine Kinder.
Drei Wochen später waren Hannas Finger völlig zerkratzt, grün und von Harz überzogen, das sie nur zusammen mit der Haut abpulen konnte. Nach Berlin zurückgekehrt, machte sie Abende lang Calodermabäder, die Finger in der Ölseifensuppe, wie ihr Margarete geraten hatte.
Zu Silvester gab es Bleigießen, die anwesende Wahrsagerin raunte, sie sehe Eisblumen und ein Embryo, was aber nicht Kind bedeuten müsse, sondern auf Veränderung hindeuten könne. Und dann sei da noch etwas Drachenähnliches, vor dem solle sie sich hüten. Hanna warf den Bleiklumpen noch in derselben Nacht heimlich in den Ofen und es wurde eine Kugel daraus, ein Sinnbild der Ruhe.
Ein junger Mann, dem Hanna noch nie begegnet war, hatte Margarete auf der Silvesterfeier umgarnt. Mit Blick auf Hanna hatte er gefragt, wer denn diese dralle Blüte sei. Margarete antwortete mit einem Lachen, die sei zu schade für ihn. «Das ist meine kleine Schwester. Die sieht jetzt vielleicht noch aus wie ein Mauerpflänzchen, aber sie wird eine schöne kräftige Malve, versuchen Sie gar nicht erst, die Finger nach ihr auszustrecken, ich brech sie Ihnen, Sie Schwerenöter.» Hanna war froh über Margaretes Forschheit, mit der sie dem jungen Mann stellvertretend für Hanna einen Korb gab und ihr ins Ohr flüsterte: «Das war der Falsche.» Hanna merkte sich dieses neue Wort: Schwerenöter.
Seit sie aus Magdeburg zurückgekehrt war, musste sie an Karl denken, den sie dort beim Tanz im Kristallpalast auf der Leipziger Straße kennengelernt hatte. Vier Wochen später hatte er ihr einen Brief nach Berlin geschrieben. Nichts weiter als einen Neujahrsgruß, «EIN GUTES JAHR 1933», und einen Satz: «In der Hoffnung, Sie wiederzusehen, Ihr Karl Krause.» Margarete hatte den Brief abgefangen, geöffnet, gelesen, gelacht. «Unsere Hanna hat einen Verehrer. Ah, er beherrscht die Süße der Konversation, was ist er denn von Beruf?» – «Eisenbahnversicherungsvertreter», sagte Hanna. Margarete schaute abschätzig: «Vergiss ihn, Versicherungskaufmänner sind Langweiler. Eisenbahnversicherungsvertreter sind ganz besonders langweilig, die haben statt Stroh den Fahrplan im Kopf. Und Krause ist kein Name, sondern eine Sackgasse. Lass dir Zeit mit dem Heiraten. Du kommst mit zu den Frühjahrsbällen, da wird sich schon einer finden, der dir mehr bietet als so ein Provinzheini. Was willst du in Magdeburg? Wenn es nur ein Karl sein soll, der findet sich auch in Berlin. Und im Übrigen ist das Gewerbe im Niedergang. Wer kann sich noch eine Versicherung leisten?» Hanna erwiderte nichts, obwohl sie fand, dass Karl alles andere als ein Langweiler war. Wie er sie beim Tanz durch die Luft wirbelte, das hatte schon Aufsehen erregt, was ihr peinlich gewesen war, obwohl ihr eigentlich nichts peinlich sein sollte als Berlinerin. Ein Fußballer war er und Anna, ihre Freundin aus Schultagen, hatte ihm einmal dabei zugesehen, wie er bei Katerbows Schwimmanstalt kopfüber von der Brücke in die Alte Elbe gesprungen war.
Hanna beobachtete die Schaffnerin, während sie das Ein- und Aussteigen überwachte und, als niemand mehr draußen stand, mit der linken Hand die lederne Zugleine zog, um die Klingel zu betätigen. Das gefiel ihr, und sie überlegte manchmal, ob diese Arbeit was für sie wäre. Sie mochte das Schiffchen auf dem Kopf und die schnellen Bewegungen der linken Hand, mit der die Frauen das Geld aus dem Galoppwechsler herausholten. Ein seltsames Wort, aber Hanna mochte solche Ausdrücke und sammelte sie in einem Schulheft, wie auch die komplizierteren Blumennamen, die sie nicht vergessen wollte.
Die Straßenbahn fuhr wieder an, knirschend, wegen des Schnees, der immer noch in dichten Flocken zur Erde schwebte.
Hanna zog die Teilstreckenfahrscheine für sich und den Hund unter dem Handschuh hervor, um sie bei der Kontrolle vorzeigen zu können. Das Loch war auf der 4, was hieß, vier Haltestellen durfte sie mitfahren. Scharnweber-, Gürtel-, Möllendorff-, Normannenstraße. Anfangs sah alles gleich aus, die Häuser variierten kaum, aber dann kam die S-Bahn-Brücke, danach überquerten sie die Frankfurter Allee, und zwei Haltestellen später musste sie aussteigen.
Seit gestern schon trug Hanna einen Brief von Rose an Margarete mit sich herum. Wenn Rose sich die Mühe machte, ihrer Schwester zu schreiben, dann musste es etwas Wichtiges sein. Kaum war Margarete heute Morgen aus dem Haus, hatte Hanna ihn über Wasserdampf geöffnet. Jetzt holte sie ihn aus der Handtasche und las. Rose machte Margarete Vorwürfe wegen ihres losen Großstadtlebens, das auf Hanna abfärbte, schon alleine die Frisur sei nicht geeignet, Hanna vor die Kundinnen zu stellen. «Ein Trotzkopf hast du aus dem Medchen gemacht.» Bis zu Hannas Volljährigkeit sei sie aber ihr Vormund und wolle sie jetzt zurückhaben, «bis das Mädel ein Ehemann findet, der ihr Mores leert».
Blöde Hundsrose, vertrocknen soll sie! Hanna dachte daran, den Brief nach dem Aussteigen in den nächstbesten Gully zu werfen, aber sie war klug genug zu wissen, dass sie damit das Problem nur vertagte, aber nicht aus der Welt schaffte. Sie würde das kleine Ladenmädchenopfer sein. Vielleicht würde Margarete sich weigern, sie zurückzugeben? Sie konnte sehr hartnäckig sein, wenn sie etwas nicht wollte.
Hinter Hanna duftete es seit der letzten Haltestelle nach Jasmin und sie bekam sofort Sehnsucht nach Roses Gewächshäusern, die einfach besser rochen als Sauerkraut und Gurken.
Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm zurückzugehen und darauf zu warten, dass Karl ihr einen Antrag machte. Wer wusste, was in Berlin noch alles passieren würde. Manchmal waren nachts draußen schwere Stiefel zu hören und Schreie, einmal auch Schüsse, und Heinrich sagte ihr, sie solle sofort die Straßenseite wechseln, wenn Männer in den senfgelben Uniformen der SA ihr entgegenkämen. Aber das machte sie ohnehin bei jedem Uniformierten.
Andererseits durfte sie hier Bohnenkaffee trinken und Margarete hatte ihr beigebracht, Make-up so aufzutragen, dass sie nicht geschminkt aussah. Seitdem hatte Hanna immer eine kleine Puderdose dabei und auch jetzt, als die Straßenbahn schon wieder stand, kurz bevor sie unter der S-Bahn-Brücke hindurch in die Möllendorffstraße bog, holte sie die Dose hervor und puderte nach. Sollte sie wirklich zurückmüssen, würde sie die Dose vor Roses Argusaugen verstecken.
2
Studentenblume
Auch Tagetes genannt, aus Mexiko stammend. Leuchtendes Gelb oder Orange, manchmal rot-orange oder sogar weiß. Aus der Familie der Korbblütler. Ist nur einjährig, aber sehr anpassungsfähig und robust. Riecht streng. Eignet sich mehr für Blumenbeete und Balkonkästen als für Sträuße. Wenn im Strauß, dann nur 1–2 und mit angenehm duftenden Blumen.
Wenn sie, allein in ihrem Laden, schräg aus dem großen Schaufenster blickte oder mittags, wenn die Kundschaft zu Tisch war, kurz zum Durchatmen vor die Tür trat, konnte Hanna auf das Knochenhauerufer sehen. Die Straße sah so grobschlächtig aus, wie ihr Name klang, nur dass die Bezeichnung «Ufer» mehr versprach, als sie halten konnte. Denn der Blick auf die Elbe war durch allerhand Bauten versperrt. Auf beiden Straßenseiten standen enge, dunkle Gebäude, in unregelmäßigen Abständen wurden die Häuserreihen von Gassen unterbrochen. Sie schlängelten sich hinauf zur Jakobstraße, die im doppelten Sinne gehobener war, also mit ihrer Lage zehn Meter über dem Fluss nicht hochwassergefährdet wie die Straßen am Ufer und zugleich voller Menschen, die auf die da unten in ihrem Gedränge herabschauten.
Seit einem Jahr war Hanna Besitzerin eines Blumenladens auf dem Johannisberg am Rand des Knattergebirges, dem Armenviertel der Stadt. Sie hatte ihn zu günstigen Konditionen über einen Freund von Karl bekommen, der Mitglied der Sozialdemokratischen Partei gewesen war. Mit ihm hatte Karl im Oktober 1932 Steine auf die Wagenkolonne von Adolf Hitler geworfen, um seinen Auftritt in der Stadthalle zu stören. Er war immer noch stolz darauf, dass einer seiner Steine die Limousine des Führers getroffen hatte. Hitler war seitdem nicht mehr in Magdeburg gewesen, aber viele der Genossen waren im Gefängnis gelandet oder an unbekannte Orte verschleppt worden. Auch die Vorbesitzerin ihres Ladens war verhaftet worden, warum, wollte Hanna gar nicht wissen, aber Karl erzählte ihr ungefragt, dass man die Genossin beim Flugblätterverteilen im Viertel erwischt hatte. Den Abstand für die Ladeneinrichtung zahlte Hanna an den sozialdemokratischen Untergrund ab. Die Zeiten gefielen Hanna nicht, aber sie hatte sich vorgenommen stillzuhalten, zu viel stand für sie auf dem Spiel. Und Karl sollte auch lieber den Mund halten.
Ihre halbe Schwester Margarete hatte sich im Januar 1933 zwar gegen Rose durchgesetzt und Hanna zu deren Ärger nicht freigegeben, aber dafür war Karl über Ostern nach Berlin gekommen. Hanna und er hatten sich per Telegramm an der Berolina auf dem Alexanderplatz verabredet und Hanna beobachtete von einem Fensterplatz im Aschinger aus, wie er mit scheußlichen Narzissen, die eindeutig gegen ihn sprachen, um den Sockel der Berolina kreiste und alles und jeden mit Neugierde beobachtete. Hanna mochte die Berolina, ihr Schwager hatte ihr erzählt, dass eine Blumenverkäuferin vom Potsdamer Platz für sie Modell gestanden hatte. Um ihren Anblick täte es ihr leid, wenn Karl sich trotz allem als passabel erweisen und sie nach Magdeburg mitnehmen würde.
24 Stunden später war Hanna sich noch nicht sicher, ob Karl der Richtige war, aber er hatte lebende Eltern mit ungewöhnlichen Namen – Willibald und Sibylle –, was sie auf seltsame Weise elektrisierte, als könnte ein großer Wunsch von ihr doch noch wahr werden. Außerdem roch Karl so gut nach Erde, Rauch und einem leichten Hauch Schweiß. Deswegen ließ sie sich nach einem Kännchen Kaffee und drei Weinbrand auf eine Nacht mit ihm ein, in einem der Hotels am Alexanderplatz, dessen Hintereingang nicht so scharf bewacht wurde wie bei den besseren Häusern. Hinter den dünnen Wänden waren von allen Seiten Seufzer, spitze und tiefe Schreie, Stöhnen und das Klatschen von Händen auf Haut zu hören gewesen, was Karl ermutigte. Hanna starrte auf die Blumentapete, weiße Lilien auf grünem Grund. Der Schnaps in ihrem Kopf ließ die Blüten tanzen. Zu einem Strauß wollten sie sich nicht fügen. Das, was ihr geschah, nahm sie mit Neugier und Schmerz wahr. Der Schmerz tat nicht weh, er rüttelte sie nur durcheinander, die Neugier kroch in alle Löcher. Es gefiel ihr gut, dass sie jemand anfasste, ohne sie zu verachten. Die meisten Berührungen, an die sie sich erinnerte, waren Ohrfeigen oder Schläge auf den Hinterkopf. Das Handtuch unter ihrem Hintern kratzte. Sie fragte sich, woher Karl wusste, dass man ein Handtuch über das Laken legen musste, aber sie traute sich nicht zu fragen.
Ende Dezember wurde Hanna Mutter eines Jungen. Noch bevor die Schwangerschaft zu sehen gewesen war – Hannas Reformkleider und ihre ohnehin nicht besonders schmale Gestalt hatten neugierige Blicke ins Leere laufen lassen –, hatte sie Karl geheiratet. Ohne Pomp und Trallala, nur ein kleines Fest bei den Schwiegereltern im Garten. Ende September war es schon empfindlich kühl, es ging nicht bis in die Puppen. Vor Mitternacht torkelten die letzten von Karls Freunden ins Dunkle. Einer wollte ihr auf den Hintern hauen, traf aber ihren Rücken. Hanna missfiel, dass Karl schon den zweiten Abend in Folge sturzbetrunken war. Beim Polterabend hatte sie noch Verständnis, trank trotz Schwangerschaft selbst einen Kurzen mit, aber dass Karl am nächsten Morgen nach einem ausgiebigen Frühschoppen zum Altar gewankt war, war ihr unangenehm. Rose und Walter saßen bei der Feier etwas abseits und redeten nur mit Liese und ihrem Mann. Liese hatte ja in den Gewandmeisterclan des Magdeburger Westens eingeheiratet, freilich war ihr eine Schwangerschaft zugutegekommen, denn Heinz war eigentlich schon mit einer besseren, noch jungfräulichen Partie verlobt gewesen. Aber die Gewerbetreibenden der Großen Diesdorfer Straße und ihre Kundinnen hatten mit Klatsch und Tratsch dafür gesorgt, dass die arme schwangere Waise Liese nicht sitzengelassen wurde, ihre Marmeladenstullen jetzt mit Messer und Gabel aß und ihren Sohn Siegfried mit Butter fütterte. Von wegen Drachentöter! Verfressen war er. Hanna hatte ihm schon ein paar Mal auf die Finger gehauen, weil er von fremden Tellern aß, und Liese hatte sich Hannas Einmischung verbeten.
Liese konnte so schrecklich angeben, vor allem, wenn sie einen Likör zu viel getrunken hatte. Selbst bei der Hochzeit ihrer Schwester musste sie im Mittelpunkt stehen. Hanna regte sich besonders darüber auf, dass sie alleine zu Karls Schifferklavierspiel unter der Lichtergirlande tanzte. Auch darüber, dass Karl es sich nicht nehmen ließ, Liese eigens vorzuspielen. Unterdessen schlief ihr Heinz hinter den Gewächshäusern seinen Rausch aus. Der Schneider vertrug nichts, aber wenigstens hatte er Karls gebraucht gekauften Anzug so umgearbeitet, dass er wie angegossen saß und Karl selbst völlig besoffen eine gute Figur machte. Dass Hannas Hochzeitskleid spannte und zum Hals hin unschöne Falten warf, störte Heinz nicht, er war schließlich Herrenschneider. Margarete hatte sich und Heinrich entschuldigen lassen. Schon als sie ihrer halben Schwester geschrieben hatte, um die Schwangerschaft zu beichten, gab Margarete ihr noch mal deutlich zu verstehen, dass sie Karl für dritte Wahl hielt. Die 500 Mark, die sie Hanna geschickt hatte, waren aber der Grundstock für den Laden gewesen und hatten ihr das Betteln um einen Bankkredit erspart.
Seit Hanna den Laden betrieb, redeten Rose und Walter kein Wort mehr mit ihr, auch zu Feiern wurden sie und Karl nicht mehr eingeladen. Hanna war über Margarete zu Ohren gekommen, dass Rose überall herumerzählte, die Sträuße ihrer Halbschwester taugten nichts, im Knattergebirge würden ohnehin nur betrunkene Freier billiges Grünzeug für die Huren kaufen oder Nelken fürs Knopfloch. Hanna verstand nicht, warum Rose sie so sehr hasste. Sie hatte das Dach über dem Kopf und das Essen, das man ihr gewährt hatte, doch mit harter Arbeit vergolten.
Schon mit zehn hatte Hanna, da reichte sie mit den Füßen kaum an die Pedalen heran und trat mit den Zehenspitzen, bei jedem Wetter mit Walters Fahrrad Grabkränze ausgefahren. Die meisten Leute starben, wenn es entweder zu heiß oder zu kalt war. Aber selbst bei Glatteis war auf Hanna Verlass und oft hatte sie die Schule verpasst wegen eiliger Lieferaufträge. Über allem stand die Drohung, zusammen mit ihrer Schwester Liese ins Waisenhaus abgeschoben zu werden. Alles war besser als dieses Los: die Ohrfeigen von Rose, wenn Hanna wieder einen Strumpf zerrissen hatte. Ein Strauß ihr nicht gefiel. Der Ofen nicht warm genug war. Auch Walters Schläge mit dem Gürtel bei schlimmeren Vergehen wie Blumen zerdrücken oder zu spät mit dem Fahrrad heimkommen. Schläge waren normal, die anderen Mädchen in der Schule redeten gern davon, mit immer neuen Ausschmückungen, oder zeigten auf dem Schulhof ihre Blutergüsse, blaue Flecken, Striemen vor, als wäre Züchtigung ein Liebesbeweis. Hanna nahm sich vor, ihre Kinder möglichst nicht zu schlagen.