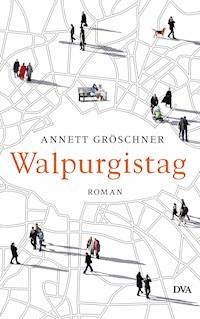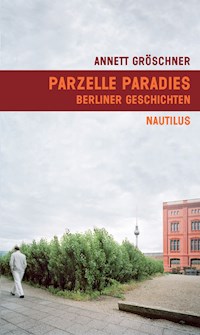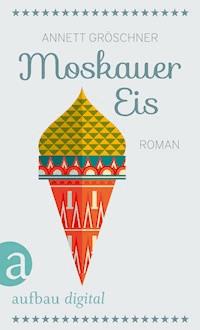Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Eine erstklassige Mischung aus Anekdoten, Analysen und Alkohol. Und die große Frage, ob wir so leben wollen, wie wir leben sollen. Hört auf diese Frauen!“ Katja Oskamp Drei Freundinnen, ein Küchentisch, vor den Fenstern die Nacht: Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reden. Über sich als „Ostfrauen“, was auch immer diese Schublade bedeutet, über das Glück krummer Lebensläufe, über die Gegenwart mit ihrer sich ständig reindrängelnden Vergangenheit. Es wird getrunken, gelacht und gerungen, es geht um Erinnerungsfetzen und Widersprüche, um die Vielschichtigkeit von Prägungen und um mit den Jahren fremd gewordene Ideale. Im japanischen Volksglauben gibt es Geister, die aus achtlos weggeworfenen Dingen geboren werden – „wie sähe der Dinggeist der DDR aus?“, fragen die drei. Ihr Buch ist dem Erinnern und dem Sich-neu-Erfinden gegenüber so gewitzt und warmherzig, wie es jede große Gesellschaftsdiskussion verdient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Eine erstklassige Mischung aus Anekdoten, Analysen und Alkohol. Und die große Frage, ob wir so leben wollen, wie wir leben sollen. Hört auf diese Frauen!« Katja OskampDrei Freundinnen, ein Küchentisch, vor den Fenstern die Nacht: Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reden. Über sich als »Ostfrauen«, was auch immer diese Schublade bedeutet, über das Glück krummer Lebensläufe, über die Gegenwart mit ihrer sich ständig reindrängelnden Vergangenheit. Es wird getrunken, gelacht und gerungen, es geht um Erinnerungsfetzen und Widersprüche, um die Vielschichtigkeit von Prägungen und um mit den Jahren fremd gewordene Ideale. Im japanischen Volksglauben gibt es Geister, die aus achtlos weggeworfenen Dingen geboren werden — »wie sähe der Dinggeist der DDR aus?«, fragen die drei. Ihr Buch ist dem Erinnern und dem Sich-neu-Erfinden gegenüber so gewitzt und warmherzig, wie es jede große Gesellschaftsdiskussion verdient.
Annett Gröschner Peggy Mädler Wenke Seemann
Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über Annett Gröschner, Peggy Mädler, Wenke Seemann
Impressum
Inhalt
NACHT 1 — VORWORT ODER DAS KLISCHEE DER OSTFRAUEN, DAS WIR SELBER SIND
NACHT 2 — EIGENTUM ODER WARUM DIE KLASSENLOSE GESELLSCHAFT FÜR DIE MEHRHEIT DER DEUTSCHEN DAS SCHLIMMSTE IST
NACHT 3 — FRAUEN IN DIE OFFENSIVE — WER SICH NICHT WEHRT, KOMMT AN DIE KOCHINSEL
NACHT 4 — DER APPELLPLATZ IN UNS — VON SOLIDARISCHEN IDEALEN UND TRAUMSCHIFFLOSEN WIRKLICHKEITEN
NACHT 5 — GUMMITWIST ODER DER KÖRPER ALS SCHLACHTFELD
NACHT 6 — DIE SCHWERKRAFT DER VERHÄLTNISSE ODER WAS PASSIERT HIER GERADE?
NACHT 7 — GEISTER DER ZUKUNFT ODER EIN »vom utopismus entferntes denken«
Bildnachweise
NACHT 1
VORWORT ODER DAS KLISCHEE DER OSTFRAUEN, DAS WIR SELBER SIND
Wir sollen uns die Nächte um die Ohren schlagen und über den idealen Staat nachdenken. So weit der Auftrag und das Klischee. Die Ostfrau, die mit Wodka und Zigarette in der Hand nächtelang in der Küche über Ideal(e) und Wirklichkeit(en) fabuliert, während sich der Abwasch türmt, die Waschmaschine rumpelt und die Kinder Alpträume haben. Aber trinken wir wirklich Wodka? Oder den Eierlikör aus dem von unseren Müttern aus dem Chemielabor geklauten Primasprit? Rotkäppchensekt? Haben wir bei Lidl Champagner gekauft, weil er gerade billiger ist als Butter? Heutige Aufgabe: Die unattraktive Minderheit mit Hilfe der Ostfrau eine Nacht lang schönsaufen.
Drei Frauen lehnen an der Brüstung eines Balkons in der achten Etage eines Berliner Plattenbaus, mit Blick auf den Luisenstädtischen Kanal. Sie sind nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. An ihrem Habitus werden sie früher oder später als Ostdeutsche erkennbar sein. Oder sich selbst zu erkennen geben. Der Kanal war vor 1989 ein Sandhügel im Grenzstreifen, darauf ein Wachturm. Hier zu wohnen galt als Privileg, der Erstbezug, wie die ersten Mieter*innen einer Plattenbauwohnung genannt wurden, durfte beim Feierabendbier über die Mauer hinweg in den Westen schauen. Vierunddreißig Jahre später schauen wir einfach nur nach Kreuzberg rüber. Wir gehören zu jenen, die noch wissen, wo die Mauer verlief*1 und dass die, die einst in diesem Plattenbau wohnten, nicht zu den Normalsterblichen gehörten. Die Normalsterblichen, das waren und sind die weniger Privilegierten. Die kamen erst in den Neunzigern hierher, plötzlich galt das Viertel als Gegend für Loser, angesagt waren die Gründerzeithäuser gegenüber in Kreuzberg oder im Prenzlauer Berg. Wenke ist vor zehn Jahren hierhergezogen, gerade noch rechtzeitig. Denn inzwischen hat die Platte wieder Wartelisten, für all jene, die keine bezahlbare Wohnung im Zentrum finden können.
Wenke trinkt manchmal ein Bier nach Feierabend, wobei wir uns nicht sicher sind, ob es sowas wie Feierabend überhaupt noch gibt. Oder jemals gab. Nach Arbeitsschluss trugen unsere Mütter den Einkauf in Netzen nach Hause, versorgten die Kinder und legten sie schlafen, schleuderten die Wäsche, die Väter machten den Abwasch oder brachten den Müll raus. Dann vor dem Schlafengehen noch ein letztes Bier. Auf dem Balkon. Oder auf dem Sofa im Wohnzimmer.
PEGGY Unser Wohnzimmer mit Schrankwand und Couchgarnitur befand sich im Erdgeschoss eines Hauses, das mitten auf dem Betriebsgelände des VEB Energiekombinats Dresden stand. 2012 wurde es abgerissen. Die Wohnung hatte 60 Quadratmeter. Ringsherum: Kabeltrommeln, Werkhallen, Schornsteine, eine Krananlage. Vor dem Haus: ein Streifen Garten mit Flieder, Birke, Sandkasten und Schaukel.
ANNETT In meiner Familie trank meine Mutter das Bier. Die gesamten 60 Jahre ihrer Ehe hat der Kellner, die Serviererin und später die Servicekraft das Bier ungefragt meinem Vater hingestellt und das alkoholfreie Erfrischungsgetränk meiner Mutter.
WENKE Wir waren Erstbezug. Zweieinhalb Zimmer auf 55 Quadratmetern, im fünften Stock mit direktem Blick auf die Warnowwerft in Warnemünde. Fernheizung und Balkon, Badewanne, Herd, Spüle und ein Küchenschrank gehörten zur Standardausstattung. Genauso wie die drei verschiedenen Tapeten mit unterschiedlich großen Blumenmustern in variierenden Farbkombinationen aus Beige, Gelb, Orange und Braun, die über die Jahre durch Raufaser ersetzt wurden. Ich hatte ein eigenes Zimmer.
ANNETT Ich hatte kein eigenes Zimmer. Wenn ich heute meinen Vater in der Hochhauswohnung mit Blick auf die Elbe besuche, dann frage ich mich, wie wir zu viert in die winzige Wohnung gepasst haben. Man kam ja schon im Flur nicht aneinander vorbei. Der Zaubertrick war: Wir haben uns in der Wohnung, bis auf das Wochenende, fast nur zum Schlafen aufgehalten. Noch dazu waren wir eine Familie von Nachteulen. Meine Eltern sind gerne abends weggegangen. Und wir Kinder waren immer mit irgendwas außerhalb beschäftigt. Wenn ich heute nachts auf der anderen Elbseite stehe und das Hochhaus sehe, ist hinter genau drei Fenstern Licht, in der Wohnung meiner Eltern. Alle anderen im Haus schlafen längst.
Meine Eltern hatten kein Schlafzimmer, sondern einen mit Hellerau-Möbeln*2 bestückten Raum mit zwei übereck gestellten Schlafsofas. Eltern ohne Ehebett waren schlimmer als getrennte Eltern. Wenn mein Vater in den Sechzigerjahren mit dem Kinderwagen über die Elbinsel ging, wurde er gefragt, ob seine Frau verstorben sei.
PEGGY Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer und sogar ein Bad — das ist ein Traum. Für meine Mutter, die im Heim aufgewachsen ist.
ANNETT Für meine Mutter mit sechs Geschwistern in drei Räumen war erstmal alles wie ein Traum. Aber dann brannte ihr dauernd das Essen an, weil die Töpfe so klein waren. Sie war das Kochen für eine Großfamilie gewohnt. Meine Mutter kochte, mein Vater machte alles andere an Hausarbeit.
PEGGY Meine Eltern können nicht kochen und vertrauten auf die Schulspeisung. Ich vertraue heute ebenfalls wieder auf die Schulspeisung, auch wenn ich weiß, dass sie schlecht ist.
WENKE Meine Tochter hat das Schulessen irgendwann stillschweigend durch YumYum-Instantnudeln ersetzt. Und was ist mit den anderen Arbeiten?
PEGGY Einkäufe, Abwasch, Putzen, Wäsche erledigt zu 80 Prozent mein Mann. Wie das klingt: mein Mann. Aber was klingt besser? Friend, lover and father of our daughter, mit dem ich verheiratet bin?
ANNETT Peggy, wieso Englisch?
PEGGY Na wegen des Klangs. Egal. Der Gefährte würde sagen: Es sind 90 Prozent. Das war eigentlich mit allen meinen Mitbewohnern so. Wenn ich mit Frauen den Alltag teile, gebe ich mir mehr Mühe. Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Das ist eigentlich keine Gleichbehandlung, und meine Scham ist auch nicht feministisch.
ANNETT Zu Hausarbeiten habe ich ein lumpenproletarisches Verhältnis.
WENKE Manchmal entspannt mich Hausarbeit, aber meistens nicht.
An den Wänden von Wenkes Wohnung sind keine Tapeten, der raue Beton ist glatt gewachst. Viele Regale mit Büchern. Fotobände. Ein schmales Sofa. Ein Sideboard. Ein runder Holztisch. Wenke hat gekocht (Ofengemüse und Salat) und es perlt in unseren Gläsern. Peggy wollte im Lidl Champagner kaufen, dann gab es aber nur Crémant. Die erste Flasche ist schon fast leer. Im Plattenbau gegenüber leuchten die Fenster in verschiedenen Farben. Gelb, rot, lila. Violette Neonleuchten waren einst der Hit. In Dresden, Magdeburg oder Rostock. Angeblich wachsen Kakteen unter lila Licht besser, wir haben das nie nachgeprüft. Und unsere Mütter haben übrigens nie geraucht (höchstens mal eine Zigarette unter Freundinnen), wir dafür um so mehr. Annett und Peggy haben inzwischen wieder aufgehört.
PEGGY Warum haben wir überhaupt damit angefangen?
ANNETT Vielleicht war es Trotz. Es war mein erstes Silvester in Berlin, 1983. Ich war an dem Abend in der Wohnung der Geliebten*3 von Ekkehard Schall, die bis nach Mitternacht auf ihn warten musste, weil er erst mal Silvester mit seiner Frau gefeiert hat. An dem Abend nahmen sich fast alle Gäste vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Da habe ich gedacht: Och nö, dann fang ich mal an. Ich war die Einzige, die ihren Vorsatz eingelöst hat. In Berlin war es wenigstens kein Problem, Zigaretten zu bekommen. In Schönebeck*4, wo ich vorher wohnte, bist du meistens vergeblich durch die ganze Stadt gefahren, um welche zu kriegen, die nicht ungenießbar waren. Das hatte mich immer ein bisschen abgeschreckt, in Berlin fiel das weg. Wenn ich kein Geld hatte, habe ich Karo geraucht. Wenn ich ein bisschen Geld hatte, alte Juwel, und wenn ich richtig fett Geld hatte, habe ich Club gekauft. Am liebsten waren mir Cabinet. Was ich auch sehr gern geraucht habe, waren Mentholzigaretten. Die gab es aber nur in Ungarn.
WENKE Ich weiß noch genau, wie Cabinet geschmeckt haben, das war die erste Packung, die ich mir gekauft habe — zu Abi-Zeiten, 1995. Da habe ich mir noch gesagt: Nee, du kannst jetzt nicht jeden Nachmittag ’ne Zigarette rauchen, da wirst du ja abhängig. An der Uni in Rostock haben sich dann immer alle zum Rauchen im Treppenhaus getroffen. Die Philosophische Fakultät war auch in so einem Plattenbau-Hochhaus untergebracht, neben dem ehemaligen Stasi-Gefängnis. Später, kurz vor meinem Abschluss am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni in Berlin, haben dann Studierende das Rauchverbot eingeführt. Wohlgemerkt: Studierende! Die haben Primeltöpfe in die Aschenbecher im Foyer gestellt. Was eine der wenigen Ost-Professorinnen, die dort gelehrt hat, nicht daran hinderte, in ihrem Büro weiter Kette zu rauchen.
PEGGY Ich habe 1993 angefangen, da war ich siebzehn und dachte, ich kann mit Zigaretten dem Kleinbürgertum entfliehen.
WENKE/ANNETT Mit roten Gauloises?
PEGGY Genau. Oder jemand hat Parisienne mitgebracht. Ich dachte natürlich auch, ich kann mit Zigaretten dem Osten entfliehen. Und der Provinz.
ANNETT Ich mochte diese Fotostrecke von Ensslin, Proll und Baader in Paris, wie sie vollkommen cool mit ihren Zigaretten im Café sitzen. Als ich in Paris lebte, habe ich dann auch Gitanes geraucht. Ohne Filter.
PEGGY Die habe ich auch probiert, aber es ging nicht. Es ging einfach nicht.
ANNETT Das Schöne war, dass man dann weniger geraucht hat, weil man nach einer schon halb tot war.
PEGGY Als ich schwanger wurde, habe ich aufgehört. Und nach der Geburt doch irgendwann wieder angefangen. Meine Tochter hat es gehasst. Eine Zeitlang habe ich heimlich geraucht. Ich fand das Lügen furchtbar. Das war keine Freiheit mehr.
ANNETT Was für mich unter die Kategorie Rabenmutter fällt und was ich zutiefst bedaure, war, dass wir im Auto geraucht haben, während die Kinder auf der Rückbank saßen. Unter freiem Himmel habe ich damit bis heute kein Problem. Auf den Spielplätzen im Prenzlauer Berg gab es damals ziemlich hartgesottene Eltern, die haben immer auf der Lehne der Bänke gesessen und Bier getrunken und geraucht, die billigsten Sorten. Und wir haben geschlaucht bei ihnen, während die Kinder miteinander spielten. Heute sitze ich mit den Enkelkindern wieder auf diesen Spielplätzen. Die Bänke gibt es immer noch, die Kinder spielen an der gleichen Stelle, aber inzwischen sind es Superpremiumkinder. Ich glaube, wenn ich mir da eine Golden American anzünden würde, ich wäre nicht halb tot, ich wäre einfach mal ganz tot.
PEGGY Schon wenn du draußen am Zaun …
WENKE … drehen die Leute durch. Hallo, wir sind draußen! An der Luft! Was soll denn das?!
Es ist heute keine gute Idee mehr, auch nur in der Nähe eines Spielplatzes im Prenzlauer Berg zu rauchen. Oder heimlich abends am Fenster oder auf dem Balkon, wenn die Kinder schlafen. Unsere Kinder stehen auf Seiten unserer Mütter, entschiedener und konfliktbereiter als sie. Und wer schreibt und raucht, raucht in der Regel immer zu viel. Also haben zwei von uns vor Jahren aufgehört, auch wenn drei von uns denken, dass der Abrieb der ganzen SUVs in der Stadt oder eine Wohnlage an der von morgens bis abends mit Autos vollgestopften Frankfurter oder Prenzlauer Allee unsere Lungen mehr belastet als das, was Wenke im Monat für 50 Euro an gedrehtem Tabak raucht.
ANNETT Wenn die atombombenbestückte Kurzstreckenwaffe in Kaliningrad Richtung Berlin startet, zünde ich mir spätestens wieder eine an.
Und das sind jetzt wirklich genug Worte zum Thema Freiheit, Trotz, Gewissen und Tod. Aber weil es an diese Stelle passt und auch zum Klischee gehört, hier noch schnell eine
Liste an alkoholischen Getränkesorten, die wir ausprobiert haben (beginnend mit dem ersten Glas in der Kindheit):
Weinbrand(bohnen) von Peggys Großeltern, selbstgemachter Eierlikör zu Ostern im Glas (Annett) oder gekaufter im Schokobecher (Peggy & Wenke), Rotkäppchensekt zu Silvester (Wenke). Mon Chéries kamen, wenn überhaupt mit dem Westpaket und wurden nach einmaligem Naschen konsequent weiterverschenkt.*5
Und dann?
WENKE In den Neunzigerjahren Saurer Apfel, billiger Rotwein und Cola-Rum für 1,50DM in der Mensa, die abends zum Studentenclub wurde. Bier kam später, nach dem trockenen Weiß- und Rotwein, als es kurzzeitig so etwas wie Feierabend gab. Heute Rosé und Gin Tonic.
PEGGY Ich weiß es nicht so genau. Was habe ich in den Neunzigern getrunken? Wein wahrscheinlich. Rotwein? Baileys? Whiskey? Ich wollte die Protagonistin in einem französischen Schwarz-Weiß-Film sein, wir wollten Boheme sein. Und heute? Immer noch Wein. Aber inzwischen lieber Wodka als Whiskey.
ANNETT In den Achtzigern Bier, Wodka-Cola, Gin Tonic. (Der Gin Tonic im Palast der Republik war mit Abstand der beste.) Weinbrand zum Kaffee (Boheme), am liebsten natürlich französischen, aber es reichte nur für Goldi, Goldbrand, und nie vor Einbruch der Dunkelheit, ich habe da eine Uhr in mir drin. Dann zwei Jahre gar kein Alkohol, weil meine Leber die Pille nicht vertrug, dann kam die Schwangerschaft, ebenfalls weil meine Leber die Pille nicht vertrug, in der Stillzeit kein Alkohol.
Dann im neuen Leben im Winter Rotwein, im Sommer Weißwein oder Rosé, die Karriere als Restaurantkritikerin scheiterte an der mangelnden Kenntnis beim Wein. Harte Getränke verstauben in der Speisekammer. Nur beim Aperol werde ich wegen der Farbe im Sommer manchmal schwach. Curaçao hätte ich fast vergessen. Grüne Wiese, eine Mode der späten Achtziger, da hätte eigentlich schon klar sein müssen, dass nach drei Gläsern die DDR untergeht.
PEGGY Gespritztes mag ich auch: Holunderspritz, Aperolspritz, the Spritz of my beautiful houseman: Weißwein, Ginger Ale, viel Eis, viel Orange.
ANNETT If beautiful houseman, then white wine or Manhattan.
PEGGY Ich muss mal auf die Toilette, wo ist denn die?
WENKE Hier gleich. Die nächste Tür. Ja, nee, nee, direkt links. Es ist ja ein Plattenbau, da gibt’s nicht so viele Möglichkeiten.
ANNETT Aber der Blick ist wirklich ganz toll.
Peggy kommt zurück.
PEGGY Jetzt aber mal zügig weiter mit den vielen anderen Klischees, sonst ist die halbe Nacht rum und wir haben gerade mal angefangen.
WENKE Ostfrauen sind unprätentiös. Als Sibylle Bergemann bei einem Dokumentarfilmdreh mehrfach aufgefordert wird, doch mal etwas netter in die Kamera zu schauen, sagt sie: »Ich bin nicht nett!«
ANNETT Ich bin an-nett wie an-organisch, wird auch oft missverstanden.
PEGGY Ich fürchte, ich bin überwiegend nett. Ich lächle ganz viel weg.
WENKE Ich meine diese unprätentiöse Art, mit dem öffentlichen Blick umzugehen. Wie die Frauen in Helke Misselwitz’ Dokumentarfilm Winter adé von 1988, und da nicht nur die Frauen in der Fischverarbeitung, sondern auch die Werbefrau aus Berlin. Oder die Turnerinnen, die auf dem Foto von Barbara Klemm über der Rostocker Altstadt fast utopisch in den Seilen hängen. Ich liebe dieses Foto!
PEGGY Ja, das Foto ist toll. Diese aus heutiger Sicht anscheinend nicht normierten Körper in diesen aus Performancekünstler*innen-Perspektive schon wieder interessanten Body-Trikots, kombiniert mit weißen Schläppchen. Der Wind und die Anstrengung im Gesicht, derweil sie hoch über der heruntergekommenen Stadt schweben. Diese schönen Tilla Eulenspiegels. Ich muss gestehen, ich habe FÜR UNS eine alte FÜR DICH von 1983 auf eBay gekauft, weil ich immer wieder merke, ich stehe auf die werktätige Frau. Auf dem Titelblatt hier und auch sonst.
ANNETT Die Für Dich ist aber schon DDR-Zeitschriften-Frauen-Propaganda.
PEGGY Ich weiß, ich falle hier voll auf die Propaganda rein. Die kriegt mich irgendwie. Das ist, wie auf die Werbe-Romantik des Kapitalismus reinzufallen.
WENKE Du stehst nicht auf die berufstätige, sondern auf die werktätige Frau?
PEGGY Ja. Es ist die werktätige Frau. Die nach Schweiß riecht. Nach Betriebsgelände. Die an Maschinen arbeitet. Die taff ist. Selbstbewusst. Die sich mit Kabeln und Technik auskennt. Die Frau hier auf dem Titelbild ist ja keine Sekretärin, das ist eine Gabelstaplerfahrerin! In diesem Fall aus dem Werkzeugmaschinenkombinat Roter oder Siebter Oktober — irgendsowas. Meint ihr, die Frau hier ist eigentlich Model und hat nie in diesem Betrieb gearbeitet, und es ist pure …
ANNETT Propaganda! Genau!
WENKE Die haben aber schon auch die Frauen aus den Betrieben fotografiert.
ANNETT Aber es wurde nicht jede genommen. Wenn du aufmüpfig warst und deinen DSF-Beitrag*6 nicht bezahlt hast, kamst du nicht aufs Titelblatt. Du musstest attraktiv sein, aber nicht zu schön. Sauber. Aufgeräumt. Wie der Betrieb im Hintergrund.
WENKE Meine Mutter hätten sie nicht fotografiert, die war nicht in der DSF.
PEGGY Meine Mutter auch nicht. Obwohl die sogar in Kittelschürze gut aussah, damals in den Siebzigerjahren!
Peggy liest in der Für Dich herum.
PEGGY Oh Gott, das ist gleich wieder abschreckend. Der Text hier drin ist wie ’ne eiskalte Dusche. Ich lasse mich vielleicht blenden von dieser attraktiven Gabelstaplerfahrerin auf dem Titelbild, aber wenn ich die Allgemeinplätze über sie lese, ist es auch schon wieder vorbei. Einen Alltag ohne ihre Arbeit kann sie sich nicht vorstellen, aha. 22 Jahre, verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Viel zu früh geheiratet, sag ich da nur. Sie ist in einer Jugendbrigade namens Philipp Müller. Kenne ich nicht. Philipp Müller — war das eine berühmte sozialistische Figur?
ANNETT Der war, glaube ich, in der verbotenen West-KPD und ist erschossen worden auf einer Demo. Etliche Schulen und Straßen in der DDR waren nach ihm benannt.
PEGGY Okay, alles klar. Ich lese mal weiter: Der Kontakt zu ihren Kollegen und Kolleginnen — nanu, hier wird gegendert — ist für unsere Gabelstaplerfahrerin sehr wichtig. Und über den Krippenplatz für ihre Tochter ist sie auch froh. Im Overall fühlt sie sich wohl. Das verstehe ich gut. Hier haben wir zum Beispiel einen Popeline-Overall mit sportlichen Details. Er lässt sich mit darunter getragenen Pullis und Hemdblusen abwechslungsreich ergänzen. Und hier steht übrigens auch, dass sie Facharbeiterin für Umschlagprozesse und Lagerwirtschaft ist. Keine Ahnung, was das heißt.
WENKE Das ist so umständlich wie Facility Manager heute.
PEGGY Weiß ich auch nicht, was das heißen soll. Neben der Arbeit hat sie noch eine Funktion als Vertrauensmann. Da haben wir ja schon die DSF oder den FDGB. Und jetzt ist auch Schluss mit gendern! Beim Vertrauen und den Funktionären hört es auf. Natürlich besucht sie auch einen Meisterlehrgang, um den Ansprüchen ihrer Arbeit und der übertragenen Verantwortung noch besser gerecht zu werden. Es ist kein bequemer Weg. Achtung: Jetzt kommen bestimmt die Kinder. Ah, ja: »Ihr Tag, ausgefüllt durch Beruf, Kindererziehung und Haushalt, lässt trotzdem noch Platz für eigene Interessen.« Was hat sie denn für Interessen?
WENKE Kochen?
ANNETT Nein. Lesen!
PEGGY Lesen finde ich gut! Und ich muss sagen: In den Siebzigern und frühen Achtzigern gab es ein paar wirklich schöne (Kurz)Haarschnitte. Wäre die Mauer 1979 gefallen, hätten die Ostler*innen so viel besser in den Geschichtsbüchern ausgesehen.
WENKE Der Haarschnitt ist gut, aber die Fotos hier sind nicht besonders.
ANNETT Das liegt auch an dem schlechten Papier, da säuft jeder Kontrast ab.
WENKE Aber auch dieser Hintergrund — das ist doch kein Bild, was soll denn dieses Kreuz da direkt über ihrem Kopf an der Tür?
ANNETT Das Kreidekreuz hieß, der Schornsteinfeger kommt ins Haus.
PEGGY Der Schornsteinfeger ist die Segnung an den Türen im Osten. Gut, ich leg die Für Dich wieder weg — können wir abschließend festhalten, dass ich die Einzige bin, die empfänglich für die werktätige Frau auf Titelblättern ist?
WENKE Nein, bist du nicht.
PEGGY Danke, Wenke.
ANNETT Ich habe ambivalente Gefühle dabei. Als ich meine Diplomarbeit über die Dichterin Inge Müller geschrieben habe, musste ich mich mit diesen Zeitschriften beschäftigen. Inge Müller hat für Die Frau von heute geschrieben, das war die Vorgängerin der Für Dich. Und wenn du das verglichen hast, war Die Frau von heute wesentlich spannender, was die Konflikte anging. Die war viel, viel härter. Da wurden auch Sachen diskutiert wie: Darf ich Kinder schlagen? — oder Ähnliches. Darüber wurde sonst nicht geredet. Die Für Dich blieb dagegen immer an der Oberfläche, auch wenn es mal den einen oder anderen guten Artikel gegeben hat. Aber insgesamt kam das schon ziemlich propagandistisch rüber. Ich stand mehr auf das Frauenbild der Zeitschrift Sibylle*7.
WENKE Ich habe ein Foto gefunden, das mein Vater gemacht hat, auf dem lehnen zwei Werftarbeiterinnen mit Eimern und Helmen an einem Auto. Das ist schön. Aber vielleicht ist es auch deshalb schön, weil man das inzwischen so selten sieht, in dieser Form, in so einer Selbstverständlichkeit.
PEGGY Überhaupt die vielen Arbeiter*innen-Figuren in den Büchern, Filmen und Gemäldegalerien damals.
ANNETT Die Ausgezeichnete von Wolfgang Mattheuer. Ich habe über dieses Bild ein ganzes Romankapitel geschrieben. Diese müde Frau, die sich schön gemacht hat für den Anlass, und dann liegen drei kümmerliche Tulpen vor ihr. Daran musste ich immer wieder denken, als zu Beginn der Coronapandemie die Leute im Prenzlauer Berg auf ihren Balkonen standen und klatschten, und zwar für die Pflegekräfte, die früher mal mit ihren Familien in genau diesen Vorderhauswohnungen gewohnt hatten und nach erfolgreicher Privatisierung irgendwo anders Quartier finden mussten. Die konnten das Klatschen gar nicht hören, die Klatschenden beklatschten sich selbst.
PEGGY Werner Bräunig! Der klatscht nicht, sondern kriecht in den Berg.
ANNETT Ja, ein großartiger Schriftsteller, der sich wegen anhaltender Erfolglosigkeit totgesoffen hat. Den hat die SED auf dem Gewissen. Es gab ja ab Ende der Fünfzigerjahre den Bitterfelder Weg, eine Bewegung, die die Künstler*innen und Schriftsteller*innen aufforderte, in die Betriebe zu gehen. Es ist an sich nicht schlecht, eine andere Wirklichkeit zu entdecken, die die meisten vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm haben. Aber es war eben eine Bewegung von oben. Und das Lustige, man kann auch sagen: das Dialektische an dieser Geschichte ist ja, dass genau die Schriftsteller*innen, die die idealen schreibenden Arbeiter*innen gewesen wären, konsequent ausgestoßen wurden. Wie Wolfgang Hilbig. Oder Thomas Brasch und Helga M. Novak, die, weil sie schrieben, was sie schrieben, und aufmüpfig waren in der Öffentlichkeit, in die Produktion strafversetzt wurden und dort wirklich hinter die Kulissen guckten. Das wurde nicht veröffentlicht oder erst sehr viel später.
Die Dialektik mit all ihren Widersprüchen im Schönen, Guten und Idealen bekommt eine eigene Nacht. Auch die Utopie und die Schwerkraft der Verhältnisse müssen noch warten.
PEGGY Machen wir weiter mit der Liste der Klischees über die Ostfrau?
ANNETT Positive oder negative?
WENKE Geht es dabei eigentlich um den Blick von außen oder aus dem Inneren der Frauenkollektive?
PEGGY Erstmal von außen. Mit Tempo, ohne langes Nachdenken. Los geht’s: Ostfrauen lassen ihre Kinder abends oder bei Krankheit allein.
WENKE Ostfrauen lassen ihre Kinder schreien.
PEGGY Auf dem Balkon.
WENKE Auf dem Balkon, wegen der frischen Luft. Ostfrauen lassen ihre Kinder vor der Kaufhalle stehen.
ANNETT Ostfrauen haben kein Verhältnis zum Leben, weil sie dauernd abtreiben.
PEGGY Ostfrauen heiraten früh, bekommen früh Kinder, lassen sich aber bald wieder scheiden.
ANNETT Ostfrauen sind Muttis.
WENKE Und junge Omis.
ANNETT Ostfrauen arbeiten gern. Im Sozialismus wie im Kapitalismus.
WENKE Auf dem Bagger …
PEGGY … auf dem Mähdrescher
ANNETT … und auf der Krananlage. Ostfrauen haben überhaupt eine zu hohe Erwerbsneigung.
PEGGY Ostfrauen riechen nach Action-Haarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare.
WENKE Ostfrauen haben keine rasierten Beine.
ANNETT Ostfrauen sind alle BMSR-Techniker*8.
WENKE Oder MTA*9. Wie meine Mutter.
PEGGY Das ist jetzt aber eher intern.
WENKE Der externe Blick wurde längst vom Kollektiv internalisiert — und umgekehrt.
PEGGY Ostfrauen sind rockfeindlich.
ANNETT Aber nicht rockmusikfeindlich. Ostfrauen tragen Kittel aus Dederon*10. Sogar beim Theaterbesuch.
WENKE Ostfrauen haben nicht so hohe Erwartungen.
ANNETT An ihre Männer. Ostfrauen haben immer einen Beutel in ihrer Handtasche.
WENKE Und ein Buch von Christa Wolf.
PEGGY Ostfrauen haben ein sehr natürliches Verhältnis zu ihrem …
ANNETT … Körper.
WENKE Und zu ihrer Sexualität. Ostfrauen ziehen sich gerne aus.
ANNETT Mit Ostfrauen kann man Pferde stehlen.
PEGGY Wo gab es denn bitte schön Pferde in der DDR?
ANNETT Wurden alle von Frauen gestohlen und zu Buletten verarbeitet. Der Partyhit!
PEGGY Erzähl das nicht meiner Tochter! Ostfrauen verlieben sich aus freien Stücken oder geplant in Berufsoffiziersbewerber.
ANNETT Nee, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Nicht per se.
WENKE Meine Mutter hat einen geheiratet. Hat aber noch rechtzeitig gemerkt, dass es Quatsch ist, und sich wieder scheiden lassen.
PEGGY Und ich habe Liebesbriefe gefunden. Mit zehn, elf Jahren, in der Schublade meiner Mutter. Da war auch ein Bild dabei von einem jungen Mann in Uniform. Die müssen sich irgendwo an der Ostsee begegnet sein und meine Mutter war verliebt.
ANNETT Vielleicht hat der nur seinen normalen Wehrdienst absolviert. Da müsstest du gucken, ob er auf dem Foto irgendwelche Pickel auf den Epauletten*11 hat.
PEGGY Zum Glück war meine Mutter keine Lehramtsstudentin, sondern nur Krippenerzieherin. Sonst hätte sie vielleicht den Mann in Uniform geheiratet und nicht meinen Vater.
ANNETT Diese Anspielung versteht jetzt keine*r außer uns.
PEGGY Diese Anspielung erklären wir später. Unter dem Stichwort: Körperpolitik!
WENKE Weiter in der Liste: Ostfrauen können die Wocheneinkäufe am Lenker ihres Fahrrads transportieren.
ANNETT Und zwei Kinder noch dazu.
PEGGY Ostfrauen tragen ihr Herz auf der Zunge.
WENKE Ich trage mein Herz im Gesicht. Man sieht immer sofort, was ich denke.
ANNETT Ostfrauen heizen um 5 Uhr morgens die Öfen an und die Kinder müssen sie dann zumachen. (Und vergessen es oft.)
WENKE Ostfrauen stellen den Milchreis zum Quellen ins Bett, bevor sie zur Spätschicht gehen.
ANNETT Und die Kartoffeln, damit die warm bleiben. Ostfrauen sind Freundinnen der Vorratswirtschaft.
PEGGY Ostfrauen haben ein pragmatisches Verhältnis zur Hausarbeit.
WENKE Ostfrauen fahren nur Auto, wenn ihre Männer zu viel getrunken haben.
PEGGY Oder nicht da sind.
ANNETT Außer meine Mutter. Habe ich mal erzählt, dass meine Mutter sich heimlich ein Auto zusammengespart hat?
PEGGY Ja, hast du, kannst du aber gern nochmal für Wenke erzählen.
ANNETT Meine Mutter hat als Zweitjob in einem Eiscafé gearbeitet und alles Trinkgeld gespart. In dem Eiscafé saßen immer die Filous der Stadt rum, die haben irgendwelche Geschäfte gemacht und zum Kaffee den teuren Weinbrand bestellt. Einer von denen hat meiner Mutter ein Auto besorgt, und sie hat dann heimlich die Fahrerlaubnis gemacht. Sie musste den Fahrlehrer immer zu seiner Geliebten fahren und hatte dann Zeit zum Einkaufen. Und wenn er von seiner Geliebten zurückkam, ging die Fahrstunde weiter. Das hat sie meinem Vater alles nicht erzählt.
WENKE Krass. Das heißt, sie hat ein Auto gehabt, von dem dein Vater nichts wusste, und konnte es fahren, was dein Vater auch nicht wusste?
ANNETT Das Schöne war ja, dass meine Mutter sowas nicht für sich behalten konnte. Sie hatte das Auto und war schon damit rumgefahren. Dann hat sie es vor dem Hochhaus abgestellt und mein Vater musste auf den Balkon kommen. Meine Mutter hat von oben auf einen der Trabis gezeigt und gesagt:
PEGGY Das da ist meins!
ANNETT Genau. Das ist mein Auto. Und mein Vater hat gesagt:
PEGGY Da fahre ich nie mit. Niemals.
ANNETT Am nächsten Tag ist sie mit dem Auto zu seinem Institut gefahren und hat dort gewartet, um ihn abzuholen. Zuerst ist mein Vater die ganze Zeit neben dem Auto hergelaufen. Gut, irgendwann ist er eingestiegen.
WENKE Ostfrauen sind hart im Nehmen.
ANNETT Und selten perfektionistisch.
PEGGY Ostfrauen beißen die Zähne zusammen. Und schlucken ihre Wut oft runter.
WENKE Ostfrauen sind nicht befindlich.
PEGGY Aber genügsam. Ostfrauen reichen drei Joghurtsorten.
ANNETT Ja, aber heimlich wünschen sie sich doch fünf.
WENKE Ostfrauen können mit Veränderungen umgehen. Wenn sie müssen.
PEGGY Ostfrauen können weggehen. Wenn sie müssen.
WENKE Ostfrauen versorgen ihre Familie auch im Neoliberalismus, selbst wenn sie dafür nach Österreich gehen müssen.
ANNETT Und zwar nicht zum Wandern.
WENKE Oder nach Dänemark.
ANNETT Ostfrauen machen aus Scheiße Trillerpfeifen.
PEGGY Ostfrauen verlassen ihren Mann, wenn er zu viel Scheiße baut.
ANNETT Na ja, nicht alle.
WENKE Manchmal dauert es lange. Wie bei meiner Mutter.
ANNETT Ostfrauen brauchen ein Kollektiv, das ihnen sagt, dass sie sich von ihrem Mann trennen sollen.
PEGGY Und was machen die lesbischen und bisexuellen und trans- und intersexuellen Ostfrauen? Werden die auch vom Kollektiv getröstet und beraten?
ANNETT Die kommen in der Ostfrau an sich nicht vor. Die Ostfrau an sich bezieht sich nur auf den Mann. Hier zum Beispiel:
Bert Papenfuß die ostfrau an sich
ist sympathisch, weil so normal
macht keine coolen, abgeklärten sprüche
über intime bereiche, ist fast immer gut gelaunt
hat ein herz für die gastronomie
bleibt nicht bei geplänkelter unverbindlichkeit
sondern verbreitet eine atmosphäre sinnlicher geborgenheit
ist in höherem grade berufstätig
fährt gerne rad, ißt thai, wiegt weniger
hat eine bessere figur & lustigere augen sowieso
kann sich gehen lassen, am liebsten
mit vollgas, hat fundiertes wissen & wenig bauch
ist blond oder braun, gutaussehend & unternehmungslustig
heißt silke & nicht wiebke oder gar kirsten
ist weich & resolut, hält die fäden in der hand
ist überhaupt nicht zickig; ihr genügt eine plastiktüte
ostfrauen sind geistesgegenwärtig & praktisch
veranlagt, ohne dabei ins pragmatische abzufallen
sind fidele häuser, mit denen man pferde stehlen kann
von einem, ders wissen muß*12
PEGGY Autsch.
WENKE Von wann ist das Gedicht?
ANNETT Von 1995. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, entscheide mich aber doch fürs Lachen. Es ist ja weniger ein Gedicht über Ostfrauen, eher über »einen, ders wissen muß« und dabei einen auf sich beschränkten Blick hat, in dem sich seine Bedürfnisse spiegeln. Hauptsache, sie macht sich nicht über seine primären Geschlechtsorgane lustig. Bevor Paris seinen Apfel verteilt hat, sind die Frauen lachend weg. Was mich wirklich wundert, ist, dass Papenfuß Plastiktüte sagt und nicht Plastetüte. Schon deshalb kann ich das Gedicht nicht ernst nehmen.
Zu dem Gedicht stellen sich natürlich noch viele weitere Fragen, bevor wir entscheiden, was wir ernst nehmen oder nicht: Ist die Ostfrau in den Neunzigerjahren etwa als eine Art Vorreiterin sehr viel Rad gefahren und hat Thai gegessen? (Wir können uns nur an chinesische Gerichte erinnern.) Warum werden wir bei manchen Ostler*innen trotz Herz auf der Zunge (oder im Gesicht) einfach nicht schlau, wie sie Äußerungen eigentlich meinen? Liegt das an der lyrischen Form der Aussage oder an der Verunsicherung des lyrischen Ichs? Versuchen wir immer noch, zwischen den Zeilen zu lesen? Was ist im Gedicht mit fundiertem Wissen gemeint? Und mit »in höherem grade berufstätig«? Ist es erstrebenswert, nach einem Kneipenbesuch spontanen Sex zu haben, der sich weniger nach Aufregung als nach Zuhause anfühlt? Ist der Sex dann mit oder ohne Frühstück*13? Leuchtet im Bild des Pferdestehlens vielleicht doch auch eine gewisse kriminelle Energie der Neunzigerjahre auf? Geht es darum, was Verbotenes zu tun? Keine Angst und keine Macht zu haben? Haben ostdeutsche Männer noch weniger Sinn für Mode und Accessoires (Handtaschen!) als ostdeutsche Frauen? Oder verweist die Plastiktüte vielleicht auf einen westdeutschen männlichen Blick? Und wenn ostdeutsche Frauen »fidele Häuser« sind, ist die Verehrung des lyrischen Ichs dann eine Art Hausbesetzung?
PEGGY Plaste- oder Plastiktüte ist mir egal. Aber die Lobpreisung ist schlimmer als die Zuschreibung. Die Ostfrau als verkörperter Antifeminismus. Die Ostfrau als Normalität. Nicht zickig. Sinnlich. Immer gut gelaunt.
ANNETT Gewicht im unteren Normbereich.
PEGGY Ernsthaft?
ANNETT Über »normal« müssen wir uns überhaupt mal unterhalten. Was ist normal? Das ist ja etwas, was eben auch Ostfrauen und Ostmänner gerade ständig im Mund führen. Und ganz schlimm die AfD mit ihrem Slogan: »Deutschland. Aber normal.« Immer wenn es gegen alle anderen auf der Welt geht, soll alles wieder schön normal sein. Claudia Pechstein sagt: Unsere Frauen möchten wieder normal in den »öffentlich-rechtlichen« Verkehrsmitteln fahren, deshalb müssen wir abschieben, abschieben, abschieben. Wir möchten wieder normale Verhältnisse.
PEGGY Verhältnisse, die sich nicht verändern, nicht in Bewegung sind.
WENKE Bloß nicht auffallen in einer STANDARD-Normalverteilung.
PEGGY Okay. Dieses Normal ist furchtbar und wird gestrichen. Unser Ideal ist die Ostfrau, die sich nicht um Normen schert. Die ihr Ding macht und anderen keine Vorschriften. Die nicht gefallen will.
ANNETT Die sich ihren eigenen Lebensentwurf macht, das gab es ja auch im Osten schon. Aber wenn du irgendwie anders ausgesehen hast, nicht gearbeitet hast, wenn du mit deiner Lederjacke und Punkerfrisur daherkamst, haben diese selbsterklärten Normalen dich so schlecht behandelt, wie sie heute Leute aus Syrien schlecht behandeln.
PEGGY Und dann hast du noch diese Männer, die sich mit oder ohne Punkerfrisuren gegen die Norm in der DDR auflehnen und nächtelang über neue Verhältnisse diskutieren, nur bei den Frauen soll möglichst alles beim Alten bleiben, damit die Geborgenheit nicht flöten geht. Also einerseits Widerstand und Lust, das System zu unterlaufen, aber wenn es um Frauen geht, da ist es schön …
ANNETT … wenn sie nicht nerven, sondern 40 Stunden in der Woche das Geld verdienen, während der Künstler künstlert.
Diese Widersprüchlichkeit ist überall, das dürfen wir nicht vergessen, auch bei den Ostfrauen, damit müssen wir umgehen. Ostfrau heißt immer auch Hilde Benjamin und Margot Honecker. Ostfrau heißt neben Claudia Pechstein auch Franziska Giffey und Manja Schreiner, die uns im Berlin des 21. Jahrhunderts die autogerechte Eigentümer*innenstadt als Zukunft verkaufen wollen und wie Giffey jeden Eingriff in die Eigentumsverhältnisse der Daseinsvorsorge als Rückfall in DDR-Verhältnisse denunzieren (auch dazu kommen wir später!). Und zugleich kriegen sie es nicht hin, dass Kinder unmittelbar nach der Geburt eine Geburtsurkunde bekommen, weil die Verwaltung dysfunktional ist.
PEGGY Ich liebe Urkunden. Aber wie einigt man sich eigentlich auf gemeinsame Regeln und Prozesse und Veränderungen, wenn man niemandem Vorschriften machen will?
ANNETT Gute Frage für später.
WENKE Erstmal zurück zur Norm in uns. Ostdeutsche sind mit einer starken Normierung aufgewachsen. Und dann waren sie plötzlich nicht mehr die Norm. Sondern anders. Das darf man auch nicht vergessen.
ANNETT Neulich hatte ich eine Veranstaltung mit dem Psychotherapeuten Hannes Uhlemann, der meinte, wenn Leute aus dem Westen in seine Praxis kommen, fangen sie als Erstes an, ihre Mutter zu kritisieren. Und wenn es Leute aus dem Osten sind, sagen sie: Meine Kindheit war normal, ich war viel draußen.
PEGGY Ich werde ab jetzt sagen: Ich hatte eine interessante Kindheit, habe viel draußen und drinnen gespielt, und meine Mutter ist nicht schuld. Sollen wir die Ostfrau vielleicht einfach ganz streichen? Das klingt ja immer auch so nach essentiellem Kern oder unausweichlichen Prägungen und Deformationen, nach Gruppenzwang.
ANNETT Nein, ich finde nicht, dass sie gestrichen werden muss. Sie ist ja eh ein Konstrukt. Das Konstrukt muss nur ergänzt werden. Offen, fluide sein. Sich verändern dürfen. Das gibt es auch, glaube ich, bei Habermas, diese bewegliche Identität, die changiert, die nie gleich ist. Ich bin heute nicht mehr dieselbe Frau wie in den Achtzigerjahren. Es gibt Eigenschaften und Erfahrungen von damals, die ich für mein Leben als praktisch oder notwendig oder überlebenswichtig ansehe, die ich mitgenommen habe. Aber da sind auch tausend andere Sachen dazugekommen. Letztendlich bin ich auch eine Westfrau, etwa aus der Perspektive von Menschen, die aus Russland, Belarus oder Syrien kommen. Und nicht zuletzt: Ein bisschen Mann sind wir auch.
PEGGY Ich bin sehr viel Mann, ehrlich gesagt, ich habe so einen Bartwuchs. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
WENKE Aha.
ANNETT Es ist ja immer die Frage: Wo stehst du gerade? Aus welcher Perspektive schaust du dich an? Und wirst angeschaut? Ich bin eine weiße Frau. Eine Frau aus der Stadt. Für Frauen, die AfD wählen, sind wir akademische linke Zecken.
WENKE Auch wenn wir uns die unattraktive Minderheit*14 heute noch schönsaufen: Über die AfD müssen wir sprechen!
PEGGY Ich werf mich gleich in die Ecke und heule.
WENKE Trink lieber noch was.
ANNETT Für Diskussionen über AfD und Putin müssen wir nüchtern sein.
PEGGY Vielleicht muss ich langsam mal mein Gutgelauntsein streichen. Mein Weglächeln. Mein Verbindlichsein. Andererseits verbinde ich mich aber so gern mit Menschen, ich bin wirklich ausgesprochen gern verbindlich.
ANNETT »Unverbindlichkeit« heißt ja auch, dass eine Gesellschaft nicht funktioniert. Wie willst du dich dann auf etwas verlassen? Gerade in Situationen, wo es vielleicht gefährlich ist? Das Geplänkel der Unverbindlichkeit ist doch auch etwas, was uns, glaube ich, gestört hat, als wir im Westen angekommen sind: dass nichts, was du mit jemandem ausmachst, am Ende auch verbindlich ist, also dass der Vertrag oder ein Versprechen eingehalten wird.
WENKE Verbindlichkeit kann auch eine Last sein. Kann moralisch sein oder bürokratisch werden. Ich fände es cool, wenn der Rechtsstaat verbindlich wäre. Ich habe nicht den Eindruck, dass er es ist.
ANNETT Ich finde ja, dass die DDR ein Willkürstaat war. Du konntest dich auf nichts verlassen. Rückblickend wird immer so getan, als wären die Regeln ganz klar gewesen: Wenn du das gemacht hast, ist dir das passiert. Aber das stimmt einfach nicht. Du konntest für die gleichen Sachen hinter Gittern verschwinden oder dir ist nichts passiert. Manchmal musst du dich heute dafür rechtfertigen, dass dir nichts passiert ist, weil das Bild von dem Staat, in dem du aufgewachsen bist, heutzutage so schön klar und transparent ist. Das war es aber nicht. Es war ziemlich undurchsichtig.
WENKE Ich habe eben nebenbei ChatGPT zur Ostfrau befragt. Das Orakel schreibt: »Einige der bemerkenswertesten Frauen der DDR waren die Kosmonautin Sigmund Jähn, die Bildhauerin Käthe Kollwitz und die Schriftstellerin Christa Wolf. Diese Frauen haben gezeigt, dass Ostfrauen in der Lage sind, Großes zu erreichen, wenn sie die Möglichkeit dazu erhalten.«
ANNETT Seit wann wird der Name Sigmund weiblich gelesen?
PEGGY Und seit wann hat Käthe Kollwitz die Gründung der DDR miterlebt? Wer wird eigentlich den Quatsch, den die KI kostenlos für den Kapitalismus schreibt, in Zukunft korrigieren?
WENKE Schlecht bezahlte Autor*innen!
PEGGY Und wer füttert das System?
WENKE Das System wird doch gar nicht mehr von Menschen gefüttert, sondern alle verfügbaren Texte fließen automatisch ein. Je weniger im Netz über den Osten gesprochen wird, desto höher die Fehlerquote bei der KI.
ANNETT Ich wage mal eine These: Die ostdeutsche Frau unterscheidet sich soziologisch nicht wesentlich von der Westfrau aus unterprivilegierten Verhältnissen, nur dass die Ostfrau mehr Frauenrechte hatte, das Recht auf Abtreibung zum Beispiel. Und die Westfrau hatte wiederum mehr Freiheiten, Meinungs- oder Reisefreiheit zum Beispiel. Wären wir statt in der Rostocker oder in der Magdeburger Platte in den Neubauten des Westberliner Märkischen Viertels aufgewachsen, wäre unsere Kindheit von anderen Süßigkeiten und Warenfetischen geprägt gewesen. Aber wir wären genauso als Schlüsselkinder vollberufstätiger Mütter groß geworden, die dann eben in den Westberliner Industriebetrieben Schicht gearbeitet hätten, während wir im Fahrstuhl kokelten. Was bedeutet: Im Bild der Ostfrau zeigt sich vor allem der Kontrast zu unseren Kommilitoninnen, Kolleginnen und zu den in den Medien präsenten Frauen unserer Generationen, die ja selten Arbeiterinnenkinder sind, sondern überwiegend aus westdeutschen bürgerlichen Verhältnissen kommen. Sie sind der Maßstab. Ihre Mütter saßen in der Einbauküche. Und ihre Töchter mussten das Vollzeitarbeiten mit Kindern neu erfinden.
PEGGY Interessante Zwischenthese. Vielleicht reicht sie fürs Erste. Ich bin auch schon halb betrunken. Und wir haben noch nicht über die Ideale der Ostfrauen gesprochen. Weder über die Ideale unserer Mütter noch über die eigenen. Das war doch der eigentliche Auftrag an uns!
WENKE Also ich finde, gefällig sein bei so einem Auftrag ist nicht.
ANNETT Wir wanzen uns nicht ran. Wir bleiben Mogelpackungen.
WENKE Wir sind DDR-sozialisiert. Sorry.
PEGGY Waren wir nicht eben noch ein Konstrukt?
WENKE Wir holen den Stahl für die Zäune aus dem Garten.
PEGGY Was soll denn das heißen?
ANNETT Immer radikal, aber niemals konsequent.
WENKE Und was heißt das?
ANNETT Ja, das kann man sich immer wieder mal fragen.
PEGGY Mir solls recht sein. Ich kann eh nicht unbefangen über Ideale sprechen, ich denke da immer gleich an Ideologie. Und die Ideale meiner Mutter waren auch eher privater Natur. Obwohl sie doch ein gesellschaftliches sozialistisches Wesen sein sollte. Der neue Mensch für den neuen Staat und die neue Gesellschaft. Meine Mutter aber wollte nach ihrer Zeit im Kinderheim lieber eine Familie haben, eine eigene Wohnung, und in den Nullerjahren dann ein eigenes Haus, dafür sind meine Eltern sogar aus Dresden weg in die Kleinstadt gezogen, um sich das leisten zu können. Und ich wiederum habe so eine Sehnsucht danach, das Private zu öffnen, das Private zu teilen, ein gesellschaftliches Wesen zu sein. Das Private ist mir so eng.
ANNETT Wir könnten auch mal eine Nacht nur mit Träumen machen. Anstatt der Ideale.
PEGGY Ich träume doch kaum.
WENKE Deine Träume, Annett, haben immer so was schön Surreales.
PEGGY Wir können dich ja immer, bevor wir mit einer Nacht beginnen, fragen, was du in der letzten Nacht geträumt hast. Du bist unser …
WENKE/PEGGY Orakel.
ANNETT Eben war das Orakel noch ChatGPT. Gestern Nacht hatte ich im Traum so eine schwarze Turnhose an wie in meiner Kindheit. So eine Baumwollturnhose. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich über den Alexanderplatz gehen und habe diese komischen Sachen an. Also habe ich so getan, als wäre ich einfach mal eine Joggerin, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen BH anhabe, aber auch gar keinen brauche, weil ich ganz kleine Brüste hatte. Das fand ich so schön.
WENKE Meine Mutter hat sich die Brüste verkleinern lassen.
PEGGY Ich habe eher spät Brüste bekommen, eigentlich als Letzte in der Klasse. Erst nachdem die DDR untergegangen ist, sind meine Brüste gewachsen. Erst habe ich mich gefreut, aber dann lag ich in der Badewanne und dachte: Aufhören!!! Stopp!! Ich hatte voll den Horror, dass sie nicht aufhören zu wachsen und immer größer und größer werden. Die hatten ja schon das Maß, das ich gut fand, überschritten.
WENKE Ich war ziemlich früh dran. Ich weiß noch, wie furchtbar ich es fand, dass wir in der zweiten Klasse im Schwimmunterricht alle in Badehose schwimmen mussten. Badeanzüge waren nicht erlaubt.
ANNETT/PEGGY Also wir hatten Badeanzüge an.
WENKE In der vierten Klasse hatte ich dann auch einen Badeanzug, aber in der zweiten durfte ich noch keinen tragen. Ich habe meine Brüste nie gemocht.
ANNETT Ich auch nicht. Ich wollte immer aussehen wie Patti Smith.
PEGGY Ich mag meine Brüste inzwischen sehr. Eigentlich wäre ich gern androgyner geworden, aber so gehts auch.
ANNETT Ich wollte immer, dass meine Brüste verschwinden. Immer radikal, niemals konsequent. Sie sind immer noch da.
PEGGY Das geht eigentlich nicht, dass ihr eure Körper so abwertet!
ANNETT Nur die Brüste!
PEGGY Trotzdem. Das macht man als (Ost-)Frau nicht!
WENKE Keine Vorschriften bitte!
PEGGY Stimmt, macht, was ihr wollt. Ich müsste dann auch mal los, in ein paar Stunden klingelt der Wecker.
WENKE Bei mir auch.
PEGGY Eine der Nächte müssen wir aber wirklich ganz durchmachen. Ich möchte mit euch die Morgendämmerung sehen.
WENKE Ich finde auch, dass es psychologisch einen Unterschied macht, ob man um eins oder um sechs nach Hause geht.
PEGGY Und wenn unsere Mogelpackung hier klappt, machen wir ne Reihe draus. Erst eine Buchreihe und dann eine Netflix-Serie. »Drei ostdeutsche Frauen essen Bratwurst in der Provinz«. Oder: »Drei ostdeutsche Frauen bereisen die Welt und suchen den Kommunismus«.
WENKE Das ist jetzt aber ne marktwirtschaftliche Prägung.
PEGGY Klar. Schließlich geht es hier auch um Daseinsvorsorge. Und um Annetts Rente.
Und hier noch ein Gedicht für den sicheren Heimweg:
Annett Gröschner Blühende Landschaften
Immer den kopf gesenkt wirst du beschrieben
Selbst wenn du täglich empfindliche güter
Auf deinem hut in die welt balanciertest
Dreh dich oder winde dich
Mit deinem spielbein herum in der luft
Das ist — wir wollen es nicht verschweigen —
Festgezurrt an unserer fahne
Daß dein ausfallschritt des jahrhunderts
Schön auf dem boden der tatsachen bleibt:
Schäbige schatten ziehst du noch immer
Wie eine trümmerfrau fort aus dem schlick
Wozu die anstrengung? was deine mutter
Dir auf den weg gab kannst du vergessen
Was hier gebraucht wird sind ballerinen
Keine matrosin in arbeiterschuhn
(1997)
NACHT 2
EIGENTUM ODER WARUM DIE KLASSENLOSE GESELLSCHAFT FÜR DIE MEHRHEIT DER DEUTSCHEN DAS SCHLIMMSTE IST
(Bio-)Deutsche neigen eher zur Nation als zur klassenlosen Gesellschaft. These: Wenn sie sich zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus entscheiden müssten und es keine Möglichkeit der Stimmenthaltung gäbe, würde eine Mehrheit den Nationalsozialismus wählen. Der Faschismus bedient die niederen Instinkte. Und er stellt nicht das Eigentum in Frage. Das Haus der »arischen« Familie Mustermann wurde nicht angetastet, auch wenn es am Ende ein Trümmerhaufen war. Auch DDR-Bürger*innen durften sich ein Eigenheim bauen — aber nicht viele. Die Neigung zu Hecken, Zäunen, Mauern als gesamtdeutsches Phänomen. Es wird eine lange Nacht mit vielen Kassenstürzen. Ohne Garantie auf Überblick.
Was hast du heute Nacht geträumt, Annett?
Nichts.
Drei Frauen sitzen auf dem Geländer des Kaiserstegs in Berlin-Schöneweide und schauen zu, wie die Sonne in der Spree versinkt. Es ist einer der schönsten Orte in Berlin, um einen Sonnenuntergang zu erleben, aber man muss der morbiden Industrielandschaft ringsherum schon etwas abgewinnen wollen.
PEGGY Da fällt mir ein: Ich habe neulich festgestellt, dass es aus den Neunzigerjahren von mir und meinen Freundinnen ziemlich viele Aktbilder gibt, die wir in irgendwelchen stillgelegten Fabrikhallen von uns gemacht haben. Mit dem ganzen Staub und Dreck am Körper. Irgendwann haben wir damit aufgehört.
ANNETT Das Motiv war auch schon vorher da. Die Achtzigerjahre in Ostberlin waren eine Zeit, in der der Körper im Bild an Stellenwert gewann. Der verletzliche, nackte Körper. Bei Tina Bara hast du im Hintergrund diese steinerne Monstrosität, Gebäude, die schwer verwundet sind, durch Alter, Chemie oder Krieg.
WENKE »Häuser ohne Haut«, hat sie mal gesagt. Ihre Arbeit Lange Weile*15 ist toll. Als Buch wie als Film.
ANNETT Du schaust auf diese heruntergekommenen Gebäude und weißt nicht, was hinter den Mauern stattgefunden hat. Du merkst nur, dass da Geschichten sind, die du irgendwie rauskriegen willst, aber es ist wahnsinnig schwer, darüber etwas zu erfahren. Und gleichzeitig bist du dieser junge Mensch, der nahbar sein will, verletzbar sein will und sich an diesen Fassaden und Verhältnissen reibt. Ziegelstein ist ein wunderbarer Werkstoff aus Matsch und Hitze, aber man kann sich auch ziemlich dran verletzen.
Der Kaisersteg wurde aus Ziegeln und Eisen gebaut, aber nicht für den Kaiser, der ist hier nie über die Brücke stolziert, sondern für seine Untertanen, die in den Fabriken von Oberschöneweide*16 den Wohlstand mehrten oder für den Krieg arbeiteten. Der alte Kaisersteg war ein Juwel der Ingenieurskunst, das Eisen der Pylonen bildete an den Spitzen filigrane geometrische Muster. 1945 wurde die Brücke von der SS gesprengt. Die Beschäftigten der bald darauf volkseigenen Betriebe — unter anderem des Transformatorenwerks Karl-Liebknecht, des Kabelwerks Oberspree und des Werks für Fernsehelektronik — mussten am Bahnhof Schöneweide in die Straßenbahn steigen und einen Umweg fahren. Darunter auch Thomas Brasch und Helga M. Novak, Schriftsteller*innen, die zur Bewährung in die Produktion geschickt worden waren und über diese Zeit Texte geschrieben haben, hart und zärtlich zugleich.
Thomas Brasch DER TOD DER DREHERIN
Dann ragt ein Bein in den Himmel.
Dann fliegt ein Körper durch die Luft.
Dann liegt ihr Hals vor dem Reifen.
Das ist nichts. Das ist der Tod
einer Dreherin, die von der Spätschicht kam
zum S-Bahnhof Schöneweide.
Sie war 50 Jahre alt, und fünfunddreißig davon
stand sie an der Maschine. Sie hatte zwei Töchter,
die hatten zwei Väter, die haben zwei Frauen.
Wenn eine Frau stirbt, ist die Geschichte am Ende.*17
ANNETT Jedes Mal, wenn ich mit der S-Bahn an dem total verfuckten Bahnhof Berlin-Schöneweide ankomme und an einer sehr unübersichtlichen Straße über die Gleise der Straßenbahn gehe und das überlebe, muss ich an diese Dreherin denken.*18
PEGGY Diese Kreuzung ist gemeingefährlich. Ich mache mit dem Fahrrad immer einen Bogen drum.
Erst 2007 wurde der neue Kaisersteg eröffnet, da waren die Betriebe längst durch Treuhand-Verkauf, mehrfaches Weiterverscherbeln, Misswirtschaft, Korruption oder Konkurrenz-Beseitigung stillgelegt. Die leeren Hüllen werden inzwischen langsam wiederbelebt — vor allem durch Kunst, Clubs und Wissenschaft.
Auch die Villa am südlichen Ende des Stegs, in der wir heute die Nacht verbringen, ist inzwischen eine Arbeitsstätte für Kunst, Musik und Literatur. Peggy und Annett haben hier temporäre Arbeitsräume unterm Dach. Erbaut wurde die Villa einst für das Ehepaar Richard und Elsbeth Lehmann. Die Firma A & A Lehmann stellte Borten, Litzen, Quasten, Troddeln, Fransen, Volants her — kurz: Posamenten und Plüsch. Eine Villa in Spuckweite zur Produktionsstätte war Ende des 19. Jahrhundert