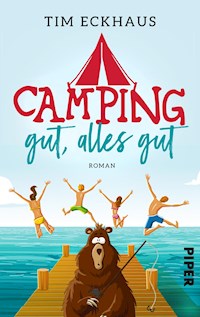Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein packender Krimi voller Überraschungen und subtilem Witz. Der Koch Leo Matschler will eigentlich nur seiner Mutter auf dem Hof helfen, als er nach langer Zeit in den Ort seiner Jugend zurückkehrt. Doch kaum ist er dort angekommen, wird er Zeuge, wie ein Mann im Gasthaus tot zusammenbricht. Böse Zungen beschuldigen Leo und die »Kräuterhexe« Zofia Zaluski des Mordes. Gemeinsam versuchen die beiden, ihre Unschuld zu beweisen – und decken dabei alte Lügen auf, die so mancher lieber unter Verschluss gehalten hätte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tim Eckhaus wurde 1971 in Graz geboren. Seit vielen Jahren schreibt er Unterhaltungsromane, in deren Mittelpunkt die menschliche Natur mit ihren oft skurrilen Eigenheiten steht. »Most und Mord« ist sein Krimidebüt.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: arcangel.com/Galya Ivanova
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg
ISBN 978-3-98707-054-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lesen & Hören, Berlin.
1
Der schwere Duft des Spätsommers hatte sich auf die Hügellandschaft gelegt, und die Birnbäume trugen pralle Früchte, als Leo Matschler in das Mostviertel einfuhr. Trotz der malerischen Umgebung, die in sonnigem Eifer nichts als Frieden und ländliche Behaglichkeit vermittelte, wuchs die Angst in ihm. Er musste sich mit einem Blick in den Rückspiegel vergewissern, dass er ein gestandener Mann war, in seinen Dreißigern – und längst kein Kind mehr. Nicht das Kind, das hier aufgewachsen und in seiner Schulzeit unablässig gequält worden war.
Erwachsen war er, doch er musste im kalten Rechteck des Spiegels feststellen, dass er ungewöhnlich blass aussah – die Ereignisse der letzten Tage in Wien hatten ihn mehr gestresst als gedacht.
War die Kündigung richtig gewesen?
Er hatte keine Wahl gehabt. Das »Goldganserl«, ein einstmals respektables Restaurant im Schatten des Stephansdoms, hatte seine besten Zeiten hinter sich. Dort nicht mehr Küchenchef zu sein war doch schon lange ein Wunsch von ihm gewesen. Der Anruf seiner Mutter, der ihn hierhergeholt hatte, war zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Es war nicht mehr weit bis Waidingen, und Leo dachte schon, er hätte die Angst im Griff. Doch nach einer der schlangengleichen Kurven sah er den kleinen Wald. Das Grün der Bäume erweckte eine seiner übelsten Kindheitserinnerungen. Er wusste, dass es nicht half, sich dagegen zu wehren, also ließ er alles geschehen, während sein Mittelklassewagen sich gegen die Steigung des nächsten Hügels stemmte …
Es passiert in genau diesem Wald, auf einer Lichtung.
Zwei seiner Klassenkameraden halten seine Arme und Beine fest, drücken sie in den mit Fichtennadeln übersäten Lehmboden. Ein dritter Junge fixiert seinen Kopf. Der vierte, der Anführer der Bande, hält ihm einen gläsernen Krug vor die Lippen. »Jetzt wirst du endlich trinken«, sagt dieser Junge, der größte und stärkste, und schwenkt den Krug, sodass etwas von der glänzenden gelblichen Flüssigkeit herausschwappt.
Der kleine Leo, die körperlichen Veränderungen der Pubertät noch weit vor sich, hat plötzlich den Geruch von Most in der Nase. Vergeblich versucht er sich mit aller Kraft freizustrampeln, spannt jeden seiner kindlichen Muskeln an. Er spürt, wie ihm die Röte ins Gesicht schießt. Jetzt drückt der Junge, der seinen Kopf hält, noch fester. Es fühlt sich an, als würde Leo in einen Schraubstock gezwängt. Seine Schläfen füllen sich mit stechendem Schmerz, und für einen Moment ist da die grauenhafte Vorstellung, sein Schädel könnte platzen.
Der Anführer lässt den Krug mit dem Most vor Leos bebendem Gesicht kreisen. Für Leo ist dieses Getränk flüssig gewordene Abscheu, Gift, eine tiefe Demütigung. Er presst die Lippen aufeinander. Sie sollen die Türen eines Tresors sein, den die anderen niemals aufbrechen können.
Der Anführer drückt den Krug fest gegen Leos Mund, bis er schmerzt. Dann klatscht eine Ohrfeige auf Leos Wange. Und noch eine.
Leo weiß, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann. »Hör auf«, flüstert er.
Als der Anführer kurz innehält und den Krug ein klein wenig zurückzieht, in der Erwartung, nun leichtes Spiel zu haben, und sich auch der Griff um Leos Kopf lockert, nutzt Leo seine Chance.
Mit einer raschen Bewegung dreht er sich zur Seite, rollt sich weg. Wie ein um sein Leben fürchtender Käfer krabbelt er ein paar Meter, rappelt sich auf, wankt, kann es selbst nicht glauben, den eisernen Händen entronnen zu sein. Er sieht seinen überraschten Peinigern einen Moment in die Augen. Dann setzt der Fluchtinstinkt ein, und Leo beginnt zu rennen.
Die anderen jagen nach wenigen Sekunden hinter ihm her wie ein Rudel blutgieriger Hunde. »Du wirst uns nicht entkommen!«, ruft der Anführer in einem Rausch von Macht.
Die Bluthunde hinter ihm laufen schnell, ihre Schritte trommeln durch den Wald. Aber Leo ist keinen Deut langsamer. Und er ist schlauer. Er nutzt eine Gabelung des Weges, versteckt sich hinter einer dicken Fichte. Die Zeit der Verwirrung, in der sich die Hohlköpfe umsehen, genügt, um den alten Baum hinaufzuklettern.
Er kann sie nun von oben betrachten. Sie sind unter ihm, sie suchen ihn, vergeblich. Leo atmet schwer und schaut hoch. Er ist der Sonne schon nahe. Durch knorrige Äste und Nadeln strahlt sie zu ihm durch. Sie will ihn beruhigen und ihm zeigen, dass er es schaffen kann.
Dann ist die Erinnerung vorbei.
Leo richtete sich im Fahrersitz auf, presste die Lippen zusammen und wischte sich über die Stirn. Er atmete durch. Genoss die Gewissheit, der Bande entkommen zu sein. Das Gefühl, sich nie gebeugt zu haben in den vielen Schlachten damals, erfüllte ihn mit grimmiger Kraft.
Aber nun wieder kämpfen?
Warum sollte er das tun – war es ein Fehler gewesen, hierherzukommen?
So ganz in Gedanken übersah er beinahe, dass er gerade das mit dunklen Flecken übersäte Ortsschild passierte: Waidingen. Mehr stand da nicht. Kein »Willkommen« oder »Schön, dass Sie hier sind.«
Waidingen war bloß zwei Autostunden von Wien entfernt. Dennoch fuhr Leo nur ganz selten aus der lebendigen Großstadt an diesen Ort, der ausschließlich von Landschaft umgeben war, und wenn, dann um seine Eltern zu besuchen. Mit den Leuten im Ort wollte er nichts zu tun haben.
Auch jetzt verspürte Leo den Impuls, einfach durch die lose Ansammlung von Einfamilienhäusern mit ihren Hecken und strebsam errichteten Gärten durchzufahren. Ohne stehen zu bleiben. Ohne sich mit der Volksschule oder der Kirche oder dem kleinen Laden, der alles anbot, was man für ein durchschnittliches Leben in Waidingen so brauchte, auseinanderzusetzen.
Doch nach der Kurve und noch vor der Straße, die einen weiteren Hügel hinauf zu seiner Mutter führte, wartete der »Mostler«. Das Gasthaus mit seinem langen Dach und den kleinen Fenstern hatte für Leo immer etwas Geducktes, Feiges gehabt. Als würde es, wenn man ihm zu nahe kam, hochspringen und flüchten.
Leo drosselte das Tempo. Es gab da eine Frau im Mostler, den einzigen interessanten Menschen hier: Andrea Pichler. Leo lächelte. Ob sie auch noch so oft an ihn dachte wie er an sie? Jung waren sie gewesen, sechzehn Jahre bloß. So verliebt, doch hatten sie sich eine Fernbeziehung nicht vorstellen können. Es hatte geendet, als er seine Kochlehre in Wien begonnen hatte.
Vielleicht war es die Aufbruchsstimmung, in der sich Leo befand, weil er seinen Job hingeschmissen hatte, vielleicht aber auch die Tatsache, dass er schon seit einem Jahr Single war – auf jeden Fall stellte Leo den Wagen am kleinen Platz vor dem Mostler ab und betrat das Gasthaus.
Stickige, von vielen Menschen überwärmte Luft schlug ihm beim Öffnen der abgegriffenen Eingangstür entgegen. Er kannte die säuerliche Note, die sich ohne jede Scham verbreitete, nur zu gut: der Geruch von Most. In seiner Küche liebte er ihn, er hatte ihn sogar zum Markenzeichen seiner Kochkunst erhoben: Mostsuppe, Mostbratl, Mostschober gehörten zu den Köstlichkeiten, mit denen er sich in der großen Stadt einen Namen gemacht hatte.
Hier aber kam ihm der Geruch von Most vulgär und bösartig vor.
Das Getränk hatte zwei Gesichter. Leo war stolz darauf, dass er über seinen Schatten gesprungen war, das Folterinstrument seiner Jugend umgedeutet und dem Most ein anderes, charmanteres Antlitz verliehen hatte.
Im engen Vorraum, in dem Hüte und Jacken an Wandhaken aufgespießt waren, drangen ein vielstimmig geschrienes »Prost!« und das Klirren von aneinandergeschlagenen Gläsern an sein Ohr.
Als er in die große Wirtsstube trat, verstand er, was den Lärm verursachte.
Etwa ein Dutzend Männer mit aufgeregt geröteten Gesichtern saß rund um den wuchtigsten Tisch im Raum, die meisten ein Glas Most vor sich, ein paar wenige tranken Bier. An den anderen Tischen, zum größten Teil ebenso besetzt, ging es ruhiger zu. Nicht alle der Frauen und Männer kannte Leo, aber am Tisch neben der feuchtfröhlichen Männerrunde saß der Gemischtwarenhändler Oskar Kloiber. Mit dem jetzt alt und grauhaarig gewordenen Mann verband Leo einige der wenigen schönen Erinnerungen an das Dorf. Als Kind hatte er von Oskar immer wieder Süßigkeiten bekommen, wenn er im Laden vorbeigeschaut hatte. Oskar saß allein und stierte gedankenverloren in das Glas Most vor sich, das er schon zur Hälfte geleert hatte.
Oskar hatte Leo gar nicht bemerkt, deshalb wollte er ihn ansprechen. Schon ging er auf ihn zu, als sich ein breitschultriger Kerl vom großen Tisch erhob und das Wort an Leo richtete.
»Ja, spinne ich denn? Bist du nicht der Matschler Leo?«
Leo erkannte die Stimme sofort, dieses gepresste Vibrato: Rudi Steiner, sein Feind aus Schulzeiten. Der Anführer der Jungenbande, derjenige, der Leo gequält hatte, als er ein Kind gewesen war.
Sie hatten ihn nicht bloß zwingen wollen, endlich Most zu trinken. Sie waren wie ein ständiger Alptraum gewesen, aus dem man nicht aufwachte. Rudi und seine Kumpane hatten Leo unzählige »Streiche« gespielt, seine Schultasche versteckt, sein Jausenbrot gestohlen, seinem Fahrrad die Reifen aufgeschlitzt, ihn verprügelt. Sie alle gemeinsam gegen ihn.
Es brachte Leos Herz in unangenehme Wallung, Rudi hier zu sehen, und die Ohrfeigen, die er von ihm kassiert hatte, brannten plötzlich wieder auf seiner Wange. Er hatte sich nie gut gegen Rudi verteidigen können, immer war der körperlich stärker gewesen. Auch jetzt machte er einen trainierten, fitten Eindruck, schlank, muskulös und braun gebrannt. Sicherlich hätte er Leo, der in den letzten Monaten zum Teil aus Frust über die Arbeitsbedingungen im Goldganserl etwas Speck angesetzt hatte, locker die Nase eingeschlagen.
Leo sah sich die Runde an: Die meisten anderen an Rudis Seite waren genau die Flaschen, die damals schon mit ihm gemeinsame Sache gemacht hatten. Sie starrten Leo nun feindselig an.
»Da hast du mich richtig erkannt, Rudi«, sagte Leo, bemüht, seine Stimme ruhig zu halten.
Rudi grinste schief und sagte: »Darf ich bekannt machen: Das ist der Feitelverein.« Stolz sah er sich in seiner Runde um, offensichtlich war er das Oberhaupt dieses Vereins, unter dem sich Leo nicht wirklich etwas vorstellen konnte.
»Meine Mutter«, sagte Leo, »hat mir erzählt, du bist Polizist geworden?«
Rudi antwortete nicht gleich, vielmehr legte sich ein prüfender Ausdruck auf sein Gesicht. Leo hatte sich bemüht, seine Frage ohne jede Ironie vorzutragen.
»Ja, ich bin Polizist. Und du rührst in Kochtöpfen, wie man hört?«
Brutales Gelächter ertönte von den anderen Mitgliedern des Feitelvereins, was Rudi dazu ermutigte, gleich eins draufzusetzen: »Wien ist doch eine grausliche Stadt, nur Dreck und Huren, wie kannst du dort leben?«
»Vielleicht steht der Leo aber auf Dreck und Huren«, brüllte ein anderer aus der Runde.
»Lange habe ich gedacht«, sagte Rudi mit einem Grinsen, »der Leo steht eher auf Mannsbilder.«
Wieder lachten alle.
»Da hast du dir umsonst Hoffnungen gemacht«, sagte Leo.
Er bemerkte, dass einige der Feitelvereinsmitglieder gern noch einmal losgelacht hätten, aber sich nicht trauten. Nur einer konnte angesichts der schlagfertigen Antwort ein Prusten nicht zurückhalten. Er erntete sofort einen bösen Blick von Rudi und machte eine entschuldigende Geste.
»Schau einmal nach dahinten«, sagte Rudi und deutete an das andere Ende des Wirtsraumes.
Als Leo sich umdrehte, sah er eine Frau die Treppe herunterkommen. Sie hatte tiefschwarzes Haar, trug ein grünes Dirndl und lächelte strahlend herüber, als sie Leo erkannte. Es war Andrea, was Leos Herz einen Freudentanz hüpfen ließ. Ihr Anblick war wunderbar, wie der eines Engels, der aus dem Himmel herabstieg. Natürlich kam sie nicht aus dem Himmel, sondern sie wohnte, wie Leo von seiner tratschenden Mutter schon vor einiger Zeit erfahren hatte, nach wie vor – so wie damals, als Leo noch im Ort gewesen war – im oberen Stockwerk. Zusammen mit ihren Eltern, die das Gasthaus besaßen.
»Das fesche Madl, das du da siehst, wird meine Frau werden!«, verkündete Rudi. »Wir sind verlobt.«
Leos Herz stellte den Freudentanz augenblicklich ein, er stemmte die Hände in die Hüften und rief: »Wie bitte?«
Gern hätte Leo weitere Details erfahren – selbst wenn er schon lange nicht mehr mit Andrea zusammen war, fühlte er eine tiefe Verbundenheit –, doch in diesem Moment zeigte der Feitelverein, was er draufhatte. »Feitel aussa!«, rief Rudi laut. Das hatte große Wirkung. Alle Mitglieder des Vereins ließen ihre Getränke links liegen, fassten in ihre Hosentaschen, holten Taschenmesser in verschiedenen Längen heraus und klappten sie in beeindruckender Geschwindigkeit auf. Die funkelnden Klingen streckten sie in die Höhe, ein martialischer Gruß, der Leo einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte.
Leo sah hinüber zum Nebentisch. Dort hatte Oskar das seltsame Ritual des Feitelvereins missbilligend betrachtet. Er schüttelte den Kopf, wollte seinen Most wieder an die Lippen setzen – doch da traf sein Blick Leo zum ersten Mal.
In dem Augenblick, als Erkennen das Gesicht des alten Mannes zeichnete und sich Leo sicher war, dass in Oskars Gehirn seit Ewigkeiten vergessene Bilder eines kleinen blonden Jungen namens Leo erstrahlten, geschah es.
Oskar wurde bleich.
Er begann schwer zu atmen, griff sich an die Brust. Seine Augen wurden groß, sein Mund ging auf, als wollte er schreien. Doch es fehlte ihm die Luft dazu. Seine Hand krallte sich um das Glas Most, dann, als jede Kraft aus den Fingern gewichen war, wurde sein Griff weich. Sein Oberkörper kippte nach vorne und schlug dumpf auf der Tischplatte auf. Sein Kopf knallte auf das Mostglas, das hinabfiel und am Boden zersplitterte.
Oskar lag verdreht mit leeren Augen auf dem Tisch, sein weißes Haar hob sich wie Asche vom braunen Holz ab.
Es wurde still im Raum. Für lange Sekunden starrten alle die leblose Gestalt an. Dann schüttelten die Ersten ihre Starre ab und stürmten zu Oskar Kloiber, dem Mann, bei dem sie immer einkauften.
Auch Leo stürzte los. Doch Rudi blieb ungerührt vor ihm stehen. Für eine Sekunde hatte Leo das Verlangen, mit aller Macht in ihn hineinzurennen, ihn niederzureißen, trampelnd über ihn hinwegzulaufen. Dennoch tat er es nicht. Rudi war zu groß, zu stark, er hatte sich wie eine Wand vor ihm aufgebaut. Leo wich aus. Während der paar Schritte zu Oskar spürte er Rudis brennenden Blick im Rücken.
Dann war er endlich beim Tisch, von dem Mostgeruch ausging. In Leos Vorstellung ragten die hölzernen Beine nicht bloß aus einer hellgelben Lacke, sondern aus einem Sumpf voller Tod und Verwesung. Er drängte sich an den anderen vorbei, die versuchten, Oskar mit Rufen und Rütteln wach zu bekommen.
Leo legte seine Hand an den faltigen, trockenen Hals. Suchte nach einem Puls. Doch da war keiner mehr.
2
»Los, helft schon«, herrschte Leo den am Nebentisch sitzenden Feitelverein an. Zwei der Kerle ließen sich nach kurzem Zögern und einem Seitenblick zu Rudi dazu hinreißen, aufzustehen. Gemeinsam nahmen sie Oskar, der mehr wog, als Leo gedacht hatte, und legten ihn auf den von braunen Fliesen bedeckten kalten Boden.
Während Ulrike Nonn, die Frau des Dorfarztes, mit zitternden Fingern auf einem für sie viel zu großen Handy die Nummer ihres Mannes anrief, begann Leo mit der Herzdruckmassage. Immer wieder und wieder presste er seine Hände gegen Oskars Brustbein, spürte, wie es nachgab und zurückkam. Leo forschte in Oskars Gesicht, ob da irgendeine Regung zu erkennen war, doch es behielt diesen leblosen, etwas überraschten Ausdruck. Fahl war seine Haut plötzlich, sie hatte nichts mehr mit dem rosigen Teint zu tun, an den Leo sich von früher erinnern konnte.
Der Laden, die aus Kindersicht so hohen Regale mit den bunten Süßigkeiten und Oskars gütiges Lächeln – all das verblasste mit den Minuten, schien mit der Lebenskraft des alten Mannes aus dieser Welt zu verschwinden.
Wenig später war auch Dr. Nonn eingetroffen. Der gedrungene Mittsechziger, der Leo in seiner Kindheit die eine oder andere Spritze verpasst hatte, was man als Kind nicht verzeiht, musste wohl schon am Ende seines Berufslebens stehen. Dennoch hatte er eine zielstrebige und professionelle Art, sich über die Situation einen Überblick zu verschaffen. Er lobte in kurzen Worten, dass Leo gleich mit der Herzdruckmassage begonnen hatte, und übernahm die Reanimation – wobei er abwechselnd nicht nur Herzdruckmassage, sondern auch Atemspende durchführte. Dazu setzte er einen Beatmungsbeutel und eine Kunststoffmaske ein, die er eilig über Oskars Mund stülpte.
Mit jedem Drücken und Loslassen von Oskars Brustbein stand dem Arzt mehr Schweiß auf der Stirn. Regelmäßig überprüfte er, ob der Puls endlich zurückgekehrt war.
Nach etwa zwanzig Minuten wurde Dr. Nonn immer langsamer, wie eine Dampfmaschine ohne Dampf, und der Mediziner musste erkennen, dass er hier kein Wunder mehr vollbringen konnte. Er richtete sich auf, wischte sich den nassen Film von der Wange und bestätigte Oskars Tod.
Andrea, die wie alle anderen die Reanimationsversuche des Arztes mit bangem Warten mitverfolgt hatte, verzog erschrocken das Gesicht.
»Wie kann das nur sein?«
Leo stellte fest, dass sich Andreas Stimme mit den Jahren kaum verändert hatte. Er hatte ihren weichen, warmen Klang immer geliebt, auch wenn ihm in diesem Augenblick bewusst wurde, wie lange er ihn nicht vernommen hatte.
»Es war sein Herz«, kommentierte der Arzt knapp, kurzatmig und mit verschobener Brille. »Mehr erfahren nur die Angehörigen.«
Es dauerte nicht lange, bis Oskar abgeholt wurde. Zwei Träger des hiesigen Bestattungsunternehmens hoben den für immer Entschlafenen hoch – ohne jede Mühe, wie eine Selbstverständlichkeit, vielleicht dachten sie schon an ihren Feierabend –, legten ihn auf eine mit Rollen versehene Bahre und nahmen die kalte Leiche mit. Leo sah ihnen nach – wie das auch alle anderen im Mostler taten. Keiner der Gäste war gegangen, die Schaulust hatte sie hiergehalten.
Er atmete tief durch. Ihm war, als hätte er eben etwas Wertvolles wiedergefunden, das ihm im nächsten Augenblick entrissen worden war. Oskar zu sehen, sein vertrautes, aber gealtertes Gesicht, hatte ihn für einen Moment zurückkatapultiert in eine Zeit, in der er wenige Freunde gehabt hatte, in der nur wenige ihm Wärme und Zuneigung geschenkt hatten. Oskar war jemand Besonderes in seinem Leben gewesen. Leo wurde klar, wie viel ihm Oskar bedeutet hatte, und er verfluchte sich gleichzeitig dafür, sich nicht zumindest manchmal bei ihm gemeldet zu haben. Mit seinem Fortgang aus Waidingen hatte er ihn aus den Augen verloren. Immer waren andere Dinge wichtiger gewesen, und nun war es zu spät.
Die Ruhe danach währte nicht lange. Gleich nachdem Oskars Leichnam wegtransportiert und Dr. Nonn gegangen war, um in seiner Ordination den Totenschein auszustellen, kamen im Mostler erste Spekulationen auf.
Leo war erstaunt, wie laut und wirr es mit einem Mal im Gasthaus zuging. Alle redeten durcheinander.
»Wahnsinn, der Oskar. Er ist doch so fit gewesen«, sagten die einen.
»Fit? Offensichtlich war er herzkrank!«, warfen die anderen ein.
Und einer war sich sicher: »Ich weiß, dass er Patient bei Dr. Nonn war.«
»Glaub ich nicht, dass der so krank war, der war doch gut zu Fuß. Es wundert mich, dass er umfällt, wenn er praktisch gesund ist«, meinte sein Freund.
»Komisch, gleich nachdem er den Most getrunken hat.«
Es ging eine ganze Zeit so weiter, die Lautstärke steigerte sich – Leo wollte sich schon die sensiblen Ohren zuhalten –, bis Frau Nonn sagte: »Vielleicht war ja der Most vergiftet.«
Daraufhin wurde es erst mal ganz still. Alle rückten ein wenig vom Tisch ab, auf dem Oskar gestorben war, und stierten auf die Lacke aus Most.
»Gift?«, fragte Andrea. »Hier im Mostler? Spinnst du? Wer sollte so etwas tun?«
Frau Nonn, die sich im Dorf gern »Frau Doktor« nennen ließ, obwohl sie nicht studiert, sondern geheiratet hatte, sah Andrea nachdenklich an. Dann schickte sie ihren Blick durch die Reihen, als könnte sie mit Röntgenstrahlen erkennen, wer zu so einer Tat fähig wäre.
»Wer? Die Zofia Zaluski zum Beispiel«, sagte sie schließlich.
Es ging ein Raunen durch die Wirtsstube.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst«, sagte Leo.
»Warum nicht?«, beharrte Frau Nonn mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ich war gestern bei Oskar einkaufen und habe mitbekommen, dass sie einen wilden Streit hatten.«
»Echt?«, wollte Rudi wissen.
»Ja, die Zaluski und der alte Kloiber.«
»Worum ging es?«
»Na, sie hat behauptet, dass Oskar sich zu ihren Ungunsten verrechnete.«
»Und dann?«
»Dann hat sie zum Schreien angefangen und ihm den Tod gewünscht.«
Leo schüttelte den Kopf. »Ich kenne die Zofia noch von früher, die ist keine Mörderin.«
Frau Nonn funkelte Leo böse an. »Du hast doch keine Ahnung. Du lebst schon lange nicht mehr hier. Was bei uns so vorgeht, weißt du alles nur aus zweiter Hand, von deiner Mama.«
Rudi nickte. »Die Zaluski ist eine unheimliche Frau. Wohnt da oben am Hügel, redet mit keinem, macht irgendwas mit ihren Giftkräutern.«
»Ach, hör doch auf«, sagte Leo. »So ein Blödsinn.«
Rudi richtete sich auf, blickte nach hinten zu seinem Feitelverein und starrte dann Leo kalt an. In leisem, bedrohlichem Ton fügte er hinzu: »Es ist ja die Frage, warum das genau jetzt passiert.«
Leo hielt Rudis Blick stand. »Wenn du etwas sagen willst, sag es mir ins Gesicht.«
Rudi setzte wieder dieses schiefe Grinsen auf. »Ich behaupte gar nichts. Es ist nur so: Du kommst hierher, und Oskar stirbt.«
»Du weißt, dass ich Oskar sehr gern mochte.«
»Ja, aber manche Dinge ändern sich.«
Leo war sprachlos. Wie viel Unsinn kann ein einzelner Mensch reden?
»Außerdem«, fuhr Rudi fort, »warst du immer gut mit der Zofia Zaluski. In der Volksschulzeit habt ihr euch oft gemeinsam herumgetrieben. Ihr wart befreundet, kann man sagen.«
»Erstens ist das lange her, und zweitens muss ich mich sicher nicht rechtfertigen.«
Rudi sah ihn mit einem zur Schau gestellten Gefühl der Überlegenheit an. Offensichtlich meinte er, Leo in die Defensive gedrängt zu haben.
»Du und die Zaluski«, sagte Rudi. »Vielleicht hast du der Hexe heute ja irgendwie geholfen, Oskar loszuwerden.«
»Hör auf, sie Hexe zu nennen.«
Leo blickte sich um. Es war, als ob sich eine Mauer vor ihm aufgebaut hätte. Eine lebende Mauer von in sich verzahnten Menschen, die plötzlich durch einen gemeinsamen Glauben in hitziger Eintracht zusammengehalten wurden. Zofia Zaluski – ein Name wie ein böses Omen.
Leo hatte keine Lust mehr, sich dem Irrsinn auszusetzen. Ihm brannten die Fußsohlen, ein Gefühl, das sich bei ihm immer dann einstellte, wenn er dringend an einem anderen Ort sein wollte. Diese Wand aus Ablehnung erinnerte ihn an früher, an genau die Gründe, warum er damals das Dorf verlassen und sich eine neue Existenz irgendwo anders aufbauen hatte müssen.
»Ihr spinnt«, stieß er hervor. Er wollte nur weg von dieser glotzenden, bösen Meute, die noch nie auf seiner Seite gestanden war. Im Hinausgehen suchte er den Blick von Andrea, doch sie sah verlegen zu Boden, während Rudi ihn triumphierend angrinste.
Mit raschen Schritten verließ Leo den Mostler.
3
Während Leo viel zu schnell die Straße zu seiner Mutter hinauffuhr, brodelte die Wut in ihm. Wie verblödet die Leute hier waren. Gleich einer Herde Schafe liefen sie dem erstbesten Ruf nach, ließen sich einspannen, für jeden Zweck.
Er schlug aufs Lenkrad. Ein Mensch war gestorben! Jemand, der ihm früher viel bedeutet und der immer noch einen Platz in seinem Herzen hatte. Keiner im Ort zeigte Bedauern, dass Oskar sein Leben verloren hatte, alle wollten lieber Schuldige suchen!
Nach der letzten Biegung der schmalen Straße, die in seiner Kindheit statt mit Asphalt mit Schotter bedeckt gewesen war, erreichte Leo den Mosthof.
Der zweistöckige Vierkanthof, der auf eine über hundertjährige Geschichte in Leos Familie zurückblicken konnte, hatte eine Renovierung nötig. Früher hatten die steinernen Mauern und das dunkelrote Ziegeldach leuchtend gestrahlt, nun wirkten sie blass.
Die dichten Birnbäume rund um den Hof bildeten ein Begrüßungskomitee aus früheren Zeiten. Das sich zaghaft einstellende Gefühl, heimgekommen zu sein, dämpfte die Wut in Leo, konnte sie aber nicht ganz löschen.
Seine Mutter kam gleich aus dem alten zweiflügeligen Holztor gelaufen, als sie sah, dass sich sein Auto näherte.
Leo stellte den Wagen auf dem Parkplatz neben dem großen Mostfass ab. Von dem hatte sein Vater immer mit Stolz behauptet, es sei das erste gewesen, in das die Vorfahren Most gefüllt hatten.
Seine Mutter lächelte ihn an, als er aus dem Auto stieg. Die beiden umarmten sich. Franziska fühlte sich weich an, wie ein großes Polster. Sie war auch ziemlich füllig geworden in den letzten Jahren, aber das stand ihr gut. Sie strahlte etwas Gesundes aus.
»Mein Lieblingssohn«, sagte sie und drückte Leo fester.
»Und dein einziges Kind.«
»Endlich bist du wieder einmal hier«, sagte Franziska und klang plötzlich vorwurfsvoll.
Er ließ seine Mutter los und trat einen Schritt zurück. »Ihr könntet mich aber auch mal besuchen kommen.«
Sie zog die Stirn in Falten. »Na, jetzt wohl nicht mehr.«
Leo dachte an den Anruf zurück, mit dem sie ihn nach Waidingen geholt hatte. Ihre gestammelten Worte waren zunächst rätselhaft gewesen. Sie hatte durch ihr Weinen und Schluchzen hindurch in mehreren Ansätzen ausgedrückt, dass »Joseph von uns gegangen« sei. Leo hatte – dort im verlassenen Roten Salon des Goldganserls, wo er den Anruf entgegengenommen hatte – für einen furchtbaren Moment geglaubt, sein Vater Joseph sei gestorben. Doch dann hatte seine Mutter sich in dem ganzen Jammern, das durch den Handylautsprecher gedrungen war, so weit verständlich gemacht, dass klar wurde: Sie hatte sich nur zweideutig ausgedrückt.
»Mama«, begann Leo und blickte zu den Birnbäumen, auf die er als Kind so gern geklettert war, »du kannst nicht sagen ›von uns gegangen‹, wenn keiner gestorben ist. Ich habe mich echt erschrocken.«
»Wenn er von uns weggeht, heißt es doch: Er ist von uns gegangen.«
»Nein.«
»Doch.«
»Du hättest mir einfach mitteilen sollen, dass Vater nach Frankreich gereist ist, um den Cidre zu studieren.«
»Ausgerechnet Cidre. Das passt doch gar nicht zum Mosthof.«
»Ein weltoffenes Flair könnte euch nicht schaden. Wir haben den Birnenmost, die Franzosen den moussierenden Apfelwein.«
Franziska schaute ihn mit zusammengekniffenen Augen an. In dem Punkt hatte Leo sie nie verstanden. Sie wollte nicht einsehen, dass das immer gleiche Angebot – nämlich der typische Birnenmost der Region und ein paar eher karg eingerichtete Zimmer – auf die Dauer nicht genügte. In einem internationalen Umfeld, wo die nächste Sensation nur ein paar Flugstunden entfernt war.
»Für ein halbes Jahr ist er weg?«, fragte er.
Sie sah zu Boden. »Genau. Vielleicht hat ja alles einen anderen Grund.«
»Was meinst denn?«
»Wahrscheinlich hat der Saukerl eine Geliebte in Frankreich.«
Leo verzog das Gesicht, das schien ihm unglaubwürdig. Die beiden hatten gerade eine Krise, das hatte er bei den wenigen Telefonaten und Besuchen mitbekommen, seine Eltern stritten viel mehr als früher. Aber eine Geliebte in Frankreich traute er seinem Vater dann doch nicht zu. Er hoffte zumindest, dass es nicht so war, denn für ein Kind bedeutete es immer einen Schlag in den Magen – egal, in welchem Alter –, wenn die Eltern es mit der Treue nicht so ernst nahmen. Worauf konnte man sonst noch bauen?
Franziska lächelte. »Danke, dass du mir helfen wirst. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich täte. Aber du hättest nicht gleich deine Stelle kündigen müssen, weißt du?«
»Ach, mir hat schon länger nichts mehr gepasst im Goldganserl.«
»Dieser neue Manager?«
»Der Pletzky, genau, ein unguter Typ. Er wollte das Einkaufsbudget um dreißig Prozent kürzen, stell dir das vor! Wenn du so billig einkaufst, kannst du bloß noch einen minderwertigen Fraß kochen.«
»Die Leut werden doch immer geiziger. Unsere Gäste wollen für ein Zimmer praktisch nix mehr zahlen. Die kommen mit irgendwelchen Angeboten aus dem Internet und verlangen, dass wir auch so billig sind!«
Preisdruck überall, dachte Leo und kratzte sich am Hinterkopf. Im Goldganserl und im Mosthof spürten alle die toxische Mischung aus steigenden Kosten und einer Kundschaft, die nicht bereit war, viel für ihr Vergnügen auszugeben. Man musste etwas Besonderes bieten. Vermutlich genau aus diesem Grund befand sich der Vater auf der Suche nach neuen Einkommensquellen, und wenn die in französischem Cidre zu finden waren.
»Aber gehen wir doch endlich rein«, schlug die Mutter vor und lächelte einladend. »Du siehst hungrig aus.« Sie hatte ihre Hand auf seinen Rücken gelegt, als sie ihn in den Mosthof geleitete.
In der Stube, die im Stil eines alten Bauernzimmers eingerichtet war, setzten sie sich. Dieser Raum ändert sich nie, dachte Leo. Die gehäkelten Vorhänge und die braune Eckbank schienen aus der Zeit gefallen und mit dem Kruzifix an der Wand eine ewige Dreifaltigkeit zu bilden.
»Most magst immer noch nicht, oder? Der letztjährige ist sehr gut«, sagte Franziska mit einem Augenzwinkern. Leo ärgerte die Frage. Sie wusste, dass er nie Most trank. Sie hatte sein gespaltenes Verhältnis zu diesem Getränk mit der Zeit akzeptiert. Er verwendete Most nur zum Kochen, benutzte ihn – da hatte er die Kontrolle. Aber er wollte ihn nicht trinken. Niemals, egal, wie sehr man ihn drängte.
»Sind Gäste im Haus?«, fragte er. Die Mutter hatte acht Gästezimmer, die sie vermietete, doch Leo hatte keine anderen Wagen auf dem Parkplatz gesehen.
»Anfang der Woche kommen wieder welche«, sagte sie. »Könnten mehr sein, aber du weißt eh.«
Kein ermutigendes Zeichen, dachte er. Zu den besten Zeiten des Hofs hatte es hier nur so gebrummt vor Städtern, meist aus Wien oder Deutschland, die ein paar Tage im idyllischen Mostviertel verbringen wollten.
»Ich habe ein anderes Problem«, sagte er.
»Hunger?«
»Nein.«
»Warum bist du eigentlich so spät gekommen? Ich hatte dich früher erwartet.« Sie zeigte auf den Herd, wo erkaltete Bratwürste in der Pfanne einer ungewissen Zukunft entgegensahen.
»Oskar Kloiber ist tot.«
Sie brauchte einen Moment, bis sie die Bedeutung der Worte verstanden hatte. Ihr Mund öffnete sich zu einem ungläubigen O. »Oskar?«, fragte sie mit zitternder Stimme. »Unser Oskar?«
»Unser Oskar. Ich kann es selbst kaum glauben.«
Sie stand auf und begann auf und ab zu laufen.
»Wann ist denn das passiert?«, fragte sie schließlich.
»Vor drei Stunden. Darum bin ich nicht früher hier gewesen.«
Da Franziska ihren Sohn weiterhin verstört und fassungslos anblickte, schilderte Leo ihr die Ereignisse im Mostler. »Er ist vor meinen Augen gestorben«, schloss er. »Es war ein Herzanfall.«
»Gott im Himmel!«, flüsterte sie und faltete die Hände. »Das ist doch unglaublich. Oskar! Ich war erst letzte Woche bei ihm einkaufen. Da hat er gar nicht krank gewirkt.«
»Angeblich hatte er gesundheitliche Probleme und war bei Dr. Nonn in Behandlung. Aber die Deppen da unten denken, Oskar wurde vergiftet.«
Franziska schnappte nach Luft. »Gift? Ein Mord? Wen verdächtigen sie?«
»Stell dir vor, die Zofia Zaluski.«
Er hatte das mit einem halben Lachen gesagt, es war für ihn immer noch eine kaum ernst zu nehmende Anschuldigung. Zofia hatte einen heftigen Streit mit Oskar gehabt, aber deswegen griff man doch nicht gleich zum äußersten Mittel und mordete.
Franziska lachte nicht. Sie hatte immer schon ihre Fühler im Dorf gehabt. Was dort lief, war von elementarer Bedeutung für sie. Sie war eng verwoben mit der Gemeinschaft, die anderen waren ihr Lebenselixier, der Boden, aus dem ihre Wurzeln entsprangen. Es war eines der ganz großen Probleme gewesen, die Leo in seiner Kindheit gehabt hatte. Dass er immer alles in einer Weise machen musste, dass niemand im Dorf blöd reden konnte. Der gute Ruf war das Allerwichtigste für die Mutter gewesen und ihr häufigster Satz: »Was werden denn die anderen denken?«
»Die Zaluskis«, sagte Franziska mit einem Achselzucken, »also Zofia und schon ihre Mutter, die Dana, waren halt nie irgendwo dabei. Haben sich nicht um andere Leute gekümmert. Kein Wunder, dass Zofia verdächtigt wird.«
Leo starrte Franziska fassungslos an. »Du findest das normal, oder wie?«
Seine Mutter blickte erstaunt drein. »Wieso verteidigst du sie? Du kennst sie in Wahrheit auch nicht. Ihr seid euch im Volksschulalter höchstens ein paarmal begegnet.«
»Na ja, du spielst das herunter. Wir haben uns eine Zeit lang oft gesehen. Oft genug, um zu wissen, was für ein Mensch aus einem wird. Jedenfalls ist sie keine Mörderin.«
Die Mutter stieß die Luft aus. »Willst du sicher nichts essen?«
»Weißt du«, sagte er trotzig, »wen sie noch verdächtigen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Mich!«
Jetzt änderte sich ihr Ausdruck. Aus einem Die-Zaluski-ist-halt-seltsam-Gesicht wurde ein Gibt-es-doch-nicht-Gesicht.
»Dich? Aber wieso …?«
»Weil ich nicht eingestimmt habe in den Chor, dass es die Zofia gewesen sein soll. Und weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Hat schon gereicht.«
Jetzt hielt es Franziska nicht mehr auf dem Stuhl. Verstört lief sie ein paar Meter ziellos durch die Küche, um sich dann mit verschränkten Armen vor dem Fenster zu platzieren.
»Die können doch nicht meinen Sohn und diese Hexe in einen Topf werfen. Du bist Küchenchef in Wien.«
»War ich.«
»Ist doch egal, auf jeden Fall bist du was Besseres als die Zaluski.«
»Ich glaube ja …«, sagte Leo und stand ebenfalls auf, »… dass du dich vor allem um deinen eigenen Ruf sorgst. Einen Sohn unter Mordverdacht zu haben muss echt peinlich sein.«
Er ging zur Tür.
»Wo willst du denn hin?«, fragte sie und hielt ihn am Arm fest. Aber er riss sich mit einer erbosten Bewegung los.
»Ich fahre jetzt zur Zofia Zaluski. Sie soll wissen, was geschehen ist.«
Leo drehte sich nicht mehr um, als er den Hof verließ. Er hörte, wie Franziska die Haustür zuknallte, dann stieg er in sein Auto.
4
Der Hof der Zaluskis lag am grünen Hügel gegenüber, daran konnte sich Leo erinnern. Allerdings gab es hier jede Menge grüne Hügel, und so kam es, dass er sich zunächst verfuhr und am Hof des Mostbauern Edi Rager landete. Edi starrte ihn mit großen Augen an, doch Leo legte rasch den Rückwärtsgang ein und entkam so den neugierigen Blicken.
Schließlich, am richtigen Hügel, fand Leo den kleinen Hof. Er sah so aus, wie er ihn in Erinnerung hatte. Er war als Kind ein paarmal hier gewesen, hatte mit Zofia, die ihn aufgrund ihrer Andersartigkeit interessiert hatte, Zeit verbracht – was jedes Mal das Missfallen seiner Mutter hervorgerufen hatte.
Leo stieg aus dem Wagen und schritt auf den Hof zu. Wenn auch das Erscheinungsbild und der verschlafene Gesamteindruck des Gebäudes sich wenig verändert hatten, so gab es doch im Detail Neues zu entdecken. An den Holzwänden hatte sich Moos in den Fugen zwischen den Dielen festgesetzt. Das fleckig grau gedeckte Dach hatte einige zerbrochene Schindeln. Vor dem Hof war ein beeindruckender Garten angelegt. Blumen, Kräuter und üppige Sträucher erzeugten einen bunten Reigen aus Hunderten Farben.
Von Zofia fand Leo keine Spur. Er klopfte an die Holztür, aber niemand reagierte.
Er wollte es noch einmal versuchen, als ihn eine raue weibliche Stimme von hinten ansprach: »Wer sind Sie denn?«
Leo wirbelte herum. Da stand eine schlanke, etwas ausgezehrte Frau, die ein weites Kleid aus brauner Jute trug. Ihr gewelltes brünettes Haar war mit einem Tuch zusammengebunden, im Arm hielt sie einen Korb mit Pilzen. Sie sah Leo mit funkelnden grünen Augen an.
Nachdem der erste Schreck nachgelassen hatte, versuchte er ein Lächeln.
»Hallo, Zofia. Kennst du mich noch?«
Die Frau kniff die Augen zusammen. »Irgendwie kommst du mir bekannt vor.«
»Leo. Leo Matschler.«
Ihr Gesicht hellte sich auf. »Jetzt weiß ich’s wieder. Du warst ein Kind aus der Gegend hier.«
Er zeigte auf eine alte Eiche, die neben dem Garten wuchs. »Wir haben zusammen gespielt. Ich kann mich erinnern: Wir hatten eine Zielscheibe an diesem Baum befestigt und haben dann mit Pfeil und Bogen darauf geschossen.«
Auf Zofias Gesicht zeigte sich ebenfalls ein angedeutetes Lächeln, das aber wieder verschwand, als sie sagte: »Viele Kinder haben mich damals nicht besucht.«
Leo schwieg, dann fragte er: »Wohnt deine Mutter auch noch hier?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie ist leider schon vor längerer Zeit von uns gegangen.«
Von uns gegangen, dachte er. In diesem Fall dürfte das eindeutig sein. »Tut mir leid zu hören.«
»Ja, ich vermisse sie. Es ist nicht so einfach, den Hof ohne sie zu führen.«
Sie blickte zu Boden, in Gedanken versunken.
Leo trat von einem Bein auf das andere. »Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ich komme gerade aus Waidingen.«
»Waidingen«, wiederholte Zofia voller Verachtung.
»Ja, können wir das drinnen besprechen?«
Sie zögerte einen Moment, musterte ihn. Sie dachte wohl, dass er sich sehr verändert hatte, dann sperrte sie die Tür auf, ging wortlos hinein. Leo folgte dem Korb mit den Pilzen.
Im Inneren des Hofes dominierte ebenfalls dunkles Holz. Er war erstaunt, wie alt dieses Gebäude wirkte, daran konnte er sich nicht erinnern. Zofia führte ihn in den ersten Stock, sie kamen an einer Werkstatt vorbei, wo sie offensichtlich Tinkturen und Säfte aus Kräutern herstellte. Getrocknete Gräser und Blüten in Gläsern, Waagschalen, Töpfe. Es sah aus wie in einer historischen Apotheke, und es roch nach Heu und Gewürzen. In einem Regal mit alten Büchern bemerkte er ein in abgegriffenes Leder gebundenes Werk von Hildegard von Bingen. Von ihr hatte er schon gehört.
Auf dem Balkon, von dem aus man den großzügigen Garten überblicken konnte, setzten sie sich auf eine Holzbank.
Neben ihnen stand auf einem niedrigen Steintisch ein Stövchen, in dem die gelbe Flamme einer Kerze brannte. Die Hitze hielt eine Kanne mit duftendem Tee warm. Zofia schenkte Leo eine Tasse ein. »Ohne Tee geht es bei mir nicht. Ich bereite ihn morgens zu und trinke ihn den ganzen Tag über.«
Er nahm die Tasse mit einem dankbaren Nicken entgegen und schaute in den Garten hinab. »Im Dorf sagen sie, dass du eine Naturheilerin bist, stimmt das?«
Zofia, die sich zu ihm gesetzt hatte und sich auch einen Tee eingoss, lächelte nur. »Das ist nicht, was sie sagen. Sie benutzen ein anderes Wort.«
»Ja, leider«, gab er zu. »Tun sie das schon länger?«
»Seit Jahren. Ich will eigentlich gar nichts mehr von denen hören.«
»Kann ich verstehen. Aber heute ist etwas passiert, das du nicht ignorieren kannst.«
Sie kostete einen Schluck vom Tee. »Eine Mischung aus gerösteter Zichorienwurzel, Zimt und Orange«, sagte sie und sog den Duft über der Tasse ein.
»Oskar Kloiber ist gestorben, du weißt, der Gemischtwarenhändler.«
Mit einem Mal weiteten sich Zofias Augen. Ihre Stirn legte sich in Falten, und sie setzte die Tasse ab. Ein beunruhigter Gesichtsausdruck, der nur aus einer plötzlichen Erkenntnis stammen konnte.
»Der Traum«, flüsterte sie.
Leo war überrascht von ihrer Reaktion. Was denn für ein Traum? Da sie nur mit zusammengepressten Lippen ins Leere starrte, sprach er vorsichtig weiter.
»Oskar«, sagte er, »ist vor meinen Augen im Mostler zusammengebrochen. Wir haben versucht, ihn wiederzubeleben. Der Arzt war da. Aber es war vergeblich.«
Zofia sagte immer noch nichts, weiter den abwesenden Ausdruck im Gesicht. Langsam wurde es Leo unheimlich.
»Es war Herzversagen«, schloss er.
Wie in Trance schüttelte Zofia den Kopf. »Nein. Es war Mord.«
Fassungslos betrachtete er sie. »Wieso Mord? Wie willst du das wissen?«
Für einen furchtbaren Moment dachte er, er habe einen Fehler gemacht. Hatte diese ihm in Wahrheit längst unbekannt gewordene Frau Oskar tatsächlich ermordet? Die Starre, in die sie verfallen war, hatte etwas Erschreckendes, sicher nichts Normales. Plötzlich dachte er, dass der Tee seltsam bitter geschmeckt hatte. Sein Magen zog sich zusammen.
»Ich habe«, sagte Zofia mit großer Eindringlichkeit, »heute Nacht im Traum gesehen, dass Oskar von einem roten Hund zerfleischt wurde. Das ist in der Traumsymbolik eindeutig ein Zeichen dafür, dass jemand umgebracht wird.«
Das klang jetzt nicht nach Geständnis, dachte er, und sein Magen lockerte sich.
»Stimmt es, dass du ihn gestern gesehen hast?«, fragte er.
»Ja, ich war bei ihm einkaufen. Er hat sich verrechnet.«
»Du hast ihm den Tod gewünscht. Das weiß das ganze Dorf.«
Eine Falte bildete sich auf Zofias Stirn. »Also, das war ja nun wirklich nicht so gemeint.«
Leo zuckte mit den Schultern. »Das Problem ist halt, dass die da unten jetzt denken, dass du ihn ermordet hast.«
Sie lachte heiser auf. Es war ein Lachen, das von den negativen Erfahrungen aus vielen Jahren hier genährt war.
»Warum wundert mich das nicht?«, fragte sie. »Die Hexe hat Oskar aus Rache vergiftet. Was für eine schöne Geschichte, was für ein schönes Märchen.«
»Es geht noch weiter!«, rief er und spürte, wie die Wut wieder zurückkam. »Ich soll dir dabei geholfen haben. Voll logisch: Denn Oskar ist zeitgleich mit meinem Erscheinen im Mostler gestorben.«
Sie stieß die Luft aus. »Sie sind so furchtbar. So bösartig.«
»Ich will das jedenfalls nicht auf mir sitzen lassen«, sagte Leo entschlossen.
Zofia wandte den Kopf ab und strich mit einer fahrigen Bewegung durch ihr Haar. Ihre Finger zitterten. Ihre Stimme klang brüchig, als sie ihn schließlich wieder ansah und sagte: »Aber was willst du tun gegen ihr blödes Gerede?«
Leo starrte in den Himmel. »Du glaubst, dass hier ein Mord geschehen ist. Vielleicht stimmt das. Ich will herausfinden, was wirklich passiert ist. Das bin ich nicht nur uns beiden, sondern auch Oskar schuldig!« Als sie schwieg, fügte er hinzu. »Bist du dabei? Willst du mit mir diesen Mist hier aufklären? Den Idioten das Maul stopfen?«
Er konnte ihren inneren Kampf fühlen. Sie hatte viel mitgemacht, sie war eine Ausgestoßene, so wie er es hier gewesen war. Sie fragte sich wohl, ob es sinnvoll wäre, die Stimme zu erheben. Wozu sich überhaupt mit dem Mob im Dorf beschäftigen, so enttäuscht und erschöpft, wie sie war.
»Die geben uns doch keine Chance«, sagte sie leise. »Egal, was wir tun.«
»Dir ist es lieber, dich hier zu verstecken, als etwas zu unternehmen?«, fragte er.
Statt einer Antwort stellte Zofia die Tasse mit dem Tee ab. »Ich sollte dir etwas zeigen.«
Als sie wenig später aus dem Haus kamen, lief ein kleiner Cocker Spaniel mit hellbraunem Fell auf sie zu. Er begrüßte Leo schnüffelnd, dann sprang er freudig an Zofia hoch.
»Na du«, sagte sie und streichelte dem Hund über den Kopf. »Warst du wieder im Wald?«
»Ist das deiner?«, fragte Leo. Er beugte sich hinunter und kraulte das weiche Fell des Hundes, was sich dieser nur zu gern gefallen ließ.
»Tiere gehören niemandem, aber ja, ich sorge für ihn.«
»Lebt nur er bei dir hier oben?«
»Er ist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann.«
»Wie heißt er?«
Sie wurde ernst. »Er hat keinen Namen. Namen sind was für Menschen. Ich nenne ihn Hund.«
Es ist, was es ist, dachte Leo. Warum einem Tier einen menschlichen Namen geben, wenn man mit Menschen keine guten Erfahrungen gemacht hat?
Der Hund ohne Namen spitzte die Ohren und ließ von Zofia ab. Er hatte wohl irgendein anderes Tier im Garten bemerkt, denn er rannte wie ein Pfeil los und hinein in die Büsche.
Als Leo seinen Blick wieder Zofia zuwandte, erkannte er, dass sie sich unbemerkt ein großes Stück entfernt hatte. Wie hatte sie denn das so rasch hinbekommen? Sie befand sich plötzlich vor der Hauswand. Als er verwundert näher kam, entdeckte er neben ihr auffällige Kratzer in der Holzwand.
»Was ist das?«, fragte er. Bei genauerem Hinsehen konnte er in den inzwischen dunkel gewordenen Rillen einen Schriftzug ausmachen: »Hexe«. Doch da stand noch mehr. »Verschwinde von hier!!!«
Ungläubig starrte Leo Zofia an, deren Miene wie versteinert war.
»Wann ist das passiert?«, fragte er und fuhr die Buchstaben mit den Fingern nach. Es fühlte sich an, als wäre schon etwas Moos darübergewachsen. »Das ist doch nicht erst heute eingeritzt worden.«
»Nein. Ist zwei Wochen alt. Wenn das heute entstanden wäre, stünde da ›Mörderin‹.«
Sie hatte Sinn für schwarzen Humor, das musste er ihr lassen.
Noch einmal studierte er die eingravierten Linien. »Könnte mit einem Messer gemacht worden sein«, murmelte er. »Oder mit einem … Taschenfeitel.«
In Leo blitzte ein brutales Bild auf, das sich bereits tief in sein Gedächtnis gegraben hatte: der Feitelverein, geeint im Mostler, und seine perverse Parade von gezückten Messern.
»Hast du gesehen, wer das getan hat?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Es war in der Nacht. Die müssen leise gewesen sein. Ich habe nicht gehört, dass jemand bei mir war. Ich schlafe wie ein Baby, außer ich habe Alpträume.«
»Und dein Hund? Hat der nicht angeschlagen?«
»Er war im Haus. Er ist wie ich. Wenn er schläft, schläft er.«
Leo blickte sich um. Da war kein Zaun, jeder hätte sich dem Hof in der Nacht nähern können. Es war fast schon zu einfach, sich heranzuschleichen, um eine gewalttätige Botschaft in die hölzernen Wände zu ritzen, ohne bemerkt zu werden.
»Ist dir sonst etwas aufgefallen?«
»Ich habe am nächsten Tag ein Foto gemacht, um nichts zu vergessen.«
»Zeig mir das Bild.«
Nach kurzem Zögern – die Sache belastete sie sichtlich – verschwand sie im Haus und kehrte gleich darauf mit einer ungewöhnlich großen Kamera zurück.
»Die meisten Menschen machen ihre Schnappschüsse ja nur noch mit dem Handy«, sagte Leo angesichts des massiven Apparats und des unhandlichen Teleobjektivs. War das ein analoges Liebhaberstück oder schon digital?