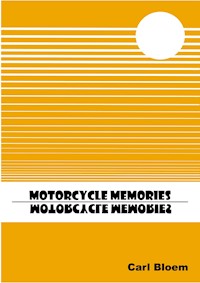
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist 1994. Carl besucht von Vancouver aus, wo einige seiner Verwandten leben, mit einem günstig erworbenen Motorrad, aber ohne Führerschein und einem riskant knappen Budget, die Vereinigten Staaten von Amerika. Während sich Carl mit Mühe durch den Nordwesten quält, fast von einer Klippe stürzt, ständig kurz vor der Pleite steht, auf ärztlichen Rat hin eine Augenklappe trägt und manchmal einfach nicht mehr weiter weiß, wird es langsam Sommer. Je weiter er nach Süden reist, um so mehr ist er sich im Zweifel darüber, ob seine Fahrt unter einem guten Stern steht. In San Francisco wird er zum Sex genötigt. Im Death Valley treibt in der Hunger ins Delirium. Aber während er sich weiter vorwärts schleppt, passiert im entscheidenden Moment immer das Richtige und der Sinn seiner Fahrt offenbart sich ihm in diesen wichtigen kleinen Augenblicken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl Bloem
Motorcycle Memories
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vor der Abfahrt
Der Zyklop von Ruby Beach
Unterwegs
San Francisco Nights
Grateful Dead
Stadt der Engel
An der Küste
Sirenen und Vulkane
Elche und Bären
Spätabends in Montana
Im Norden
Epilog
Impressum neobooks
Vor der Abfahrt
Wie so oft saß ich an der Bar. Ich mochte Bars. Das zwanglose Gespräch oder das stille Beobachten. Es tat sich immer etwas in Bars. Es ergaben sich Möglichkeiten. Oder Kinnhaken. Auf Zypern war ich einmal von der Wucht einer geraden Rechten vom Barhocker direkt auf eine Parkbank auf der gegenüberliegenden Straßenseite befördert worden. Der Schlag hatte wahrscheinlich nicht die Wucht, aber mir fehlt bis heute die Erinnerung für diesen Sprung von 75 Metern. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wir waren Downtown. Downtown Vancouver, British Columbia. Vor nicht einmal zwei Tagen war ich mit einem einfachen Flugticket in Kanada gelandet und besuchte zum ersten Mal meine Tante und ihre Familie in der neuen Welt. An diesem Abend waren meine Cousine, ein paar ihrer Freunde und ich in die Stadt gefahren, um uns zu amüsieren. Die Bar, die wir als Erstes betraten, war groß, modern, hell eingerichtet und nahezu antiseptisch sauber. Wir machten es uns in einer Sitzgruppe gemütlich und plauderten ein wenig. Ich beobachtete das Service-Personal dabei, wie sie über den blitzblanken Boden hetzten und fragte mich, wann der Kellner, der uns vor zehn Minuten zum ersten Mal bemerkt hatte, sich zu einem Besuch an unseren Tisch hinreißen lassen würde. Irgendwann, nachdem ich bereits aufgegeben hatte, kam er dann tatsächlich, aber weder bei der einzelnen Frage noch nach der kompletten Bestellung, ließ er ein Lächeln sehen. Er notierte stumpf die einzelnen Getränke und schob wieder ab. Das Service-Konzept war möglicherweise auf das klinische Interieur abgestimmt, dachte ich. Die Drinks ließen wir uns trotzdem schmecken.
Die Bar füllte sich immer mehr und die Geräuschkulisse hob an. Nach ein paar Runden bekam meine Cousine Schlagseite und kuschelte sich an ihren Freund. Die Gespräche der Freunde wurden immer persönlicher und da ich die Gruppe nicht kannte, verzog ich mich an die Theke, um in Ruhe ein paar Getränke zu ordern, bevor es möglicherweise weiter ging. Der Barmann war deutlich fixer, als die Kollegen an den Tischen und es blieb ihm neben der Arbeit immer noch ein wenig Zeit zum Plaudern.
Nach ein paar Minuten gesellte sich ein anderer Gast zu uns und stieg direkt mit ins Gespräch ein. Er hieß David, kam gelegentlich in diese Bar, kannte den Mann am Zapfhahn, verstand sich aufs Trinken und war ein ausgezeichneter Gesprächspartner.
Ich lud ihn auf ein Bier ein und nach einer Weile belangloser Plauderei fragte mich David:
„Was willst du eigentlich hier machen?
„Wollte mich ein wenig umsehen. Mal runter nach Kalifornien vielleicht", entgegnete ich. "Und wie?" fragte er.
„Keine Ahnung. Mit dem Bus", vermute ich.
Er lachte. Das war das Dümmste, was er je gehört hatte.
„Keiner fährt mit dem Bus, wenn er was erleben will", sagte er und schüttelte den Kopf, alte Frauen und Kinder fahren mit dem Bus .Er prostete mir zu und zwinkerte.
„Ich hab's verstanden, aber welche Alternativen habe ich? Ein Auto ist zu teuer", stellte ich fest.
„Fahr Motorrad", sagte er kurz.
„Würde ich gern. Ich habe aber nur einen 80er Führerschein!“
„Achtzig, was?", grunzte er verdutzt. "Was heißt das?“
„Das heißt, dass ich nur Mopeds bis 80 ccm fahren darf", fügte ich lakonisch hinzu.
„Zeig mir mal deinen Führerschein", bat er.
Ich gab ihm das rosa Faltblatt, das ich 1987 so stolz in Empfang genommen hatte und wartete, was er dazu zu sagen hatte.
„Was ist denn das?", lächelte er, "Und was bedeuten diese ganzen Stempel und ausgestanzten Stellen? Steht das hier auch irgendwo auf Englisch?“
„Stempel heißt, das darfst du. Loch heißt, du darfst nicht. Vorne steht nur Driving License auf Englisch drauf. Das war's." Er grinste.
„Hier gibt es keinen Menschen, der deutsch spricht, geschweige denn, deutsch lesen kann. Du kannst also Motorrad fahren?" fragte er spitz.
„Klar. Kann ich. Das Prinzip ist ja immer gleich, ob jetzt mit 80 oder 800 Kubik", raunte ich.
„Genau", bemerkte er knapp. Мein Vetter hat zufällig einen Hobel in der Scheune, den er loswerden will. "Interesse?“
Was für eine Frage. Ich war in der Falle. Voll angefixt. Tausende Bilder spukten sofort durch meinen Kopf. Ich saßfest. War voll geleimt.
„Schreib mir mal deine Telefonnummer auf. Ich melde mich morgen", sagte ich, zahlte die Drinks und ging zurück zu meinen Leuten, die sich bereits im Aufbruch befanden. Wir fuhren noch auf eine Party, aber ich war abgelenkt und als wir endlich zu Hause waren, lag ich mit offenen Augen im Bett und fand zuerst keinen Schlaf.
David's Vetter Will lebte etwas außerhalb von Maple Ridge, was nicht allzu weit vom Haus meines Onkels entfernt war. Meine Tante hatte mir ihren Wagen geliehen und ich wackelte mit viel zu weichen Stoßdämpfern über eine ausgewachsene Buckelpiste zum Gehöft des Verkäufers. Als ich meinem Onkel Rudi beim Frühstück eröffnete hatte, dass ich erwog, mit einem Motorrad seine Wahlheimat zu erkunden, war er nicht gerade begeistert gewesen. Er wusste zwar, dass ich fahren konnte, war sich aber auch darüber im Klaren, dass ich keinen gültigen Führerschein besaß. Ich beschrieb ihm in glühenden Worten, wie optimal die Wahl des Motorrades sei, wie preiswert die Fortbewegung im Vergleich zu anderen war, wie lange ich nun schon mein Moped fuhr und so weiter und so fort. Nach etwa fünfzehn Minuten winkte er ab.
„Also gut", sagte er, "aber erzähl es ja nicht deiner Tante, dass du keinen Führerschein hast.“
„Im Leben nicht", jubelte ich. "Ach, und könntest du mir vielleicht noch 180$ für die Versicherung vorstrecken, wenn ich den Hobel kaufe?“
Eine paar Stunden später stand ich vor der Maschine. Es war eine Honda CB 400 Hawk. Das Teil war schwarz, hatte einen roten und einen goldenen Streifen auf dem Tank, zwei Außenspiegel, einen Sturzbügel am Motor und so eine gepolsterte Heulsusenstange am Ende der Sitzbank. Das Monstrum deckte sich nicht mal annähernd mit meinen romantischen Tagträumen letzter Nacht. Aber so gar nicht.
„Willste mal ne Runde drehen?", fragte Will.
„Klar", sagte ich.
Als ich mit dem Prügel ohne Helm die famose Schlaglochpiste entlang bretterte, verlor der Anblick seinen Schrecken. Der Wind griff nach meinem Haar und ich fühlte in mir die Euphorie mit zunehmender Drehzahl ansteigen. Der Weg schüttelte mich ordentlich durch. Die Felder, die an mir vorbei eilten, wiegten sich im Wind und die Maisonne sowie das Adrenalin wärmten mich wie ein samtener Mantel.
„600$? Vergiss es", antwortete ich Will, als wir beide vor der Scheune in die Verhandlung einstiegen.
Will musterte mich und wog ab. Mein Gesicht war wie ein Stein. Der Hobel hatte so viele Spinnweben angesammelt, dass ich gelassen in die Verhandlung einsteigen konnte. Als Nächstes versuchte er, mir den ganzen Rotz wie den zweiten Spiegel und die Sissybar als Extras zu verkaufen.
„Das ist das Erste, was ich von dem Moped runterschraube. Kannst du gleich hier behalten", entgegnete ich. "Мach mir mal einen vernünftigen Preis, nicht diesen Touristenquatsch.“
Er tänzelte, kaute auf seiner Unterlippe herum und brachte halb fragend eine 500 heraus.
Ich sah den Haufen Eisen, wieder als das, was es war. Ein Albtraum aus Dreck und Schmiere. Ich schüttelte den Kopf.
„Entschuldige, dass ich deine Zeit in Anspruch genommen habe, aber ich dachte David hätte zu dir gesagt, dass ich höchstens 300 anlegen kann.“
„Sorry", legte ich nach, schaute auf den Boden und schob ein bisschen Dreck mit der Fußspitze hin und her. David war nicht da und Will wurde langsam nervös. Sein Kopf drehte sich hilfesuchend nach rechts und links und sah aus wie ein Wetterhahn an einem stürmischen Tag.
„300 300 300", wiederholte er wie ein Mantra. Als ließe sich damit irgendetwas beschwören. Aber er kam nicht weiter und ich merkte, wie er auf der Stelle trat. Er brauchte einen kleinen Schubs.
„Hör zu", sagte ich nach einer längeren Pause, mein Onkel hat mir heute morgen noch 50 Dollar zugesteckt, damit ich mir neue Kleidung kaufe, aber ich finde meinen Kram eigentlich völlig in Ordnung."
Ich drehte mich im Kreis, als würde ich versuchen, ihm meine zerbeulte Jeans anzudrehen und grinste blöde.
„Also", klärte ich, "50 bringe ich. Deal?“
Und er fiel. Ich hatte nun ein Motorrad und bereits die Hälfte meines gesamten Geldes auf den Kopf gehauen. Ich fühlte mich großartig.
Während ich mit dem Wagen meiner Tante den kleinen Weg zurück eierte, überlegte ich angestrengt, wo ich jetzt noch den ganzen nebensächlichen Kram wie Helm, Handschuhe, Jacke, Zelt und Schlafsack herbekam, ohne meine restlichen Mücken zu verbraten, kam aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Als ich in Pitt Meadows das Haus meiner Tante erreichte, war bereits Essenszeit. Zumindest das Problem konnte ich kurzfristig in den Griff kriegen. Mein Magen hatte schon während der gesamten Rückfahrt mit dem quietschenden Stoßdämpfer um die Wette gebellt. Es war Samstag und die komplette Familie war da. Es gab Fleisch vom Grill, Salat und Brot. Da es von allem reichlich gab, war mein Magen kurzfristig beruhigt.
Nach Rücksprache mit meinem Onkel eröffnete ich den Anwesenden meine Reisepläne und wies gleich am Anfang auf das Problem mangelnder Ausrüstung für die Fahrt hin. In den nächsten zwei Stunden wurde fleißig telefoniert und in den darauf folgenden drei Tagen fand sich allerhand Ausrüstung für die Fahrt im Hause meines Onkels und meiner Tante ein. Es war der Wahnsinn. Soviel Pioniergeist und Hilfsbereitschaft verschlug mir die Sprache. Jeder, der kam und etwas vorbei brachte, fragte mich neugierig nach meinen Plänen, bezeugte Hilfsbereitschaft beim Start und gab ein paar Ratschläge für das Leben auf der Straße dazu. Auf meine Frage, wann die jeweiligen Verleiher ihre Stücke wieder zu haben wünschten, wurde mir nur lapidar entgegnet:
"Wenn du wieder da bist. Gute Fahrt und viel Spaß"
Es war der Hammer. Ich bekam ein Zelt, einen Schlafsack, einen Kocher, diverse Kleinteile für die Essenszubereitung, Werkzeug, einen Australian Duster und einen Tankrucksack. Dazu kaufte ich mir in einem Gebrauchtwarenladen einen ausgemusterten Helm des Seattle Police Department, eine verspiegelte Sonnenbrille und ein paar hellbraune Lederhandschuhe. Ich war fertig. Es konnte losgehen. Aber wohin? Wo wollte ich eigentlich hin?
Es war ein Mittwoch, als ich mich auf den Weg machte. Die Wolken, denen ich Richtung Westen entgegen fuhr, waren monströs. Ich fuhr auf der 7, überquerte den Pitt kurz bevor er mit dem Fraser River zusammenstieß, vorbei an Coquitlam und Port Moody Richtung Vancouver. Ich fuhr durch die Stadt. Ich hatte es nicht eilig.
Nachdem ich das Nummernschild besorgt und das Moped abgeholt hatte, hatte ich mich erst einmal mit meiner neuen Reisebekanntschaft vertraut gemacht. Das Motorrad lief verlässlich. Der windgekühlte Motor bot wenig Überraschungen beim Punch, aber das Baujahr konnte bereits einen elektrischen Starter vorweisen. Die Trommelbremsen taten ihren Job und durch den hohen Lenker war die Sitzposition für mich erträglich, obwohl ich aber auch weniger Gefühl für die Straße hatte.
Ich legte einen hohen Gang ein und fuhr mit mäßiger Drehzahl zwischen dem Berg, auf dem die Universität lag und dem Südufer des Burrard Inlet durch, folgte dann der Hastings weiter Richtung Westen, durchquerte letztlich den Stanley Park und verließdas Gewirr der Straßen über die Lions Gate Bridge, von der Douglas Coupland in ein oder zwei Jahren schreiben sollte, sie sei wie aus flüssigem Zucker gesponnen. Vielleicht hatte er es aber auch bereits geschrieben und es lag irgendwo in seiner Schublade herum und wartete mit den anderen Geschichten darauf, endlich von Harper Collins in New York verlegt zu werden.
Ich hatte Glück. Zwei der drei Spuren waren für die Pendler stadtauswärts freigegeben. Ich spürte das Salz mit einem leichten Kribbeln auf meiner Haut und kniff die Augen etwas zusammen, als ich den Gashahn langsam drehte und die Maschine mit einem verbindlichen Zug nach vorne strebte. Es war 1994 und es wurde bald Sommer.
Der Zyklop von Ruby Beach
Sure Shot von den Beastie Boys dröhnte aus meinen Kopfhörern, als ich die Horseshoe Bay erreichte. Ich hatte mir die Kassette am Tag der Veröffentlichung frisch aus dem nächstgelegenen Musikladen geholt und mein Walkman hatte die Bandlaufrichtung nun schon ein halbes Dutzend mal gewechselt. Der Sound lief einfach die ganze Zeit durch und ich bekam gar nicht genug davon. In meinem begrenzten Gepäck befand sich noch das Album Dookie von Green Day, Ritual de lo Habitual von Jane's Addiction und Gish von den Smashing Pumpkins. Mehr war nicht drin. Mehr Platz hatte ich nicht.
Die Fähre legte gegen drei Uhr nachmittags ab und brachte mich in etwa eineinhalb Stunden nach Nanaimo auf Vancouver Island. Meine erste Nacht verbrachte ich außerhalb von Port Alberni am Beaver Creek. Ich hatte auf das Zelt verzichtet und fand mich am nächsten Morgen etwas klamm und wahllos zerstochen beim Frühstück wieder. Die Wolken hatten sich zu einer geschlossenen Decke ausgebreitet und als ich am Vormittag Richtung Mount Underwood aufbrach, lag bereits Regen in der Luft. Die Karten der BCAA (British Columbia Automobile Association), die mein Onkel mir noch vorsorglich zugesteckt hatte, wiesen in der Gegend südwestlich von Mount Hooper wenige Straßen mit Asphalt aus, was ich auf meinem Weg zum Cowichan Lake leidig erfahren musste. Mehr als einmal sprang mir der Bock auf der Schotterpiste aus der Bahn und ließ sich nur unter Mühen wieder in die gewünschte Spur lenken. Als ich gegen Abend Victoria erreichte, war ich froh, dass ich noch halbwegs geradeaus schauen konnte und erwischte nur knapp die letzte Fähre nach Port Angeles. Auf der kurzen Überfahrt setzte dann der graugrüne Regen ein.
Regen. Nichts als Regen. Ich lenkte meine Maschine von der Straße in ein flaches Waldstück. Meine Sicht endete im Lichtkegel des Scheinwerfers. Es regnete nun schon seit mehreren Stunden und wenn es noch eine einzige trockene Stelle an mir gab, so hatte ich keine Idee, wo diese sein konnte. Im Nordwesten des Washington State befand ich mich und hatte doch nicht die geringste Ahnung, wie es dort aussehen mochte. Bäume, noch mehr Bäume, eine Straße und Regen in allen Variationen. Dicke platschende Tropfen, mittlere weiche Blasen oder kleine Fäden wie Nadelstiche. Ich hatte Wasser gesehen, das der Schwerkraft trotzte und von unten nach oben meine Sachen durchfuhr. Ich war nass, müde und kalt. Dörfer mit Namen wie Elwka, Sappho und Beaver waren an mir vorübergezogen und hatten doch keine Erinnerung hinterlassen.
Meine Hände zitterten. Es war spät. Ich quälte mich von meinem Motorrad herunter und versuchte mehrfach die Maschine aufzubocken. Der Boden war aber so weich, dass mir der Hobel dabei immer wieder zur Seite wegbrach. Mit letzter Kraft stellte ich das Krad an einen Baum und versuchte im Scheinwerferlicht die Zeltstangen zu organisieren. Nach einer halben Stunde stand das Zelt, meine Füße steckten im Schlafsack und mein Kopf fiel mit einem dumpfen Klatschen auf den nassen Boden.
Wo ist eigentlich meine Taschenlampe? Über diese Frage schlief ich schließlich ein.
Die Brandung weckte mich kurz nach Morgengrauen. Ich öffnete ein Auge und sah Licht durch die Zeltplane. Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Es war etwas mit den Augen. Dem rechten Auge. Es war zu und verklebt und ließ sich nicht öffnen. Ich suchte nach einem Spiegel und wurde langsam nervös.
Was ist mit dem Auge?, dachte ich. Warum sehe ich nichts? Wo ist der Spiegel? Habe ich überhaupt einen Spiegel?
Die Gedanken tanzten wild durch meinen Kopf und brachten mich in Schwung. Mir fiel ein, dass ich gar keinen Spiegel dabei hatte, nicht hier, hier im Zelt, aber natürlich am Motorrad. Ich öffnete den Reißverschluss vom Schlafsack, öffnete das Zelt und richtete mich draußen zu meiner ganzen Größe auf. Bei meinem Blick nach vorne überfiel mich Schwindel. Der Pazifik lag vor mir groß und gewaltig und nichts trennte mich mehr von ihm außer zwei Fuß breit stoppeliger Erde. Ich fiel rückwärts über das Zelt, griff reflexartig nach den Stangen und Schnüren und kauerte mich auf dem Boden zusammen. In der kompletten Dunkelheit der Nacht bei dem strömenden Regen war mir dieses wichtige Detail wohl entgangen, die Klippe.
Ich kroch zurück zum Rand und schaute hinunter. Es ging etwa fünfzehn Meter steil nach unten. Unter mir lagen ein paar lose Felsen. Der Sand war blass gelb, die Steine grau und die Stimmung in meinem Magen hätte ich mit der Farbe grün beschrieben. Das wäre mein Ende gewesen. Dort unten auf dem Steinhaufen im fahlen Licht irgendeines Morgens hätte mich eine Kleinfamilie aus Idaho bei der Suche nach der schönsten Muschel des Ozeans entdeckt. Ein ausgemergelter, klatschnasser Leichnam in einem Australian Duster, englischen Doc Martens, einem T-Shirt der New York Mets und mit einem Helm des Seattle Police Department. Was für einen herrlichen Anblick hätte ich dort abgegeben, an diesem ruhigen Ort.
Die Wellen schlugen gegen den flachen Strand und auf einer kleinen vorgelagerten Insel, die mehr wie ein großer achtlos hingeworfener Stein aussah, standen ein paar verlorene Bäume. Die See war rau und zeugte noch von dem Sturm vergangener Nacht. Es war nicht ungewöhnlich, dass ich in meinen Stiefeln schlief, aber dass ich noch den Helm trug, las sich für mich beim genaueren Betrachten meiner geschriebenen Notizen doch etwas ungewöhnlich. Aber was machte es schon?
Ich lebte, zumindest scheinbar und hauptsächlich. Irgendetwas war mir doch im Kopf herumgegangen, bevor das alles passiert war, bevor ich aus dem Zelt kam.
Was war das noch?
Ich drehte mich auf den Rücken und starrte in den Himmel. Hier sah alles normal aus. Der Himmel hing am rechten Platz und auch wenn mir die neu aufziehenden Regenwolken gar nicht gefielen, so war ich doch froh, dass alles seine Ordnung hatte. Zumindest dort oben. Hier unten war ich vollends mit Dingen beschäftigt, die meine morgendliche geistige Flexibilität aufs Äußerste strapazierten und ich konnte mich immer noch nicht daran erinnern, warum ich eigentlich so rasch das Zelt verlassen hatte, nur um dann zu bemerken, dass der Tod keine fünfzehn Zoll vor mir lauerte und er kleine Fehltritte zwar nicht als sonderlich spektakulär, so doch für durchaus dienlich erachtete.
Neuerliche Wolken zogen von links in mein Gesichtsfeld und verloren sich alsbald hinter meinem Nasenrücken. Träge große Tränensäcke aus müden Gesichtern schwimmen durch mein Bild und stoßen gegen die Steilwand meines Riechorgans. Das Bild wirkt diffus. Als das Adrenalin sich wieder abgebaut hatte, überfiel mich eine schwere Müdigkeit. Meine Nebennieren stellten die Produktion ein und mein Schließmuskel entspannte sich. Ich dachte darüber nach, dass eine Blasenentleerung anstand, mein Magen knurrte und mein rechtes Auge nicht sehen konnte. Weiter kam ich nicht. Dann döste ich ein. Es rauschte. Ich fühlte mich wie ein alter Baumstamm im Wasser. Voll gesogen schwamm ich beharrlich weiter, obwohl ich fast doppelt so schwer war wie vorher. Ich konnte nicht untergehen.
Langsam kam ich wieder zu mir. Der Hunger trieb mich an aufzustehen. Aus den klammen Taschen meines Tankrucksacks brachte ich so etwas wie ein Frühstück hervor. Trockenfleisch, kandiertes Obst und ein paar Nüsse. An der Grenze waren mir alle frischen Lebensmittel abgenommen worden. Besonders auf Früchte und Gemüse hatten es die Zollbeamten abgesehen. Sie nannten als Grund Seuchenverschleppungsgefahr. Nachdem ich die fünf Orangen, die ich nicht bereit war dem Müll zu überantworten, brav geschafft und gegessen hatte, durfte ich einreisen. Den Durchfall und die damit verbundene mehrfach vorgenommene Darmentleerung wurde aber von den Behörden in Kauf genommen und von mir ordnungsgemäß in US-amerikanischen Bio-Kreislauf eingeschleust. Während ich nun auf den kandierten Aprikosen herumkaute, bemerkte ich wieder die Beeinträchtigung meines Sehfeldes. Ich betastete vorsichtig mein rechtes Auge und fand eine harte, klebrige Kruste auf dem Lidrand und in den Wimpern. Es war mir unmöglich das Auge ganz zu öffnen. Eigentlich war es mir überhaupt nicht möglich das Auge zu öffnen. Ich nahm lediglich Licht und Schatten durch den geschlossenen Augendeckel wahr. Ich blinzelte und schaute nach unten. Vor meinem rechten Schuh kroch ein schwer gepanzerter schwarzer Käfer durch das Gewirr aus Gras, Steinen und Sand. So ein Käfer kam bei uns zu Hause relativ häufig vor, dachte ich. Hier hatte ich bislang noch keinen von ihnen gesehen. Der kleine Kerl hatte große Geweihe an seinem Kiefer, mit denen er sich arg schwer tat. Völlig unnütz erschienen mir diese Kieferauswüchse schon in Anbetracht dessen, dass er sich lediglich von Pflanzensäften ernährte und diese Ausrüstung nur für den Kampf mit einem Konkurrenten brauchte, wenn es um die Herzdame ging. Schmiss er also im Zweikampf den Gegner vom Ast oder auf den Rücken gewann er und durfte sich paaren. Für die tägliche Routine war es aber völlig unnütz. Er benötigte sogar häufig die Hilfe des Weibchens, um satt zu werden. Was für einen Ballast die kleinen Kerle da mit sich rumschleppen müssen, dachte ich. Ist ja unglaublich!
Ich war wieder halbwegs in der Reihe und verstaute den ganzen klammen Krempel auf meinem Bock. Meine Stiefel waren komplett durchgeweicht. Ich befestigte die Doc's hinten am Motorrad und machte mich auf die Suche nach einem Augenarzt. Das war gar keine so leichte Aufgabe, wie ich bemerkte, denn rund um Ruby Beach gab es nicht mal eine richtige Stadt. Daher fuhr ich meine Route Richtung Süden auf der 101 einfach weiter und wartete ab. Nach etwa zwei Stunden erreichte ich Aberdeen und als die ersten Ampeln auftauchten, bemerkte ich den Vorteil von dreidimensionalem Sehen. Dadurch, dass mein rechtes Auge vollständig die Arbeit verweigerte, hatte ich mich mit Hilfe meiner linksseitigen Kapazität zwar bislang recht ordentlich fortbewegen können, aber nun, hier in der Stadt, war meine Tiefenwahrnehmung gefordert und so kam es, dass ich entweder drei Meter vor oder ein Meter hinter einer Ampel zum Stehen kam. Alles nur Übungssache, sagte ich mir. Klar.
Aber ich war hungrig, suchte nach einem Arzt und mein Aggregatzustand wechselte erst allmählich von flüssig zu feucht. Mittlerweile waren meine Turnschuhe ebenfalls durchgeweicht und ich wollte wieder meine Stiefel anziehen, als ich bemerkte, dass der Platz auf dem Soziussitz, wo die Stiefel trocknen sollten, leer war. Der Tag wurde immer besser.
Beim Augenarzt zahlte ich in bar. Ein Besuch, ein paar Tropfen und eine Augenklappe, das macht 42 Dollar. Nicht, dass ich eine Wahl gehabt hätte, steckte doch mein ganzes Vermögen, etwa 160 Dollar, sauber aufgerollt und leicht nass in meinem Tankrucksack. Eine Kreditkarte besaß ich nicht. Wer sollte mir auch einen Kredit geben?
Die Sprechstundenhilfe machte gleich von Anfang an deutlich, dass ich erst einmal dreißig Dollar auf den Tisch legen sollte, um einen Termin zu bekommen. Nach dem Termin bezahlte ich nochmal neun Dollar für das Medikament und drei Dollar für eine Augenklappe. Die Diagnose war eine Bindehautentzündung, wobei dem Auge besonders die Zugluft zu schaffen machte.
„Vermeiden sie es mit dem Motorrad zu fahren", hatte der Arzt mir eröffnet. "Das Auge braucht Ruhe."
Er sah mich mit seinen beiden gesunden Augen ruhig an.
„Machen Sie Witze? Ich muss weiter", entgegnete ich. "Das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ich muss nach Süden. Ich muss arbeiten. Gibt es keine Alternative?", bat ich.
„Tragen sie eine Augenklappe", sagte der Arzt daraufhin. Der Gedanke gefiel mir.
„Wo bekomme ich so ein Ding her?", fragte ich.
„Ich schreib's auf", sagte der Arzt und drückte mir etwas Mull in die Hand. Mein linkes Auge schaute ihn fragend an.
„Ich verschreibe ihnen eine Tinktur. Tränken sie damit zweimal täglich etwas Mull und legen sie es auf das erkrankte Auge. Decken sie dann das Auge mit der Klappe ab. Sie erhalten alles vorne beim Empfang. Geben sie einfach diesen Zettel ab", sagte der Doktor und hielt mir ein grünes Papier hin.
Ich nahm den Zettel und schwärmte, "Alles klar, Käptn. Besten Dank!“





























