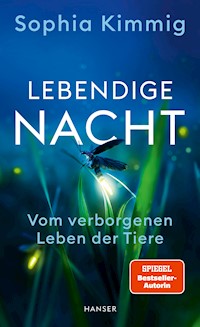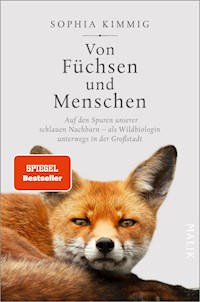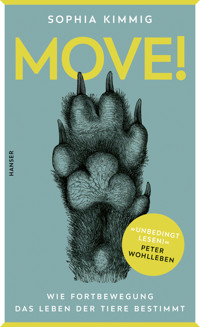
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Polarfüchse, Aale, Schmetterlinge: wie ihre scheinbar selbstverständliche Fortbewegung das Leben auf der Erde revolutionierte. »Unbedingt lesen!« Peter Wohlleben Ein Flügelschlag hin zu einem sicheren Rastplatz, ein Sprung in neues Territorium – Fortbewegung scheint selbstverständlich und ist doch entscheidend für das Leben auf der Erde. Die Mobilität der Tiere war für ihre Entwicklung revolutionär und gab ihnen Freiheit: Der Polarfuchs wandert über gefrorene Meere, Schmetterlinge ziehen tausende Kilometer weit und Aale schwimmen auf geheimnisvollen Wegen durch die Ozeane. Doch diese unglaubliche Fähigkeit hat ihren Preis: Sie macht verletzlich. Sophia Kimmig nimmt uns mit auf eine packende Reise durch die Welt der Fortbewegung – von Schwimmversuchen über den ersten Schritt an Land bis zu den spektakulären Wanderungen unserer Zeit. Die faszinierende Betrachtung eines der großen Phänomene des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Polarfüchse, Aale, Schmetterlinge: wie ihre scheinbar selbstverständliche Fortbewegung das Leben auf der Erde revolutionierte. »Unbedingt lesen!« Peter WohllebenEin Flügelschlag hin zu einem sicheren Rastplatz, ein Sprung in neues Territorium — Fortbewegung scheint selbstverständlich und ist doch entscheidend für das Leben auf der Erde. Die Mobilität der Tiere war für ihre Entwicklung revolutionär und gab ihnen Freiheit: Der Polarfuchs wandert über gefrorene Meere, Schmetterlinge ziehen tausende Kilometer weit und Aale schwimmen auf geheimnisvollen Wegen durch die Ozeane. Doch diese unglaubliche Fähigkeit hat ihren Preis: Sie macht verletzlich. Sophia Kimmig nimmt uns mit auf eine packende Reise durch die Welt der Fortbewegung — von Schwimmversuchen über den ersten Schritt an Land bis zu den spektakulären Wanderungen unserer Zeit. Die faszinierende Betrachtung eines der großen Phänomene des Lebens.
Sophia Kimmig
Move!
Wie Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt
Hanser
Für Aurelia,
die auf manch steinigem Weg an meiner Seite geht
Sisterhood
Prolog
Während ich diese Zeilen schreibe, klingen von meinem Wohnzimmerfenster her ferne Rufe an mein Ohr. Hell und sirrend summieren sie sich und kommen rasant näher. Die Stimmen vereinen sich zu einer akustischen Welle, türmen sich auf, schwellen an und entladen sich dann im kraftvollen Schrei Dutzender Kehlen. Ein Schrei, der nach purer Freiheit klingt.
Es ist die Freiheit eines Lebewesens, das den Boden in seinem ganzen Leben kaum je berührt. Das in der Luft frisst, trinkt und sogar schläft. Sein luftiges Element, nach dem es im Laufe der Evolution so eindrücklich passend geformt wurde, verlässt es über Monate hinweg nicht ein einziges Mal.
Erneut dringen die Vogelstimmen von draußen herein und ich blicke auf. Die Rufe des Mauerseglers sind lautstark und dennoch melodisch. Dieses energiegeladene Himmelskonzert gehört zu meinen liebsten unter all den Tönen in der Natur. Also stehe ich auf und verlasse meinen Schreibtisch, um auf den Balkon zu treten. Von links nähern sich die Segler in atemberaubendem Tempo. Über den begrünten Hinterhöfen finden sie Beute und so ziehen sie jagend eine Schneise und durchfliegen unter lautem Rufen die Häuserschlucht, nur um sie wenige Minuten später in umgekehrter Richtung erneut zu durchqueren. Sie flattern und gleiten, drehen in rasanten Manövern kurz vor der nächsten Hauswand ab oder überqueren in aberwitzigem Tempo und mit Haaresbreite einen First.
Allabendlich ziehen sie so ihre Kreise und ich beobachte, lausche und staune. Diese Momente sind für mich die Essenz des Sommers. Eine Essenz, die leider flüchtig ist, denn sobald die Tageslänge mitsamt der Dämmerung etwa 17 Stunden unterschreitet, verlassen uns die Vögel bereits für ihre lange Reise gen Süden. Trotz vieler spätsommerlicher Tage und lauer Nächte, die ihrem Aufbruch noch folgen werden, trotz Freiluftkino, Radeln zum Baggersee, Ohne-Jacke-das-Haus-Verlassen und Neue-Eissorten-Ausprobieren fehlt etwas. Jedes Mal, wenn sie gehen, nehmen sie etwas von der Essenz des Sommers mit, tragen es fort.
Noch kann ich abends auf meinem Balkon sitzen und den Rufen lauschen. Manchmal schließe ich dabei die Augen und versuche mir vorzustellen, wie die Welt wohl aus der Perspektive der Vögel aussieht. Wenn man so leicht und frei von jeglichen Barrieren über sie hinweggleitet.
Etwa 10.000 Kilometer liegen zwischen den Brut- und den Überwinterungsgebieten der Mauersegler. Stellen Sie sich vor, Sie müssten 10.000 Kilometer zu Fuß zurücklegen (oder 237-mal in direkter Folge einen Marathon laufen, was etwa auf dasselbe herauskäme). Unvorstellbar, nicht wahr? Dabei wirkt auch diese Zahl noch winzig, wenn man sie mit der folgenden vergleicht: Laut NABU schätzt man die Entfernung, die ein einziger Mauersegler, innerhalb nur eines Jahres, bei all seinen Flügen zurücklegt, auf etwa 190.000 Kilometer.1
In Gedanken verfolge ich ihre Wege, versuche diese unglaublichen Distanzen zu begreifen. Doch sie entgleiten mir, wie es die zarten Vögel am Himmel tun. Was für mich außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt, ist für Abermillionen von Lebewesen da draußen alltägliche Realität. Sie wandern, fliegen und schwimmen um die Welt. Doch auch die vielen kleinen Bewegungen überall — sei es der Regenwurm, der sich durch den Blumentopf auf meinem Balkon wühlt, oder die Ameise, die als Teil einer ganzen Straße von Ameisen systematisch Erledigungen nachgeht — sind in ihrer Gänze nicht begreiflich. Denn das ganze unermessliche Leben auf dieser Erde ist bewegt.
»Leben ist Bewegung, Stillstand ist Tod«, heißt es. Zugeschrieben wird die Aussage unter anderem dem Schweizer Maler und Bildhauer Jean Tinguely, der als einer der bedeutendsten Vertreter der kinetischen Kunst gilt. Also derjenigen Kunstform, die das Bewegte als integralen Anteil ihrer Ästhetik betrachtet. So auch die maschinenartigen, beweglichen Skulpturen, die Tinguely schuf. Groß, bunt und laut oder zart und filigran, aus feinen Drähten oder massiven Zahnrädern zusammengeschweißt, versuchen sie den Geist der Bewegung zu verkörpern. Ob die Zuschreibung des benannten Zitats korrekt ist, bleibt offen. In seinem Manifest »Für Statik«2, das Tinguely1959 in 40.000 Flugblättern aus dem Flieger abwerfen ließ, heißt es jedoch »Es bewegt sich alles, Stillstand gibt es nicht«3. Eine Aussage, die nicht nur radikaler, sondern wohl auch zutreffender ist, zumindest wenn es darum geht, das Lebendige in unserer Welt zu beschreiben.
Werfen wir einen gemeinsamen Blick auf diese Welt. Von oben betrachtet muss sie wie ein gigantischer Ameisenhaufen wirken — überall wimmelt es nur so von Lebewesen, die sich von einem Ort zum anderen bewegen: Fische schwimmen zielstrebig stromaufwärts zurück zum Ausgangspunkt ihres Lebens, um selbst neues Leben zu erschaffen, das demselben Kreislauf folgen wird. Am Himmel ziehen Vögel über Kontinente und Meere hinweg, um dem eisigen Tod im Winter ihrer Heimatgefilde zu entfliehen. Durch das Erdreich graben sich winzige Organismen und zersetzen das, was von denjenigen ihrer Mitgeschöpfe zurückblieb, die nun selbst stillstehen, nachdem ihr Leben endete.
Bewegung zieht sich wie ein roter Faden durch Lebensgeschichten von Organismen, aber auch durch die Geschichte des Lebens selbst. Ob es nun schwimmt, läuft, kriecht, hüpft, watschelt, gleitet, rollt oder fliegt, Bewegung prägt besonders tierisches Leben seit seinen Anfängen. Vor etwa vier Milliarden Jahren legte die Abiogenese (die chemische Evolution) den Grundstein für alles, was ihr im Laufe der biologischen Evolution nachfolgen sollte, als im wild bewegten Chaos der sinnbildlichen Ursuppe anorganische Stoffe aufeinandertrafen und aus lebloser Materie Leben wurde. Seitdem hat das Leben eine unbeschreibliche Vielfalt an Organismen hervorgebracht, die sich fleißig von A nach B bewegen.
Wie viel Bewegungsfreiheit diesen Organismen gegeben ist, unterscheidet sich dabei maßgeblich. Manch ein komplexes, vielzelliges Leben ist überwiegend stationär. Denken wir nur an eine alte Eiche, die im Angesicht von Jahreszeiten und Wetterwechseln, von aufflammenden Kriegen und geschlossenen Frieden, von Generationen von Menschen und Zeitenwenden tief verwurzelt über Jahrhunderte an Ort und Stelle verharrt.
Auch Pflanzen bewegen sich natürlich. Sie schlagen Wurzeln durch das Erdreich und sogar durch Gestein. Sie winden sich um Strukturen, öffnen und schließen ihre Blüten und Blätter oder drehen ihre Köpfe der Sonne entgegen. Wie begrenzt, ja fast gefangen, muss dieses Maß an Bewegungsfreiheit hingegen aus der Perspektive eines Steinadlers erscheinen, der sich von einer Felsenklippe aus kraftvoll in die Lüfte stürzt und sich von der Thermik in schwindelnde Höhen tragen lässt.
Wer möchte nicht lieber Adler sein als Eiche, wenn er an Freiheit denkt? Tiere, inklusive uns Menschen, legen teils unglaubliche Distanzen zurück. Doch wir zahlen für dieses Fortkommen einen hohen Preis. Während pflanzliches Leben modular aufgebaut ist und es dadurch so zäh und widerstandsfähig ist, dass Pflanzen große Teile ihres Organismus verlieren und dennoch überleben können, ist tierisches Leben unitar — einmalig, einzigartig, verletzlich und ultimativ sterblich. Ein immenser Tribut für ein Stückchen Freiheit. Betrachten wir die unglaubliche Komplexität des bewegten Lebens, drängt sich jedoch eine Erkenntnis auf: Ohne diese Freiheit wäre das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, nicht denkbar.
Die Geschichte(n) einer bewegten Welt
In MOVE! wollen wir uns der Vielfalt der Bewegungen der tierischen Welt widmen. Es ist ein Thema, das nicht nur fantastische Einblicke in die wundervolle biologische Vielfalt unseres Planeten bietet, sondern darüber hinaus eine aktuelle Brisanz aufweist: Auch wenn Leben schon immer in Bewegung war und seit jeher komplexen Veränderungen unterworfen ist, stehen wir heute vor nie da gewesenen Herausforderungen. Die Klimakrise macht zunehmend größere Teile der Erde für uns Menschen unbewohnbar. Forschende erwarten in nicht allzu ferner Zukunft klimabedingte Massenfluchtbewegungen, wie es sie seit den Weltkriegen nicht mehr gegeben hat. Menschen fliehen vor den Folgen einer Veränderung, die wiederum von Menschen verursacht wurde. Auch tierisches Leben wird zunehmend zerstreut. Wir verschleppen Organismen und damit ganze Spezies, teils absichtlich, teils ungewollt, und bringen sie in Winkel der Erde, die sie aus eigener Kraft nie erreicht hätten. So gelangen sie an Orte, an denen sich ihre Rolle im Ökosystem radikal verändern kann: Waren sie zuvor Teile eines über lange Zeiträume entstandenen, komplexen Ganzen, die sich in ein eng verflochtenes Netzwerk einfügten, so verwandeln sie sich am neuen Ort in Störfaktoren in einem anderen solchen fein justierten System. Sie werden zu invasiven Arten, die ganze Netzwerke zerreißen. Die Konsequenzen dieser globalen Drift werden wir ebenso betrachten wie die Frage nach den Chancen, die den Veränderungen innewohnen. Menschengemachte Eingriffe in die Umwelt, die manchen Arten neue Wege eröffnen, führen dazu, dass natürliche Massenbewegungen, große Ströme von Individuen über unseren Globus, die die Evolution in Jahrmillionen hervorgebracht hat, innerhalb kürzester Zeit kollabieren. Welche Folgen das hat, können wir nur erahnen.
Tierische Bewegung beschäftigt den Menschen seit jeher und in vielerlei Hinsicht. Schon frühe Höhlenmalereien zeigen Tiere nicht als statische Objekte, sondern erkennbar in Bewegung, im Galopp, auf dem Sprung. Ihr Bewegungsverhalten zu studieren, war wahrscheinlich Teil der menschlichen Überlebensstrategie. Wie schnell oder weit kann ein bestimmtes Tier laufen? Wohin ziehen die Herden dieser oder jener Art?
In der religiösen Vorstellung einer Allbeseeltheit von Naturerscheinungen vieler indigener Kulturen Amerikas konnte dem Erscheinen und Verschwinden von Tieren auch große mythologische Bedeutung jenseits von Nahrungsversorgung innewohnen und selbst im mechanistisch geprägten Europa des Mittelalters bewegten Fragen nach tierischer Migration Philosophen und Denker.
Der Vogelzug oder aus damaliger Sicht vielmehr das unerklärliche Verschwinden Abertausender Vögel jedes Jahr inspirierte zu manch abstruser Theorie. Die sogenannte Aal-Frage4 etwa, die Frage danach, woher die Aale in den Flüssen Europas stammen, beschäftigte Wissenschaftler von der Antike bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, in gewisser Hinsicht sogar bis heute. Denn auch wenn wir heute mithilfe modernster Datenlogger den Vogelzug nicht nur verstehen, sondern bis ins kleinste Detail begleiten können, und obwohl wir nach jahrhundertelangem Rätselraten endlich wissen, dass alle Aale in Europas Flüssen von einem einzigen Ort, der Sargassosee, stammen, geschieht ein großer Teil tierischer Bewegung von uns unbemerkt oder unbeachtet. Über den Zug von Insekten wissen wir beispielsweise ungleich weniger als über den der Vögel. Und auch wenn die Aal-Frage technisch gesehen beantwortet ist, hat kein Mensch je die Fortpflanzung des europäischen Aals beobachten können.
Unser Wissen über tierische Fortbewegung ist bruchstückhaft und unsere Betrachtung häufig zu kleinteilig und begrenzt. Dabei bildet Fortbewegung die Grundlage milliardenfachen Lebens auf unserem Planeten. Wie ein feines Netz zieht sich die Bewegung von Organismen durch Populationen und Ökosysteme. Sie verbindet Orte und Arten und hat dabei eine Vielfalt an Formen und Funktionen erreicht, die uns in ehrfürchtiges Staunen versetzt. Stellen Sie sich nur einmal vor, der gesamte Himmel wäre erfüllt vom Flattern von Tausenden und Abertausenden von Schmetterlingen. Lebewesen, deren hauchzarte Flügel sie dennoch Tausende Kilometer weit tragen.
Lassen Sie uns die einzigartige Welt der tierischen Bewegungen erkunden und gemeinsam staunen. Der vorliegende Text ist eine vielschichtige Betrachtung des bewegten Lebens auf der Erde. Er erzählt von der Koordination gigantischer Schwärme, die es dank abgestimmter Bewegungen schaffen, nicht zusammenzustoßen. Vom Homing Instinct, der auf scheinbar magische Weise Tiere in eine Heimat zurückkehren lässt, die sie selbst nie bewusst erlebten. Von beeindruckenden Flugkünsten, skurrilen Fortbewegungsformen, der Frage nach der richtigen Anzahl von Beinen, globalen Wanderwegen der Tiere, dem fast bewegungslosen Abhängen von Faultieren und vielem mehr. Er ist eine Geschichte von Anpassung und Veränderung, Verletzlichkeit und der allzu selbstverständlich genommenen, großen Freiheit, irgendwo hinzugehen.
Gleichzeitig ist natürlich auch diese Betrachtung tierischer Bewegungen begrenzt. Ich habe eigene Forschung zur Bewegungsökologie von Tieren betrieben und im Zuge dessen und darüber hinaus viele Arbeiten anderer Forschenden studiert. Dennoch ist es nahezu unmöglich, eine Expertin in all den vorgestellten Themenfeldern zu sein. Denn die Natur tierischer Bewegungen, von den Mechanismen verschiedener Fortbewegungsformen bis zur Koordination von Schwärmen, ist unermesslich komplex. Ihre Erforschung vereint verschiedenste Disziplinen von Zoologie über Physiologie und Chemie bis zu Physik. Kleinste Teilabschnitte des Themas können so komplex sein, dass manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich ihr gesamtes Berufsleben ausschließlich mit einem einzigen isolierten Aspekt beschäftigen und möglicherweise dennoch nur an der Oberfläche kratzen können. Darüber hinaus erreicht unser kollektives Wissen Ebenen, die für einen einzelnen Menschen nicht mehr zu verarbeiten sind. Dafür ist ein Menschenleben schlicht zu kurz.
Dieses Buch ist also eine Auswahl des uns vorliegenden Wissens und meiner Schlussfolgerungen daraus. Es ist eine Zusammenstellung faszinierender Naturbeobachtungen und Erkenntnisse, die Forschende über Generationen hinweg gesammelt haben. Darüber hinaus ist es auch meine ganz persönliche Zusammenstellung verschiedener Aspekte und Geschichten rund um tierische Bewegungen, die ich als besonders bemerkenswert empfinde — ein sorgfältig kuratierter Einblick in die Facetten einer komplexen Welt.
In zehn Geschichten erzähle ich von dieser Welt. Zehn Geschichten über faszinierende Lebewesen, über die Wege, die sie gehen, und über die großen Fragen, die sie anregen. In Summe entsteht so ein neues, emergentes Ganzes. Ich hoffe, mit diesem Buch kann ich Ihnen eine neue Perspektive näherbringen. Ich wünsche mir, dass Sie einen Eindruck von der unglaublichen Vielfalt des bewegten Lebens bekommen. Dass Sie sich mit mir aufrichtig daran erfreuen, in Ehrfurcht vergehen, Trauer empfinden und nachdenklich sein können. Dafür schicke ich Sie auf eine Reise zu verschiedenen Orten und aus wechselnden Perspektiven. Ich werde Sie mit Millionen Gnus durch die Masai Mara ziehen und mit den Karettschildkröten durch Meeresströmungen schwimmen lassen. Vielleicht bekommen wir so gemeinsam eine Idee, eine winzige Ahnung davon, wie wundervoll diese Welt ist.
1
Erste Schritte
Der Himmel spannt sich tiefblau über die Küste Spitzbergens. Unlängst hat der Frühling begonnen, doch hier im hohen Norden, jenseits des Polarkreises, hat Frühling eine andere Bedeutung als in der übrigen Welt. Der Polarkreis bildet eine unsichtbare Grenze, die die gewohnte Welt mit ihrem steten Wechsel aus Sonnenaufgang und Sonnenuntergang von jener Welt trennt, in der es im Sommer niemals wirklich dunkel und im Winter auch tagsüber nicht mehr hell wird.
Die aktuellen Temperaturen liegen um zehn Grad unter null, das Wasser ist eisfrei. Das Blau des Meeres verbindet sich am Horizont in einer wässrigen Linie mit den Farben des Himmels. Ein Polarfuchs wandert zwischen kargen Felsen umher, umtriebig erkundet das hungrige Tier den schneebedeckten Strand. Harte Kontraste formen eine Landschaft geprägt von Fels und Schnee. Wenn es Glück hat, findet das Tier hier zwischen dem Kies kleine Krebse, Muscheln und weitere Nahrung, die das Meer ausgespuckt und an die Küste gespült hat. Ein verendeter Seevogel, dessen ausgemergelter Körper von den anlaufenden Wellen umspült wird, wird zur ersten Mahlzeit des Tages.
Den ersten Winter seines Lebens hat der Polarfuchs in dieser Region verbracht. Der Winter war lang und von der fortwährenden arktischen Dunkelheit geprägt. Eine Weile hat sich der junge Fuchs in der Nähe des elterlichen Reviers herumgetrieben und versucht, dort Fuß zu fassen. Erfolglos. Nun will er nur noch eines, seinen Geburtsort verlassen. Seit einigen Wochen bewegt er sich schon entlang der Küstenlinie im Nordwesten der Inselgruppe auf und ab. Es zieht ihn westwärts, doch das offene Meer, auf das er allenthalben trifft, stellt eine unüberwindbare Barriere da. Immer weiter und weiter reichen seine Erkundungstouren, bis er das gewohnte Gebiet schließlich endgültig verlässt. Er wird nicht zurückkehren.
Nach einigen Tagen Marsch durch raues Gelände erreicht das Tier den Norden Spitzbergens und das Ufer. Dort trifft es erneut auf offenes Wasser. Intuitiv ändert der Fuchs seinen Kurs daraufhin drastisch. Er steuert nun wieder nach Südosten und überquert in den folgenden Tagen den nördlichen Teil Spitzbergens vollständig von West nach Ost. Er wandert bis zur östlichen Küste, wo er an einem späten Märzabend zum ersten Mal auf die zugefrorene See trifft und Spitzbergen in nordöstlicher Richtung über das Meereis verlässt.
Auf festem Meereis angekommen führt sein Weg einige Tage konsequent nordwärts. Das nördliche Meereis ist eine unwirkliche Umgebung, denn es gibt kaum Leben. Meilenweit nur weiße Leere. Kein anderes Tier ist zu sehen, keine einzige Pflanze kann hier wachsen, denn unter dem Eis befinden sich weder Erdreich noch Gestein, nur Ozean und Tiefe.
Tag und Nacht wechseln sich ab und der Fuchs läuft stetig gen Norden. Die Kälte umhüllt ihn wie ein vertrauter Mantel, während er durch schier endlose Weiten aus Schnee und Eis wandert. Sein Fell, dick und weich, schützt ihn vor den schneidenden Winden, die unablässig über die gefrorene Landschaft fegen. Sie hinterlassen feine Wellenmuster im pulvrigen Schnee, die der Windrichtung folgend Mandalas auf das Eis zeichnen und wieder verwischen.
Hier draußen gibt es wenig Nahrung. Der Polarfuchs muss jede Gelegenheit, etwas zu fressen, wahrnehmen, jeder Bissen kann über Leben und Tod entscheiden. Die letzten Tage waren hart und sein Magen ist leer. Daher nimmt seine Nase sofort den schwachen Geruch von Aas wahr, der unverhofft vom Wind aus der Ferne herübergetragen wird. Kurz vor Erreichen des 85. Breitengrads orientiert er sich windwärts und dreht nach Westen ab.
Eine kilometerlange Meereisrinne zwingt den Fuchs, einen größeren Umweg einzulegen. Wie offene Wunden klaffen die Rinnen im Eis und offenbaren das darunterliegende Meer. Der Umweg zehrt zusätzlich an seinen Kräften, doch etwa 40 Kilometer entfernt von dem Punkt, an dem er den Duft zum ersten Mal wahrnahm, stößt der Polarfuchs endlich auf den abgefressenen Kadaver einer Ringelrobbe. Ein Eisbär hat das an die 70 Kilogramm schwere Tier erbeutet und den Großteil des Leibes gefressen. Fett, Muskelfleisch und Organe der Robbe haben den vermutlich ebenfalls von großem Hunger getriebenen Bären für eine Weile mit neuer Energie versorgt. Anschließend ist er weitergezogen. Für den gerade einmal zwei Kilogramm leichten Polarfuchs bilden die Reste von rot gefrorenem Fleisch, die an den Knochen hängen, eine ordentliche Mahlzeit.
Er legt eine eintägige Pause ein und frisst wiederholt von dem Kadaver, bis er sich schließlich wieder auf den Weg macht, weiter gen Westen über das Eis. Trotz seiner geringen Größe bewegt er sich schnell. Der aufgefrischte Wind nimmt die Spuren mit, die seine Pfoten im Pulverschnee der letzten Nacht hinterlassen. 21 Tage nach Verlassen Spitzbergens erreicht der Polarfuchs erneut das Festland. Er ist im Nordosten Grönlands angekommen, auf der anderen Seite der Grönlandsee, dem nördlichen Teil des Europäischen Nordmeers.
Seine Reise ist jedoch noch immer nicht beendet. In den folgenden Wochen wandert er über das grönländische Eisschild, ohne sich je irgendwo niederzulassen. Nach anderthalb Monaten steten Fußmarschs verlässt er an einem grauen Dezembertag Grönland wieder, diesmal in Richtung Nordwesten erneut über das zugefrorene Meer.
Intuitiv beschleunigt er hier draußen seine Schritte. So massiv das Eis zu diesem Zeitpunkt ist, so fragil ist es gleichermaßen in Angesicht des sich wandelnden Wetters. Denn die ganze Welt, die den Fuchs umgibt, besteht aus gefrorenem Meerwasser. Steigen die Temperaturen, wird es vollständig abtauen und eine ganze Welt wird sich einfach in nichts auflösen.
Unvermittelt frischt der Wind auf und die Wolken verdichten sich am Horizont. Ein Schneesturm kündigt sich an. Mit einem letzten Blick auf den klaren Himmel macht sich der Fuchs auf den Weg zu einer kleinen Erhebung, die ihm Schutz vor den eisigen Böen bieten soll. Schnee beginnt zu fallen, zuerst sanft, dann heftiger und bald versinkt die Landschaft um ihn herum im weißen Nebel. Der Fuchs hat sich fest zusammengerollt, die kurze Schnauze unter den Schwanz geschoben lässt er sich einschneien und harrt aus. Er schließt die Augen und beginnt oberflächlich zu schlafen. So kann die erzwungene Pause wenigstens neue Kraft für die kommenden Meilen liefern. Nach einigen Stunden legt sich der Sturm und langsam lässt sich wieder mühsam erkennen, wo Schnee und Eis enden und dahintreibende Wolkenfetzen beginnen.
Nur gelegentlich zwingt das Wetter den Polarfuchs dazu, solche Pausen einzulegen. Meist trotzt das Tier Wind und Wetter und geht einfach stoisch weiter. Es wird langsamer, wenn der Wind allzu wütend an ihm reißt, doch stets setzt es eine Pfote vor die andere.
So karg und einsam, so bizarr diese Welt erscheint, so außerweltlich schön ist sie auch. Tagsüber und wenn der Himmel wolkenlos ist, bildet das Packeis ein Gemälde von Grau, Weiß, Türkis und Blau. Wo sich Meerwasserrinnen und Packeislöcher befinden, zeichnet sich das Eis leuchtend türkis unterhalb des Meeresspiegels ab. Schmelzwasserbäche gurgeln eisblau über hart gefrorenes, weißes Eis und gelegentlich liegen transparente Eisklumpen wie Glasperlen in der Landschaft und brechen das Licht in all seinen Farben.
Nachts spannt sich ein unendlich weiter, tiefschwarzer Himmel über weißen Schnee. Hier gibt es keine künstlichen Lichtquellen und der Himmel ist so dunkel, wie die Sterne hell sind. Dann wabern grüne und violette Lichter über den Nachthimmel. Leuchtende Wellen aus buntem Licht. Ätherisch schön, ziehen sie über das Himmelsmeer. Neonfarbene Streifen, wie mit einem fransigen Pinsel nach obenhin ausgestrichen. Ihr bunter Schein spiegelt sich auf dem Eis.
Es ist eine harte Schönheit, die die Arktis ihren Bewohnern schenkt. Eine Schönheit, die für die wenigen existiert, denen es gelingt, hier zu überleben. Der Polarfuchs kann hier und nur hier überleben. Es gibt kein Leben für ihn jenseits von Schnee und Eis. Also setzt er seinen Weg fort, wandert weiter durch die einsame Stille. Schließlich, 76 Tage nach Verlassen Spitzbergens und nach über 4000 zurückgelegten Kilometern, erreicht das Tier Ellesmere Island in Nunavut, Kanada, wo es sich endlich niederlässt.
Spuren im Schnee
Woher wissen wir, dass ein kleines Tier wie der Polarfuchs (Vulpes lagopus) in der Lage ist, mehrere Tausend Kilometer weit zu laufen? Dass Polarfüchse hervorragende Langstreckenläufer sind, hat jahrzehntelange Forschung gezeigt. Dass wir jedoch von dieser außergewöhnlich weiten Reise wissen, verdanken wir einem Zufallsfund: Im Sommer 2017 statteten Forschende des Norsk Polarinstitutt ein junges Polarfuchs-Weibchen mit einem GPS-Tracker aus. Gefangen wurde das Tier nahe des Fjortende-Julibreen-Gletschers in der Gegend des Krossfjords, einem Fjord im Nordwesten der Insel Spitzbergen.
Spitzbergen wird international als Svalbard (Kühle Küste) bezeichnet und gehört formal zu Norwegen, auch wenn die Inselgruppe mit ihren über 400 Inseln und Schären über 600 Kilometer nördlich vom norwegischen Festland, mitten im Polarkreis liegt. Die Besenderung der Fähe und über 40 weiterer Artgenossen diente dazu, mittels GPS-Daten das Raumnutzungsverhalten der Polarfüchse auf Spitzbergen zu erforschen. Eva Fuglei und ihren Kollegen ging es in der Studie primär darum, die Bedeutung des See-Eises für die lokale Polarfuchspopulation zu verstehen. Sie wollten wissen, wie abhängig die Küsten-Füchse vom Meereis waren und wie sie es nutzten.1 Dass sie dadurch Zeugen einer unglaublichen Reise und eines neuen Langstreckenrekordes wurden, war ein zufälliges Nebenprodukt, mit dem niemand gerechnet hatte.
Die beeindruckende Reise des Polarfuchses begann im März 2018 im Westen Spitzbergens und umfasste eine Gesamtdistanz von 4415 Kilometern. Damit gelang dem nur 1900 Gramm schweren Tier eine interkontinentale Reise von Europa nach Nordamerika, über 1789 Kilometer Luftliniendistanz durch extrem lebensfeindliches Gebiet, und das zu Fuß.
Weite Teile dieser Strecke lief die Fähe über offenes Meereis, und als sie Grönland erreichte, hatte sie bereits 1500 Kilometer zurückgelegt, was sie offenbar nicht davon abhielt, weitere 2000 Kilometer bis Kanada zu laufen. Dort blieb sie in einem begrenzten Gebiet rund um die Fosheim-Halbinsel, bis der GPS-Tracker am 6. Februar 2019 seine Übertragung einstellte.
Dass Polarfüchse weite Strecken zurücklegen können, ist seit einiger Zeit bekannt.2 Schon häufiger wurden auch im Rahmen von Forschungsprojekten größere Laufdistanzen bei Polarfüchsen beobachtet.3 Allerdings nicht so weit und nicht in dieser Geschwindigkeit. Die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit der Polarfüchsin mit einem Mittelwert von 46,3 Kilometern pro Tag schwankte stark, vermutlich aufgrund der Umgebungsbedingungen. Zwischendurch erreicht sie jedoch einen Spitzenwert von 155 zurückgelegten Kilometern pro Tag. Das ist die höchste Geschwindigkeit, die jemals für die Art aufgezeichnet wurde.
Warum weggehen?
Was motivierte das kleine Polarfuchs-Weibchen der Svalbard-Studie, unter extremen Bedingungen so weite Wege zurückzulegen? Was brachte das Tier dazu, in eine ungewisse Zukunft, mehrere Tausend Kilometer weit, zu Fuß bis nach Kanada zu laufen? Warum nehmen Tiere überhaupt die Strapazen weiter Reisen auf sich?
»Willst du immer weiter schweifen?«, fragt Johann Wolfgang von Goethe in seinem berühmten und vielfach adaptierten Gedicht Erinnerung und beantwortet die Frage direkt mit dem Hinweis darauf, warum sich das Bleiben lohne: »Sieh, das Gute liegt so nah.«4 Nicht immer liegt das Gute, das zum Überleben Wichtige jedoch in unmittelbarer Nähe. Polarfüchse werden früh selbstständig. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni, im kurzen arktischen Sommer geboren, müssen sie meist bereits im Winter desselben Jahres das elterliche Territorium verlassen und sich auf die Suche nach einem eigenen Revier machen. Die Suche kann lang und beschwerlich sein und die Tiere weit von ihrem Heimatort wegtreiben. Auf den ersten Blick sind die verschiedenen Polarfuchspopulationen geografisch isoliert, so auch die Population des Svalbard-Fuchses. Doch Spitzbergen ist saisonal durch das Meereis mit Grönland und Nordamerika verbunden, was den Polarfüchsen der Inseln eine Möglichkeit zur Fernausbreitung bietet.
Die Fähigkeit, unter kalten und rauen Bedingungen weite Strecken zurückzulegen, brachte die Tiere bereits in ihrer Evolutionsgeschichte an die entlegensten Orte. So ist der Polarfuchs das einzige endemische Landsäugetier Islands. Zum Vergleich: In Nordamerika sind über 450 heimische Säugetierarten beschrieben.5 In Deutschland sind laut der Gesamtartenliste des Rote-Liste-Zentrums, das die Bestände von Flora und Fauna dokumentiert, 107 verschiedene Säugetierarten etabliert. Darunter befinden sich zwar elf gebietsfremde Arten6 (mit denen wir uns in einem späteren Kapitel auseinandersetzen werden), der Großteil ist jedoch heimisch. Diese Säugetiere waren lange vor dem Menschen in der Region des heutigen Deutschlands verbreitet. Auf Island sieht das völlig anders aus. Keinem weiteren Säugetier, nicht einmal einem Vertreter der größten Familie der Säugetiere, den Langschwanzmäusen mit ihren 834 Arten7, zu denen auch die Ratten gehören, gelang es, Island selbstständig zu erreichen und sich dort zu etablieren.
Zunächst war unklar, ob es der Polarfuchs wirklich aus eigener Kraft nach Island geschafft haben könnte. Man spekulierte, dass der Polarfuchs von den ersten Siedlern Islands mit auf die Insel gebracht worden sein könnte. Der Gedanke ist insofern nachvollziehbar, als Island extrem abgelegen ist und alle anderen auf Island lebenden Säugetiere zu irgendeinem Zeitpunkt vom Menschen dort eingeführt wurden. Die Frage in Bezug auf die Einwanderungsgeschichte des Polarfuchses war also, ob sich seine Präsenz auf Island vor der Ankunft der ersten Menschen zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert8 nachweisen lässt.
Regulationen zur Jagd von Polarfüchsen im ältesten Rechtstext Islands legen nahe, dass die Art zu diesem Zeitpunkt bereits verbreitet war, außerdem wurden Kieferknochen, Zähne und weitere Knochen mehrerer Polarfüchse in einer etwa 2700 Jahre alten Fossilschicht gefunden. Dies sind jedoch keine eindeutigen Belege, da die Knochenfunde nicht per Radiokarbondatierung altersbestimmt wurden und später verloren gingen.9
2004 legte eine Sprengung im Rahmen von Bauarbeiten im Nordwesten Islands dann neue Knochenfunde frei. Die C14-Datierung der so gefundenen Polarfuchsschädel zeigte, dass sie etwa 3500 bis 3600 Jahre alt waren. Das war der Nachweis, dass Polarfüchse isländischen Boden betraten, lange bevor die ersten Menschen es taten.
Bis heute sind manche Fragen in der Besiedlungsgeschichte Islands durch den Polarfuchs offen, doch neuere genetische Untersuchungen zeigen eine frühe Abspaltung der isländischen Population von allen anderen arktischen Populationen, die bis heute starke genetische Durchmischung zeigen.10 Letztere ist laut Meinung der Forschenden darauf zurückzuführen, dass Polarfüchse regelmäßig große Distanzen zurücklegen und sich so auch weit entfernte Populationen fortwährend durchmischen. Die Langstreckenläufer sind ihrer hohen Mobilität also über die Jahrtausende treu geblieben.
Es erscheint unglaublich, dass es für das kleine Tier evolutionär betrachtet eine erfolgreiche Strategie sein kann, sich über riesige Distanzen durch eine solch lebensfeindliche Umgebung zu schlagen. Noch unglaublicher ist es jedoch, dass überhaupt ein Tier in so einer Umgebung überleben und sich sogar fortpflanzen kann. So unglaublich, dass der Polarforscher und Zoologe Fridtjof Nansen am 26. April 1885 auf seiner Expedition zum Nordpol bei 85° nördlicher Breite notierte: »Ich war nicht wenig überrascht, als ich gestern Morgen plötzlich die Spur eines Tieres im Schnee sah. Es war die eines Polarfuchses […]. Die Spur war ganz frisch. Was in aller Welt machte dieser Fuchs hier oben auf dem wilden Meer?«11
Was in aller Welt machte der Polarfuchs dort? Eine gute Frage, besonders in Anbetracht der extremen Strapazen, die Polarfüchse für ihre Fernausbreitung quer durch die Arktis auf sich nehmen. Die Reise über das Meereis ist nicht nur deswegen gefährlich, weil den Tieren bei einem Wetterumschwung der Boden unter den Pfoten wegtauen könnte. Allein die Witterungsbedingungen sind extrem. Zwar wird es am nördlichen Pol nicht ganz so kalt wie am Südpol, dennoch verlangen —30°C bis —20°C im Winter einem kleinen Organismus einiges ab. Schließlich muss es der Körper trotz dieser Umgebungstemperaturen schaffen, das Körperinnere und insbesondere die inneren Organe konstant warm zu halten. Gleichzeitig kann man sich hohe Stoffwechselraten, die große Wärme produzieren, in so kargen Regionen ebenfalls nicht leisten. Denn diese verbrauchen Energie und kreieren einen erhöhten Nahrungsbedarf, der sich dort schlicht nicht decken lässt.
Der Polarfuchs überlebt in dieser Kälte nur, weil er seinen Wärmeverlust minimiert hat. Der Allen’schen Regel folgend, die besagt, dass (bei homoiothermen, also gleichwarmen Organismen) die relative Länge der Körperanhänge wie Extremitäten, Schwanz oder Ohren in kalten Klimazonen geringer ist als bei verwandten Arten und Unterarten in wärmeren Gebieten, haben die Tiere kurze Schnauzen und kleine Ohren. Wenn Sie neben einem Polarfuchs einmal an einen Wüstenfuchs mit seinen riesigen Ohren denken, wird die Allen’sche Regel deutlich sichtbar. Je weniger Oberfläche die Füchse bieten, desto geringer der Wärmeverlust. Dazu kommt ein höchst effizient isolierendes Fell, das den Tieren das Leben im hohen Norden trotz Niedrigtemperarturspitzen von bis zu —50 °C ermöglicht, ohne ihren Stoffwechsel hochzufahren und damit ihren Nahrungsbedarf zu erhöhen. Dennoch brauchen die Tiere natürlich Nahrung zum Überleben und diese Nahrung ist im Polarkreis knapp.
Von Küsten- und LEMMING-FÜCHSEN
Polarfüchse lassen sich in zwei verschiedene Ökotypen einteilen (zwei Gruppen, die zur selben Art gehören, sich aber hinsichtlich ihrer Lebensweise und insbesondere hinsichtlich ihrer Ernährungsweise unterscheiden): der sogenannte Küsten- und der Lemming-Fuchs. Lemming-Füchse finden sich vor allem in Nordamerika, Eurasien und Ostgrönland. Sie leben im Inland polarer Regionen und ernähren sich hauptsächlich von Nagetieren. Besonders wichtig als Beutetiere sind Lemminge, deren Populationen in zyklischen Phasen von drei bis fünf Jahren auftreten. Bis heute ist ungeklärt, wieso. Entsprechend ihrer Beutetiere, schwanken auch die Populationen der Lemming-Füchse stark mit dem verfügbaren Nahrungsangebot.
Der Ökotypus der Küsten-Füchse bezeichnet Polarfüchse, die in Küstenregionen, zum Beispiel auf Spitzbergen, auf Island und in Westgrönland, vorkommen. Sie sind Nahrungsgeneralisten und ernähren sich unter anderem von Fischen, Weichtieren und von Meeresvögeln und deren Gelegen. Sie fressen darüber hinaus aber auch Nagetiere und alles, was ihnen das Land an Nahrung zu bieten hat. Ihre Nahrungsquellen sind planbarer und verlässlicher, jedoch besonders im Winter auch rarer. Daher sind die Populationen der Küsten-Füchse stabiler, aber es werden weniger Nachkommen großgezogen.
Beide Ökotypen unternehmen weite Wege. Polarfüchse sind als Spezies hochmobil und ausdauernde Läufer. Diese Mobilität ist jedoch gefährlich. Studien zeigen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von standorttreuen Tieren dreimal so hoch ist wie die migrierender Füchse. Das Abwandern ist also tatsächlich höchst riskant.
Gleichzeitig weisen einige Studien darauf hin, dass die Suche nach Nahrungsquellen der Hauptmotivator für Polarfüchse ist, weite Strecken zurückzulegen.12 Dafür unternehmen sie, unter anderem, längere Ausflüge auf das Meereis und kehren dann in ihr Territorium zurück. Manche Tiere verlassen ihr Revier auch endgültig oder leben vollkommen nomadisch. Lemming-Füchse zeigen stärkeres Wanderverhalten als Küsten-Füchse, was aufgrund der unterschiedlichen Verlässlichkeit der Nahrung in ihren jeweiligen Lebensräumen die These stützt, dass Nahrungssuche entwicklungsgeschichtlich eine wichtige Triebfeder für die Lauffreudigkeit des Polarfuchses war.
Die Tiere nutzen typischerweise den Winter, um in neue Regionen vorzudringen. Mit etwa 20 Millionen Quadratkilometern ist die Arktis jedoch gigantisch groß (fast 56-mal so groß wie Deutschland und etwas mehr als das Doppelte der Fläche der USA mit all ihren Klimazonen und Biotopen). Um in dieser unermesslichen Weite voranzukommen und neue Ressourcen zu entdecken, muss man also zwangsläufig ziemlich weit laufen können.
Polarfüchse sind dabei nicht nur widerstandsfähig, sondern auch erfindungsreich. Sie folgen beispielsweise über große Zeiträume und Distanzen Eisbären, um in Zeiten von Nahrungsmangel von den Resten ihrer Beute zu leben. Not macht erfinderisch und letztlich müssen sich die Strapazen auf lange Sicht betrachtet auszahlen. Denn um evolutionär stabil zu sein, muss ein Verhalten, zumindest unterm Strich, Vorteile für eine Art mit sich bringen. Warum? Verhaltensweisen, die zu nachteilig sind, werden durch natürliche Selektion ausgemerzt, indem diejenigen Individuen, die sie zeigen, schlicht nicht überleben und ihre Gene so nicht bis in die nächste Generation überdauern. So riskant die langen Wege der Polarfüchse also sind, müssen sie in Summe einen Überlebensvorteil darstellen.
Tiere bewegen sich aus den unterschiedlichsten Gründen. Um Nahrung zu finden, auf der Suche nach potenziellen Partnern, um Räubern auszuweichen, auf der Suche nach Schutz oder einer neuen Heimat. Ein Ortswechsel verspricht neue Möglichkeiten, die am alten Standort möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt bestehen.
Es kommt Bewegung in die Sache
Es liegt ein unverkennbarer Vorteil in der Möglichkeit, zu gehen, wenn es ungemütlich wird. Ist man an seinen Standort gebunden, ist man schließlich den dortigen Bedingungen auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. Besteht diese Option nicht, kann eine Veränderung der Umweltgegebenheiten im schlimmsten Falle sogar das Ende der eigenen Existenz bedeuten.
Betrachtet man die drei Reiche des komplexeren Lebens, das Tierreich (inklusive uns Menschen), das Reich der Pilze und das Pflanzenreich, scheint Fortbewegung auf den ersten Blick jedoch nicht allzu beliebt in der Evolution gewesen zu sein. Sowohl die Pilze als auch die Pflanzen haben neben den Tieren das Land erobert und beide Reiche sind von sessilen (sesshaften), stationären Organismen geprägt. Wieso ist nicht alles Leben stationär, wie das der Pflanzen und Pilze, die sich (in der Regel) nur über Generationen hinweg, nicht aber auf individueller Ebene bewegen können?
Die fundamentalen Unterschiede, die diese Lebensweisen ausmachen, und die Konsequenzen, die diese Verschiedenheit nach sich zieht, werden wir im Kapitel Freiheit genauer betrachten. Zunächst interessiert die Frage, was die Entstehung von Fortbewegung erdgeschichtlich überhaupt motivierte. Warum bewegen sich tierische Organismen fort? Wenn wir einmal unsere Lupe herausholen und uns die Welten außerhalb unserer täglichen Wahrnehmung anderer Lebewesen ansehen, finden wir Bewegung, die sehr viel älter ist als das erste tierische Leben. Und wenn wir schon dabei sind, die Lupe auszupacken, holen wir doch gleich noch die Zeitmaschine aus dem Schrank und schauen uns die Entstehung des Lebens und des ersten bewegten Lebens einmal genauer an.
Vor etwa vier Milliarden Jahren gab es die Erde bereits seit einigen Hundertmillionen Jahren13, doch sie beherbergte zunächst noch kein Leben. Irgendwann um diese Zeit, wobei dieses Irgendwann ein extrem großes Zeitfenster von 500 Millionen Jahren evolutionsgeschichtlicher Unschärfe ist, entwickelten sich aus unbelebter Materie biologische Einheiten — es entstand Leben. Auch wenn es noch sehr lange dauern sollte, bis das Leben Formen annahm, wie wir sie uns heute unter dem Begriff Lebewesen vorstellen.
Wie das erste, das allererste Leben in die Welt kam, ist so etwas wie der heilige Gral in den stammesgeschichtlichen Wissenschaften — der Phylogenie. (Die Frage nach der Entstehung des Lebens ist wohl in allen menschlichen Kulturkreisen und Denksystemen gestellt worden.14 Als Fragestellung, die offenbar zur Essenz des menschlichen Nachdenkens über sich selbst gehört, haben sich auch Philosophie und Religion mit ihr befasst. Uns interessiert an dieser Stelle jedoch die wissenschaftliche Betrachtung der Geschichte des Lebens.)
Die Phylogenese oder Phylogenie bezeichnet die stammesgeschichtliche Entwicklung der Gesamtheit aller Lebewesen auf der Erde. Dazu gehört die Entstehung verwandtschaftlicher Gruppen und biologischer Systeme ebenso wie die Evolution einzelner Merkmale von Organismen. Im Rahmen phylogenetischer Forschung haben Generationen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unzählige Puzzleteile über die Geschichte des Lebens zusammengetragen. Doch wo nahm es seinen Anfang? In Bezug auf die Entstehung des Lebens stolpert man allenthalben über die These William Harveys »Ex ovo omnia« (Alles aus dem Ei). Der englische Arzt und Anatom Harvey (1578—1657) widmete sein Leben der Erforschung des menschlichen Körpers. Zu seinen größten Errungenschaften gehört die erste sachgemäße Beschreibung des menschlichen Herz-Kreislauf-Systems, nachdem man zuvor lange geglaubt hatte, das Blut im Körper würde fortwährend von der Leber produziert. Ein bahnbrechender Fortschritt in der Geschichte der Medizin.15 Darüber hinaus beschäftigte er sich auch intensiv mit Embryologie und der Entstehung von Leben. Seine These bezog sich allerdings auf die ontogenetische Entstehung des Lebens — also die Frage, woher ein jedes gegenwärtiges, also im Hier und Heute existentes Individuum stammt. Das Ei stand für ihn am Anfang der Entwicklung jedes einzelnen Lebewesens, nicht aber des Lebens selbst.
Leicht umformuliert zu »Omne vivum ex ovo« (Alles Leben kommt aus dem Ei) machte der italienische Naturforscher Francesco Redi den Satz bekannt, als er die damals verbreitete These infrage stellte, komplexe Organismen wie Insekten entstünden durch Abiogenese, also durch die fortwährende Urzeugung aus unbelebter Materie. Man nehme etwas Dreck und Stein, knete es gut durch, und voilà: ein Käfer. Aus heutiger Sicht erscheint die Idee einer Urzeugung ganzer vielzelliger Lebewesen absurd. Die Abiogenese oder Urzeugung von Vielzellern wurde entsprechend durch wissenschaftliche Arbeiten im 17. und 18. Jahrhundert widerlegt. Auch die Idee von der Urzeugung weniger komplexer Einzeller und Bakterien musste sich nach den Forschungen des Chemikers und Bakteriologen Louis Pasteur in das Museumsarchiv verworfener Erklärungsmodelle in der Geschichte der Naturwissenschaften einreihen.
Dabei war der Grundgedanke an sich gar nicht so falsch. Die Erklärungsmodelle setzen nur zu spät in der Geschichte des Lebens an. Viel zu spät, nämlich am Beginn des Lebens konkreter, höchst komplexer Individuen. Heute wissen wir, dass die Erzeugung solch neuer Individuen auf der geschlechtlichen oder ungeschlechtlichen Fortpflanzung bereits vorhandener Organismen basiert, nicht auf der fortlaufenden Entstehung aus toter Materie. Biogenese, aus Leben entsteht Leben. Wenn wir jedoch viel weiter zurückgehen in der Erdgeschichte, lange bevor das Leben überhaupt komplex wurde, treffen wir wieder auf sie — auf die Urzeugung. Wir finden sie in der brodelnden Ursuppe des Lebens.
Wenn Leben aus Leben entsteht, führt uns das unweigerlich zu einem Paradoxon. Das Biogenese-Paradoxon, welches in der berühmten Frage danach, ob Henne oder Ei zuerst existierte, verbildlicht wird. Die Auflösung dieses Paradoxons besteht in der Abiogenese, der Urzeugung, also der Entstehung belebter aus unbelebter Materie. Zur Entstehung des Lebens auf der Erde gibt es, wenig überraschend, verschiedene Erklärungsmodelle. Sie unterscheiden sich jedoch vorwiegend in Fragen nach Spezifika, wie dem Ort der Entstehung. Die Theorie der Abiogenese selbst ist heute wissenschaftlicher Konsens. Ihr zufolge entwickelten sich durch chemische Evolution in der Urumgebung der frühen Erde erste organische Substanzen.
Diese chemische Evolution verlief in mehreren Phasen. Am Anfang stand die Synthese und Anhäufung kleiner organischer Moleküle (Monomere), die sich später zu komplexeren polymeren Makromolekülen wie Proteinen verbanden. Irgendwann begannen diese Komplexe, sich zu vervielfachen. Die Bildung von Lipidmembranen (Schichten aus Fetten, die noch heute unsere Körperzellen umhüllen) um diese neuen, funktionalen Komplexe grenzte sie von ihrer Umgebung ab. Es entstanden sogenannte Protobionten, die ersten Vorläufer der Zellen, inklusive ihres eigenen Stoffwechsels.
Auch wenn wir womöglich niemals abschließend klären werden, wie das Leben auf der Erde genau entstand, sind die chemische Evolution und ihre verschiedenen Phasen vielfach experimentell überprüft und bestätigt worden. Unabhängig voneinander beschrieben zunächst sowohl der sowjetische Biochemiker Alexander Iwanowitsch Oparin als auch der britische Biologe J. B. S. Haldane die Bedingungen einer Uratmosphäre, unter denen die Abiogenese möglich sein sollte, und postulierten, die Atmosphäre des Planeten vor vier Milliarden Jahren sei dazu geeignet gewesen. Anders als heute gab es damals weder Sauerstoff noch eine Ozonschicht, die UV-Strahlung war entsprechend deutlich stärker, die Atmosphäre bestand vorwiegend aus vulkanischen Gasen.
1953 testeten die Amerikaner Stanley Miller und Harold C. Urey die Hypothesen von Oparin und Haldane. Ihnen gelang der Nachweis der Entstehungsmöglichkeit organischer Substanzen aus anorganischer Materie.16 Auch wenn andere Experimente weiteres Licht ins Dunkel brachten, stellt das Miller-Experiment einen Meilenstein für das Bemühen dar, die Anfänge des Lebens auf der Erde zu begreifen.17 Mit der Entdeckung der sogenannten Schwarzen Raucher, hydrothermaler Quellen am Grunde der Tiefsee, kamen Diskussionen darüber auf, ob die chemische Evolution sich nicht vielmehr dort als unter atmosphärischen Bedingungen abgespielt haben könnte. Auch die Gaswolken zwischen Sternen werden als Entstehungsort diskutiert, demnach wären erste Moleküle aus dem All auf die Erde gekommen. Spannende Denkansätze, die sich möglicherweise nie abschließend klären lassen werden. Für die weitere Entwicklung des Lebens spielt das jedoch eine untergeordnete Rolle. Irgendwo in wildbewegten Gaswolken, chaotischer Uratmosphäre oder im Strudel schwarzer Unterseevulkane nahm alles seinen Anfang. So oder so herrschten auf der Erde bereits früh die Bedingungen, die es benötigte, um aus komplexen Molekülen, Protobionten, die ersten Zellen und alles ihnen folgende Leben entstehen zu lassen.
Eine kurze Geschichte des Lebens
Die ältesten Informationen zur Frühgeschichte des Lebens reichen in etwa bis zur Zeitmarke von 3,8 Milliarden Jahren zurück, weil für alles Davorliegende der nötige Informationsträger, die sedimentäre Überlieferung, fehlt.18 Der Deutsche Geochemiker Manfred Schildlowski schrieb in seiner Abhandlung über die Entstehung des Lebens: »Bekanntlich ist in der Erdgeschichte Zeit immer durch Stoff belegt, wobei die Abfolge geologischer Formationen letztlich materialisierte Zeit repräsentiert.« Im Falle des ältesten Lebens auf der Erde ist diese materialisierte Zeit ein Fund von einzelligen Organismen in einer 3,46 Milliarden Jahre alten Gesteinsschicht im Westen Australiens.19 Erstaunlicherweise ähneln diese frühen Bakterien bereits den noch heute existierenden Formen.
Die uns vertrautesten Organismen sind diejenigen, die mit dem bloßen menschlichen Auge sichtbar sind. Doch über drei Viertel der Geschichte des Lebens auf der Erde bestand dieses aus mikroskopisch kleinen Einzellern. Von da an wurde das Leben Schritt für Schritt komplexer. Es bräuchte jedoch eine ganze Bibliothek, um diese Geschichte im Detail nachzuerzählen, daher hier nur die extreme Kurzfassung à la »History of Everything«, dem Titelsong der beliebten Science-Sitcom The Big Bang Theory:
Die ersten Lebewesen waren einfach aufgebaute Zellen mit einer Hülle und einem gelartigen Inneren, das auch Erbinformationen beinhaltete. Diese Erbinformationen waren, anders als bei uns Eukaryoten (eukaryon, »mit Kern«) nicht in einen Zellkern verpackt. Diese sogenannten Prokaryoten (»vor Kern«, kernlos) werden meist in zwei Linien unterteilt, die Archaeen und die Bakterien, denen wir — wenn man bedenkt, dass sie zu den wichtigsten menschlichen Krankheitserregern gehören — verständlicherweise nicht in Sympathie verbunden sind. Lange bildeten sie jedoch das einzige Leben auf der Erde.
Die Gruppe der Cyanobakterien war weit verbreitet und vielfältig. Sie kennen Cyanobakterien möglicherweise als »Blaualgen«, die uns im Sommer das Baden in Seen vermiesen. Aber wir verdanken ihnen viel, denn sie brachten durch Fotosynthese Sauerstoff in die Welt. Nach und nach füllten sie die Atmosphäre mit dem für uns so kostbaren Gas. Während dieser Vorgang vielen Prokaryoten zum Verhängnis wurde, legte er den Grundstein für einen Großteil des heutigen Lebens.
Vor etwa 2,1 Milliarden Jahren entstanden die ersten Eukaryoten und brachten damit ein neues Zell-Design aufs Tableau. Ein Design, das beispielsweise in Polarfüchsen und Menschen noch heute Anwendung findet, denn sie sind vielzellige Eukaryoten. Diese Zellen waren viel größer und komplexer aufgebaut und besaßen kleine Organellen wie Mitochondrien (für die Produktion von Energie in tierischen Zellen) oder Chloroplasten (für die Fotosynthese bei Pflanzen). Ähnlich wie unsere Organe im Körper konnten diese winzigen Organellen verschiedene Funktionen in den Zellen übernehmen. Wahrscheinlich entstanden Eukaryoten durch den Zusammenschluss mehrerer einfacherer Zellen. Kleine Organismen machten andere zu einem Teil von sich selbst (sogenannte Endosymbionten). Gemeinsam bildeten sie im Laufe der Evolution ein neues, komplexeres und letztlich untrennbares Ganzes.
Diesen Zusammenschluss von einzelnen Individuen zu einer neuen Lebensform konnte die Wissenschaft 2024 im Detail am Beispiel einer Alge nachvollziehen. Diese Alge machte ein bis dato eigenständiges Bakterium zu einem Organ.20 (Als würden wir uns eine Pflanze einbauen, die dann für uns Fotosynthese betreibt, sodass wir uns von Sonnenlicht ernähren können.) In der in Science erschienenen Studie beschreiben die Forschenden, wie ein Cyanobakterium seine Unabhängigkeit verlor und danach als neues Zellorganell Ammoniak für die Alge Braarudosphaera bigelowii produziert. Zwei Lebensformen sind so zu einem neuen Organismus verschmolzen, der als erstes höheres Lebewesen Luftstickstoff verwerten kann. Wie wir gesehen haben, ist so ein Zusammenschluss in der Evolutionsgeschichte zwar schon mehrfach passiert, in Anbetracht der Zeitspanne, in der dies passierte, ist es jedoch selbst evolutionsbiologisch betrachtet ein extrem seltenes Ereignis.
Das neue Level an Komplexität von Zellen ermöglichte die Entstehung einer enormen Vielfalt an Einzellern, den Protisten, die uns mitsamt ihrer kreativen Fortbewegungsmethoden später noch begegnen werden. Ein ähnlicher Prozess des Zusammenschlusses brachte eine weitere Milliarde Jahre später die ersten Vielzeller mit sich. Auch die ersten Vielzeller waren noch klein. Erst vor etwa 600 Millionen Jahren entstanden größere Organismen inklusive der ersten Tiere. Im Rahmen der sogenannten kambrischen Radiation explodierte die Vielfalt der Vielzeller förmlich und vor etwa 500 Millionen Jahren eroberte das Leben, das sich bis dahin über Milliarden Jahre im Wasser abgespielt hatte, endlich das Land. Pflanzen und Pilze besiedelten das Festland gemeinsam und sind dadurch bis heute eng miteinander verbunden. Ein beeindruckender Fossilbericht zeigt durch unzählige Funde, Puzzleteilen gleich, die anschließende Entwicklung der Fische zu Amphibien, dann weiter zu Reptilien und daraus gleichermaßen hervorgehend Vögeln und Säugetieren. Vor 50 bis 60 Millionen Jahren bestanden damit die meisten heute existenten tierischen Ordnungen bereits, inklusive der Primaten. Vor etwa 5 Millionen Jahren begann dann die Geschichte der Menschwerdung und vor gerade einmal ungefähr 300.000 Jahren erschien Homo sapiens auf der Weltbühne.21
Beim Blick in die heutige Natur ist es schwer vorstellbar, dass es ein Davor gab. Dass alles, was uns nun so vertraut ist, einen Großteil der Erdgeschichte lang nicht existierte und mit einer Prise Chemie in der bewegten »Ursuppe« der frühen Erde seinen Anfang nahm. Doch seitdem ist unbegreiflich viel Zeit ins Land gegangen. Es fällt uns schwer, die Bedeutung großer Zahlen zu erfassen, besonders den Sprung von Millionen zu Milliarden (oder den 3,46 Milliarden Jahren Geschichte des Lebens). Für ein besseres Verständnis können wir die Zeitskala anpassen, sodass sie mehr Bezug zum eigenen Leben hat: Eine Million Sekunden sind etwa elfeinhalb Tage. Etwas weniger als zwei Wochen also. Überschaubar, nicht wahr? Und wie viel wären dann eine Milliarde Sekunden? Etwa 11.570 Tage, also fast 32 Jahre Ihres Lebens.
Seit seinen Anfängen hatte das Leben also viel Zeit, sich weiterzuentwickeln. Leben ist ein Kontinuum. Die kontinuierliche Organisation zu Verbindungen höherer Ordnungen (von Molekülen über Zellen bis hin zu Organismen), die Entstehung von Variation und das Formen ebendieser durch selektive Kräfte im Außen führte uns letztlich ins Heute. Die Komplexität des Lebens gründet auf der Hierarchie von Strukturebenen von der atomaren Ebene bis zum Ökosystem und mit jeder Stufe treten Eigenschaften auf, die die einzelnen Komponenten nicht zeigen. Die Einzelteile eines Hämoglobins bestehen beispielsweise aus simplen Elementen wie Eisen, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Erst durch die Faltung des Moleküls in eine bestimmte Form, durch das Zusammenwirken seiner Einzelteile, erhält es eine Eigenschaft, die es zuvor nicht hatte: Es kann den lebenswichtigen Sauerstoff durch unsere Blutbahn transportieren. Diese Emergenz ist der Kern biologischen Lebens.
Wann das Leben Laufen lernte
Bewegung spielte offensichtlich schon bei der Entstehung des frühen Lebens eine Rolle. Immer wieder mussten einzelne Moleküle und Organismen zueinanderfinden, um neue, weiterentwickelte Organisationsformen zu bilden. Doch die chaotische Bewegung der Ursuppe lässt sich schlecht mit einem Sonntagsspaziergang vergleichen. Wann also begann sich der erste Organismus aktiv zu bewegen?
Tatsächlich viel früher, als man zunächst vermuten würde: Schon etwa die Hälfte der Prokaryoten, der simplen ersten Lebewesen auf der Erde, deren Spuren 3,46 Milliarden Jahre zurückreichen, kann sich gezielt fortbewegen. Ihre Zellen verfügen über sogenannte Geißeln oder Flagellen. Wie eine Peitsche geformt, ermöglichen solche Anhängsel durch kräuselnde Bewegungen im Wasser Vortrieb. Wir kennen diesen Anblick vermutlich am besten von der Fortbewegung des menschlichen Spermiums. Auch wenn es sich dabei um eine eukaryotische Zelle (also eine ältere, komplexere Zelle mit Kern) handelt, ist die Funktionsweise ähnlich.
Bis zu 50 Mikrometer pro Sekunde Schwimmgeschwindigkeit erreichen manche Bakterien. Das ist in etwa das Hundertfache ihrer Zellgröße in einer Sekunde.22 Wenn wir die Zellgröße mit einer menschlichen Schrittlänge von etwa einem Meter gleichsetzen, entspräche das einer Laufgeschwindigkeit von 360 Stundenkilometer! Usain Bolt mit seinen 44,72 Stundenkilometern über die 100 Meter kommt dagegen einer Schnecke gleich.
Neben Flagellen gibt es auf der Urerde mindestens zwei weitere Fortbewegungsmethoden. Sogenannte Spirochäten, lang gezogene Bakterien, haben Strukturen unter der äußeren Zellwand, die sich verformen können und so zu einer spiralförmigen Bewegung führen. Sie bewegen sich wie ein winziger Korkenzieher, der sich drehend durchs Wasser zieht. Eine dritte Methode basiert darauf, eine Art schleimige Fäden auszustoßen, die sonst dazu dienen, an Dingen zu haften (wie eine Art winziger Spiderman). Zügig ausgespuckt können sie durch den Rückstoß auch der Fortbewegung dienen, ähnlich wie ein Düsenantrieb.
Erste Formen der Fortbewegung gab es also schon vor Milliarden von Jahren. Doch warum? Die Entscheidung eines Polarfuchses, abzuwandern, ist letztlich im Großen das, was die Bewegung eines Bakteriums im Kleinen ist. Sie folgt einem Ziel.
In einer homogenen Flüssigkeit wäre jede Bewegung ziellos und somit sinnlos. Denn worin liegt der Sinn, sich fortzubewegen, wenn es ohnehin überall gleich aussieht? In der Umgebung der Bakterien müssen sich also ebenfalls Ziele verbergen, auch wenn diese weniger offensichtlich sind als die Suche eines jungen Fuchses nach dem eigenen Revier. Die rudimentärste Form zielorientierter Fortbewegung, wie sie Bakterien und Archaeen zeigen, ist die Taxis.23 Sie ist eine simple und dennoch zielgerichtete Orientierungsreaktion von Lebewesen aufgrund einer Umgebungsinformation. Das heißt, ein Lebewesen richtet sich nach einem Reiz oder Umweltfaktor aus. Das kann für unser Bakterium beispielsweise die Temperatur, die Beleuchtungsstärke oder auch die Konzentration eines chemischen Stoffes sein.
Wie bewusst diese Bewegung ausgeführt wird, ist dabei fraglich. Die Frage nach der Bewusstheit tierischer und damit auch unserer eigenen Fortbewegung ist eine eigene Geschichte, der wir uns zu einem späteren Zeitpunkt widmen. Dafür werden wir eine Ratte namens Razza kennenlernen und einen Blick auf die von Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen (beide Pioniere der klassischen Verhaltensforschung) formulierte Instinkt-Theorie werfen. Für den Moment reicht es uns, einen Begriff daraus herauszugreifen, der eine zielgerichtete Handlung beschreibt, die tierischem Verhalten zugrunde liegt (wie das Suchen eines Raubtieres nach Beute, um seinen Hunger zu stillen): die Appetenz. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet »nach etwas strebend«. Damit drückt sie also ein innewohnendes Bedürfnis aus. Wonach streben Organismen? Im fundamentalsten Sinne wohl nach Veränderung. Taxis ermöglicht diese Veränderung, ohne komplexe Entscheidungen und ohne lange Beine oder prächtige Flügel.
Auf etwas zuzustreben, kann genauso wichtig sein wie die Fähigkeit, sich von etwas zu entfernen. Mit Taxis kamen beide Möglichkeiten in die Welt und ermöglichten erstmals zielgerichtetes, bewegtes Leben.
Der Reiz, der eine Taxis auslöst, lässt sich ihrem Namen entnehmen. So bezeichnet Phototaxis beispielsweise die Bewegung auf eine Lichtquelle zu (oder von ihr weg), Thermotaxis die Bewegung in Reaktion auf einen Temperaturreiz und Gravitaxis oder Geotaxis Bewegung, die sich an der Schwerkraft orientiert. Sie ermöglicht es Mikroorganismen beispielsweise, zu erkennen, wo oben und unten ist, und sich in einem Gewässer ins nährstoffreichere Sediment herabzubewegen.
Chemotaxis, die Bewegung aufgrund der Konzentration eines Stoffes, ist eine grundlegende Zellreaktion, die in der frühen Geschichte des Lebens vermutlich entscheidende Überlebensvorteile bot. Gemeinsam mit der Entstehung von Rezeptorsystemen, die in irgendeiner Form die Umgebung erfassen, bot sie die einmalige Gelegenheit, bessere Orte aufzusuchen und ungünstige Umgebungen zu verlassen. Dabei sehen die Schwimmbewegungen von Bakterien alles andere als zielgerichtet aus. Sie sind eine Mischung aus sich abwechselnden Schwimm- und Taumelbewegungen. Auf den ersten Blick erscheint die Bewegungsrichtung zufällig und die Abläufe wirken willkürlich. Im Grunde ist es den Bakterien tatsächlich nicht möglich, sich gezielt von einem Ort zum nächsten zu bewegen. Sie können nicht einfach eine Richtung wählen und losschwimmen. Sie bewegen sich zunächst willkürlich, prüfen dann allerdings ihre Umgebung und bewegen sich gegebenenfalls erneut. In der Summe entsteht dadurch erstaunlicherweise eine zielgerichtete Bewegung hin zu einer Quelle (oder von ihr weg). Durch ihre schlagenden Flagellen erinnern Bakterien irgendwie an winzige Tierchen, doch letztlich sind es nur simple Hüllen mit Ruder. Evolutionsgeschichtlich ist es noch ein weiter Weg von einem flagellenschlagenden Einzeller, der dem Licht entgegenschwimmt, bis zu einem Polarfuchs, der Tausende Kilometer durch die Einsamkeit der Arktis wandert. Doch es ist der erste Schritt auf diesem Weg.
Klein, aber oho
Mit der großen Vielfalt der einzelligen Protisten, die die Entwicklung der komplexeren Eukaryoten-Zelle ermöglicht, kamen vielfältigere Fortbewegungsmethoden ins Spiel. Schaut man etwas genauer hin, sieht man es im Wasser überall wuseln und wimmeln. »Dies war für mich unter all den Wundern, die ich in der Natur entdeckt habe, das Wunderbarste von allen; und ich muss sagen, dass mir bisher nichts größeres Vergnügen bereitet hat als der Anblick so vieler Tausender Lebewesen in einem kleinen Wassertropfen, die sich untereinander bewegen, jedes einzelne Lebewesen mit seiner eigenen Bewegung«, bemerkte der niederländische Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek, als er mithilfe des Mikroskops erste Einblicke in diese uns sonst verborgene Welt gewann.24
Protisten, das ist eigentlich keine stammesgeschichtliche Gruppe, sondern vielmehr eine Sammelbezeichnung für alle Eukaryoten (also Lebewesen mit komplexen Zellen), die eben nicht Pilze, Tiere oder Pflanzen sind. Manche sind mit den Tieren enger verwandt, andere mit den Pflanzen, und auch wenn sie vor beiden entstanden, geht ihre Diversifizierung in der Evolutionsgeschichte weiter. 60.000 Arten sind bekannt, die meisten sind Einzeller und die bekannteste ist vielleicht die Amöbe.
Man sollte diese Einzeller jedoch nicht unterschätzen. Selbst der einfachste Protist ist komplexer als all die kernlosen Prokaryoten (mit den Bakterien und Archaeen), die zuvor schon Hunderte Millionen Jahre die Erde beherrschten. Schließlich müssen Protisten in nur einer Zelle diverse Funktionen ausführen, für die anderen vielzelligen Eukaryoten wie uns diverse Zellen und Organe zur Verfügung stehen. Man muss sich einen Protisten eher wie ein winziges Tier vorstellen statt wie eine unserer Körperzellen.
Zu den Protisten gehören zum Beispiel Pantoffeltierchen. Ihr Körper ist von Tausenden kleinen Härchen, den Cilien, bedeckt. Damit können sie aktiv schwimmen. Sie gehören zur großen Gruppe der Wimperntierchen, die diese Form der Fortbewegung eint. Auch die berühmte Amöbe kann sich fortbewegen. Sie stülpt ihr Plasma wie kleine Scheinfüße aus und zieht den Körper mit dem restlichen Plasma nach. Somit kriecht sie ganz ohne Skelett und Muskulatur. Die Technik ähnelt aber bereits dem, was später in der Evolution Muskulatur und Skelett übernehmen werden. Zu den pflanzenähnlichen Protisten gehört beispielsweise Volvox. Sie sehen aus wie eine filigrane, halb transparente und leuchtend grüne Kugel, deren Wand aus Hunderten oder Tausenden zweigeißeligen Zellen gebildet wird. Wenn sie sich vermehren, bilden sich im Inneren neue Kugeln, die man hindurchscheinen sieht.
Auch die Schleimpilze gehören zu den Protisten. Schleimpilze haben sich in den letzten Jahren durch einige erstaunliche wissenschaftliche Funde auch in der populärwissenschaftlichen Berichterstattung einen Namen gemacht. So zum Beispiel der Schleimpilz Physarum polycephalum, der sich in einem Experiment durch ein Labyrinth bewegte, das dem Großraum Tokyos nachempfunden war.25 Dies tat er so effizient, dass seine Bewegungsmuster letztlich das Bahnnetz Tokyos widerspiegelten. Ohne Augen, Muskeln oder Hirn schafft es der Schleimpilz nicht nur, sich von A nach B zu bewegen, sondern auch die kürzeste, effizienteste Route dafür zu finden. Doch wie kann ein Schleimpilz seine Position verändern? Er besitzt ein Zytoskelett mit bestimmten Proteinen (wie Aktin und Myosin), die auch die späteren höheren Tiere inklusive uns Menschen in ihren Muskeln verwenden. So kann er sich aktiv vorwärtsmanövrieren und seinen Körper nachziehen.
Die früheste vollständig dokumentierte Fortbewegung eines nicht mikroskopischen Lebewesens ist die von Yilingia spiciformis. Ylingia ist ein wurmähnliches Tier, das einer Weizenähre gleicht. Das größte bekannte Exemplar war etwa 27 Zentimeter lang. In der Dreischluchtenregion im heutigen Südchina fanden Forschende im Kalkstein eines Steinbruchs am Fluss Yangtse die über 540 Millionen Jahre alte Spur eines Tieres. Das Besondere daran: Erstmals waren nicht nur Lauf- oder Grabspuren des Tieres sichtbar. Solche Spuren hatte man in der Gegend schon früher gefunden. Sie bilden vielleicht die ältesten hinterlassenen »Fußabdrücke« in der Geschichte tierischen Lebens.26 Spuren alleine lassen jedoch einen großen Interpretationsspielraum offen, besonders in einer Welt, deren Bewohner einem überwiegend unbekannt sind.
Diesmal fand man jedoch etwas, das in der Fossilgeschichte ein seltenes Glück ist. Der Verursacher der Spur wurde mitsamt seiner Fährte konserviert.27 Wie in einem steinernen Gemälde, das den Moment festhält, in dem die Tiere das Laufen lernten. Die Spuren eines wurmartigen Urtiers mögen zunächst unspektakulär erscheinen, doch die Entwicklung der Motilität (die Fähigkeit zur aktiven Bewegung) höherer vielzelliger Tiere wie Ylingia war eine Innovation, die die Erde nachhaltig veränderte.
Fortbewegung prägt das Leben seit seiner Entstehung. Schon die ersten Organismen in der Geschichte des Lebens schwammen offenbar mithilfe von Rudern aktiv durch die Ursuppe des Lebens. Bis zur Vielfalt heutiger tierischer Bewegungen bedurfte es jedoch einer langen Entwicklungsgeschichte. Ein Großteil des tierischen Lebens, das sich heute so selbstverständlich durch unsere Welt bewegt, entstand erst in den letzten wenigen Hundertmillionen Jahren einer Milliarden Jahre währenden Geschichte.
Auch war die uns so viel vertrautere Welt an Land über lange Zeit überwiegend immobil. Nachdem Pflanzen und Pilze das Land erobert hatten, sollten noch Millionenjahre vergehen, bis die höheren Tiere im großen Stil Bewegung in die Sache brachten. Warum das Leben an Land zunächst stillstand, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt betrachten. Am Ende der Geschichte (zumindest aus heutiger Sicht) steht jedenfalls eine enorme Vielfalt von Lebewesen, die ihre eigenen Wege gefunden haben. Was sie vom Bakterium bis zum Mauersegler vereint, ist, dass sie sich bewegen, weil sie nach Veränderung streben.
Das Streben nach Verbesserung ist allen sich bewegenden Organismen gemein. Egal, ob wir ein Pantoffeltierchen oder eine Biologin sind. Wir bewegen uns, weil wir uns mehr erhoffen vom Dort. Aufgrund von Millionen kleinen Entscheidungen, bewusst oder unbewusst, bewegen wir uns fort. Ein Ruderschlag hin zum Licht. Ein Flügelschlag hin zu einem sicheren Rastplatz. Ein Schritt hin zu einem neuen Territorium am anderen Ende der arktischen See.
2
Die Natur der Bewegung
Sanft fällt Sonnenlicht durch das Blätterdach des Amazonas-Regenwaldes und verliert sich auf seinem Weg durch Schichten von Grün. Nahe am Boden ist das Licht schwach und schummrig. Nur wenige, vereinzelte Lichtflecken beleuchten einen Teppich aus Moosen und Farnen. Es riecht nach feuchter Erde.
Gut getarnt von der dichten Krautschicht bevölkert eine Vielzahl an Insekten und anderen Kleinstlebewesen den Waldboden. Sie bauen herabfallendes Laub und totes Holz ab, belüften den Boden und bilden die Grundlage eines weit verzweigten Nahrungsnetzes im artenreichsten Ökosystem der Erde. Immer wieder verrät ein leises Rascheln oder die Bewegung einiger Blätter, dass hier auch größere Bodenbewohner unterwegs sind.
Aus der Krautschicht heraus recken sich Sträucher bis zu acht Meter hoch dem Licht entgegen. Hier treffen sich Schatten und Licht und verschmelzen zu einem diffusen Leuchten. Große Blätter helfen Sträuchern und Palmen, so viel wie möglich des spärlichen Lichts aufzunehmen. Über den Stängel eines langen Palmblattes marschiert eine Straße aus Blattschneideameisen. Ein großer, leuchtend blauer Schmetterling flattert vorbei und verschwindet wieder im Blätterwerk. Die Luft ist warm und Wasserdampf hängt in Schwaden zwischen Sträuchern und Bäumen.
In der unteren Baumschicht des Waldes stehen Gummibäume, Baumfarne und Kakaobäume. Um das kostbare Licht zu nutzen, das die oberste Baumschicht des Regenwalds durchbricht, wachsen sie schmal nach oben. Einzelne Sonnenstrahlen werfen schimmerndes Licht auf baumbewohnende Bromelien. Als gelbe und feuerrote Farbtupfer stechen sie aus dem Grün. Statt aus dem Erdreich wachsen sie an den Stämmen und auf den Ästen anderer Pflanzen, um näher ans Licht zu kommen. Dazwischen stehen die mächtigen Stämme derjenigen Bäume, die das Kronendach des Regenwaldes bilden.