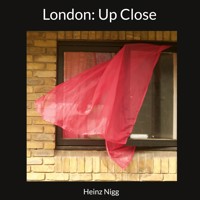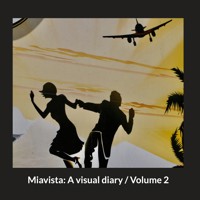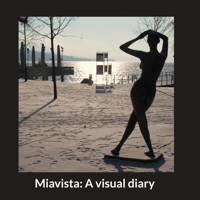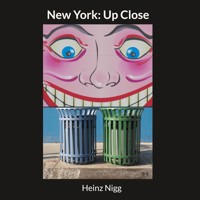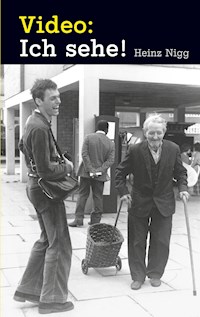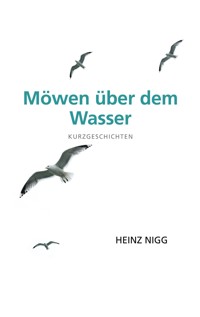
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn sich das Leben plötzlich ändert? Eine Frau im Krieg sucht das Gespräch mit dem Feind. Ein Mann erwacht aus einem Albtraum und muss sich der Realität stellen. Ein Kind streift durch eine verlassene Fabrik und macht eine überraschende Entdeckung. Eine Gruppe kämpft für ein Kulturzentrum für alle. Doch wie weit tragen Neugier, Empathie und Zivilcourage, wenn sie auf Widerstand stoßen? In diesen Erzählungen werden Realität und Fantasie geschickt verknüpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ein kosmischer Biss
Aufrechter Gang
Die Stadt erträumen
Roter Punkt
Brückenbauerin
Am Zaun
Verborgene Stimmen
Seltsame Zeiten
Flucht aus Platons Höhle
Eine Schildkröte stellt Fragen
An einer Kreuzung
Berliner Kinogeschichte
I am still alive
Sofie in Manhattan
Wer will noch ein Stück?
Oxford Street
London ruft
Addio Lugano bella
Auf der Suche nach dem Nichts
Heimreise
Steil auf den Hausberg
Willkommen in Bennos Welt
Kunst in der Telefonzelle
Unerwartete Liebe
Eine Trennung
Stilles Aufbegehren
Kleine Schritte
Möwen über dem Wasser
Das Schulheft
1487
Mutig, liebe Brüder
Anpassung und Widerstand
Margot, Luise, Mina und Gino
Das vergessene Denkmal
Gold und Silber
Wenn Banken wanken
Der Duft von Gattafin
Der Preisträger
Kurzer Urlaub
Doppelbilder
Ein stiller Tag
Ein verlorener Sohn
Wiedersehen
Wohnen im Stadthotel
Feuer in der Lichtung
Wo bist du?
Ein kosmischer Biss
Ich schlurfe durch die Wohnung
Es ist Sommer
Der Kühlschrank surrt
Bio-Kirschen locken
Ein Gedanke blitzt auf
An den Urknall vor 13 Milliarden Jahren
Es war heiß: drei Milliarden Grad
Aus Chaos entsteht Ordnung
Irgendwann endet alles
Sterne erlöschen
Dunkelheit breitet sich aus
Hier bin ich, jetzt, in diesem Augenblick
Ich beiße in eine Kirsche – Saft und Süße
Ich kaue langsam
Das Universum in meinem Mund
Draußen zwitschern Vögel
Die Sonne wärmt das Fensterglas
Unser Planet
Ein Zuhause im Kosmos
Riesig und doch begrenzt
Ein Atemzug, ein Biss, ein Staunen
Noch eine Kirsche
Noch ein Gedanke
Noch ein Augenblick
Aufrechter Gang
Rolf und ich sitzen in einem kleinen Café in Zürich. Draußen ist es herbstlich kühl, drinnen umgibt uns eine warme, zeitlose Atmosphäre. Ich schaue in Rolfs Gesicht, von den Jahren geprägt, aber mit dem unverändert wachen Blick, der mich in die wilden Siebziger zurückversetzt – eine Zeit voller Träume und Pläne. „Weißt du noch, wie wir damals die Schulbank gedrückt haben?“, frage ich ihn. „1968 – das Jahr, in dem alles möglich war?“
Rolf lacht, aber in seinen Augen liegt doch etwas Melancholie. „Natürlich erinnere ich mich. Wir wollten die Welt verändern, mehr Freiheit, weniger Maulkorb. Hätten wir damals gewusst, dass Freiheit auch Verantwortung bedeutet ... “
„Wahrscheinlich hätten wir trotzdem rebelliert“, antworte ich trocken. Auch ich spüre etwas Wehmut in mir. Eine Weile schweigen wir. Dann tauschen wir Erinnerungen aus wie Karten bei einem spannenden Spiel. Unsere erste gemeinsame Wohnung: kahle Wände, eine leere Truhe mit einer Kerze darauf. Es war, als würden wir die Welt für uns neu erschaffen. Da fällt mir der Spruch ein, den wir damals in die Truhe geritzt haben: „Wir wollen immer wach sein!“
Rolf nickt. „Genau so haben wir uns das vorgestellt. Mit offenen Augen durchs Leben gehen!“ Er schweigt. Ich spüre, wie sich etwas in ihm bewegt.
„Weißt du“, sagt er schließlich, „manchmal frage ich mich, ob es der aufrechte Gang ist, der uns zu etwas Besonderem macht. Ohne ihn kein Homo sapiens, keine Kultur, kein Bewusstsein.“
„Der aufrechte Gang?“, wiederhole ich überrascht. „Was hat das mit Kultur zu tun?“
„Eine ganze Menge.“ Rolf rückt näher. „Der Antropologe Adolf Portmann nennt uns Menschen sekundäre Nesthocker. Wir kommen unfertig auf die Welt, hilflos und abhängig. Vielleicht macht uns gerade dieses Unfertige offen für soziale Kontakte und gegenseitiges Lernen.“
„Das klingt plausibel. Soziale Bindungen als eine Überlebensstrategie!“
„Genau, und das unterscheidet uns vielleicht von anderen Tieren: Isoliert können wir kaum überleben. Unsere Gefühle, unsere Neugier, unsere Kreativität – all das entfaltet sich nur, wenn wir uns verbunden fühlen.“
Rolf hebt die Kaffeetasse, seine Stimme wird etwas leiser. „Denk an die Geschichten der rumänischen Waisenkinder unter Ceaușescu. Erschütternd, wie sie darunter gelitten haben, ohne wirkliche Bindungen aufzuwachsen.“
„Ein trauriger Gedanke“, stimme ich zu. „Vielleicht ist unser Bedürfnis nach Kontakt und Nähe tatsächlich der Schlüssel zu dem, was wir Kultur nennen.“
Ein Lächeln huscht über Rolfs Gesicht. „Und zur Rebellion, wenn es sein muss“, fügt er trocken hinzu. Wir lachen.
Nach einer Weile ergänze ich: „Unsere WG hat uns zusammengebracht und unseren Horizont erweitert.“
„Ja, das stimmt,“ antwortet Rolf. „Es waren die Gleichaltrigen, unsere Freundinnen und Freunde, die uns gezeigt haben, dass es mehr gibt als die Regeln unserer Eltern und Verwandten.“
Wir schweigen, bis Rolf fragt: „Glaubst du, wir sind wach geblieben?“
Ich schaue ihn amüsiert an. „Wach? Vielleicht anders, als wir damals dachten, aber ja – auf unsere Art sind wir wach geblieben.“
In diesem Augenblick fühle ich mich jung. Während die Herbstsonne durch das Fenster des Cafés fällt, wird mir klar: Die Welt hat sich verändert, aber sie steckt noch immer voller Möglichkeiten.
Die Stadt erträumen
Jill und Stefan spazieren durch den neuen Stadtteil Zürich-West hinter dem Hauptbahnhof. Die Sonne steht hoch am Himmel, ihr Licht fällt fast zu perfekt auf den akkurat gepflegten Park, den sie durchqueren. Das Geräusch eines Zuges ist deutlich zu hören. Die Gleise sind nah. Der Rest der Stadt scheint weit entfernt.
„Hier sieht es aus wie auf einer Bühne, bereit für den ersten Akt“, sagt Jill und bleibt vor einem hübschen kleinen Schulgebäude aus Holz stehen, dessen Fassade im Sonnenlicht glänzt.
„Da würde ich gerne zur Schule gehen“, seufzt Stefan bewundernd.
„Aber dieses schöne Gebäude ist natürlich nicht mehr für uns bestimmt“, meint Jill, „es gehört den nächsten Generationen.“
Neugierig nähern sich die beiden dem Holzgebäude und sehen eine Gruppe Erwachsener auf dem Schulhof Fußball spielen. Jill und Stefan sprechen sie an. Sie gehören zu einem Planungsteam, das sich mit der Entwicklung von Zürich-West beschäftigt. Engagiert berichten sie von ihren Ideen, den neuen Stadtteil mit Leben zu füllen.
„Warum passiert hier noch nichts?“, fragt Jill schließlich etwas frustriert.
„Das ist alles noch neu“, erklärt einer aus der Gruppe, der sich als Tom vorstellt und Stadtplaner ist. „Es wird Jahre dauern, bis hier richtig Leben einzieht.“
Jill zieht die Augenbrauen hoch. „Warum warten?“
Eine junge Frau namens Anna, eine Filmemacherin, ergreift das Wort.
„Das noch leere Schulgebäude ist ein Ausgangspunkt. Wir machen einen Film darüber, wie die Kinder hier einmal die Räume und die Umgebung nutzen könnten. Vor kurzem habe ich eine Filmdokumentation über eine kleine Stadt in Italien gemacht. Dort gestalten die Kinder ihre Schule selbst, von den Wänden bis zum Schulhof und inspirieren damit ihre Umgebung.“
Anna macht eine kurze Pause und schaut in die Runde, bevor sie hinzufügt: „Warum soll das nicht auch hier in Zürich passieren?“
Jill staunt: „Ein Experiment, um die Zukunft vorwegzunehmen! Die Idee gefällt mir.“
Die Energie der Gruppe ist ansteckend.
„Manche Dinge existieren nur, weil wir daran glauben“, sagt Tom leichthin.
„Und was passiert, wenn wir nicht mehr daran glauben?“, fragt Jill augenzwinkernd.
„Dann verschwindet die Stadt wie ein Spuk“, sagt Anna lachend.
Jill und Stefan verabschieden sich von der Gruppe und gehen weiter. Sie erreichen eine Brücke, die über eine breite Ausfallstraße führt. Unten stehen Menschen vor einem Asylbewerberheim, die Papiere fest in der Hand. Einige unterhalten sich leise, andere sind allein. Alles wirkt wie eingefroren. Je länger Jill die Menschen beobachtet, desto mulmiger wird ihr. Einige laufen nervös auf und ab. Jill kämpft gegen das Gefühl an, nichts für sie tun zu können.
„Was wäre, wenn ihre Zukunft genauso zur Diskussion stünde wie die des neuen Stadtteils?“, fragt Jill und lehnt sich ans Geländer. „Es ist, als würden wir die Zukunft der Stadt planen und diese Menschen außen vor lassen.“ Das macht mich traurig.
Stefan blickt auf die Szene unter ihnen und meint lakonisch: „Ihre Wirklichkeit wird nicht gestaltet, sondern verwaltet. In ihren Gesichtern sehe ich Freude und Resignation zugleich. So viel hängt vom Zufall ab und von Entscheidungen, die sie nicht beeinflussen können.“ Er zögert kurz und fügt hinzu: „Aber vielleicht ändert sich alles schneller, als wir denken, wenn wir nur genug Druck machen.“
Jill: „Ja, vielleicht. Ich hoffe jedenfalls, dass unsere Stadt die Asylsuchenden nicht nur als Statisten in einem Theaterstück behandelt.“
Mit der Straßenbahn fahren Jill und Stefan zur Roten Fabrik, wo gerade ein Musikfestival stattfindet. Punk der 80er Jahre dröhnt aus den Boxen in der Aktionshalle. Der Kontrast zum ruhigen Park mit dem neuen Schulhaus in Zürich-West könnte kaum grösser sein. Auf der Bühne steht Rams, der legendäre Sänger der Bucks. Die Menge tanzt ausgelassen.
„Glaubst du, dass die Rote Fabrik überleben wird?“, fragt Stefan, als er sich mit Jill in eine ruhige Ecke setzt. „Die Jungen verdrängen die Alten. Aber ohne das Wissen der Alten ...“, zitiert er aus einem Jubiläumsbuch über die Rote Fabrik.
„Wir brauchen beides“, sagt Jill, „den Idealismus der Jungen und die Erfahrung der Alten. Irgendwie wird das schon klappen.“
Am nächsten Tag leiten Jill und Stefan einen Workshop in der Roten Fabrik. Vierzig Schülerinnen und Schüler aus einem Vorort von Zürich sind gekommen. Jill und Stefan führen die Kinder durch die Räume und erzählen von den Jugendunruhen der 80er Jahre und dem Kampf um Freiräume. Die Kinder hören aufmerksam zu, doch immer wieder wandern ihre Blicke zu den bunten Wänden und den Kunstwerken um sie herum.
Ein Kind fragt: „Braucht es Gewalt, um Freiräume zu schaffen?“
Jill muss kurz nachdenken. „Im Notfall schon, aber nie gegen Menschen“, sagt sie. „Oft reicht eine gute Idee, um etwas in Gang zu bringen.“
Verträumt blickt Jill in die Ferne und denkt an die Schule in Zürich-West – die Schule, die nicht fertig ist.
Nach dem Workshop gehen die Kinder auf Fotosafari durch die Fabrik. Sie knipsen die Graffiti an den Wänden, die Aktionshalle und die Kunstwerke. Jill und Stefan beobachten, wie die Kinder die Umgebung entdecken und auf ihre Weise festhalten.
Als sie die Fabrik verlassen, sagt Stefan: „Vielleicht ist alles, was wir tun, ein großer Traum – ein Traum von einer Stadt, wie wir sie uns wünschen. Einiges wird in Erfüllung gehen, manches wird verschwinden, und wer weiß, was noch alles passieren wird.“
Jill lächelt und denkt an Robert Musil: Wo es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben.
Roter Punkt
Der Abend nach meiner Wanderung beginnt entspannt. Ich sitze in einem Restaurant, umgeben vom Stimmengewirr der Gäste und dem gelegentlichen Klirren von Gläsern.
Da erhebt ein Mittfünfziger am Nebentisch seine Stimme, als wolle er sichergehen, dass ihn alle hören. „Ich heirate meine Inderin erst, wenn sie den roten Punkt von ihrer Stirn entfernt hat!“ Er grinst. Einige Gäste lachen gezwungen, andere starren angestrengt in ihre Gläser, als suchten sie dort eine Fluchtmöglichkeit. Unbehagen breitet sich aus. Als würde ein kalter Wind durch den Raum wehen.
Ich beobachte die Szene aus den Augenwinkeln und nippe an meinem Glas. In der Ecke sitzt eine Frau mit asiatischen Gesichtszügen. Ihre tätowierten Arme und das elegante Kleid verleihen ihr eine besondere Coolness. Die Arme hat sie vor der Brust verschränkt. Obwohl sie ihren Kopf leicht senkt, fixieren ihre Augen den Redner – wachsam, fast herausfordernd. Neben ihr sitzt ihr Begleiter, ruhig und in sich gekehrt.
Vom Nebentisch beugt sich ein junger Mann mit gegelten Haaren und buntem Hemd vor. Lächelnd fragt er: „Wenigstens ist sie keine Wrestlerin, oder?“ Seine Worte klingen unsicher, wie ein letzter Versuch, die angespannte Stimmung zu retten.
Die Frau steht auf. Ihre Bewegungen sind ruhig, beinahe fließend. Sie tritt einen Schritt vor und sagt leise, mit fester Stimme: „Sie reden, als wären wir hier auf einer Trophäenjagd?“
Die Gäste verstummen. Alle Blicke richten sich auf sie. Der eben noch so selbstsichere Redner runzelt die Stirn und meidet ihren Blick.
„Wir Frauen tragen rote Punkte auf der Stirn“, fährt sie fort, „weil das zu unserem Glauben gehört. Aber wenn es ein Kriterium für Ehetauglichkeit ist, solche Symbole wegzulassen, dann ist das einfach dumm.“
Betretenes Schweigen. Der Redner errötet, wohl weil ihm klar wird, dass er gerade die Hauptrolle in einem peinlichen Drama übernommen hat.
„War doch nur Spaß“, sagt er zu seinem Tischnachbarn, der plötzlich damit beschäftigt ist, auf seinem Handy eine imaginäre Nachricht zu lesen.
Die Frau lächelt unmerklich. Sie fügt hinzu: „Wenn das Ihr Niveau ist, sollte ich vielleicht doch Wrestlerin werden. Das wäre sicher ein interessanter Abend.“
Ihr Begleiter hebt langsam den Kopf, legt seiner Partnerin sanft die Hand auf die Schulter und nickt – eine vertraute Geste, als hätten sie solche Situationen schon oft erlebt.
Das Gemurmel setzt wieder ein, aber die Gespräche sind leiser, vorsichtiger geworden.
Manchmal genügt eine klare Stimme, um eine ganze Gruppe zum Nachdenken zu bringen.
Brückenbauerin
Maryam schaut sich im Kursraum um. Neugier und eine leichte Beklommenheit liegen in der Luft. Ihr Blick fällt auf Hamid, den Taxifahrer aus Kabul. Sein traditionelles Gewand und der lange Bart stechen sofort ins Auge. Neben ihm sitzen seine sechs Söhne, die Schultern gesenkt, die Blick nervös auf den Boden gerichtet.
„Wir sprechen heute über Gleichberechtigung“, beginnt Maryam. Sie sieht, wie Hamids Kiefermuskeln spielen. Sie spricht von Frauenrechten. Hamid zuckt zurück.
„Wie kannst du das nur akzeptieren?“, zischt er sie an.
Beim Thema Homosexualität schüttelt er den Kopf und verschränkt die Arme. Sein Blick drückt Unverständnis und Ablehnung aus. Maryam nimmt innerlich Abstand. Sie kennt diese Abwehr nur zu gut und sagt: „Ich erinnere mich an meine eigene Ankunft in Europa als junge Iranerin. Die kulturellen Unterschiede waren überwältigend. Aber ich habe es geschafft. Jetzt möchte ich euch helfen, diese Brücke zu überqueren.“
In der Pause hört sie zufällig ein Gespräch zwischen Hamids ältestem Sohn und seinem Freund.
„Sie mag mein Land nicht“, sagt der Sohn verbittert, fast trotzig. „Neulich wollte ich ein Mädchen kennenlernen. Sie hat mich abgewiesen und gesagt, ich sei aufdringlich. Was soll das heißen?“
Sein Freund stimmt ihm zu. „Mir ist etwas Ähnliches passiert. Ich wollte mein Fahrrad am See mit Wasser putzen. Da wurde ich angerempelt und gefragt, was ich da mache. Ich fühle mich, als hätte ich kein Recht, hier zu sein!“
Maryam bleibt stehen. Sie könnte einfach weitergehen, aber sie weiß, wie wichtig es ist, solche Sätze nicht unkommentiert zu lassen. „Ich weiß nur zu gut, wie anstrengend es ist, sich in einer neuen Kultur zurechtzufinden“, sagt sie schließlich bestimmt und kommt näher. Die Jungen schweigen. Ihre Blicke ruhen auf Maryam – vielleicht schon etwas weniger verschlossen als zuvor.
Maryam gibt nicht auf. Woche für Woche kommt sie in den Kursraum, erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, ermutigt die Teilnehmer, Fragen zu stellen. Geduldig hört sie zu, erklärt, diskutiert – und notiert kleine Fortschritte. Sie weiß: Veränderung braucht Zeit.
Am letzten Kurstag kommt Vater Hamid zu ihr. Seine Schultern wirken entspannter, sein Blick ist offen und neugierig.
„Jetzt verstehe ich“, sagt er leise. „Die Welt muss nicht überall so sein wie in Afghanistan. Vielleicht gibt es auch hier Gutes zu entdecken.“
Maryam ist erleichtert. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt ist getan. Sie weiß: Der Bau jeder Brücke beginnt mit dem ersten Stein.
Am Zaun
Die Sonne brennt erbarmungslos auf das Mittelmeer. Zweitausend Menschen drängen sich vor einem sieben Meter hohen Zaun. Verzweifelt, aber entschlossen. Jemand ruft: Wir müssen es versuchen!
Jenseits des Zauns stehen Uniformierte, die Helme tief ins Gesicht gezogen. Ein paar Steine fliegen. Ein Schrei in der brütenden Hitze: „Bitte, helft uns!“ Die Menge drängt nach vorn, wie eine Welle, die gegen einen Felsen brandet.
Mitten im Chaos steht sie: eine Frau mit staubbedecktem Gesicht, die Tasche fest an den Körper gepresst. Ihr Atem geht stoßweise. Neben ihr hustet ein Mann, bricht im beißenden Tränengas zusammen. Für einen Moment scheint die Welt stillzustehen.
„Komm, gib mir deine Hand!“ Die Stimme der Frau ist klar und ermutigend. Der Mann zögert, seine Augen sind trüb vor Angst und Erschöpfung. Schließlich ergreift er ihre Hand. „Gib nicht auf“, sagt sie und zieht ihn hoch.
Ein junger Mann hält sein Handy hoch über den Kopf. Er filmt das Chaos. „Das passiert hier jeden Tag und keiner schaut hin!“
Neben ihm steht eine Frau, die mit wütender Stimme ruft: „Das sind doch Menschen!“
Videos tauchen in den sozialen Medien auf und verschwinden wieder unter neuen Schlagzeilen.
Ein älterer Journalist mit grauem Bart steht abseits, die Kamera in der Hand: „Wir profitieren von