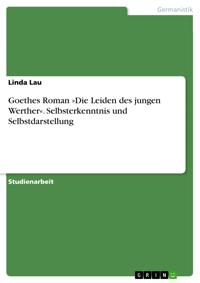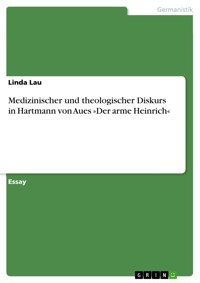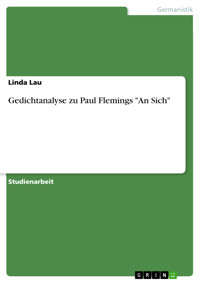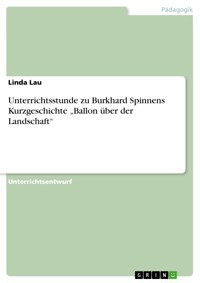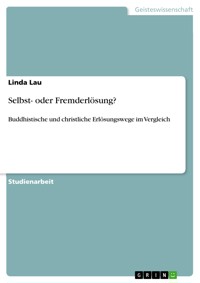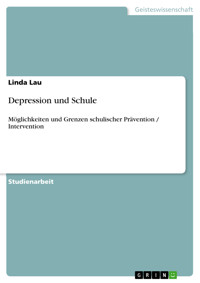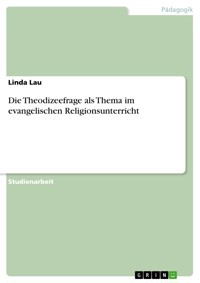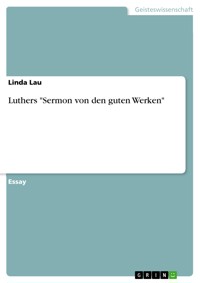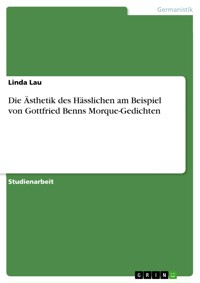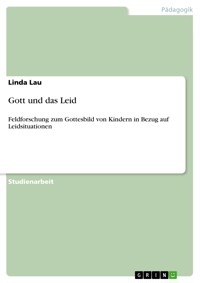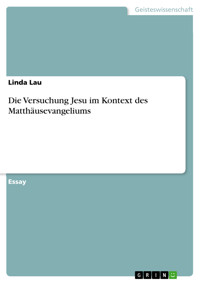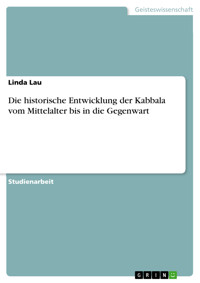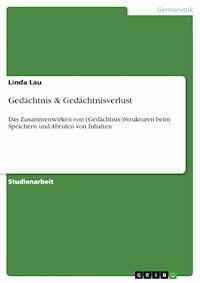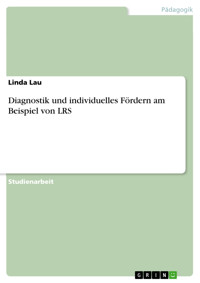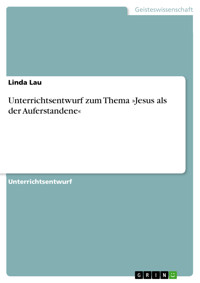15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Theologie - Biblische Theologie, Note: 13, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Für eine eigene zu bearbeitende exegetische Arbeit im Rahmen des Seminars „Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik“ wurde der Bibeltext aus Matthäus 5, 38-48 gewählt, der ein Teil der Bergpredigt Jesu ist und zwei der für sie charakteristischen Antithesen umfasst. In einer Abhandlung über das Verhältnis von Gesetz und Propheten lässt Jesus deutlich werden, dass er nicht gekommen sei um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. In den darauf folgenden Antithesen wird dies gezeigt: Einem von Jesus zitierten Gebot aus dem Alten Testament stellt er stets ein „Ich aber sage euch [...]“ gegenüber. Die Intention des Verfassers Matthäus könnte gewesen sein, Jesus als Lehrer darzustellen, der über große Weisheit verfügt, die über die menschliche Erkenntnis hinausgeht. Außerdem kann eines seiner Anliegen gewesen sein, die Botschaft, die ihn selbst zur Buße und in die Nachfolge getrieben hatte, weiterzusagen und einen authentischen Bericht über das Leben und Wirken Jesu zu verfassen. Schülern könnte sich einen Sinn einerseits erschließen, indem sie das geforderte Verhalten Jesu als richtig und nachahmenswert erkennen, andererseits könnte es aber auch als unerfüllbare Forderung erkannt werden. Schüler könnten Jesus ebenso als Gesetzesgeber und Lehrer, wie auch als Gerechten, für den das Liebesgebot im Vordergrund steht, deuten. Auf den Leser kann der Text sehr herausfordernd wirken. Er kann für ihn persönlich die Darbietung eines moralisch richtigen Verhaltens im Umgang mit den Mitmenschen sein. Auch können die Erzählungen ermutigend wirken, da Jesus eine völlig neue Möglichkeit eröffnet mit Konflikten, Hass und Streit umzugehen, auf den anderen wiederum wirkt sie verstörend und unbegreiflich, ja geradezu utopisch. In der Folgenden Arbeit beschäftigen wir uns als Gruppe mit der genannten Textstelle, die zweigeteilt unter den Titeln „Vom Vergelten“ und „Von der Feindesliebe“ in der Lutherübersetzung erscheint. In der Wahl des methodischen Zugangs stützen wir uns auf die historisch-kritische Exegese, die besonders viel Wert darauf legt, den biblischen Text in seinem historischen Kontext zu verstehen und auszulegen, wobei die Entstehungsgeschichte eine besondere Rolle spielt. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Page 1
1. Einleitung
1.1. Allgemeine und begriffliche Einführung
„Die Erzähler des Neuen Testaments waren nicht nur Gestalter oder gar Schöpfer ihrerErzählungen, sondern in erster Linie selber Rezipienten. Mit ihren eigenen
Vorstellungen, mit ihrem Verstehen, ihren Fragen, erzählten sie die Jesus-Christus-Geschichte nach,und sie erzählten sie neu.“1
So antwortet Eckart Reinmuth in seinem WerkHermeneutik des Neuen Testamentsauf die Frage, was in neutestamentlichen Texten erzählt wird. Die Jünger waren Augenzeugen eines der größten Ereignisse in der Geschichte und beschreiben dies vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Vorstellungen, Erfahrungen und dem Kontext ihrer Kultur. Somit tradieren sie nicht nur den faktischen Inhalt der Geschichte, sondern auch einen ihr beigemessenen Bedeutungsinhalt.
Handelt es sich bei den biblischen Erzählungen nun um persönlich erfahrene Wahrheiten, die eine bestimmte Personengruppe für sich erschließen und in Anspruch nehmen konnte - oder handelt es sich um allgemeingültige, absolute Wahrheiten, die für die ganze Menschheit geltend gemacht werden können? Reinmuth legt seine Emphase darauf, nach Wahrheit zu fragen, und konstatiert, dass wir mit unterschiedlichen Wahrheiten und Annahmen von Wahrheit leben, die widersprüchlich nebeneinander stehen können.2Dabei ist er sich des Risikos bewusst, das besteht, wenn ein Text Kritikern und Befürwortern gleichermaßen ausgesetzt ist, der sich nicht vor seiner eigenen Interpretation schützen kann, sondern dem Verständnis und dem Urteil seiner Rezipienten ausgeliefert ist. Auch im ArtikelDie Welt verstehen „gemäß den Schriften“von Thomas Ruster finden sich wichtige Punkte zur Frage wie sich Bibeltexte verstehen lassen. Zu Beginn geht er auf die Situation des heutigen Religionsunterrichts ein, dessen Methode es ist, an das Gottesverständnis der Kinder anzuknüpfen und ihnen damit das christliche Gottesverständnis zu erläutern. Dabei kann sich das Wirklichkeitsverständnis der Schüler3von dem der Bibel unterscheiden. Es kann nicht einfach assimiliert werden, sondern der Religionsunterricht komme da zum Ziel, wo die tatsächliche Lebenswelt als Voraussetzung genommen und von dort aus das Wirklichkeitsverständnis der Bibel erklärt wird. Die Schüler sehen sich mit ihnen fremden Welten konfrontiert und reagieren unterschiedlich auf die Anschauung der Bibel. Die meisten Schüler und auch Lehrer richten ihr Wirklichkeitsverständnis an den Naturgesetzen
1Reinmuth, E.:Hermeneutik des Neuen Testaments-Eine Einführung in die Lektüre des neuen Testaments,Göttingen 2002,
S. 77.
2Vgl. Reinmuth: a.a.O., S.70ff.
3Zur besseren Lesbarkeit wird sich auf die männliche Form beschränkt.
Page 2