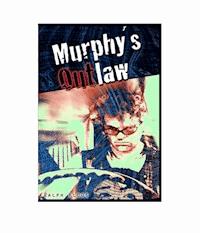
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einige Zutaten zu dieser wahren Story finden sich in jeder spannenden Erzählung: Sex, Drugs, Liebe, Verrat, Flucht und Wiederkehr - angerührt mit jeder Menge Rock ´n Roll - geschüttelt von einer korrupten Jury - genossen auf einer kleinen Atlantik-Insel im ewigen Frühling der Canary Islands. Doch Murphy´s Outlaw ist mehr als eine biographische Piraten-Geschichte ... Der Leser wird auf eine mit treibenden Beats unterlegte Reise in eine fremde Welt entführt, und dann nimmt die Geschichte eine vollkommen unerwartete Wendung … Ein lange vertuschtes Geheimnis um das vergessene Foltergefängnis der katholischen Inquisition wird entdeckt und gelüftet und somit ist dieser investigative Teil von Murphy´s Outlaw der schlagende Beweis dafür, dass das Schicksal einen ausgesucht exquisiten Humor hat und die Besten Geschichten vom wahren Leben geschrieben werden. Mehr Infos über dieses Buch auf: murphys-outlaw.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralph Kloos
Murphy´s Outlaw
Rübezahl Verlag
Originalausgabe von 2010
Wenn alles was schief gehen kann, schief geht,
dann nennt man das: MURPHY´S LAW.
Und wenn es dann trotzdem noch gut geht,
dann heißt das ab jetzt: MURPHY´S OUTLAW.
4. Juli 1629 / Bamberg / Untere Sandstrasse Elisabeth hatte sich gerade angeschickt, ihr heutiges Tagwerk in ihrer kleinen Schneiderei vorzubereiten, als es mehrmals laut an der Haustür klopfte. Noch bevor sie die Tür erreicht hatte pochte es erneut, dieses mal aber wesentlich stärker und fordernder. Elisabeth hatte die Türklinke erst halb heruntergedrückt, als die Haustür krachend aufsprang, denn einer der “Besucher” hatte fest mit dem Stiefel dagegen getreten, und innerhalb weniger Augenblicke war die kleine Schneiderstube voll geharnischter Büttel des Fürstbischofs von Bamberg. “Seid Ihr die Elisabeth Möhrlin - auch Einhendlers Lisbeth genannt - und von Marckschonfeld gebürtig?” Mit scharfer Stimme hatte sie der Anführer der Männer angeherrscht und Elisabeth war so verstört, dass sie nur stumm nicken konnte, denn ihre schlimmsten Alpträume drohten gerade wahr zu werden. Den Hauptmann, der ihr die Hiobsbotschaft direkt in ihr engelshaftes Gesicht verkündete, kannte sie flüchtig, doch er war vollkommen ungerührt von ihrem panischen Gesichtsausdruck: ”Elisabeth Möhrlin, Ihr werdet verdächtigt, mit den Zauberern und Hexen gemeinsame Sache zu machen. Darüber hinaus wurdet Ihr von mehreren bereits verurteilten Truden besagt: Man hat Euch beim Hexentanz, beim Ausritt und beim “Schlecht-Wetter machen” erkannt und Ihr werdet deshalb - im Namen des Fürstbischofs - von der Hexenkommission im Malefiz Haus vernommen. Ihr werdet uns also unverzüglich dorthin begleiten!” Wie in Trance streichelte die junge Schneiderin ein letztes Mal über den schönen Damaststoff, den sie gerade mit einer Abschlussborte umnäht hatte, doch einer der Büttel zog sie ruckartig an der Schulter, fesselte ihre schlanken Hände mit einem groben Strick und zog sie unsanft aus der Tür in die kleine Gasse, die nach wenigen Metern in die Sandtrasse führte. Dann hörte Elisabeth das laute Poltern der Stiefel im ersten Stock, denn die Schergen untersuchten das gesamte Haus nach verdächtigen Gegenständen und okkulten Beweisen. Seitdem ihre liebe Tante Katharina vor vier Monaten verstorben war, wohnte Elisabeth allein in dem verwinkelten Haus mit der Schneiderwerkstatt im Erdgeschoss und führte dort ein zurückgezogenes Leben. Ihre Tante hatte sie im Frühjahr 1623, mit 12 Jahren, nach Bamberg geholt, denn ihre leiblichen Eltern waren im Abstand von wenigen Wochen in Marckschonfeld verstorben und Elisabeth hatte sonst keine anderen Verwandten. Eine Monat nach ihrer Ankunft wurden große Feierlichkeiten im gesamten Erzbistum vorbereitet, um den neu gewählten Fürstbischof Johann Georg II, Fuchs von Dornheim gebührend in sein katholisches Hochamt einzuführen. Elisabeth hatte noch nie so viele fremdartige Menschen gesehen, die aus dem gesamten Reich angereist waren und in ihren besten Kleidern eine tagelange opulente Amtseinführung feierten. Nach seiner Einführungspredigt hatte der neue Fürstbischof großzügig Goldmünzen unter das Volk werfen lassen und selbst die Armenhäuser der Stadt wurden mit allerlei milden Gaben und mehreren Fässern Wein beschenkt. In den ersten Jahren seiner feudalen Herrschaft schien Fürstbischof Fuchs von Dornheim kein besonderes Interesse an weiteren Hexenprozessen zu haben und als das “Hexenbrennen” dann doch begann, war zuerst auch nur die kleine Stadt Zeil am Main betroffen, die ca. 30 Kilometer von Bamberg entfernt war und auf dem Weg ins Bistum Würzburg lag. Im Jahr 1626 kaufte Johann Georg ein großes Grundstück von den Stahlschützen der Stadt. Es lag direkt an der Stadtmauer und zusammen mit dem Generalvikar Dr. Friedrich Förner liess er auf diesem Gelände das Malefiz-Haus errichten, dass Ende 1627 in Betrieb genommen wurde Spätestens nachdem im Vorjahr der Kanzler der Stadt, Dr. Georg Haan mit seiner gesamten Familie verbrannt worden war, konnte sich kein Bürger in Bamberg mehr sicher sein, nicht auch zum Opfer der allgegenwärtigen Hexenkommission zu werden.
Wer einmal ins Malefiz-Haus “eingelegt” wurde, den sah man frühestens bei den öffentlichen Verbrennungen wieder, sofern man diesen bedauernswerten Menschen dann überhaupt noch erkennen konnte. Elisabeth hatte nur ein einziges mal an einer dieser Massenveranstaltungen Teil genommen - und das auch noch gegen ihren eigenen Willen, denn einer der neuen Hexenkommissare, Dr. Ernst Vasoldt, studierter Hexenjäger aus Ingolstadt, war Anfang des Jahres 1628 ebenfalls in das Sandgebiet gezogen. Er wohnte in dem reich verzierten Haus am Ende der Sandstraße, dass nach der Verbrennung der ehemaligen Eigentümer, zu einem Spottpreis in seinen Besitz übergegangen war.
Dr. Vasoldt war ein schmächtiger, knochiger Mann von knapp 1.60 Größe, der nicht nur einen kleinen Gehfehler hatte und leicht humpelte, sondern der auch so schlecht sah, dass er grundsätzlich mit zwei verschiedenen Augengläsern ausgerüstet war. Seine Lupen-Brille war für das genaue Studium seiner Opfer und der Hexen-Akten und die andere Brille benötigte er zur Fernsicht. Fast jede Woche war er nun schon in die kleine Schneiderei gekommen, um sich aus teuren Stoffen reich verzierte Hemden und Röcke schneidern zu lassen, aber Tante Katharina konnte ihn vom ersten Augenblick nicht leiden. Offensichtlich war Dr. Ernst Vasoldt ganz verzaubert von der jungen, schüchternen Schneiderin, die allein bei dem Gedanken erschauern musste, diesen Mann auch nur bedienen zu müssen. Obwohl ihre langen braunen Haare seidige Locken hatten, versteckte Elisabeth ihre Haarpracht fast immer unter einem züchtigen Häubchen und trug auch niemals Kleider, die ihre weibliche Figur betonten. Als die Scheiterhaufen vor dem Stadttor an der Langen Gasse im Jahr 1628 fast wöchentlich brannten, merkte Tante Katharina, dass sie Dr. Vasoldt nicht länger vertrösten könnte, denn er hatte sie bereits mehrmals vergeblich zu einer Hexenverbrennung eingeladen. Für alle gottesfürchtigen Katholiken gehörte es zum guten Ton, sich an den Hinrichtungen einzufinden, um die teuflischen Hexenbanner, gemeinsam mit der ganzen Gemeinde zu vernichten. Wer sich dort nicht sehen lassen wollte, der machte sich schnell selbst verdächtig.
Schweren Herzens hatten sich die beiden Frauen auf dem Platz vor dem Stadttor eingefunden. Wie ein gieriger kleiner Geier hatte Dr. Vasoldt, ungeduldig wippend, auf sie gewartet und geleitete sie stolz auf einen der vorbereiteten Tribünenplätze, der für geladene Gäste und die hohen kirchlichen Herrschaften reserviert war. In mehreren Ochsenkarren wurden die fünf Opfer die knapp 300 Meter vom Malefiz Haus zum Richtplatz gefahren. Sie trugen die verdreckten, lumpigen Trudenkittel und wurden von zahlreichen Kindern in der Menschenmenge begleitet, die sie verspotteten und ihnen alle Arten von Grimassen schnitten. Alle fünf Verurteilten waren Frauen, und Elisabeth zuckte merklich zusammen, denn sie hatte gleich zwei der verstümmelten Opfer wieder erkannt. Die Frauen wurden nacheinander vor die Tribüne geschleppt, auf der das gesamte Domkapitel in vollem Ornament saß: es fehlte nur der Fürstbischof, der die Verbrennungen aber generell mied. Mehrere hundert Bamberger Bürger waren anwesend, labten sich an den Speisen und Getränken der Marketender und redeten über die bevorstehende Hinrichtung der verdammten Hexenbanner, von denen schon so viele unter der Folter ihre Buhlschaft mit dem Teufel gestehen mussten und die ausnahmslos auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Dr. Vasoldt hatte vor Elisabeth stolz damit geprahlt, dass er es war, der bei zwei der Delinquenten die peinliche Befragung geleitet hatte, und dass es seiner geschickten Fragestellung zu verdanken war, dass selbst die verstockteste Hexe, namens alte Düslin, zugegeben hatte, die Hostien in St. Martin entwendet zu haben, um sie beim Hexensabbat einzugraben. Elisabeth und ihre Tante Katharina kannten die alte Düslin seit Jahren persönlich, die als eine der frömmsten und gottesfürchtigsten Frauen in ganz Bamberg bekannt war. Doch was da knappe zehn Meter entfernt von Ihnen vor dem Richtblock stand, hatte rein optisch gar nichts mehr mit der Frau zu tun, die ihnen als alte Düslin bekannt war. Erst jetzt bemerkten sie die beiden Nachrichter, die sich ein paar Meter entfernt von den fünf mächtigen Scheiterhaufen an einem kleineren Feuer zu schaffen machten und mehrere Eisenzangen mit einem Blasebalg zum Glühen brachten. Die Alte Düslin und eine weitere Frau, die Elisabeth entfernt bekannt vorkam, wurden in die Nähe des Richtblocks geführt, während die anderen drei Frauen von den Henkern nacheinander auf die Scheiterhaufen gehoben wurden, denn anscheinend waren sie bereits zu geschwächt, um die Leitern alleine hochzuklettern. In der Mitte eines jeden Scheiterhaufens war ein großer Stamm mit einem Metallring befestigt, an den die Opfer mit einem Strick um den Hals gefesselt wurden. An den schmerzverzerrten Gesichtern konnte man die Qual erkennen, die die gefolterten Frauen beim Festzurren erlitten, aber durch den anhaltenden Lärm der Volksmenge, konnte man die Schreie dieser armen Menschen kaum hören. Mit einem lauten Trompetenstoß des fürstlichen Trompeters verschaffte sich der Generalvikar Dr. Friedrich Förner Gehör und hielt eine seiner berüchtigten Hetzreden gegen die schändlichen Zauberer und Hexen, die im fürstlichen Hochstift ihr nächtliches Teufelswerk ausübten, dem Teufel huldigten, mit ihm Verkehr hatten und somit den einzig wahren Gottesglauben für immer verlassen hatten. Nach dieser Predigt stellte er die einzelnen Delinquenten der Hinrichtung mit ihrem vollen Namen vor und verlas die Listen ihrer eingestandenen Verbrechen. Die alte Düslin blickte nicht einmal nach oben, als ihr Urteil verlesen wurde, denn vor ihrer Verbrennung war sie zu zwei Griffen mit glühenden Zangen verurteilt worden: wegen der eingestandenen Hostienschändung und des begangenen Wetterzaubers. Auch die zweite Frau hatten Elisabeth und ihre Tante fast nicht wieder erkannt, aber es war wirklich die allseits respektierte und angesehene Apothekerin Lisa Burckhardin, die hier vor ihnen kauerte. Trotz ihrer 36 Jahre, sah sie aus wie eine uralte Frau - die Wochen lange Marter hatte aus einer schönen, wohlhabenden Dame eine zerschundene, arme Hexe gemacht, die man nur bemitleiden konnte. Mit zynischer Häme verlas Generalvikar Dr. Förner zuerst das erfolterte Geständnis der Apothekerin, um danach noch ein weiteres Pergament aus seiner Kutte zu ziehen. “Der hochwürdige unser allerseits gnädige Fürst und Herr von Bamberg, Johann Georg II Fuchs von Dornheim hat aus sonderbar bewegenden Ursachen der geständigen Hexe Lisa Burckhardin , die hohe fürstliche Gnade erwiesen, dass sie nämlich erstlich mit dem Schwert vom Leben zum Tod hingerichtet wird. Als dann soll ihr Körper mit dem Feuer zu Pulver und Asche verbrennt werden. Das kurze Schluchzen der geschundenen Frau hörte sich, trotz ihres schlimmen Zustands, wie ein freudig erlöstes “Ja” an und nachdem die gesamte Gemeinde ein letztes VATERUNSER gebetet hatte, begann die grausame Hinrichtungs-zeremonie mit der ehemaligen Apothekerin. Ein Schwall von Blut ergoss sich über hölzernen Richtbock, nachdem der vermummte Henker mit einem sauberen Schlag den kahl rasierten Kopf vom Rumpf der Apothekerin getrennt hatte. Mit zwei Händen nahm er den abgeschlagenen Kopf und hielt ihn der tobenden Menge entgegen. Während Friedrich Förner und Dr. Vasoldt zustimmend nickten, trugen die Henker den Rumpf und den Kopf auf den ersten der Scheiterhaufen und mit ein paar pechgetränkten Fackeln steckten sie das Reisig zügig in Brand und schon nach zwei Minuten brannte der gesamte Holzstoß lichterloh knisternd. Der Dampf des verbrannten Fleisches vermischte sich auf seltsame Weise mit den Gerüchen der Garküchen, die am Rande des Platzes, direkt an der Stadtmauer, aufgebaut waren. Elisabeth war so berührt, dass es ihr unmöglich erschien, zu Essen oder zu Trinken und am liebsten wäre sie auch sofort aufgesprungen und hätte den Hinrichtungsort verlassen, doch die wiederholten Blicke von Dr. Vasoldt und der starke Händedruck ihrer Tante Katharina ließen sie erstarrt sitzen bleiben. Die nächsten drei Hinrichtungen verliefen alle gleich. Nachdem die Verurteilten an dem Pfahl gebunden waren, wurden sie von einem Priester der Jesuiten ausgiebig mit Weihwasser besprüht. Mit der Verbrennung würde ihnen der Teufel ausgetrieben, und somit könnten ihre gereinigten Seelen dann friedlich gen Himmel fahren. Mit jedem weiteren angezündeten Feuer verdunkelte sich der Himmel - nicht nur wegen dem Rauch, sondern auch, weil sich ein nahendes Gewitter mit entfernt grollendem Donner ankündigte. Soweit sie es von der Tribüne aus beobachten konnte, sah Elisabeth mit schreckensbleichem Gesicht, wie das Feuer die angeblichen Hexen und Zauberer langsam tötete. Sobald das Reisig den unteren Teil des Scheiterhaufens in Brand gesetzt hatte, fingen die armen Opfer an, zu Schreien und zu Zappeln. Obwohl der schwelende Rauch fast die gesamte Sicht auf das Zentrum des Feuers verhinderte, konnte man selbst nach mehreren Minuten noch erkennen, dass die Frauen noch lange nicht tot waren, sondern schreiend, hustend, konvulsiv zuckend ihr Leben aushauchten. Elisabeth drückte die Hand ihrer Tante so fest zusammen, dass diese erschrocken zusammenzuckte. Wer jetzt aufstand und vor dem Höhepunkt der Veranstaltung verschwand, der machte sich garantiert verdächtig. Die alte Düslin hatte die ganze Zeit abwesend auf dem Boden gehockt. Von Zeit zu Zeit zerrte sie an ihren Fesseln herum und blickte wirr in die schreiende Menge. Auf das Kommando von Dr. Förner wandten sich die Scharfrichter an die alte Frau: Zwei der Schergen hielten sie an den Händen fest, während der Dritte mit einem festen Ruck den grauen Trudenkittel der alten Düslin von hinten zerriss. Ein lautes Raunen ging durch die Menge, denn der wochenlang geschundene Körper der armen Frau war komplett blau geschlagen. Die einzelnen Striemen der Peitschenhiebe konnte man gar nicht mehr erkennen, denn der gesamte ausgemergelte Körper dieses Menschen war blau geprügelt und zwischen den Beinen erstreckte sich eine einzige Fläche braunroten Schorfes bis hinunter zu den Knien. Die alte Düslin hatte tagelang tapfer jeder Folter widerstanden, doch dann setzten sie die Folterknechte für einen ganzen Tag auf dem Bock und rüttelten alle halbe Stunde daran, bis sie schliesslich doch Alles zugeben musste, was die Doktoren der Inquisition von ihr hören wollten. Wer die alte Düslin noch vor ein paar Monaten gesehen hatte, konnte sich kaum vorstellen, dass dies hier dieselbe Frau war, doch nun kam der vierte Henkersknecht mit einer rot glühenden Brustkralle und obwohl kaum noch eine große Reaktion von der abgemagerten alten Frau zu erwarten war, bäumte sich der zermarterte Körper blitzschnell auf, als sich das glühende Eisen in ihre schlaffe Brust frass und eine weissliche Wolke stinkenden Dampfes aus ihrem Oberkörper zischte. Der Henker war wenigstens so menschlich, dass er die Prozedur nicht unnötig in die Länge zog. Auch die zweite Brust der alten Düslin wurde von ihm mit der Brustkrallen-Zange verbrannt, was die Menge erneut johlen ließ: “Verbrennt sie, die alte Hexe!” Skandierten sie. “Treibt ihr den Teufel aus!” Mittlerweile hatten die Schergen die alte Frau auf das Podest des Scheiterhaufens gezerrt und begannen sie festzubinden, als Generalvikar Friedrich Förner, mit sich fast überschlagender Fistelstimme, alle Übeltaten der alten Düslin in die johlende Menge schrie. Doch dann wurde die schwüle Nachmittagshitze durch einen einzigen Donnerschlag lautstark unterbrochen und Sekunden später fing es an, wie aus Eimern, zu regnen. Hektisch gossen die Schergen ein Fass Pech auf den Holzstoß und schafften es so, das letzte Feuer des Tages doch noch in Gang zu bekommen. Auch die anderen Scheiterhaufen stiessen meterhohe dampfende Wolken aus, aber sie brannten. Ein paar Blitze tauchten die verregnete Szene in ein gespenstisches Licht und die Zuschauer rannten in panischer Angst vor den Blitzen des Teufels, der wohl seine brennenden Gespielinnen betrauerte, in Richtung Stadttor oder auf die andere Seite der Regnitz. An der Hand ihrer Tante verließ Elisabeth die Richtstätte vollkommen traumatisiert und beide Frauen waren noch Stunden später unfähig, auch nur ein Wort über diese grauenvolle Hinrichtung zu sprechen. Dr. Vasoldt hatte sich mit kurzen Worten, krähenhaft aufgeplustert, verabschiedet und war mit dem Generalvikar und einigen anderen Geistlichen in Richtung Geyerswörthschloss verschwunden, um dem Fürst von Bamberg stolz vom erfolgreichen Ablauf der Hinrichtung der fünf Hexen zu berichten. Die alte Düslin war in dem schwarzen Pechqualm längst erstickt und da das Unwetter noch Stunden über dem Hochstift stand, mussten die Henker das Feuer am nächsten Morgen nochmals anschüren, denn beim Hexenbrand durfte ausser “Asche und Pulver” nichts von der Leiche übrig bleiben, da sie der gerissene Teufel sonst wieder zum Leben erwecken könnte. Während Elisabeth gefesselt hinter den Bütteln zum Malefiz Haus lief, wiederholten sich alle Bilder der damals erlebten Hexenverbrennung vor ihrem geistigen Auge. Ihr Weg führte durch die enge Sandstrasse in Richtung Brückenrathaus und an der kleinen Bäckerei schnupperte sie den leckeren Hefeduft des warmen Brotes und wusste instinktiv in dieser Sekunde, dass sie diesen Geruch wohl nie wieder riechen würde und das dieser Gang ihre letzten Stunden einleitete.
Eine Nachbarin, die Ihnen entgegenkam, bekreuzigte sich erschrocken, denn sie hatte Elisabeth erkannt und mittlerweile wusste jeder Bürger der Stadt, was es bedeutete, wenn man “in captura” der fürstbischöflichen Büttel war. Woche für Woche predigte Dr. Friedrich Förner von der Kanzel in Sankt Martin, dass Jeder vom Teufel verführt werden könnte und dass sich die wahren Gläubigen tagtäglich im Gebet gegen die Anfechtungen des Bösen wehren mussten. Der schwere Gang zum Malefiz Haus führte über den Grünen Markt in die Gasse, die heute Franz-Ludwig-Strasse heißt. Seitdem das neu gebaute Foltergefängnis im Jahr 1627 fertiggestellt worden war, hatte Elisabeth diesen Teil der Stadt möglichst gemieden, denn es kursierten die grausamsten Geschichten über das, was innerhalb des ummauerten Geländes mit den armen Opfern des Fürstbischofs geschah. Von den Anwohnern, die in direkter Umgebung des Hauses wohnten, wurden diese Gräuelgeschichten noch lebhaft gefördert, denn die abergläubischen Nachbarn hatten natürlich schon des öfteren den leibhaftigen Beelzebub mit seinen Hexenbannern um das Haus fliegen sehen. Der Legende nach wollte der listige Teufel seine treue Gefolgschaft angeblich Nachts aus den Fängen des Fürstbischofs retten, weshalb die weiblichen Gefangenen selbst im Schlaf angekettet in ihren Zellen liegen mussten. Nachdem die kleine Gruppe das streng bewachte Hoftor passiert hatte, sah Elisabeth zuerst die großen Dobermänner, die an langen Ketten auf dem Anwesen verteilt waren und sofort bellten, sobald sich jemand näherte. Von außen war das Malefiz Haus ein prunkvolles Gebäude, aus großen Sandsteinen gebaut und mit allerlei geometrischen Verzierungen geschmückt, die den Teufel vom Betreten des Hauses abhalten sollten. Das mächtige Haupthaus war eines Fürstbischofs wahrhaft würdig. Über der Eingangstür prangte eine Statue der Justizia mit Schwert und Waage, aber der lateinischen Spruch, der über der Tür prangte, war für Elisabeth nicht zu verstehen, denn sie konnte zwar Lesen und Schreiben, aber natürlich nicht die lateinische Sprache. Auf zwei großen verzierten Steintafeln im ersten Stock war ein Text zu lesen: in Deutsch und in Lateinisch. Er stammte aus dem Buch der Könige und bevor sich die Tür nach Minuten endlich öffnete, las Elisabeth diesen Spruch aus der Bibel: “Das Haus wird ein Exempel werden, dass Alle die vorüber gehen werden, sich entsetzen und blasen und pfeifen und sagen: Warum hat der Herr diesem Land diesem Haus also getan? So wird man antworten: Darum, dass sie den Herrn ihren GOTT, verlassen haben und haben angenommen andere Götter und sie angebetet und ihnen gedienet. Darum hat der Herr all dies Übel über sie gebracht.” Elisabeth war als Kind sehr fromm und gläubig erzogen worden, doch in den letzten Monaten hatte sich ihr Verhältnis zum katholischen Glauben grundlegend geändert. Die alte Düslin und auch die Apothekerin waren herzensgute, fromme Frauen gewesen - sie konnten diese unglaublichen eingestandenen Verbrechen unmöglich begangen haben. Es waren die unsäglichen Foltermethoden des Hexenbrenners Fuchs von Dornheim, die keines der völlig unschuldigen Opfer lange aushalten konnte: diese perfide gequälten Menschen zerbrachen im Laufe der Marter und wünschten sich danach nur noch einen schnellen, barmherzigen Tod von ihren Mördern.
Bevor Elisabeth eingefangen wurde, waren bereits mehrere Bürgermeister und fast der gesamt Rat der Stadt in den Flammen der Inquisition gerichtet worden und die junge Schneiderin war intelligent genug, um zu erkennen, dass gerade die konfiszierten Vermögen der verbrannten Hexenopfer der wahre Grund für die Verhaftung und Verbrennung so vieler wohlhabender Bürger war. In ihrem Fall konnte es nicht das Geld sein, das sie in den Strudel des Verdachts der Hexenkommission zog - dafür waren sie und die kleine Schneiderei im Sandgebiet einfach viel zu unbedeutend. Kaum hatte Sie diesen Gedanken beendet, als Dr. Vasoldt aus der Tür des Malefiz Hauses trat und sie zynisch begrüsste: “Jungfer Elisabeth! Ihr hier? Ihr möchtet wohl Euren Zechgenossen vom Hexentanz einen letzten Besuch abstatten?” Allein der zischende Unterton in der fistelnden Stimme von Dr. Vasoldt machte Ihr klar, das der wahre Grund für ihre Verhaftung direkt vor ihr stand. Nach der Hinrichtung hatte sie wochenlang einen großen Bogen um den unsympathischen Hexenkommissar gemacht, doch da er fast täglich an der Schneiderstube vorbei schlich, war es eines Abends zu einer unangenehmen Szene mit ihrer Tante Katharina gekommen. Dr. Vasoldt hatte bei der Anprobe seinen neuen Rockes eindeutige Bemerkungen in Bezug auf Elisabeth gemacht und das er, trotz seines Alters, an eine Heirat mit ihrer unvermögenden Nichte gedacht hätte. Hinter der Hoftür hatte Elisabeth der Unterhaltung im Geheimen gelauscht und obwohl sie sich sicher war, dass ihre Tante jegliche Avancen der ekligen Hexenkommissars strikt ablehnen würde, musste sie ihm ihre Empörung unbedingt persönlich entgegen schreien - und das war eine sehr unkluge Art und Weise, sich mit einem der gefährlichsten Hexenjägers des ganzen Bistums anzulegen: “Einen so bösen alten Mann wie Euch, will ich niemals zum Ehemann nehmen - lieber ginge ich für immer in ein Kloster.” Damit hatte sie sich Dr. Vasoldt eindeutig zum Feind gemacht, doch während der drei folgenden Monate ließ er sich nicht ein einziges Mal in der Schneiderei sehen. Tante Katharina hatte sich im eisigen Winter eine verschleppte Lungenentzündung geholt und lag kurz darauf im Sterben. Schon eine Woche nach der schmucklosen Beerdigung auf dem Gottes Acker kam der Hexenkommissar mit einem weissen Hemd zur Schneiderstube gehumpelt und wollte es ändern lassen. Elisabeth konnte einfach nicht anders und weigerte sich, diese Arbeit auszuführen. Sie spürte geradezu körperlich, dass ihr Schicksal von diesem Moment an, besiegelt war, doch sie konnte einfach nicht anders. Aus Dr. Vasoldts verschlagenen Augen funkelte es sadistisch und um seinen lange geplanten Triumph noch eingehender zu geniessen, wechselte er sein Augenglas und musterte Elisabeth ausgiebig mit seiner Lupe. “Ihr wurdet gleich von zwei Hexen besagt, die ebenfalls hier einliegen, Jungfer Elisabeth! In der peinlichen Befragung werden wir sehen, ob ihr auch zu den Teufeln und Zauberern gehört, die unser ehrwürdiger Fürstbischof alle ausnahmslos ausbrennen wird!” Dr. Vasoldt befahl den Hauptmann der Wache zu sich heran und flüsterte ihm ein paar Sätze ins Ohr. Dann verabschiedete er sich mit einem Griff an seinen schwarzen Hut und verlies das Grundstück durch das Eisentor. Gleich nach ihrer Einlieferung hatte man Elisabeth in einer der größeren Zellen im Erdgeschoss eingesperrt - doch schon am nächsten Morgen begann ihre peinliche Befragung, denn Sie wurde gebunden und in eines der Befragungszimmer im Erdgeschoss verbracht und dort auf einen schweren Stuhl gefesselt. Vor ihr saßen drei Hexenkommissare, aber Dr. Vasoldt war nicht dabei. Ebenfalls anwesend waren ein wieselflinker Schreiber und ein Folterknecht, der schon am frühen Morgen faulig nach Bier und kaltem Schweiss stank. Nach dem Beginn der Befragung hatte sich hinter Elisabeth eine Tür geöffnet, durch die man eine andere Frau heranbrachte, die in ihrem Rücken stand und sie identifizieren sollte. “Erkennt Ihr die Angeklagte Elisabeth Möhrlin, mit der Ihr nicht nur beim Hexentanz gesehen worden seid, sondern mit der ihr auch das schlechte Wetter von 1626 gemacht habt?” Eine kaum vernehmbare Stimme der Frau antwortete fast flüsternd: “Ja, das ist die Hexe - mit ihr zusammen haben wir auch aus Kinderleichen Flugsalbe gesotten und mehrmals die heilige Hostie aus der Kirche gestohlen und in der Erde vergraben.” Danach wurde die unbekannte Frau wieder abgeführt und auch Elisabeth wurde ohne weitere Befragungen in ihre Zelle gesperrt - aber diesmal brachte man sie über die enge Treppe in den ersten Stock. Der abartige Gestank nahm ihr fast den Atem, denn hier oben roch es nach einer scharfen Mischung aus Kot, Urin, Eiter und Erbrochenem. Nachdem sie von den Lochhütern in ihre winzige Zelle gesteckt und angekettet wurde, gab man ihr den Holzeimer für die Notdurft und einen größeren Krug mit Wasser. Dann schloss sich die Zellentür und sobald sich die schweren Stiefeltritte der Wörter nach unten entfernt hatten, hörte Elisabeth dumpf eine weibliche Stimme aus der Nachbarzelle: “Wer seid ihr? Wer hat Euch besagt? Haben sie Euch schon in der peinlichen Frag verhört? So entwickelte sich eine halb geflüsterte Unterhaltung mit Helena Kauderin, die man eine Woche vor Elisabeth in Bamberg eingefangen hatte, aber dann hörten sie die Schritte der Wächter auf der Treppe und konnten nicht mehr weiter sprechen. Kurz nach Sonnenuntergang hatte eine Nachbarin aus dem Wirtshaus in der Sandstraße eine Mahlzeit für Elisabeth zum Torwächter gebracht. Der Braten, Brot und das Gemüse wurden auf einem Holzteller mit hölzernem Löffel in die Zelle gebracht und zu trinken gab es einen ganzen Humpen Bier. Elisabeth mochte zwar kein Bier, aber der Alkohol würde sie so müde machen, dass sie vielleicht sogar schlafen konnte, denn Sie hatte panische Angst vor ihren eigenen Albträumen in der Marterkammer. Am frühen Morgen wurden zuerst drei weibliche Gefangene aus dem Erdgeschoss zur nächsten Verbrennung auf dem Richtplatz vorbereitet. Jeder einzelnen wurde die Beichte abgenommen und durch die geschlossene Tür konnte Elisabeth das Wehklagen und das monotone Beten der Jesuiten-Priester hören. Zu diesem Zweck war im ersten Stock ein spezielles “Beichtkämmerlein” eingerichtet worden und in jedem der zwei Stockwerke existierte sogar eine kleine Kapelle mit Altar und Kniebank. Zum normalen Klang der Kirchenglocken von Bamberg mischte sich an diesem Tag ein weiterer Ton, denn im Brückenrathaus, inmitten der Regnitz, schlug heute die so genannte Malefiz Glocke - für alle Einwohner das unüberhörbare Zeichen, dass wieder einmal eine Hinrichtung anstand, obwohl in Bamberg mittlerweile jedermann wusste, was Generalvikar Dr. Förner an jedem Sonntag wortgewaltig seiner Gemeinde predigte. Er zelebrierte die Namen aller verurteilten Angeklagten wie in einem Theaterstück und die schlimmste Hexen-Geschichte erzählte er immer zum Schluss.
Er lies auch keine Einzelheit aus den Geständnissen der verurteilten Hexen aus und verbreitete so nicht nur die Neuigkeiten im Kampf gegen den Teufel, sondern vor allem Angst und Schrecken innerhalb der gottes-fürchtigen Bevölkerung. Da es in Bamberg auch eine der ersten Druckereien und Papiermühlen im heiligen Reich Deutscher Nation gab, lies Dr. Friedrich Förner seine Hexenpredigten sogar in gedruckter Form verteilen, denn er war zweifelsohne ein “moderner Theologe”.
Die frei gewordenen Zellen wurden von den mürrischen Wärtern flüchtig ausgefegt, mit neuem Stroh belegt und so dauerte es auch nur wenige Stunden, bis sich die schwere Eingangspforte für eine neue Gefangene öffnete, die aus Zeil am Main mit einem Pferdetransport überführt worden war. Normalerweise waren nur wenige der 26 Zellen im Malefiz Haus nicht belegt, doch durch die zahlreichen neuen Besagungen der vergangenen Wochen, war es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Hexen und Zauberer eingefangen werden würden. Die Hitze des und nahenden Sommers verstärkte den üblen Gestank im Inneren des Hauses dermaßen penetrant, dass die Richter und Hexenkommissare das Haupthaus ausschliesslich durch die hintere Hoftür betraten und sich tunlichst auch nur in den Gerichtsstuben und in der Folterkammer aufhielten. Was sich in den Zellen und Wachstuben des Nachts abspielte, entzog sich jeglicher Kontrolle der Hexenkommission, denn dann herrschte nur noch der Kerkermeister im Malefiz Haus und so konnten die brutalen Folterknechte mit ihren teilweise blutjungen Gefangenen alles tun, was immer sie wollten.
In den dreckigen, gemauerten Zellen hausten zahlreiche Ratten und anderes ekliges Ungeziefer. Mehrmals bettelten die Gefangenen lautstark um mehr Wasser, doch erst Stunden später erbarmten sich die Büttel, denn in der stinkig, schwülen Hitze war das Schleppen der Wassereimer eine schwere anstrengende und unbeliebte Arbeit. Am nächsten Morgen wurde es schlagartig ernst, denn schon kurz nach Sonnenaufgang kam Dr. Vasoldt ins Malefiz Haus und lies Elisabeth vom Büttel ins Erdgeschoss zerren. Als sie gebunden vor ihm stand, wechselte er genüsslich seine Brille und näherte sich ihrem Gesicht bis auf wenige Zentimeter. Da er einen halben Kopf kleiner war als sie, stellte er sich, wichtig machend, auf seine Zehenspitzen. ”Heute, Jungfer Elisabeth, werde ich Euch in die Geheimnisse unserer peinlichen Befragung einweihen”, sein hämischer Unterton und seine Stimmlage machten ihr klar, dass sie diesem Sadisten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. “Ich lasse Euch zuerst einen Blick in das “gefaltete Stüblein” werfen, damit Ihr Euch, wenn ihr Bedenkzeit braucht, nicht mit der Pein der langen Weile zu quälen braucht.” Der Geruch im gesamten Malefiz Haus war faulig und kaum zu ertragen aber als sich die Tür zu dieser Zelle öffnete, musste Elisabeth mit ihrem plötzlich aufstossenden Mageninhalt kämpfen: Die dunklen Wände dieser Einzelkammer waren übersät mit Kratzspuren und Exkrementen, doch als sie den Boden dieser Zelle sah, mussten sich die junge Schneiderin fast übergeben. Anstelle eines normalen Stein oder Holzbodens ragte in dieser, knapp 1 mal 1 Meter großen Zelle ein Boden aus scharf angespitzten Pyramiden aus einer schleimig, glänzenden Masse, die sich bei etwas besserem Licht, als eine verdickte Suppe aus Kot, Maden, getrocknetem Blut und Eiter entpuppte. “Wer in dieser Zelle nachdenkt, der denkt schnell”, hechelte der widerliche Hexenkommissar in Elisabeths Ohr. “Und nun folgt mir doch bitte noch in die” peinliche Frag”, denn ich möchte Euch auch die anderen heiligen Befragungsinstrumente demonstrieren.” Durch das linke hintere Befragungszimmer gingen sie auf den Hof hinter dem Malefiz Haus, der mit einer fünf Meter hohen Holzwand als Sichtschutz mit der Folterkammer verbunden war. Die frische Morgenluft hatte noch nie besser gerochen und Elisabeth genoss diese kurze Verschnaufpause um ganz tief durchzuatmen. Auf dem ummauerten Hof stapelte sich Klafter weise Holz, mehrere große Fässer, eine Wanne für die Badungen und über eine breite Treppe ging es fünf Stufen hinauf zur geöffneten Folterkammer. Zwei kräftige Folterknechte schürten gerade ein Feuer und somit war es stickig heiss in dieser Kammer, in deren Mitte sich der wehe Zug befand. Im Boden eingelassen war ein metallenes Gitter, denn die Folterkammer war nach modernsten Erkenntnissen gebaut worden: Unter ihr floss ein kleiner Abwasserkanal bis unter die Stadtmauer und von dort in das Schwarzwasser, und somit liessen sich austretende Körperflüssigkeiten recht einfach mit einem Eimer Wasser in diesen Bach spülen. An der linken Seite des Folterkammer führte ein Treppe in den ersten Stock: dort war eine Balustrade für die Zuschauer der peinlichen Befragung, denn neben den verschiedenen Folterinstrumenten und dem großen Tisch für die Hexenkommissare war kaum noch genügend Platz für die Folterknechte und die Opfer, die oftmals parallel drangsaliert wurden. Von manchen dieser grausamen Folterinstrumente hatte Elisabeth bereits gehört, doch erst die peinliche genaue Erklärung von Dr. Vasoldt lies sie mehrmals vor Angst erschauern. “Wenn ihr nicht zugebt, mit wem und wann ihr das Hexenhandwerk ausgeübt habt, dann werden wir Euch hier den Teufel austreiben und Euch von Eurer verstockten Besessenheit erlösen. Und glaubt mir Eines: bis heute haben wir noch jeden bösen Geist mit der scharfen Marter ausfindig gemacht - da wird Euch auch Euer unschuldiges Leugnen nicht lange helfen.” Die Angst vor den zu erwartenden Folterqualen war eine Sache, aber seitdem Elisabeth die schreienden und zuckenden Menschen bei der Verbrennung gesehen hatte, hatte sie geradezu panische Angst vor dem Tod auf dem Scheiterhaufen. Noch hatte sie ihre eigenen Kleidung an und ihr hübsches Schneiderhäubchen auf, doch schon am Ende seiner Erklärungen lies sich Dr. Vasoldt von einem der Folterknechte einen grauen Trudenkittel aus grobem Leinen geben und hielt ihr diesen triumphierend zischend ins Gesicht: “Ab morgen werdet ihr wie die anderen Hexen eingekleidet und dann sehen wir uns hier in dieser Kammer wieder.” Dann wurde sie wieder in ihre Zelle im ersten Stock gebracht und in Ketten gelegt. Am Nachmittag gab es unüberhörbares Geschrei aus dem Erdgeschoss, denn ein männlicher Gefangener wurde in das gefaltete Stüblein gesperrt und schrie dort ununterbrochen in seinen Qualen. An der Stimme erkannte Elisabeth sofort den Ratsherren und Weinhändler Peter Fürst, für den sie noch vor wenigen Wochen ein kostbares Wams genäht hatte. Einer der reichsten Bürger der Stadt winselte, wie ein kleines Kind um Gnade, dann betete er lautstark schreiend stockend und weinend das Vaterunser, immer und immer wieder. Elisabeth nutzte die unerwartete Gelegenheit um mit ihrer Zellennachbarin zu reden, denn die Büttel hatten sie davor gewarnt, sich zu unterhalten. “Wie ist es Euch ergangen?” fragte Sie und Elisabeth schilderte ihr halb flüsternd vom Ablauf ihrer peinlichen Befragung. Helena indes, konnte nur zögernd über ihre Leidensgeschichte sprechen. Gleich in der ersten Nacht im Malefiz Haus waren zwei Folterknechte in ihre Zelle gekommen und hatten sie in eine der Wachstuben im Erdgeschoss gebracht. Dann zwangen sie die gefesselte Frau, einen ganzen Humpen Wein zu trinken und vergewaltigten sie danach gemeinsam bis zum Morgengrauen. Gleich am nächsten Tag wurde sie von den gleichen Männern in der peinlichen Frag ausgezogen, kahl geschoren, ihre letzten Haare wurden mit Hilfe von brennendem Branntwein abgeflammt und sie musste den Trudenkittel anziehen. Nach der ersten Anwendung der Daumenschrauben und dem wiederholten Auspeitschen war Helena kurz vor dem Zusammenbruch und dachte darüber nach, bei der nächsten Foltersitzung eine erfundene Geschichte einzugestehen, doch ihre größte Sorge war, dass die Hexenkommissare erst dann mit der widerlichen Folter aufhörten, wenn sie auch eine genügende Anzahl an neuen Denunziationen für künftige Verhaftungen aus den halb toten Opfern herausgepresst hatten. “Wenn ich es könnte, dann würde ich mich umbringen, denn alle, die wir hier einliegen, sind dem Scheiterhaufen geweiht. Sie lassen niemanden mehr frei, der hier gefangen ist. Und ich will niemanden besagen müssen.” Das Geschrei von Peter Fürst war einem monotonen Singsang gewichen, bis es nach wenigen Minuten ganz still wurde. Elisabeth machte sich keine Illusionen, dass es Flucht-möglichkeit oder gar Gnade für sie geben könnte: Ihr Schicksal war verwirkt. In der Hitze döste sie ein und wachte, Stunden später, durch die Mark erschütternden Schreie aus dem Erdgeschoss auf: Anscheinend war Peter Fürst eine Zeitlang bewusstlos im gefalteten Stüblein gelegen, denn jetzt schrie er, fast noch lauter als zuvor, und hämmerte wie wild an die massive Zellentür: “Ich gebe alles zu, Alles. Ja - ich bin ein Hexer. Ja! Ja! Ja! Ich habe die heilige Hostie vergraben. Ich gestehe Alles, was ihr hören wollt, bloß lasst mich heraus aus dieser verdammten Kammer. Lasst mich heraus!” Kurz darauf rasselten die Ketten mit den vielen Schlüsseln und der heulende Ratsherr wurde auf den Hof gebracht und mit zwei Eimern Wasser übergossen, dann schubste man ihn in die Gerichtsstube im Parterre, zu den Doktoren der Inquisition, die die vergangenen Stunden ausgiebig im Wirtshaus gezecht hatten. “Haben wir es Euch nicht gesagt, dass das Leugnen keinen Zweck hat? Der Teufel will heraus aus Euch und deshalb haben wir Euer Geständnis bereits vom Schreiber zu Protokoll nehmen lassen. Ihr müsst es dann morgen nur noch unterzeichnen. Dankt dem gnädigen Fürstbischof, dass er Euch den Beelzebub schon in wenigen Tagen mit dem Feuer austreiben wird und Eure gereinigte Seele ins gelobte Himmelreich auffahren kann.
Der am ganzen Leib zitternde Peter Fürst wurde in seine Zelle gesperrt und bekam dort Besuch von einem Jesuiten Pater, der mit ihm betete und seine blutenden Wunden mit einer Kräutersalbe aus der Abtei versorgte. Als ihre Zellentür am nächsten Morgen geöffnet wurde, standen gleich drei Folterknechte vor Elisabeth und zerrten sie unsanft in das untere Befragungszimmer. Ohne Vorwarnung rissen sie ihr die Kleider vom Leib und liessen sie dann nackt, inmitten des Raumes, stehen. Angeführt von Dr. Vasoldt füllte sich der Raum kurz darauf und Elisabeth versuchte schamhaft ihren Schoss mit den Händen zu bedecken. Ihr kleinen Brüste waren versteckt hinter ihrem glänzenden braunen Haar. Sie war eine makellose junge, schöne Frau, die noch nie nackt vor einem Mann gestanden hatte. Hinter dem großen Tisch nahmen Dr. Vasoldt, zwei weitere Hexenkommissare und ein Schreiber Platz. Links und rechts von der nackten Schneiderin postierten sich Folterknechte und hielten sie so fest, dass ihre Unterarme schmerzten. Dr. Vasoldt wechselte umständlich nestelnd seine Brille und kam hinter dem Tisch hervor. In seiner rechten Hand hielt er eine Lupe und in der anderen Hand ein metallenes Gerät, dass Elisabeth nicht erkennen konnte. Wie ein Geier untersuchte Dr. Vasoldt jeden Zentimeter ihres Körpers mit akribischer Genauigkeit. Sie könnte seinen rasselndem Atem hören und riechen, denn er stank penetrant nach fauligem Fleisch und nach Alkohol. Elisabeth zuckte nur kurz zusammen, als er ihren unberührten Schoß mit seinen knochigen Fingern untersuchte, aber dann hatte Dr. Vasoldt an ihrer rechten Kniekehle ein kleines Muttermal entdeckt und sofort mit der Metall-Nadel eingestochen. Doch da gleich darauf ein kleiner Blutstropfen aus dem Muttermal austrat, handelte es sich hier anscheinend nicht um ein Teufelsmal und so schimpfte Dr. Vasoldt auf die List des schlauen Teufels und wies die Folterknechte an, den Trudenkittel für Elisabeth zu holen.
Nachdem sie den groben, kratzigen, grauen Leinenkittel angezogen hatte, wurde sie erneut abgeführt - allerdings wurde sie diesmal nicht in den ersten Stock gebracht, sondern man sperrte sie in die gegenüber liegende Stube des Befragungszimmers. Da man sie nicht angekettet hatte, konnte Elisabeth durch das Gitter der Zellentür alles verfolgen, was sich an diesem Tag im Parterre des Malefiz Hauses ereignete. Sie sah ihre Zellennachbarin Helena - kahl geschoren und humpelnd in das Befragungszimmer gehen - dann wurde sie durch die Hintertür ins Folterhaus gebracht, denn aus einer weiteren Zelle wurde Peter Fürst in den Gerichtsraum geführt. Obwohl die schwere Tür geschlossen war, konnte Elisabeth genug verstehen, um sich den Zusammenhang zusammen zu reimen. Nachdem Peter Fürst in seiner Pein schließlich zugegeben hatte, ein Hexer zu sein, sollte er nun das Geständnis unterschreiben, was gleichzeitig sein eigenes Todesurteil bedeutete. Peter Fürst wollte nicht sterben und bettelte lautstark um sein Leben, denn er sei ein guter Christ und hätte ja nur wegen der scharfen Pein gestanden. Die schneidende Stimme von Dr. Schwartzkontz ließ eine minutenlange Litanei über den bedauernswerten Peter Fürst ergehen: “Jetzt wo der Teufel in Euch gemerkt hat, dass die Macht unseres Fürstbischofs größer ist, als die seine, da wollt ihr Wurm es mit Betteln versuchen. Nein Nein Ihr Schelm - auf diesem Ohr sind wir taub. Ihr habt nun die letzte Gelegenheit Euer aufgesetztes Geständnis zu ratifizieren oder wir bringen Euch direkt wieder in die Peinliche Frag und lassen Euch dieses mal mit dem Bock und der Schwefelfeder torquiren.” Der ehemalige Ratsherr Peter Fürst war gebrochen und schaffte es nur noch, sich einen Tag Bedenkzeit auszubitten, was ihm von Dr. Schwarzkontz auch barmherziger weise eingeräumt wurde. “Aber morgen Mittag läuft diese Gnadenfrist endgültig ab.” Nach dem Abschluss aller “peinlichen Untersuchungen” hatte der ehemalige Ratsherr Peter Fürst insgesamt 87 weitere Bürger schriftlich bei der Hexenkommission als Hexer und Zauberer angezeigt. Stunden später konnte man an den näher kommenden Geräuschen hören, dass die Hintertür zum Hof geöffnet wurde und sich die Gerichtsstube erneut füllte. Elisabeth konnte kaum etwas verstehen, doch als sich die Tür schließlich öffnete, schossen ihr die Tränen in die Augen, denn Helena wurde von zwei Bütteln heraus geschleppt. Ihr grauer Kittel war unterhalb ihres Schosses komplett mit Blut getränkt und beide Arme sahen seltsam dunkel aus. Die Folterknechte hatten Ihre Zellennachbarin Stunden lang auf den spanischen Bock gesetzt und weil sie immer noch niemanden denunzieren wollte, hatte man sie an der Streckleiter festgebunden und ihre Achseln mit der Schwefelfeder angegriffen. Durch den unerträglichen Schmerz war Helena bewusstlos geworden und konnte so natürlich nicht mehr antworten, was die Hexenkommissare so ärgerte, dass sie ins Wirtshaus gingen, ausgiebig zechten und erst am Nachmittag wieder zurück kamen und sie von der Streckleiter abnehmen liessen. In der Zwischenzeit hatte Elisabeth die vergleichsweise große Zelle verzweifelt durchsucht. Anstelle von Stroh gab es ein richtiges Bett mit Kopfkissen und Decke doch der Anblick der gemarterten Helena hatte sie so traurig gemacht, dass sie erstmals seit ihrer Verhaftung hemmungslos weinen musste. Warum hatte sie Bamberg nicht schon vor Wochen verlassen? Im lutherischen Nürnberg brannte man keine Hexen - dorthin hätte sie gehen sollen. Und warum hatte sie niemals ernsthaft daran gedacht, dass es auch sie hat treffen können? Sie war vollkommen ausgeliefert und zermarterte sich den Kopf, um einen möglichen Ausweg zu finden, als sich unerwartet die Schlüssel im Türschloss drehten. Dr. Vasoldt kam mit einer Kerzenlampe in den Raum und schloss die Tür hinter sich. “Ich rufe Euch dann, wenn ich Euch brauche!” rief er dem Wächter durch die geschlossene Tür, in der gleich darauf die Schlüssel sperrten. Im hellen Schein der flackernden Lampe wirkte sein knöchriges Gesicht noch abstoßender und anscheinend hatte er sich mit einigen Humpen Bier Mut angetrunken, denn er sprach mit schwerer Zunge. “Jungfer Elisabeth - wie schön und anmutig Ihr doch seid, doch morgen wird Euch leider der Teufel ausgetrieben und man wird Euch den Kopf scheren, Euch Peitschen und Euch so lange auf den spanischen Bock setzen, bis ihr Eure Buhlschaft gesteht.“ Der Sabber lief aus beiden Mundwinkeln und seine glasigen Augen wurden durch die Brille unwirklich vergrößert. Genau in diesem Moment hatte Elisabeth die Idee, die ihr wie eine Eingebung des wahren barmherzigen Gottes vorkam. Im Flackern des Kerzenlichts war es ein Reflex im Brillenglas von Dr. Vasoldt, der ihr den Weg gezeigt hatte. Sie trat einen Schritt zurück, bückte sich nach vorne und zog sich langsam und verführerisch den Trudenkittel über den Kopf. Dann schüttelte sie ihre langen lockigen Haare aus, spreizte ganz langsam ihre langen Beine und stand so in ihrer unberührten Schönheit splitternackt vor dem zitternden Hexenkommissar. “Wenn ihr mir einen Gnadenzettel vom Erzbischof beschafft, so will ich Euch in jeder Weise gefügig sein. Was auch immer ihr Euch wünscht - und Niemand hat mich bis jetzt berührt.” Elisabeth wunderte sich selbst über sich, denn noch nie hatte sie sich so verführerisch angepriesen. “Wollt Ihr mich denn nicht berühren, oder hab ihr gar das falsche Augenglas dabei? Ihr könnt mich ja gar nicht richtig betrachten.” Sie streichelte sich erotisch über den Bauch, die Scham und ihre perfekten Brüste, während sich unter dem Rock von Dr. Vasoldt sichtbar eine Erektion abzeichnete und sich dicke Schweissperlen auf seiner Stirn bildeten. Nervös griff er in die rechte Rocktasche, um das Augenglas für nahe Entfernungen aufzusetzen. Genau in dem Moment als er die eine Brille abgenommen hatte, bewegte sich Elisabeth. Sie hatte ihren Plan nur kurz durchgespielt und obwohl sie eher eine zierliche junge Frau war, traf ihr hochgezogenes rechtes Knie mit solcher Wucht den Hoden von Dr. Vasoldt, dass dieser, wie von der Axt gefällt, nach vorne sackte und stöhnend japsend auf dem Zellenboden zusammensackte. Seine beiden Brillengestelle lagen neben ihm und mit dem Holzkrug für das Wasser zertrümmerte die nackte Elisabeth die Gläser beider Brillen mit fast hysterisch anmutenden Schlägen. Dann suchte sie in aller Hast eine der Brillen-Scherben auf dem Boden aus und steckte sie in ihrem Mund. Dr. Vasoldt hatte inzwischen wieder einigermaßen Luft bekommen und fing an, hysterisch nach den Wächtern zu schreien. “Wache! Wache! Die teuflische Hexe hat mich angegriffen. Wache! Sie hat versucht mich zu blenden!” Elisabeth zog sich eilig den Drudenkittel an und verstreute mit ihrem Fuss die restlichen Brillenscherben auf dem Boden, immer konzentriert, dass sie das Stück Glas in ihrem Mund nicht verschluckte. Der schwer angesoffene Kerkermeister hieb mit einer kurzen Peitsche mehrmals lustlos auf Elisabeth ein und zog sie dann an den Haaren bis in den ersten Stock und nachdem er endlich den richtigen Schlüssel für ihre Zelle gefunden hatte, gab er ihr einen kräftigen Fusstritt, der sie heftig in das Stroh fliegen liess. Durch den Fusstritt des Kerkermeisters hatte die Scherbe einen kleinen Schnitt in ihrem Mund verursacht. Der Geschmack nach ihrem eigenen Blut lies Elisabeth mutig lächeln, denn das bedeutete, dass sie keine stumpfe Schneide in ihren Mund gesteckt hatte. Zur Sicherheit versteckte sie das zerbrochene Brillenglas im Eimer für den täglichen Stuhlgang, denn aus dem Erdgeschoß hörte sie den tobenden Dr. Vasoldt, der offensichtlich, wie ein halbblinder Maulwurf, die Reste seiner Brillen im Schein seiner Kerzenfunzel zusammensuchte. Kurz darauf hatte er das Gelände keifend verlassen und es wurde still im Malefiz Haus. Elisabeth Möhrlin fischte ihre gläserne Rettung aus dem Eimer mit ihrem Kot. Mit etwas Wasser aus dem Krug säuberte sie das Stück Glas, dass ihr in diesem Moment wertvoller erschien, als der kostbarste Diamant dieser Welt. Obwohl sie mehrmals an der Ziegelwand gepocht hatte, gab es aus Helenas Nachbarzelle keinerlei Antwort - entweder sie war bewusstlos oder bereits an den Folgen der heutigen Foltersitzung verstorben. Elisabeth nahm einen letzten ausgiebigen Schluck vom Wasser, fühlte im Dunkeln wo ihr Puls am stärksten pochte, dann fuhr sie ein paar mal mit dem Zeigefinger über die scharfe Kante, biss sie sich ganz fest auf ihre Lippen und ritzte sich mit drei kräftigen Schnitten die Venen des linken Armes von unten nach oben auf. Dann wechselte sie den Arm und das Brillenglas und vollendete ihr letztes Werk mit mechanischer Wucht. Als sie ihren Mund wieder öffnete, spürte sie erfreut, das das warme Blut an beiden Armen pochend auf ihre Beine und das Stroh tropfte. In der Dunkelheit ihrer Zelle gab es nur dieses kleine Loch in der Mauer, durch das man einen ganz winzigen Ausschnitt vom Sternenhimmel sehen konnte. Mit der sanften Wärme des austretenden Blutes spürte Elisabeth eine schläfrig, süße Erleichterung in sich aufsteigen, die ihr wie die absolute Erlösung erschien. Sie würde nicht gefoltert werden. Und sie würde niemanden denunzieren müssen und sie würde nicht einmal als Leiche auf dem Scheiterhaufen enden, denn sie hatte ja noch nicht gestanden, weshalb man ihr nicht einmal ein christliches Begräbnis versagen konnte. Elisabeth lächelte wie eine Siegerin und weinte trotzdem gleichzeitig: Den Hexen–Kommissar Dr. Ernst Vasoldt würde sie nie wieder sehen, nie wieder riechen müssen und auch seine zynische Stimme blieb ihr für alle Zeiten erspart.
Während ihr Atem mit jedem Pulsschlag ein klein wenig schwächer wurde, träumte die junge Schneiderin ihren letzten Traum von einem glücklichen Leben mit einem stolzen Bräutigam und eigenen Kindern. Sie fantasierte von den einmaligen Wäldern und Wiesen ihrer Kindheit, sie sah sich mit offenem Mund bei der feierlichen Inthronisation der Fürstbischofs in der Menge stehen und sie roch die nahen Regnitzufer, hörte das Gequake der zahlreichen Enten und das Sonntagsläuten der Kirchenglocken von Bamberg. Als man sie am nächsten Morgen ausgeblutet im Stroh liegend fand, sprach man tagelang im gesamten Hochstift nur noch vom Tod der jungen Hexe, denn sie war lächelnd eingeschlafen und bot, trotz des vielen Blutes und des groben Leinenkittels, ein Bild absoluter Glückseligkeit. “Der gerissene Teufel hat seine schöne Buhlin vor der peinlichen Befragung in der Marterkammer gerettet und zu sich geholt!” So lautete die offizielle Version, die Dr. Friedrich Förner der ehrfürchtigen Kirchengemeinde bei der nächsten Sonntagsmesse präsentierte und so sollte es schlussendlich noch bis zum 1. Februar des Jahres 1632 dauern, als eine übermächtige schwedische Armee vor dem katholischen Bamberg aufmarschierte und dem Massenmord an der gepeinigten Bevölkerung damit endgültig ein Ende setzte. Bis zu diesem Tag wurden im Malefiz Haus des Hexenbrenners Fuchs von Dornheim noch hunderte weiterer unschuldiger Bürger zu Tode gequält oder zur Hinrichtung vorbereitet. Das schlimmste Foltergefängnis der europäischen Inquisition wurde für immer geschlossen. Die Hexenkommissare und der gesamte fürstbischöfliche Hofstaat hatten die Stadt einen Tag vor der Einnahme bei Nacht und Nebel verlassen und befanden sich auf der Flucht.
Bevor die letzten zehn überlebenden Gefangenen aus dem Malefiz Haus entlassen wurden, mussten sie, die so genannte Urfehde (oder Urgicht) unterschreiben: es war ihnen fortan strikt verboten, über ihre Folterhaft zu sprechen und sie schworen bei ihrem Leben, dass sie niemals Rache am Gericht nehmen würden.
362 Jahre später ... ca. 3240 km südwestlich: Die Insel FuerteventuraKalima oder Scirocco - ich habe das immer verwechselt, aber ab 50°C Grad in der Sonne, war es spätestens am dritten Tag vollkommen egal, ob man von einem staubigen Wind aus der Sahara oder einem sandigem Sturm aus Nordafrika weichgegrillt wurde - und heute war bereits Tag sieben in der Wüstensauna. Der einzige Weg in das zwei Kilometer entfernte Dorf, war eine knochentrockene Waschbrettpiste aus festgefahrenem rotbraunen Lehm. Jeder Besucher kündigte sich schon von Weitem mit einer riesigen Staubfahne an und wurde normalerweise auch von dem großen Bardino-Rüden meiner Nachbarn lauthals bellend begrüßt, aber schon kurz nach dem Beginn der großen Hitze, wurde es fast gespenstisch still in der Siedlung - keine Vogelschwärme, keine vereinzelten Möwen und meine beiden Katzen schliefen den ganzen Tag bewegungslos auf der schattigen Terrasse unter der gemauerten Sitzbank. Absolut ungewohnte Windstille und beim Blick auf den grellen Horizont nur noch brodelnde optische Schlieren, die bei längerer Betrachtung, wie verdampfende Landschaften aussahen, die langsam von der brutalen Kraft der sengenden Sonne ausgeblichen wurden. Seit knapp 3 Jahren war ich jetzt schon auf der Flucht, ausgeschrieben bei Interpol, unschuldig verurteilt, mit falschem Namen und gefälschten Papieren unterwegs und trotzdem vollkommen glücklich, denn ich hatte hier auf Fuerteventura einen perfekten Platz gefunden, um auch noch die kommenden 7 Jahre als Outlaw überstehen zu können. Eigentlich gab es jetzt keine bessere Zeit für eine ausgiebige Siesta - aber selbst dafür war es einfach zu heiß. In einem Anfall von irrwitzigem Hospitalismus hatte ich vor drei Wochen der Band um meinen neuen Freund Rolf, dem Drummer, die leer stehende Werkstatt hinter dem Haus als Proberaum überlassen. Die aus vier Musikern bestehende Band spielte fetten, straighten Surfrock in brachialer Lautstärke und war das Beste, was die Insel zu bieten hatte. Was ich bei der Zusage leider nicht geahnt hatte: aus arbeitstechnischen Gründen konnte die Band nur tagsüber proben - und für die Lautsprecher, Verstärker, Mischpulte und Elektrogitarren brauchten sie auch noch den Benzin betriebenen Stromgenerator, der lautstark stinkend, im Vorbau hinter dem Haupthaus, vor sich hin tuckerte. Wegen eines bevorstehenden Gigs am kommenden Wochenende hatten sie sich entschlossen, schon ab früh um neun, das gesamte Programm einmal komplett durchzuspielen - so als Art Generalprobe. Dank des stundenlangen Exklusiv-Konzerts war somit an Schlafen nicht mehr zu denken. Selbst Schuld. Seit mehr als zwei Monaten war der Himmel wolkenlos und so wurde das Haus normalerweise ausschließlich mit geräuschlosem Solarstrom versorgt - der Laptop war sehr sparsam und obwohl das Radio den ganzen Tag und die halbe Nacht an war, konnte ich gar nicht so viel Strom verbrauchen, wie die Sonne tagtäglich in die Speicherbatterien brannte. Seit einer Stunde war die Probe beendet und Rolf hatte schwitzend einen Joint mit seiner neuesten Eigenzüchtung gedreht, während ich mit der italienischen Kaffeemaschine einen rabenschwarzen Espresso gebrüht hatte. Obwohl es einige Minuten im ganzen Wohnzimmer nur nach frischem Kaffee gerochen hatte, war jetzt wieder die dominant süßliche Grundnote meiner eigenen Gras-Plantage die einzig wahrnehmbare Kopfnote im gesamten Haus: In nur zwei Wochen würden meine 40 geliebten weiblichen Babies, reif an bestem Harz, bereit zur Ernte sein und so hatte ich den ganzen Vormittag genutzt, um die überflüssigen Deckblätter zu entfernen, nach Schädlingen Ausschau zu halten, sparsam zu gießen und vor allem, um nach drohenden „Schwuchteln“ zu suchen - bei Ihrem Verlangen sich unbedingt zu reproduzieren, gelang es der einen oder anderen Pflanze oftmals „abzuzwittern“ - sprich Hermaphrodit zu werden und dann männliche Pflanzenteile auszubilden. Das war mir dummerweise im Jahr zuvor bei meiner ersten Guerilla-Plantage im Süden der Insel mit zwei Pflanzen passiert. Dafür hatte ich jetzt aber jede Menge an besten Samen. Wahrscheinlich war es aber dieses Jahr selbst den Maries zu heiß, um sich dermaßen anzustrengen - alles war im sprichwörtlich grünen Bereich - und da einzelne Blüten schon mehr braune als weiße Blütenhärchen ausgebildet hatten, schnitten wir einen Bund nach gründlicher Auswahl chirurgisch einwandfrei von einer der großen Pflanzen ab und toasteten ihn Testweise unter der Windschutzscheibe meines Jeeps, bis er knurpsig trocken war.
Dieses Instant-Schnell-Röstverfahren war zwar im klassischen Sinn jedes Ur-Kiffers ein barbarisches Sakrileg, aber scheiß drauf - ich wollte nach zweieinhalb Monaten Gärtnerei endlich wissen, ob sich der tägliche Aufwand auch wirklich gelohnt hatte. Seit einer halben Stunde hatten wir nicht mehr geredet, denn der Turn des ersten Joints mit der neuen Sorte war einfach Hammermäßig und in Verbindung mit der Wüstenhitze vollkommen plättend. Durch die ganze Buddelei im Patio waren meine langen gepflegten Fingernägel schwarz und voller Erde. Seit über zehn Jahren arbeitete ich fast ausschließlich am Computer und da sind lange Fingernägel beim Hacken einfach viel geiler als kurze. Man kann den Anschlag der Nägel auf der Tastatur ganz anders - viel sensitiver „Hören“ und dadurch bekommt man ein perkussiv-akustisches Hack-Feeling. Ich hatte mein Haus vor etwa drei Monaten telefonisch von der Besitzerin angemietet, die anscheinend irgendwas mit Grafik zu tun gehabt haben musste, denn in ihrem „Office“ hatte ich jede Menge Stifte, Lineale, Schablonen und Zirkel gefunden. Zum Reinigen meiner Fingernägel hatte ich einen massiven, etwa zwanzig Zentimeter langen, metallenen Retouchier-Stift mit einer Spitze aus poliertem Edelstahl ausgesucht und ins Wohnzimmer mitgenommen. Den hatte ich seit einer halben Stunde konzentriert im Einsatz, um auch die letzten Krümel Erde aus den verstecktesten Winkeln meiner Nägel zu kratzen. Dabei kam man wenigstens nicht weiter ins Schwitzen.
Der einzige Sender, den man um die Siestazeit überhaupt ertragen konnte war Radio Tres - eine nationale Radiostation aus Madrid - ganz ohne Werbung - die nachmittags ein recht erträgliches Chillout-Programm sendeten. Sanfte Downbeat Mucke im Mix mit ein paar Klassikern - wie gesagt, musikalisch durchaus angenehm unauffällig - auf der anderen Seite wieder kurzzeitig zum Schreien, wenn die spanischen Moderatoren versuchten, englische oder international Bands anzusagen: Bin Floi und Filib Gla waren da noch die harmlosesten Benennungen. Doch jetzt krabbelte urplötzlich diese verdammte fette schwarze Ameise auf dem Tisch herum und passte irgendwie nicht da hin - außer Kaffeetassen, Gras, Papers und Kippen gab es sowieso nichts Essbares - und - ich hatte sie auch nicht eingeladen. „Du bist fällig,“ war mein erster Gedanke, als ich sie auf dem hölzernen Couchtisch herumkrabbeln sah. Aber einfach zerquetschen war ja irgendwie plump und ... ich hatte doch eine etwas subtilere „Waffe“ in Form des Metallstifts in meiner Hand. Rolf lächelte bloß spöttisch über meine drohende Bemerkung: Nicht einmal wenn man nur zehn Zentimeter über einer laufenden Ameise gelauert hätte, wäre es realistisch gewesen anzunehmen, dass man sie dann auch treffen könnte - dazu war sie viel zu klein ... und viel zu schnell. Von meiner Position - knapp zwei Meter entfernt - halb bewusstlos in den Polstern liegend- war schon überhaupt nicht daran zu denken - aber genau das war ja das Spannende daran. Im Geiste gab ich der Ameise eine letzte Chance: Wenn Du Dich in den nächsten 30 Sekunden nicht vom Tisch entfernt hast - dann putz ich Dich von der Platte! Als ob mich das Insekt herausfordern wollte, hielt es an, stellte es sich auf ihre hinteren vier Beine und präsentierte mir seine geballte acht Millimeter Formicula-Power in voller Größe, um dann wie wild geworden, den Tisch auf und abzurennen. Ich wog den kalten Metallstift sicher in meiner Hand - obwohl die Temperatur im Zimmer, subjektiv gesehen, schweineheiß war, fühlte sich das gebürstete Aluminium angenehm kalt zwischen den Fingerspitzen an - die Griffmulden am Schaft waren der perfekt gestylte Halt, als ich den Stift in Richtung flüchtende Ameise richtete. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich. Mit ausgeblendeter Optik machte sich auch gleich wieder der penetrant süßlich aufdringliche Duft des Marihuanas bemerkbar - die Nüstern weit offen - ruhig einatmen. Es gab nicht die geringste realistische Chance ein sich bewegendes Mikroziel auf diese Distanz zu treffen - ich wartete bis sich der Song seinem Höhepunkt näherte ... dann ... in der winzigen Pause bis zum nächsten Refrain ... dann warf ich... Mit einem kurzen „Pluck“ war der Stift im weichen Holz eingeschlagen und stecken geblieben - ich öffnete die Augen - Rolf hatte sich ruckartig aus seiner THC-Lethargie gepult und aufgerichtet - ungläubig gaffte er auf den Tisch. Ich nahm meine Brille und setzte mich ebenfalls auf: Wir konnten es beide nicht glauben, aber ich hatte die Ameise wirklich getroffen ... mitten im Lauf ... was an sich schon mal ziemlich utopisch war, doch sie war alles Andere, als leblos dahingerafft, sondern mehr als aktiv.
Die Metallspitze hatte sich genau in dem Moment in das Holz gebohrt, als das letzte der drei rechten Beine der rennenden Ameise gerade in diesem Bruchteil einer Sekunde am Einschlagsort war. Es war einfach nicht zu fassen. Bingo! Ich hatte sie auf dem Tisch regelrecht fest getackert. Die ruck-gebremste Ameise war anscheinend so gar nicht mit dieser Behandlung einverstanden, denn die fünf freiliegenden Beine drehten auf dem Holztisch ununterbrochen durch - wie die im Sand slippenden Reifen eines Jeeps - sie war von der Stahlspitze gefesselt und probierte vergeblich in alle Richtungen zu ziehen und zu fliehen. Rolf sah mich mit seinen verkifften Glotzies vollkommen ungläubig an. Bis auf das sechste Bein war die Ameise absolut unverletzt. Man hätte es vielleicht auch unter dem Motto „pseudo-wissenschaftliches Experiment“ abhaken können und einfach warten, wie viele Tage sie das wohl so durchhalten könnte, aber ich erinnerte mich in dem Moment daran, dass ich ja mal vor knapp zwei Jahren recht dankbar war, über die Mithilfe einer riesigen Menge von Ameisen: der große Verkaufsschlager auf unserem Haifisch-Kutter waren die Gebisse der Bestien, die wir den sensationsgeilen Touris für saftiges Geld andrehten. Das manuelle Ausbeinen der Kauleisten von Blauhaien und Makkos war ein richtiger Scheiß Job, denn die mehrlagigen Beißer der Haie waren scharf wie Rotz und da das glitschige Zahnfleisch überaus flexibel war, fluchte unser Bootsmann Pepe bei dieser Arbeit, wie ein spanischer Marinero eben stundenlang so vor sich hin flucht. „Joder - puto mandibula del jodido Tiburon de mierda“. Aber dann hatten wir neben dem Haus unseres Kapitäns einen großen Ameisenhaufen entdeckt, auf dem wir die stinkenden Gebisse einfach ablegten. Nach ein paar Tagen waren sie von Tausenden von Ameisenzangen so perfekt blank geputzt, dass sie nicht einmal mehr nach Fisch rochen - dafür hatten sie so einen leicht säuerlichen Geruch von Ameisensäure, der sich aber mit ein wenig Spülmittel leicht entfernen ließ. Es war echt irre anzusehen, wie ein ganzes Ameisenvolk mit ihren winzigen Kiefern an dem für ihre Verhältnisse gigantischen Haifisch-Maul herum nagten - und das auch noch komplett umsonst. Und so holte ich nach kurzer Überlegung eine Postkarte, schob sie ganz langsam Millimeterweise unter den winzigen Körper der tapferen Ameise und setzte sie, nachdem ich den Stift vorsichtig aus dem Holz gedreht hatte, in die Palme, die vor dem Haus stand. Sie wartete ein paar Sekunden, drehte sich ein letztes Mal um und verschwand dann blitzschnell in den Innereien der Palmen-Rinde. Wir packten die Surf-Boards, ein paar kühle Drinks und noch etwas Rauchwerk in den Jeep und fuhren die knappen zehn Kilometer Sandpiste zu einem einsamen Beach ... es hatte den Anschein, als ob endlich etwas Wind aufkommen sollte. Touchdown: 8. Februar 1959
Mein Leben begann an einem schönen Faschingssonntag so gegen acht Uhr morgens im Kreissaal des Bamberger Krankenhauses und mein richtiger Name ist Ralph Kloos. Nach knapp zehn Jahren Pause war ich wohl mehr ein kleiner Unfall, denn meine drei Geschwister waren 10, 12 und 16 Jahre älter als ich. Da meine Eltern nach dem zweiten Weltkrieg aus Schlesien fliehen mussten, lagen meine genetische Wurzeln wohl eher dort, aber Bamberg war durch mangelnde Kriegsbeschädigungen eine besonders gut erhaltene fränkische Kleinstadt mit etwa 70.000 Einwohnern, die einen pittoresk-mittelalterlichen Charme versprühte und deshalb von meinen Eltern als neuer Nachkriegs-Wohnsitz ausgesucht worden war. Es war mein großer Bruder, der dann wenige Tage nach meiner Geburt bemerkte, dass mein linkes Auge nicht richtig reagierte. Es wurde untersucht und innerhalb von mehreren Jahren auch zweimal operiert, doch mit den damaligen Mitteln der Operationstechnik war wohl nichts zu machen: Ich war also einäugig und hatte einen leicht schielenden Silberblick. Vor allem meine Mutter war eine ständig mahnende Quelle an Vorsichtsmaßnahmen - sie versuchte mir immer klar zu machen, dass ich besonders vorsichtig sein sollte, denn ein kleiner Unfall könnte mich ja schließlich erblinden lassen - und vielleicht war es vor allem diese Tatsache der Grund, warum ich mich so gar nicht mit dieser Gefahr auseinandersetzen wollte, weshalb ich genau die gegenteilige Aktionen unternahm, ständig herumkletterte, mich prügelte und so gar keinen Bock auf übertriebene Vorsicht hatte.
Meine Eltern wohnten im Bamberger Haingebiet in einer Mietwohnung, die direkt am Stadtpark lag. Und so war meine Kindheit ziemlich unbeschwert und glücklich bis zu dem Tag, als ich dann endlich eingeschult wurde. Schon am zweiten Schultag passierten seltsame Dinge an der Hain-Schule, die inmitten eines Parks lag. Auf dem Schulhof wurden die evangelischen Schüler durch eine weiße Linie von den katholischen Schülern getrennt - bewacht von zwei Lehrern. Während wir also im Klassenzimmer friedlich nebeneinander saßen, gab es auf dem Pausenhof jede Menge Kloppereien zwischen den beiden Parteien. Da ich einer der wenigen evangelischen Schüler war, gehörte ich damit im kreuz- und erzkatholischen Bamberg zur Minderheit und obwohl man sich ja schon bald an diesen Zustand gewöhnt hatte, kostete mich einer dieser jugendlichen Auseinandersetzungen an unserer Religions-Demarkationslinie einen meiner Milchzähne. Wer sich diese Schikane ausgedacht hatte, weiss ich bis heute nicht, aber Tatsache ist, dass es diese Linie zumindest während meiner ersten zwei Schuljahre in Bamberg gab - dafür gibt es ja Zeitzeugen und auch in Trier schien es diese Praxis in den 60er Jahren zu geben, denn ein Freund von mir erlebte dort ebenso, wie Schüler, nach Konfession getrennt, die Pause verbringen mussten. Trotz meiner Frechheiten war ich ein “guter Schüler” und bekam auch nur wenig Watschen, denn damals war die Prügelstrafe natürlich politisch noch voll korrekt und besonders der alte Lehrer Minges war noch ein Pädagoge der alten Schule, der gerne mit Links antäuschte, um dann mit Rechts voll zuzuschlagen. Obwohl meine Eltern nicht gerade in Geld badeten, war es klar, dass man mich auf das Gymnasium schicken würde.





























