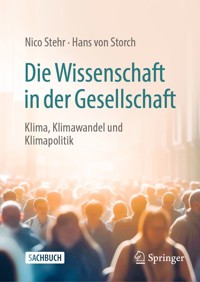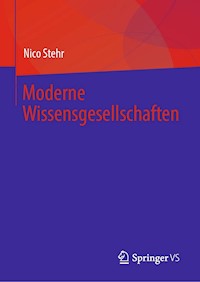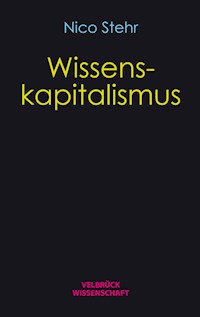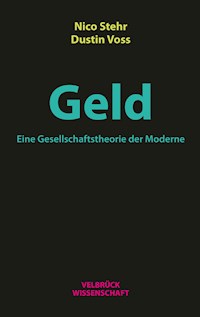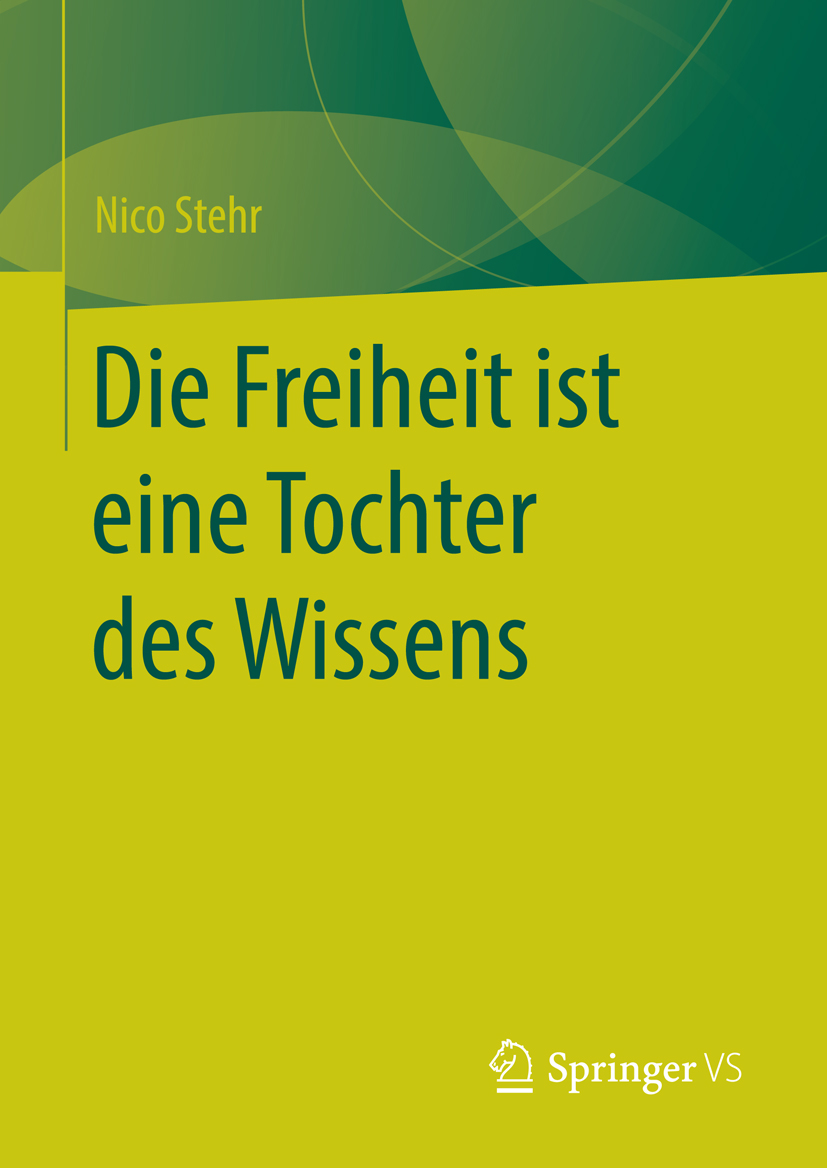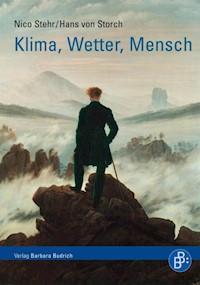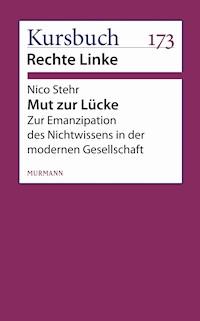
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Professor für Kulturwissenschaften Nico Stehr befasst sich in seinem Aufsatz für das Kursbuch 173 mit der Rolle von Wissen und Information in der Gesellschaft. Hierbei differenziert Nico Stehr die Begriffe in Prozess-Kenntnisse einerseits und Eigenschaftskenntnisse andererseits. Er macht weiter auf das Problem aufmerksam, dass eine symmetrische Verteilung dieser Formen in einer Wissensgesellschaft wohl nicht durchzuhalten ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 20
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nico Stehr
Mut zur Lücke
Zur Emanzipation des Nichtwissens in der modernen Gesellschaft
Ich möchte meine Beobachtungen mit zwei mir sehr sympathischen Zitaten einleiten. Alfred Schütz vertritt zum einen die Ansicht, dass »das herausragende Merkmal des Lebens der Menschen in der modernen Welt ihre Einsicht sei, dass weder sie noch ihre Mitmenschen ihre Lebenswelt als Ganzes vollständig verstehen«. Georg Simmel betont zum anderen: »Unser Wissen gegenüber dem Gesamtdasein, auf dem unser Handeln sich gründet, ist durch eigentümliche Einschränkungen und Abbiegungen bezeichnet.«
Meine These zum angeblichen Phänomen des Nichtwissens lässt sich im Sinne von Schütz und Simmel, aber noch genauer mit einem Verweis auf eine Formulierung des Ökonomen Joseph Stiglitz über die an Märkten scheinbar agierende unsichtbare Hand prägnant zusammenfassen: Warum ist die unsichtbare Hand unsichtbar? Weil es sie nicht gibt. Warum ist Nichtwissen so schwer zu erfassen? Weil es Nichtwissen nicht gibt.
Da ich aber nicht bereits an dieser Stelle kapitulieren will, konzentriere ich mich in diesem Essay auf die Beobachtung von wissenschaftlichen Diskursen, in denen behauptet wird, es gebe so etwas wie Nichtwissen. Die Dichotomie Wissen/Nichtwissen erscheint in vielen Abhandlungen zu diesem Thema als performativer Sprechakt, der sich allerdings nur einer Seite des von ihm Bezeichneten anempfiehlt, nämlich Wissen. Ich kann mein restriktives Erkenntnisinteresse des nur Beobachtens nicht immer beibehalten; von Zeit zu Zeit weiche ich davon ab und urteile, als ob es Nichtwissen gäbe.
Ich möchte gleichzeitig auf andere Termini aufmerksam machen, die mir empirisch und theoretisch ertragreicher erscheinen als der nackte Begriff des Nichtwissens. Schließlich darf ich auf eine Reihe von faszinierenden, aber kaum erforschten Themen verweisen, die mit der Frage der gesellschaftlichen Funktion beziehungsweise des gesellschaftlichen Umgangs mit scheinbar unzureichendem Wissen zu tun haben. Kurzum, es geht um die Funktion des Nichtwissens in der Wissensgesellschaft.
Freud und Hayek: Warum resignieren?
Beginnen wir zum Thema »Nichtwissen« bei Sigmund Freud und Friedrich Hayek. Ihr Zugang ist, wenn ich mich nicht täusche, typisch für den wissenschaftlichen Diskurs. Sie erkennen zwar, dass es das originäre Forschungsthema Nichtwissen nicht geben kann, fahren aber ungestört fort, das zu erforschen, was es gar nicht gibt. Dies gibt mir noch Gelegenheit zu fragen, warum die Beschäftigung mit dem Thema Nichtwissen, besonders für die deutschsprachige »scientific community«, typisch ist. Ist es eine Art Sonderweg?
Doch zurück zu Freud. Seine Lehre vom Traum als psychischem Phänomen, wie er sie in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse