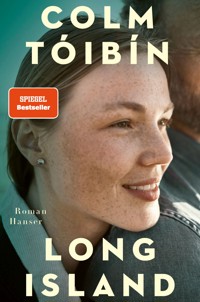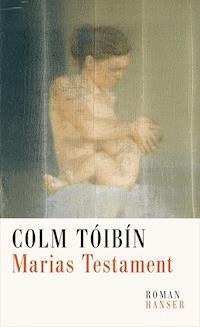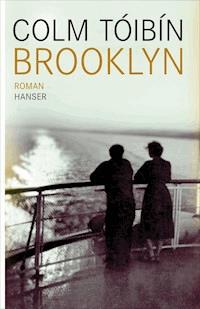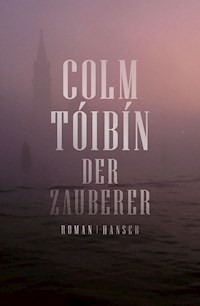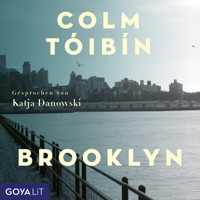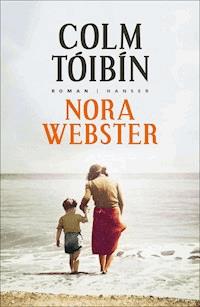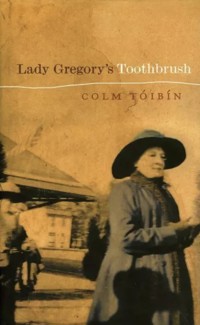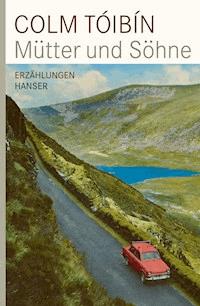
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten von Menschen, die mit ihrem Leben zurechtkommen müssen, nachdem etwas passiert ist: Die Söhne in Toibins erstem Erzählungsband sind Diebe, Priester, Bauern, die Mütter Folksängerinnen, Alkoholikerinnen oder Geschäftsfrauen, aber alle unterhalten hochkomplizierte Beziehungen zueinander. Der hochgerühmte Autor Colm Toibin ist eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur aus Irland. Frei von Sentimentalität und Klischees zeichnet er hier Figuren, die sich dem Tod eines geliebten Menschen oder der Enthüllung eines so schrecklichen Geheimnisses wie Kindesmissbrauch zu nähern versuchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die Söhne in Toibins erstem Erzählungsband sind Diebe, Priester, Bauern, die Mütter Folksängerinnen, Alkoholikerinnen oder Geschäftsfrauen, aber alle unterhalten hochkomplizierte Beziehungen zueinander. Einer alten Frau wird mitgeteilt, dass ihr Sohn wegen Kindesmissbrauch vor Gericht kommen wird, doch sie weigert sich, ihr gewohntes Leben deshalb in irgendeiner Weise zu ändern. In einer Kneipe hört ein junger Mann plötzlich seine Mutter singen, die die Familie verlassen hat, als er noch klein war, gibt sich aber nicht zu erkennen. Es spielen sich Dramen ab, die jedoch nicht gezeigt werden, die Personen geben nichts direkt preis, doch man ahnt, dass hinter dem Ungesagten immer etwas danach drängt, zum Ausbruch zu kommen.
Toibins Augenmerk richtet sich insbesondere darauf, wie Menschen mit ihrem Leben zurechtkommen, nachdem etwas passiert ist - nachdem jemand gestorben oder verschwunden ist oder ein Geheimnis enthüllt wurde.
Colm Tóibín
Mütter und Söhne
Erzählungen
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Carl Hanser Verlag
Für Michael Loughlin undVeronica Rapalino
Inhalt
Der Gebrauch der Vernunft
Ein Lied
Die Parole
Famous Blue Raincoat
Ein Priester in der Familie
Eine Fahrt
Drei Freunde
Ein Sommerjob
Ein langer Winter
Eins minus eins
Danksagung
Der Gebrauch der Vernunft
Die Stadt war eine große Leere. Er stand auf dem Balkon einer der Dachgeschosswohnungen auf der Charlemont Street. Die weite öde Fläche unter ihm war leer. Er schloss die Augen und dachte an die anderen Wohnungen in diesem Geschoss, jetzt am Nachmittag größtenteils leer, so wie die kleinen kahlen Badezimmer leer waren und die offenen Treppenhäuser leer waren. Er stellte sich die Häuser vor, die in langen Streifen von Vororten vom Zentrum ausstrahlten: nach Norden Fairview, Clontarf, Malahide; nach Süden Ranelagh, Rathmines, Rathgar. Er dachte über die Selbstsicherheit dieser Straßen nach, über ihre Stärke und Solidität, und dann ließ er seine Gedanken durch die Zimmer von Vorstadthäusern schweifen, Schlafzimmer, den ganzen Tag leer, Parterrezimmer, die ganze Nacht lang leer, die langen Gärten hinter den Häusern, aufgeräumt, gestutzt, auch sie den ganzen Winter lang und einen großen Teil des Sommers lang leer. Die traurigen Dachböden, ebenfalls leer. Wehrlos. Niemand würde einen Eindringling bemerken, der über eine Mauer kletterte, durch einen Garten huschte, um über die nächste Mauer zu klettern, einen unscheinbaren Mann, der die Rückseite des Hauses nach Lebenszeichen, nach einer Alarmanlage oder einem Wachhund absuchte und dann lautlos ein Fenster aufstemmte, hineinschlüpfte, vorsichtig ein Zimmer durchquerte, nach einem sicheren Fluchtweg suchte. Er würde eine Tür öffnen, ohne ein Geräusch zu machen, so auf der Hut, dass er fast unsichtbar wäre.
Er dachte an die Leere der Clanbrassil Street, durch die seine Mutter zum »Dock« ging. Es war so, als ob selbst die Luft, die sie umgab, und auch der Bürgersteig und die Backsteine der Gebäude sich der Gefahr bewusst wären, die sie darstellte, und ihr aus dem Weg gingen. Das blonde Haar ungekämmt, schlurfte sie in Pantoffeln zur Gastwirtschaft. Ein unechter Goldring, unechte Armreifen und auffällige goldene Ohrringe, die sich mit dem Rot ihres Lippenstifts, dem Grün ihres Lidschattens, dem Blau ihrer Augen bissen. Jetzt drehte sich seine Mutter um, um zu sehen, ob ein Auto kam, damit sie die Straße überqueren konnte, und stellte, wie er sich ausmalte, fest, dass die Straße vollkommen leer war, ohne jeglichen Verkehr, dass die Welt ihr zu Gefallen entleert worden war.
Während sie sich der Gastwirtschaft näherte, wusste seine Mutter, dass sich ihre Nachbarn vor ihren unerwarteten Liebenswürdigkeiten ebensosehr fürchteten wie vor ihren Wutausbrüchen und ihren Alkoholkollern. So konnte ein Lächeln ihrerseits ebenso unwillkommen sein wie ein finsterer Blick. Zumeist trug sie eine gleichgültige Miene zur Schau. Weder auf der Straße noch im Pub brauchte sie zu drohen, man wusste, wer ihr Sohn war, und man glaubte, er sei ihr leidenschaftlich ergeben. Er wusste nicht, wie sie es fertigbrachte, alle glauben zu lassen, er würde selbst die geringfügigste Kränkung seiner Mutter rächen. Auch ihre Drohungen waren leer, dachte er, leerer als alles andere.
Er stand auf dem Balkon und rührte sich nicht von der Stelle, als sein Besucher, der sich dem Gebäude durch die verborgene Seitentür des Komplexes genähert hatte, auftauchte. Er ließ, wie er es jede Woche tat, Detective Inspector Frank Cassidy an sich vorbei in die kleine Wohnung ein, die seiner Schwägerin gehörte und von ihm nur einmal in der Woche benutzt wurde. Cassidy trug, was er immer anhatte, und sein gerötetes Gesicht zeigte eine Mischung aus verstohlenem Schuldbewusstsein und geschäftsmäßiger Selbstsicherheit. Er zahlte Cassidy jede Woche einen Betrag, der entweder zu hoch oder zu niedrig war, jedenfalls hinlänglich falsch, um ihm das Gefühl zu geben, dass Cassidy ihn eher zum Narren hielt als dass er seine eigenen Leute verriet. Als Gegenleistung lieferte ihm Cassidy Informationen, die ihm größtenteils schon bekannt waren. Trotzdem hatte er immer das Gefühl, dass Cassidy, sollten ihm die Gesetzeshüter jemals zu nahe kommen, ihn dies schon wissen lassen würde. Er würde es, wie er glaubte, aus Gefälligkeit tun oder aber, damit er in Panik geriet. Oder vielleicht auch beides. Er selbst sagte Cassidy nichts, aber er konnte nicht wissen, ob seine Reaktion auf eine bestimmte Information eines Tages nicht alles verraten würde, was Cassidy brauchte.
»Sie beobachten die Wicklow Mountains«, sagte Cassidy anstelle einer Begrüßung.
»Sagen Sie ihnen, dass sie nur ja die Augen offen halten sollen. Die Schafe fressen Gras. Das verstößt gegen das Gesetz.«
»Sie beobachten die Wicklow Mountains«, sagte er noch einmal.
»Von einem bequemen Sessel in der Harcourt Street aus«, sagte er.
»Wollen Sie es ein drittes Mal hören?«
»Sie beobachten die Wicklow Mountains.« Er imitierte Cassidys schleppenden Midland-Tonfall.
»Und sie haben einen jungen Kerl auf Ihren Fall angesetzt. Mansfield heißt er, und ich schätze, Sie werden noch einiges von ihm hören.«
»Das haben Sie mir schon letzte Woche gesagt.«
»Ja, aber er hat sich schon an die Arbeit gemacht. Er sieht nicht aus wie ein Polizist. Er sucht nach Juwelen.«
»Erzählen Sie mir nächste Woche etwas Neues.«
Nachdem Cassidy die Wohnung verlassen hatte, ging er wieder auf den Balkon und ließ den Blick noch einmal über die rußige Welt schweifen. Als er sich abwandte, fiel ihm etwas ein, eine deutliche Erinnerung an den Bennett’s-Juwelenraub. Sie hatten fünf Angestellten, alles Männer, befohlen, sich mit dem Gesicht an die Wand zu stellen, als einer von ihnen gefragt hatte, ob er sein Taschentuch herausholen dürfte.
Er hielt sie mit einer Pistole in Schach, allein, während er darauf wartete, dass die anderen die übrigen Mitarbeiter zusammentrieben. Er hatte dem Typ mit einem nachgemachten, schleppenden amerikanischen Akzent gesagt, wenn er sich die Nase putzen müsse, solle er wirklich besser sein Taschentuch herausholen, aber wenn er irgend etwas anderes heraushole, sei er ein toter Mann. Er hatte in einem beiläufigen Ton gesprochen, um zu verstehen zu geben, dass er keine Angst hatte, sich mit einer so dummen Frage abzugeben. Aber als der Typ das Taschentuch herausholte, war das ganze Kleingeld in seiner Tasche mit herausgefallen, und Münzen waren überall auf den Fußboden geprasselt. Die Männer sahen sich um, bis er sie anschrie, sie sollten sich augenblicklich wieder zur Wand drehen. Eine Münze rollte ein Stück weiter; seine Augen folgten ihr, und als er sich bückte, um die anderen Münzen aufzulesen, ging er hin und hob auch die auf. Dann schlenderte er zurück und händigte dem Mann, der sich die Nase hatte putzen müssen, die Münzen aus. Das bereitete ihm ein Gefühl der Ruhe, der Erleichterung, fast des Glücks. Er würde Schmuck im Wert von über zwei Millionen Pfund rauben, aber er gab einem Mann sein Kleingeld zurück.
Er lächelte bei dem Gedanken, als er in die Wohnung zurückging, sich die Schuhe auszog und sich auf das Sofa legte; jetzt, wo Cassidy gegangen war, würde er noch ein, zwei Stunden warten. Er erinnerte sich auch, dass sich während dieses Raubüberfalls eine der weiblichen Angestellten geweigert hatte, sich in die Herrentoilette bringen zu lassen.
»Sie können mich erschießen, wenn Sie wollen«, hatte sie gesagt, »aber da gehe ich nicht rein.«
Seine drei Kameraden, Joe O’Brien mit seiner Balaklava-Mütze, Sandy und dieser andere Typ, hatten plötzlich nicht gewusst, was sie tun sollten, und hatten sich zu ihm gewandt, als ob er ihnen vielleicht wirklich befehlen könnte, sie zu erschießen.
»Bringt sie und ihre Freundinnen auf die Damentoilette«, hatte er leise gesagt.
Er hob den Evening Herald auf und sah sich noch einmal das Foto von Rembrandts Bildnis einer alten Frau an, und er fragte sich, ob das Gemälde ihn an diese Geschichte erinnert hatte oder ob umgekehrt die Geschichte ihn daran erinnert hatte, sich wieder das Bild anzusehen. Daneben war ein Artikel, in dem es hieß, die Bullen würden mehrere Spuren verfolgen, die zur Wiederauffindung des Gemäldes führen könnten. Die Frau auf dem Gemälde sah ebenfalls stur aus, wie die Frau in der Schmuckfabrik, aber älter. Die Frau, die sich geweigert hatte, in die Herrentoilette zu gehen, war von der Sorte, die man sonntags abends mit einer Gruppe Freundinnen vom Bingo zurückkommen sah. Sie hatte der Frau auf dem Gemälde überhaupt nicht ähnlich gesehen. Er rätselte, worin die Verbindung zwischen den beiden bestehen mochte, bis ihm aufging, dass abgesehen von der Sturheit überhaupt keine bestand. Die Welt, dachte er, spielte seinem Verstand Streiche.
Dein Verstand ist wie ein Haus, in dem es spukt. Er wusste nicht, woher er das hatte, ob ihm das jemand gesagt, ob er es irgendwo gelesen hatte, oder ob es eine Zeile aus einem Lied war. Das Haus, aus dem er die Gemälde gestohlen hatte, sah genau wie ein Spukhaus aus. Vielleicht war ihm deswegen dieser Satz eingefallen. Die Gemälde zu stehlen war ihm zu dem Zeitpunkt wie eine gute Idee vorgekommen, jetzt war er sich allerdings nicht mehr so sicher. Er hatte den Rembrandt gestohlen, der jetzt, zwei Monate nach dem Raub, auf dem Titelblatt des Evening Herald erschien, dazu einen Gainsborough und zwei Guardis und ein Gemälde von einem Niederländer, dessen Namen er nicht aussprechen konnte. Der Raub war tagelang auf den Titelseiten gewesen. Er erinnerte sich, wie er laut losgelacht hatte, als er etwas von einer Bande von internationalen Kunsträubern gelesen hatte, Experten auf dem Gebiet. Man hatte den Raubüberfall mit anderen in Verbindung gebracht, die in den letzten Jahren auf dem europäischen Festland verübt worden waren.
Drei dieser Gemälde waren jetzt in den Dubliner Bergen vergraben; niemand würde sie jemals finden. Zwei weitere lagen auf dem Dachboden von Joe O’Briens Nachbarn in Crumlin. Insgesamt waren sie zehn Millionen Pfund oder mehr wert. Allein der Rembrandt war fünf Millionen wert. Er sah sich das Foto im Herald genau an, aber er verstand nicht, was daran so besonders sein sollte. Das Bild war größtenteils in irgendeiner dunklen Farbe gehalten, Schwarz vermutlich, aber es sah nach gar nichts aus. Die Frau auf dem Gemälde machte den Eindruck, als brauchte sie ein bisschen Aufheiterung, wie eine sauertöpfische alte Nonne.
Fünf Millionen. Und wenn er das Gemälde ausgrub und es verbrannte, würde es nichts mehr wert sein. Er schüttelte den Kopf und lächelte.
Man hatte ihm von Landsborough House erzählt und davon, wieviel die Gemälde wert seien und was für ein leichter Job das sein würde. Er hatte lange über Alarmanlagen nachgedacht und hatte sogar eine bei sich zu Haus installieren lassen, um genauer über ihre Funktionsweise nachdenken zu können. Dann war ihm eines Tages die Idee gekommen: Was würde wohl passieren, wenn man den Stromkreis einer Alarmanlage mitten in der Nacht unterbrach? Der Alarm würde trotzdem ausgelöst werden. Aber was würde dann passieren? Niemand würde die Anlage reparieren, erst recht nicht, wenn alle annahmen, dass es ein falscher Alarm gewesen war. Man brauchte sich lediglich zurückzuziehen, sobald der Alarm losging, und zu warten. Eine Stunde später, wenn sich die Aufregung gelegt hätte, konnte man dann zurückkommen.
Eines Sonntagnachmittags fuhr er zum Landsborough House. Es war erst ein Jahr her, dass das Haus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war; die Beschilderung war klar. Er musste sich die Alarmanlage ansehen, sich einprägen, wo die einzelnen Bilder hingen, und sich ein Gefühl für die Räumlichkeiten verschaffen. Er hatte gewusst, dass die meisten Besucher an einem Sonntagnachmittag Familien sein würden, aber er hatte seine Familie nicht mitgenommen, er nahm nicht an, dass es ihr Spaß gemacht hätte, zu einem Herrenhaus zu fahren oder darin herumzulatschen und sich irgendwelche Gemälde anzusehen. Er zog ohnehin gern allein los, ohne je zu sagen, wohin er ging oder wann er zurück sein würde. Sonntags sah er oft Männer, die mit einer ganzen Familie im Wagen aus der Stadt hinausfuhren. Er fragte sich, was das wohl für ein Gefühl sein mochte. Ihm wäre es auf den Geist gegangen.
Das Haus war voller Schatten und Echos. Nur ein Teil — »Flügel« war wahrscheinlich das richtige Wort — stand Besuchern offen. Er nahm an, dass die Eigentümer den Rest des Hauses bewohnten, und lächelte in sich hinein bei dem Gedanken, dass sie sich, sobald er Zeit gehabt hätte, einen richtigen Plan auszuarbeiten, auf eine Überraschung gefasst machen konnten. Sie waren alt, dachte er, und es würde ein Kinderspiel sein, sie zu fesseln. Seiner Erfahrung nach neigten alte Leute dazu, einen Heidenlärm zu machen; ihre Schreie waren lauter oder zumindest nervender als diejenigen ihrer jüngeren Pendants. Er würde daran denken müssen, starke, leistungsfähige Knebel mitzubringen.
Am Ende eines Korridors gab es eine riesige Galerie, und dort waren die Bilder aufgehängt. Er hatte die Namen der wertvollsten auf einem Zettel stehen und war überrascht zu sehen, wie klein sie waren. Wenn niemand hingesehen hätte, dachte er, hätte er eins davon nehmen und sich unter die Jacke stecken können. Andererseits konnte er sich vorstellen, dass hinter jedem Bild ein Alarmkontakt angebracht war und dass die so verschlafen wirkenden Wachen im Ernstfall sehr schnell in Aktion treten würden. Er ging den Korridor entlang zurück, in den kleinen Laden, wo er Postkarten mit Reproduktionen der Bilder, die er zu stehlen plante, und Poster vom Rembrandt kaufte, der das Kronjuwel seiner Beute sein würde. Sein Schwager rahmte ihm später zwei dieser Poster ein.
Er genoss die Vorstellung, dass niemand — überhaupt niemand, weder die Wachen noch die anderen Besucher, noch die Frau, die ihm das Geld abgenommen und die Karten und die Poster eingepackt hatte — auf ihn geachtet hatte und sich je an ihn erinnern würde.
Die Bullen wussten, dass er die Gemälde hatte. Ein paar Wochen nach dem Raubüberfall erklärte ein Artikel auf der Titelseite des Irish Independent, er sei die »Irish Connection«. Mittlerweile, nahm er an, hatten sie begriffen, dass es gar keine internationale Gang gab, zu der er in Verbindung gestanden hätte, dass er auf eigene Faust vorgegangen war, mit lediglich drei Helfern. Diese drei Helfer waren jetzt zu einem Problem geworden, da jeder von ihnen glaubte, dass er wenigstens ein paar hundert Riesen in bar bekommen würde. Alle drei hatten das Geld sofort verplant, sie fragten ihn ständig danach. Er hatte keine klare Vorstellung davon, wie er diese Gemälde zu Geld machen sollte.
An dem Abend würden zwei Holländer in einem Hotel auf der North Side absteigen. Den Kontakt zu ihm hatten sie durch einen Mann namens Mousey Furlong hergestellt, der früher mit einem Pferdewagen mit Schrott gehandelt hatte und jetzt Heroin an Kinder und Jugendliche verkaufte. Er schüttelte den Kopf, als er an Mousey Furlong dachte. Er hielt nichts vom Heroingeschäft, es war zu riskant, es waren zu viele Leute an einem Deal beteiligt, und ihm graute vor der Vorstellung, dass süchtige Kids an seine Haustür kommen würden, ausgemergelte, bleiche Kids mit riesigen Augen. Außerdem stellte Heroin die Welt auf den Kopf, es bedeutete, dass Männer wie Mousey Furlong Kontakte zu Holländern hatten, und das, dachte er, war ein widernatürlicher Sachverhalt.
Mousey sprach vom Rembrandt, als wäre er ein neues, lukratives Rauschgift in der Dubliner Szene. Die Holländer, sagte Mousey, waren an dem Rembrandt interessiert, aber sie würden ihn erst prüfen müssen. Sie hatten das Geld in bar parat und konnten es, gleich nachdem sie das Bild gesehen hatten, auszahlen. Über den Rest der Beute, fügte Mousey hinzu, könnten sie sich später unterhalten.
Die Holländer mussten vermutlich ebenfalls vorsichtig sein; falls sie das Geld bei sich hatten, wäre es einfach, ihnen aus einiger Entfernung das Poster zu zeigen, sich das Geld zeigen zu lassen und sie dann zu fesseln und mit der Beute zu verschwinden, während sie mit einem wunderschön gerahmten Poster nach Holland zurückkehrten. Er beabsichtigte nicht, den Holländern den Rembrandt zu zeigen, bevor er sich ein Bild von ihnen gemacht hätte; statt dessen würde er ihnen zunächst einen Guardi und den Gainsborough zeigen, um ihnen zu beweisen, dass er die Gemälde hatte.
Ein Raubüberfall war meist eine einfache Sache. Man stahl Geld, und sofort gehörte es einem; man verwahrte es an einem sicheren Ort. Oder man stahl Schmuck oder Elektrogeräte oder Zigaretten en gros, und man wusste, wo man sie zu Geld machen konnte. Es gab Leute, denen man vertrauen konnte, eine ganze Welt, die wusste, wie man eine solche Transaktion organisierte. Aber mit diesen Gemälden war es eine andere Sache. Hier war es notwendig, Leuten zu vertrauen, die man nicht kannte. Was, wenn die zwei Holländer Bullen waren? Das Beste war, zu warten, dann umsichtig vorzugehen und dann wieder zu warten.
Er stand vom Sofa auf und stellte sich an das kleine Fenster, das auf den Balkon ging. Dann trat er hinaus auf den Balkon. Halb erwartete er, in der Trostlosigkeit unten eine Gestalt lauern zu sehen, einen einsamen Mann neben einem Motorrad, aber es war niemand da, wieder diese Leere, als wäre die Welt eigens für ihn ausgeschüttet worden, zu seinem Vergnügen oder um ihn zu ängstigen. Er nahm an, dass Cassidy seinen Kollegen von dieser Wohnung erzählt hatte, und vielleicht brauchten sie niemanden zu seiner Beobachtung abzustellen, hatten sie doch Cassidy, der das Geld, wie er mittlerweile vermutete, jeden Monat in den Polizei-Hilfsfonds einzahlte. Allein beim Gedanken wurde ihm ganz übel. Er fragte sich, ob es nicht an der Zeit wäre, in Sachen Cassidy etwas zu unternehmen, aber er würde damit warten, bis die Gemälde erfolgreich verkauft wären. Im Laufe der Jahre hatte er gelernt, dass es immer am klügsten war, nur ein Problem auf einmal anzugehen.
Er ging wieder hinein und legte sich auf das Sofa. Er starrte an die Decke und dachte an nichts. Nachts schlief er gut, und zu dieser Tageszeit war er sonst nie müde, aber jetzt war er müde. Er drehte sich auf die Seite, legte sich ein Kissen unter den Kopf, und im Bewusstsein, dass seine Schwägerin erst in ein paar Stunden zurückkommen würde, nickte er allmählich ein.
Er wachte nervös und beklommen auf; was ihn beunruhigte und veranlasste, sich aufzusetzen und auf seine Uhr zu sehen, war der Verlust der Konzentration und der Kontrolle. Er hatte lediglich eine halbe Stunde lang gedöst, aber ihm wurde bewusst, dass er wieder von Lanfad geträumt hatte, und er fragte sich, ob er je aufhören würde, von diesem Ort zu träumen. Es war vierundzwanzig Jahre her, dass er ihn verlassen hatte.
Er hatte geträumt, er wäre wieder dort, würde zum erstenmal eingeliefert werden, von zwei Polizisten flankiert dort ankommen, Korridore entlanggeführt werden. Aber das war nicht er als dreizehnjähriger Junge, das war er jetzt, nachdem er so viele Jahre lang getan hatte, was ihm passte, verheiratet war, morgens von Kinderstimmen geweckt wurde, abends fernsah, Raubüberfälle verübte, Pläne machte und Geschäfte abschloss. Und was ihn an dem Traum beunruhigte, war das Gefühl, dass es ihn freute, eingesperrt zu sein, Ordnung in seinem Leben zu haben, sich an Regeln zu halten, rund um die Uhr bewacht zu werden, nicht allzuviel nachdenken zu müssen. Während er im Traum diese Korridore entlanggeführt worden war, hatte er ein Gefühl heiterer Resignation, ja fast der Freude verspürt.
So hatte er sich die meiste Zeit über im Mountjoy-Gefängnis gefühlt, wo er seine einzige Freiheitsstrafe als Erwachsener verbüßt hatte. Seine Frau und ihr erstes Kind hatten ihm gefehlt, und es hatte ihm gefehlt, gehen zu können, wohin er wollte, aber es hatte ihn nicht gestört, jeden Abend eingeschlossen zu werden, er hatte es genossen, so viel Zeit für sich zu haben. Es geschah nichts Unvorhersehbares, und das machte ihn zufrieden; die anderen Häftlinge wussten, dass sie ihm besser nicht zu nahe kommen sollten. Er verabscheute das Essen, aber er achtete nicht darauf, und er verabscheute die Schließer, aber auch sie wussten, dass sie sich vor ihm in acht nehmen mussten. Wenn seine Frau ihn einmal die Woche besuchte, hütete er sich, irgend etwas zu verraten, irgendwelche Emotionen zu zeigen, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie einsam und isoliert er manchmal war. Statt dessen sprachen sie darüber, was sein würde, wenn er wieder herauskäme, während sie ihm langsam den Finger in den Mund schob, einen Finger, den sie gerade in sich hineingesteckt hatte, so dass er ihren Geruch in sich aufnehmen und bei sich behalten konnte, und dann ließ er sie von den Nachbarn und ihrer Familie erzählen, während sie den Finger wieder für ihn auffrischte. Er berührte ihre Hand, damit der Geruch für den Rest des Tages bei ihm blieb.
Am häufigsten musste er an seine ersten Tage in Lanfad denken. Vielleicht deswegen, weil es im Landesinneren lag und er bis dahin nie außerhalb der Stadt gewesen war. Er war wie erschlagen von dem Haus, von seiner Kälte und Unfreundlichkeit und von der Tatsache, dass er drei oder vier Jahre würde dort bleiben müssen. Er hatte sich keinerlei Gefühle gestattet. Er weinte nie, und wenn er traurig war, zwang er sich, eine Zeitlang an nichts zu denken; er tat so, als wäre er nirgendwo. So bewältigte er seine Jahre in Lanfad.
Während seines ganzen Aufenthalts wurde er nur ein einziges Mal geschlagen, und das war, als alle Jungen im Schlafsaal einzeln nach draußen geholt und mit einem Riemen auf die Hände geschlagen wurden. Gewöhnlich aber ließ man ihn in Ruhe; wenn er wusste, dass die Gefahr bestand, erwischt zu werden, hielt er sich an die Regeln. Er begriff, dass es leicht war, sich in Sommernächten hinauszuschleichen, solange man wartete, bis alles ruhig war und wenn man den richtigen Begleiter aussuchte und sich nicht zu weit entfernte. Er lernte, wie er die Küche plündern konnte, und achtete darauf, dass das nicht zu oft vorkam, für den Fall, dass sie ihm eine Falle stellten. Wie er jetzt auf dem Sofa lag und darüber nachdachte, ging ihm auf, dass es ihm gefallen hatte, allein zu sein, sich von den anderen fernzuhalten, niemals derjenige zu sein, der dabei erwischt wurde, wie er von Bett zu Bett sprang oder sich prügelte, wenn der aufsichtführende Bruder hereinkam.
In einer seiner ersten Nächte dort gab es im Schlafsaal eine Prügelei. Er hörte, wie es anfing, und dann etwas wie: »Sag das noch mal, und ich mach dich platt.« Dann folgten anfeuernde Rufe. Es war also offensichtlich eine Prügelei im Gange; bei so viel Energie im Schlafsaal musste einfach etwas los sein. Es war zwar dunkel, aber man konnte Silhouetten und Bewegungen ausmachen. Und er hörte das Gekeuche und wie Betten zurückgeschoben wurden und dann das Geschrei von allen Seiten. Er rührte sich nicht. Bald würde es zu seinem Stil werden, sich nicht zu rühren, aber in diesem frühen Stadium hatte er noch keinen Stil entwickelt. Er war zu unsicher, um etwas zu tun. Deswegen brauchte er, als das Licht anging und einer der älteren Brüder, Bruder Walsh, hereinkam, nicht wie die anderen in sein Bett zurückzuflitzen, aber trotzdem hatte er Angst, als der Bruder mit langen Schritten bedrohlich im Schlafsaal umherging. Jetzt herrschte absolute Stille. Bruder Walsh sprach zu niemandem, aber er schritt die Betten ab und sah jeden einzelnen Jungen so an, als wollte er ihm gleich an die Kehle springen. Als der Bruder ihn ansah, wusste er nicht, was er tun sollte. Er erwiderte den Blick, wandte dann die Augen ab und sah dann wieder hin.
Schließlich sprach der Bruder.
»Wer hat angefangen? Wer angefangen hat, soll aufstehen.«
Keiner antwortete. Keiner stand auf.
»Ich werde mir wahllos zwei Jungen herausgreifen, und sie werden mir sagen, wer angefangen hat, und ob sie das tun werden, und es wird um so schlimmer für denjenigen sein, der angefangen hat, wenn er sich jetzt nicht meldet.«
Der Akzent klang merkwürdig. Er wusste beim besten Willen nicht, was er tun sollte, also tat er angestrengt so, als würde das alles gar nicht passieren. Er kannte keinen der Jungen mit Namen, und er hatte den, der die Prügelei angefangen hatte, nicht deutlich genug gesehen, um ihn jetzt identifizieren zu können. Außerdem wusste er nicht, wie die Regeln waren, ob die Jungen nicht vielleicht vereinbart hatten, dass niemand, unter keinen Umständen, je verpetzt werden durfte. Es war ihm ein Rätsel, wie es die anderen geschafft hatten, sich die Namen aller übrigen einzuprägen. Es kam ihm unmöglich vor. Während er darüber nachdachte, blickte er auf und sah, dass jetzt zwei Jungen neben ihrem Bett standen, die Augen zu Boden geschlagen. Bei einem von beiden war das Oberteil des Pyjamas zerrissen.
»Schön«, sagte Bruder Walsh. »Ihr zwei kommt jetzt mit.«
Der Bruder ging zur Tür und schaltete das Licht aus, und zurück blieb vollkommene Stille. Keiner flüsterte auch nur. Er lag da und lauschte. Die ersten Geräusche waren schwach, aber bald hörte er einen Schrei und ein Wimmern und dann das unverkennbare Geräusch eines Riemens und dann nichts und dann ein Schmerzensgeheul. Er fragte sich, wo sich das Ganze abspielte, er meinte, es müsste auf dem Korridor draußen vor dem Schlafsaal sein oder im Treppenhaus. Dann nahmen die Schläge, von ständigem Stöhnen und Gebrüll begleitet, einen regelmäßigen Rhythmus an. Und bald kamen Stimmen hinzu, die immer und immer wieder »Nein!« riefen.
Im Schlafsaal rührte sich niemand; keiner gab einen Ton von sich. Es hörte nicht auf. Als die zwei Jungen endlich die Tür öffneten und versuchten, im Dunkeln zu ihren Betten zurückzufinden, wurde die Stille sogar noch tiefer. Während die beiden in ihren Betten weinten und schluchzten, gaben die übrigen Jungen keinen Ton von sich. Er wünschte, er wüsste die Namen der Jungen, die bestraft worden waren, und fragte sich, ob er sie am nächsten Morgen erkennen würde, ob sie wegen dem, was passiert war, anders aussehen würden.
In den folgenden Monaten erschien es ihm unglaublich, wie schnell die Jungen vergessen konnten, was in jener Nacht passiert war, und jegliche Vorsicht fahrenließen. Regelmäßig brachen im dunklen Schlafsaal Prügeleien aus; die Jungen schrien und sprangen aus dem Bett und setzten sich damit der Gefahr aus, erwischt zu werden, wenn das Licht anging und Bruder Walsh oder irgendein anderer Bruder oder auch manchmal zwei Brüder zusammen dastanden und zusahen, wie alle wieder ins Bett huschten. Und jedesmal wurden die Hauptschuldigen gezwungen zu gestehen und anschließend mit nach draußen genommen und bestraft.
Langsam wurden die Brüder auf ihn aufmerksam; sie erkannten, dass er nicht so wie die anderen war, und nach und nach begannen sie, ihm zu vertrauen. Er vertraute ihnen allerdings nie, und ebensowenig ließ er zu, dass eine zu große Nähe zwischen einem von ihnen und ihm entstand. Statt dessen lernte er die Kunst, beschäftigt auszusehen und respektvoll zu wirken. Während seiner Zeit in Lanfad hatte er nie einen Freund, ließ er nie jemanden nah an sich herankommen. Am Anfang, als er Schwierigkeiten mit Markey Woods hatte, einem Typ, der älter und kräftiger als er war, musste er sich überlegen, wie er mit ihm verfahren sollte.
Es war immer einfach, einen Begleiter zu finden, jemanden, der bereit war, für einen zu arbeiten, wenn man ihm Schutz und Aufmerksamkeit bot. Er fand einen drahtigen Burschen namens Webster, aber er verriet Webster nicht, was er vorhatte. Er sagte ihm, er sollte Markey erzählen, im Moor wären Zigaretten versteckt, zwar ziemlich weit vom Schulgebäude entfernt, aber noch auf dem Gelände. Wie erwartet, drohte Markey Webster, wenn er ihn nicht zum Versteck führte, würde er ihn zusammenschlagen. Und so war er irgendwann zusammen mit Markey und Webster unterwegs zur fernen äußersten Grenze des Lanfad-Gutes. Er hatte Webster instruiert, sich auf ein verabredetes Zeichen hin auf Markey zu stürzen, ihn einfach zu Boden zu schlagen. Er hatte an einem Seil, das er aus der Werkstatt gestohlen hatte, mit Knoten experimentiert, und so wusste er, wie er Markeys Beine schnell fesseln und dann das Seil zu seinen Händen hochziehen und auch die fesseln konnte. Das würde zwar schwieriger werden, aber mit gefesselten Beinen konnte Markey sich wehren, soviel er wollte, er würde keine Chance haben.
Das alles nahm in der Praxis mehr Zeit in Anspruch, als er sich vorgestellt hatte, denn Markey versetzte Webster einen Schlag nach dem anderen, bis dieser ängstlich wurde und fast nicht mehr zu gebrauchen war. Endlich drückte er Markey zu Boden und schaffte es, das Seil um ein Handgelenk zu knoten, und riss dabei so fest daran, dass er ihm fast den Arm brach, drehte ihn dann auf den Bauch, so dass er beide Handgelenke zusammenbinden konnte. Er hatte sich überlegt, dass es keinen Sinn hatte, Markey zusammenzuschlagen. Das hätte ihn völlig kaltgelassen. Aus diesem Grund hatte er eine Augenbinde sowie eine kleine Zange mitgebracht, die er ebenfalls in der Werkstatt gefunden hatte. Sobald er Markeys Augen verbunden hatte, drehte er ihn auf den Rücken und befahl Webster, ihm in die Rippen zu treten, und während Webster dies mit großem Vergnügen tat, brüllte Markey ihm mit weit aufgerissenem Mund Drohungen zu.
Er musterte kurz Markeys Mund, während dieser weiterbrüllte, und dann stieß er rasch mit der Zange zu und packte damit einen von Markeys oberen linken Backenzähnen. Entgeistert klappte Markey zwar augenblicklich den Mund zu, aber die Zange ließ nicht locker.
Er begann, am Zahn zu ruckeln und zu zerren, inzwischen besorgt wegen des Lärms, des hysterischen Geschreis, das Markey veranstaltete. Er wusste, dass die Zange einen einzelnen Zahn gepackt hatte, und deswegen begriff er nicht, warum es so lange dauerte, ihn zu lockern und herauszuziehen. Bei seinem einzigen Zahnarztbesuch — in dessen Verlauf er erkannt hatte, wie einfach und wirkungsvoll das sein würde — war der Zahn sehr schnell draußen gewesen.
Plötzlich hörte er auf, Druck auf die Zange auszuüben, und anstatt weiter zu versuchen, den Zahn zu lockern, ruckte er einmal hin und her und zog dann mit aller Kraft zurück. Markey heulte auf. Es war erledigt. Der Zahn war draußen. Als Webster kam, um ihn sich anzusehen, war er fast so blass wie Markey.
Er nahm Markey die Augenbinde ab und zeigte ihm den Zahn. Er wusste, dass es jetzt wichtig war, Markey nicht zu schnell weglaufen zu lassen, seine Fesseln noch nicht zu lösen und ihn ein Weilchen bluten zu lassen, während er sich ganz ruhig mit ihm unterhielt, ihm klarmachte, dass er, sollte irgend jemand in der Schule ihn oder Webster jemals wieder anrühren, ihm einen weiteren Zahn ziehen würde, und noch einen und noch einen, bis Markey nur noch Zahnfleisch übrig hätte. Sollte aber, erklärte er Markey, einer der Brüder jemals etwas von der Sache erfahren, dann würde er keine Zähne ziehen, dann würde er sich Markeys Dödel vornehmen. Hatte er das verstanden? Er führte die Zange nach unten, zwischen Markeys Beine, und kniff sie um seinen Penis zusammen. Er sprach sanft auf den schluchzenden Markey ein. Hast du das verstanden, fragte er. Markey nickte. Ich kann dich nicht hören, sagte er. Ja, sagte Markey, ja, ich hab verstanden. Er nahm die Zange weg, band Markey los und zwang ihn, zusammen mit ihnen zur Schule zurückzukehren, als wären sie die besten Freunde.
Von da an hatten die anderen Jungen in Lanfad große Angst vor ihm. Bald fühlte er sich unantastbar. Wenn er wollte, konnte er Prügeleien beenden oder für jemanden, der schikaniert wurde, Partei ergreifen, oder sich einen Jungen eine Zeitlang als Gefolgsmann halten. Aber es war stets klar, dass ihm das alles nichts bedeutete, dass er jederzeit bereit sein würde, wegzugehen, jemanden fallenzulassen, einschließlich Webster, dem er drohen musste, damit er aufhörte, sein Freund zu sein.
Die Brüder erlaubten ihm, draußen im Moor zu arbeiten, und er liebte das, die Stille, die bedächtige Arbeit, die weite, leere Ebene bis zum Horizont. Und am Ende des Tages müde zurückzukehren. Dann, in seinem letzten Jahr, erlaubten sie ihm, im Heizungskeller zu arbeiten, und eben während er dort arbeitete — es musste im Winter seines letzten Jahres gewesen sein —, ging ihm etwas auf, was er bis dahin nicht gewusst hatte.
Es gab keine Mauern rund um Lanfad, aber es war allgemein bekannt, dass jeder, der sich über einen bestimmten Punkt hinauswagte, bestraft werden würde. Jeden Frühling, wenn die Abende länger wurden, versuchten Jungen zu fliehen, sich zur Hauptstraße durchzuschlagen, aber sie wurden immer gefasst und zurückgebracht. In allen Bauernhäusern in der Umgebung schienen Wachposten an den Fenstern zu stehen und nach Ausreißern Ausschau zu halten, um sie den Brüdern zu melden. Einmal, in seinem ersten Jahr, waren zwei solche Jungen vor der ganzen Schule bestraft worden, aber das schien andere, die ebenfalls fliehen wollten, nicht abzuschrecken. Wenn überhaupt, so spornte es sie noch mehr an. Es fiel ihm schwer zu begreifen, wie jemand ohne jeden Plan fliehen konnte, ohne eine klare Vorstellung davon, wie er unbemerkt nach Dublin und vielleicht dann weiter nach England gelangen könnte.
In jenem letzten Winter hatten zwei Jungen, die ein, zwei Jahre älter als er waren, die Nase voll gehabt. Sie bekamen fast jeden Tag Ärger und schienen sich vor nichts zu fürchten. Er erinnerte sich an sie, weil er einmal mit ihnen über eine mögliche Flucht gesprochen hatte, was er tun und wohin er gehen würde. Das Gespräch hatte angefangen, ihn zu interessieren, weil sie sagten, sie wüssten, wo sie sich Fahrräder beschaffen könnten, und er davon überzeugt war, das sei die einzige Möglichkeit zu entkommen: um Mitternacht oder ein Uhr früh aufzubrechen und bis zur Fähre zu radeln. Ohne nachzudenken, hatte er hinzugefügt, bevor er aufbräche, würde er gern ein, zwei Brüder in den lodernden Heizkessel stecken. Das wäre leicht zu bewerkstelligen, sagte er, wenn man noch zwei Jungs dabeihätte und den Bruder knebelte und sich mit der Sache beeilte. Das Feuer war so heiß, sagte er, dass keine Spur von ihnen zurückbleiben würde. Sie würden in Rauch aufgehen. Mit ein bisschen Glück könnte man vier oder fünf von ihnen in die Brennkammer hineinstopfen. Kein Mensch würde etwas merken. Man könnte mit einem der tatterigen Alten anfangen. Er sagte das in dem gleichen distanzierten, nüchternen Ton, in dem er alles sagte. Er bemerkte, dass die zwei Jungen ihn unbehaglich ansahen, und begriff, dass er zuviel gesagt hatte. Als er abrupt aufstand und ging, begriff er, dass er das ebenfalls nicht hätte tun sollen. Er bedauerte, überhaupt mit ihnen gesprochen zu haben.
Am Ende flohen die zwei Jungen ohne Fahrräder und ohne einen Plan, und sie wurden wieder eingefangen. Er hörte davon, als er dabei war, einen Eimer Torf in das Refektorium der Brüder zu tragen. Bruder Lawrence hielt ihn an und erzählte es ihm. Er nickte und ging weiter. Beim Abendessen stellte er fest, dass die Jungen noch immer nicht da waren. Er vermutete, dass man sie irgendwo eingesperrt hatte. Nach dem Abendessen ging er wie gewohnt hinunter in den Heizungskeller.
Eine Weile später, als er, kurz bevor das Licht ausgemacht wurde, über den Hof ging, um noch mehr Torf zu holen, hörte er ein Geräusch. Er wusste sofort, was es war: Jemand wurde geschlagen und schrie. Anfangs konnte er nicht ausmachen, woher es kam, aber dann erkannte er, dass sich die Sache im Freizeitraum abspielte. Er sah, dass das Licht an war, aber die Fenster waren zu hoch für ihn. Verstohlen ging er zurück in den Heizungsraum und holte sich einen Hocker; den stellte er unter das Fenster. Als er hineinspähte, sah er, dass die Jungen, die zu fliehen versucht hatten, bäuchlings, mit heruntergezogenen Hosen, auf einem alten Tisch lagen und dass Bruder Fogarty mit einem Riemen auf ihr Gesäß einschlug. Bruder Walsh stand neben dem Tisch und hielt denjenigen, der gerade geschlagen wurde, mit beiden Händen fest.
Wie er diese Szene betrachtete, fiel ihm plötzlich etwas anderes auf. An der Rückwand des Freizeitraums befand sich eine alte Sicherungskammer. Sie wurde als Abstellraum verwendet. Jetzt standen zwei Brüder darin, und die Tür war offen, so dass sie ungehindert auf die zwei Jungen blicken konnten, die gerade bestraft wurden. Er konnte sie vom Fenster aus sehen — Bruder Lawrence und Bruder Murphy —, und ihm war klar, dass sich die zwei Brüder, die die Strafe vollstreckten, ebenfalls ihrer Anwesenheit bewusst sein mussten, aber vielleicht nicht sehen konnten, was sie gerade taten.
Sie masturbierten. Sie wandten kein Auge von der Szene, die sich vor ihnen abspielte — von dem Jungen, der bestraft wurde und jedesmal aufschrie, wenn der Riemen ihn traf. Er erinnerte sich nicht, wie lang er ihnen dabei zusah. Bis dahin hatte er es verabscheut, wenn Mitzöglinge bestraft wurden. Er hatte es verabscheut, sich inmitten des allgemeinen Schweigens und der Angst so ohnmächtig zu fühlen. Aber er war fast zu dem Glauben gelangt, diese Bestrafungen wären notwendig, Teil einer naturgegebenen Ordnung, für deren Aufrechterhaltung die Brüder verantwortlich waren. Jetzt wusste er, dass dabei noch etwas anderes im Spiel war, etwas, was er nicht begriff und über das nachzudenken er einfach nicht über sich brachte. Das Bild war ihm wie eine fotografische Aufnahme im Kopf geblieben: Die zwei Brüder in der Sicherungskammer sahen nicht wie für irgend etwas verantwortliche Männer aus, sie sahen eher wie hechelnde alte Hunde aus.
Er lag auf dem Sofa und wusste, dass er all das nur Revue passieren ließ, um nicht über die Gemälde nachdenken zu müssen. Er stand auf und streckte und kratzte sich, und dann ging er wieder hinaus auf den Balkon. Er hatte das Gefühl, dass ihm etwas Unfassbares ein Zeichen gab; er wollte an gar nichts denken, aber er hatte Angst. Soviel wusste er: Wenn er den Raub allein begangen hätte, dann würde er die Gemälde einfach wegwerfen, sie verbrennen, sie am Straßenrand liegenlassen. Als er endlich aus Lanfad entlassen wurde, nahm er das Gefühl mit, dass hinter allem etwas anderes lag, ein verborgenes Motiv vielleicht oder etwas Unvorstellbares und Finsteres — dass der Mensch, den man vor sich sah, lediglich ein Deckmantel für einen anderen Menschen, dass etwas Ausgesprochenes lediglich ein Code für etwas anderes war. Es gab immer Schichten und darunter noch weitere, verborgene Schichten, auf die man durch Zufall stoßen konnte oder die, je genauer man hinsah, desto deutlicher werden würden.
Irgendwo in der Stadt oder in irgendeiner anderen Stadt gab es jemanden, der wusste, wie man es anfing, diese Gemälde abzustoßen, das Geld einzustreichen und es aufzuteilen. Wenn er nur gründlich genug darüber nachdachte, wenn er sich auf dem Sofa zurücklehnte und sich konzentrierte, würde er es dann auch wissen? Aber jedesmal, wenn er darüber nachsann, geriet er in eine Sackgasse. Er fragte sich, ob er zu den anderen, die an dem Raub beteiligt gewesen waren — und sie waren in jener Nacht so stolz auf sich gewesen, alles war reibungslos gelaufen —, gehen und ihnen das Problem erklären könnte. Aber er hatte bis dahin noch nie irgend jemandem etwas erklärt. Die Leute würden sagen, dass er allmählich Schwäche zeigte. Und außerdem — wenn er diese Nuss nicht knacken konnte, würden sie es erst recht nicht schaffen. Sie taugten nur dazu, das zu tun, was man ihnen sagte.
Er musterte die unbebaute Fläche vor dem Apartmenthaus. Es war immer noch niemand zu sehen. Er fragte sich, ob die Bullen zu dem Schluss gekommen waren, dass sie ihn nicht zu beobachten brauchten, dass er jetzt schon von sich aus, ohne Ermutigung ihrerseits, anfangen würde, Fehler zu machen. Aber das war nicht ihre Art zu denken. Wenn er einen Bullen sah oder einen Anwalt oder einen Richter, sah er die Brüder von Lanfad, jemanden, der seine Autorität liebte, der es genoss, sie auszuüben, seine Macht auf eine Weise hervorzukehren, die verborgene schimpfliche Elemente nur notdürftig verhüllte. Er ging zurück in die Wohnung und an die Küchenspüle, drehte den Hahn auf und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht.
Vielleicht, dachte er, war alles viel einfacher, als er es sich vorstellte. Diese Holländer würden kommen, er würde ihnen die Gemälde zeigen, sie würden sich zur Zahlung bereit erklären, er würde sie dorthin fahren, wo sie das Geld gelassen hatten. Und dann? Warum ihnen nicht einfach das Geld abnehmen und die ganze Sache mit den Bildern vergessen? Aber an diese Möglichkeit hatten die Holländer mit Sicherheit auch gedacht. Vielleicht würden sie ihm drohen und ihm klarmachen, dass sie ihn, sollte er sich nicht an die Abmachungen halten, erschießen lassen würden. Nichtsdestoweniger fürchtete er sich nicht vor ihnen.
Er war sich nicht schlüssig, ob die Holländer eine Falle waren. Er setzte sich hin und erkannte, dass er jetzt alles getan hätte, um fruchtloses Grübeln zu vermeiden. Er vertraute niemandem. Dieser Gedanke gab ihm Kraft, und bald war er schon fast stolz darauf, dass er niemanden liebte — vielleicht war »lieben« nicht das richtige Wort, aber dass er nicht das Bedürfnis verspürte, wen auch immer zu beschützen. Abgesehen, dachte er, von seiner Tochter Lorraine, die jetzt zwei war. Alles an ihr war schön, und er freute sich darauf, sie am nächsten Morgen zu wecken und festzustellen, dass sie schon wach war und darauf gewartet hatte, dass er kam und sie in die Arme nahm. Er mochte es, wenn sie oben in ihrem Zimmer lag und schlief. Er wollte, dass sie glücklich und geborgen war. Seinen anderen Kindern gegenüber empfand er nicht so. Wohl hatte er gegenüber seinem jüngeren Bruder Billy so empfunden, aber Billy war bei einem Raubüberfall ums Leben gekommen, war mit einem Messer verletzt worden und, allein zurückgelassen, verblutet. Also empfand er Billy gegenüber, dachte er, nicht mehr allzuviel, er wusste, wie er sich davon abhalten konnte, an ihn zu denken.
Wenn er bloß diese Gemälde loswerden könnte, dachte er, wäre alles in Ordnung. Dann könnte er sein normales Leben wiederaufnehmen. Vielleicht sollte er es mit diesen Holländern ja doch riskieren, sich überlegen, wie er von ihnen das Geld im Austausch gegen die Gemälde bekommen konnte, ohne sich weiter den Kopf zu zerbrechen. Aber das durfte er nicht, dachte er. Er musste äußerst vorsichtig sein.
Er trank nicht, und er mochte Bars nicht, aber das Hotel, in dem Mousey auf seine Anweisung hin die Holländer untergebracht hatte, besaß eine ruhige Bar und einen bequemen Nebeneingang ganz in der Nähe des Parkplatzes. Trotzdem fühlte er sich nicht sicher, als er eine auffällig gekleidete Amerikanerin am Tresen sitzen und sich einen Drink bestellen sah, und einen Moment lang fragte er sich, ob sie wohl eine Polizistin war. Ihre Blicke streiften sich, und er sah so schnell wie möglich weg. Vom Standpunkt der Polizei aus betrachtet, dachte er, wäre es nicht unklug gewesen, eine wie eine Amerikanerin gekleidete Frau in die Bar zu schicken. Und aus Mousey Furlongs Sicht wäre es ebenfalls nicht unklug gewesen, einen Deal mit der Polizei zu machen und damit einen ersten Schritt in Richtung Rehabilitation zu unternehmen. Bald, dachte er, würde Mouseys Frau mit seinem ganzen Heroingeld eine Kinderkrippe oder eine schicke Wein- und Spirituosenhandlung aufmachen, und wenn es auf Weihnachten zuging, würden sie Spenden für wohltätige Zwecke sammeln. Andererseits konnte die Amerikanerin auch einfach eine Touristin und Mousey mehr oder weniger noch der alte sein.
Als die zwei Holländer kamen, erkannte er sie auf den ersten Blick. Er hatte Irland sein Leben lang nicht verlassen und war seines Wissens noch nie einem Holländer begegnet. Aber diese beiden, dachte er, waren Holländer, sie sahen einfach holländisch aus. Sie hätten nichts anderes sein können. Er nickte ihnen zu. Sie würden ihn ebenfalls erkennen, nahm er an.
Er schrieb »Bleiben Sie hier« auf ein Stück Papier und reichte es dem Dünneren, sobald der sich gesetzt hatte. Er legte sich den Finger an die Lippen. Dann ging er hinaus auf den Parkplatz und setzte sich in seinen Wagen. Das würde den beiden, Holländer oder nicht, vermutlich Stoff zum Nachdenken geben. Der Parkplatz war leer. Er hielt Ausschau nach irgendeiner Bewegung, aber niemand ließ sich blicken, kein Auto fuhr vor. Er würde noch eine Weile hier warten, nachdem er beschlossen hatte, der Versuchung zu widerstehen, zum Vordereingang des Hotels zu gehen und sich in der Lobby umzusehen. Er wusste, dass es wichtig war, ruhig zu bleiben, in Deckung zu bleiben, nur gerade eben die notwendigsten Schachzüge zu unternehmen. Er spielte kein Schach, aber er hatte einmal ein Spiel im Fernsehen gesehen, und es hatte ihm gefallen, wie langsam, bedächtig und berechnend die Spieler vorgegangen waren.
Als er wieder hereinkam, tranken die beiden Kaffee. Er wartete, bis der Barkeeper außer Sichtweite war, und schrieb dann auf einen Zettel: »Ist das Geld in Irland?« Einer der beiden nickte. »Also?« schrieb er. »Wir müssen sehen«, lautete die Antwort. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Barkeeper außer Hörweite war, sagte er mit hörbarer Stimme: »Sie müssen die Bilder sehen, ich muss das Geld sehen.«
Er versuchte, gefährlich auszusehen und so, als hätte er alles im Griff, und fragte sich, ob die Holländer so etwas anders machten. Vielleicht, dachte er, galt eine Brille tragen und mager sein und Kaffee trinken in Holland ja schon als knallhart. Auf jeden Fall sahen sie wie Profis aus. Er bedeutete ihnen, ihm hinaus auf den Parkplatz zu folgen. Er fuhr zuerst zur North Circular Road und dann die Prussia Street entlang hinunter zum Hafen. Er überquerte den Fluss und fuhr weiter nach Crumlin. Niemand im Wagen sprach ein Wort. Er hoffte, dass seine zwei Fahrgäste nicht wussten, in welchem Teil der Stadt sie waren.
Er bog in eine Nebenstraße und dann in eine Gasse ein und fuhr schließlich in eine Garage, deren Tor offengelassen worden war. Er stieg aus dem Wagen aus und zog das Schwingtor der Garage herunter. Jetzt waren sie im Dunkeln. Als er einen Schalter gefunden und Licht gemacht hatte, gab er den Holländern ein Zeichen, im Wagen zu bleiben. Er trat durch eine Tür hinaus in einen kleinen Garten und klopfte an ein Küchenfenster. Drinnen saßen drei oder vier Kinder an einem Tisch, eine Frau stand an einer Spüle; der Mann, der neben ihr stand, drehte sich um und sagte etwas. Es war Joe O’Brien. Die Kinder standen auf, nahmen ihre Teller und Tassen und verließen das Zimmer, ohne zum Fenster zu sehen. Joe hatte sie offenbar gut abgerichtet. Bald darauf sammelte auch die Frau ihre Sachen ein und verließ die Küche.
Joe O’Brien öffnete die Tür und kam in den Garten, ohne ein Wort zu sagen. Sie gingen hinüber zur Garage und sahen durch ein kleines, schmutziges Fenster zu den Holländern hinüber. Die zwei Männer saßen regungslos auf der Kühlerhaube des Wagens.
Er nickte Joe O’Brien zu, der daraufhin in die Garage ging und den zwei Holländern bedeutete, ihm zu folgen. Sie gingen hinaus auf die Gasse und durch die nächste Tür in den Garten des Nachbarhauses. Als Joe ans Fenster klopfte, stand ein alter Mann, der am Küchentisch gesessen und den Evening Herald gelesen hatte, auf und ließ sie ins Haus. Dann kehrte er sofort wieder zu seiner Lektüre zurück. Sie schlossen die Tür und gingen an ihm vorbei und die Treppe hinauf zum hinteren Schlafzimmer.
Er wusste nicht, ob der unbehagliche Gesichtsausdruck der Holländer ein wesenhaftes Merkmal von ihnen war, oder ob sie gerade jetzt unbehaglich dreinsahen und er somit etwas Ungewöhnliches darstellte. Sie spähten in das obere Schlafzimmer, als wäre ihnen ein Blick in die Tiefen des Weltraums gewährt worden. Er war versucht zu fragen, ob sie noch nie ein Schlafzimmer gesehen hätten, während Joe eine Leiter in die kleine Öffnung in der Zimmerdecke schob, die in den Dachboden führte, hinaufkletterte und mit zwei Gemälden wieder herunterkam — dem Gainsborough und einem der Guardis. Die zwei Holländer betrachteten die Gemälde konzentriert. Keiner sprach ein Wort.
Einer der beiden holte ein Notizheft heraus und schrieb: »Wo ist der Rembrandt?«
Er nahm ihm das Notizheft unwirsch aus der Hand und schrieb: »Bezahlen Sie für diese zwei. Wenn alles glattgeht, bekommen Sie morgen den Rembrandt.« Der Holländer nahm das Notizheft wieder an sich und schrieb: »Wir sind wegen des Rembrandts hier.« Sofort, noch während der Holländer das Notizheft in der Hand hielt, schrieb er: »Sind Sie taub?« Beide Holländer lasen die Frage aufmerksam, als könnte sie eine tiefe, verborgene Bedeutung enthalten, runzelten gleichzeitig die Stirn und machten dazu ein gekränktes und verdutztes Gesicht.
Er nahm das Notizheft und schrieb: »Das Geld?« Als er es dem Holländer zurückgab, fiel ihm auf, dass dieser die nächste Mitteilung in weit klarerer Handschrift schrieb: »Wir müssen den Rembrandt sehen.« Er riss ihm das Notizheft aus der Hand und schrieb rasch, fast unleserlich: »Kaufen Sie zuerst diese Bilder.« Jetzt nahm der andere Holländer das Notizheft an sich. »Wir sind hierhergekommen, um den Rembrandt zu sehen«, schrieb er in einer kindlichen Schrift. »Da es keinen Rembrandt gibt, müssen wir weitere Instruktionen einholen. Wir melden uns bald wieder, durch Mousey.«
Plötzlich begriff er, dass diese zwei Männer die vereinbarten Regeln ernst nahmen. Er hatte sich bereit erklärt, ihnen den Rembrandt zu zeigen, und jetzt hatte er die Vereinbarung nicht eingehalten. Er hatte es aus Vorsicht getan. Er würde nicht weich werden oder seine Taktik überdenken, aber er würde langsam vorgehen und so wenig wie möglich riskieren. Jetzt wussten sie, dass er im Besitz der anderen Gemälde aus dem Bruch war, und er nahm an, dass sie nicht von den Bullen beschattet wurden, obwohl er, was das anbelangte, sich nie ganz sicher sein konnte. Auch wenn sie durch ihr mürrisches Verhalten zu verstehen gaben, dass das Geschäft auf der Kippe stand, war er sicher, schon deshalb, weil Joe O’Brien ihn die ganze Zeit beobachtete, sich richtig verhalten zu haben. Er verspürte den Drang, sich einen der Typen zu schnappen, ihn zu fesseln und dem anderen zu sagen, er sollte das Geld holen, oder er würde seinen Kumpel töten, aber er hatte den Verdacht, dass die zwei Holländer diese Eventualität sowie viele weitere Möglichkeiten dieser Art berücksichtigt hatten. Sie handelten zwar nicht impulsiv, aber er hatte das Gefühl, dass sie, sollte er sich für diese Vorgehensweise entscheiden, durchaus wissen würden, was zu tun war. Es war ein Fehler, dachte er, mit Ausländern Geschäfte zu machen, aber es gab niemanden in Irland, der das Geld oder die Neigung gehabt hätte, für ein paar Bilder zehn Millionen zu bezahlen.
Als sie durch das Haus zurückgingen und dabei in der Küche an dem Besitzer vorbeikamen, blieben beide Männer gelassen. Und ebendiese Gelassenheit beunruhigte ihn, hemmte ihn, machte ihn nachdenklich. Und dann machte sie ihn unfähig nachzudenken. Er wurde aus diesen zwei Männern einfach nicht klug. Es war kaum vorstellbar, dass sie je im Gefängnis gesessen hatten, es sei denn, holländische Gefängnisse boten Kurse in Hautpflege und undurchschaubarem Verhalten an. Wer immer sie geschickt hatte, sagte er sich, hatte sie nicht nur wegen ihrer Gelassenheit ausgesucht — hinter der sich, wie er überzeugt war, echte Härte verbergen musste —, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, einen echten Rembrandt von einer Fälschung zu unterscheiden. Vielleicht war das alles, was sie konnten, dachte er, und sie würden den Rest echten Kriminellen überlassen. Vielleicht waren sie überhaupt Kunstprofessoren, sie sahen wirklich so aus wie manche der Männer, die sich im Fernsehen darüber ausließen, welchen Wert die gestohlenen Gemälde für die Menschheit darstellten.
Er wollte die Holländer nicht ohne eine weitere Zusicherung oder Verlockung ziehen lassen. Er bedeutete ihnen durch Gesten, dass Joe O’Brien sie zu ihrem Hotel zurückfahren würde, und dann ließ er sich das Notizheft geben und schrieb: »Heute in acht Tagen habe ich das Bild hier.« Einer der Männer schrieb zurück: »Wir müssen Instruktionen einholen.« Er nickte, zu Joe O’Brien gewandt, und warf ihm die Wagenschlüssel zu.
Jetzt fragte er sich, ob er nicht Joe beauftragen sollte, die zwei anderen Komplizen bei dem Raubüberfall einzuschüchtern, ihnen zu sagen, dass man sie nicht betrog oder etwas in der Art, ihnen aber auch zu sagen, dass sie ihre Hoffnungen auf schnelles Geld besser zurückschrauben sollten, und ihnen klarzumachen, dass auf etwaige Fragen oder gar Forderungen nach Geld schnell reagiert werden würde.
Joe O’Brien war der einzige Mann, mit dem er je gearbeitet hatte, der immer genau das tat, was man ihm sagte, der nie Fragen stellte, nie Zweifel äußerte, nie zu spät kam. Er kannte sich außerdem mit Dingen wie Elektroanlagen und Schlössern, Sprengstoffen und Automotoren aus. Als er den Anwalt Kevin McMahon hatte in die Luft jagen, in die ewigen Jagdgründe befördern wollen, war Joe O’Brien der einzige gewesen, an den er sich deswegen gewandt hatte.