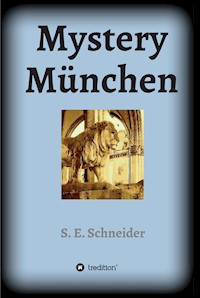
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
München als Fixpunkt in einem Roman, der nicht nur unterhält, sondern sich auch mit den Daseinsfragen unserer Zeit beschäftigt. In die mystische Welt dieser Stadt, in der Panleos im Geheimen wirken, entführt dieser Roman den Leser. Er begleitet aber auch den Münchner Redakteur Christopher, der sich aus dem hektischen Alltag zurückzieht, um endlich frei zu sein für die Dinge, die ihm wichtig sind. Dabei verfängt sich Christopher im Labyrinth seiner eigenen Ansprüche und als ihm eine ungewöhnliche, faszinierende Frau begegnet, gerät sein Weltbild ins Wanken. S.E. Schneider legt mit dem neuen Roman eine überraschende Geschichte zweier Welten vor, die als Hommage an das Leben verstanden werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
© 2021 S. E. Schneider
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage
Umschlaggestaltung, Fotomotiv: S. E. Schneider
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Paperback
ISBN: 978-3-347-35923-9
Hardcover
ISBN: 978-3-347-35924-6
E-Book
ISBN: 978-3-347-35925-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
“Es ist das Leben, das die unwahrscheinlichsten Zustände anstrebt.”
Antoine de Saint-Exupéry
MYSTERY MÜNCHEN
S. E. Schneider
PROLOG
»Wir können mit der Chippung verändern, was ihr wollt, Zettan«, raunte der Wissenschaftler dem Alphaparder zu, während er sich streckte, um dem Kopf Zettans näher zu sein. Da er es nur bis auf dessen Brusthöhe schaffte, hob er die Stimme: »Rein hypothetisch fungiert der Gechippte dann als selbstständige, sich ständig modifizierende Reparaturzelle.«
Der Alphaparder seufzte und winkte ab. Sein Blick glitt über die mondbeschienene, unendlich scheinende Ebene vor der Aussichtsplattform. Die golden befellten Arme vor der muskulösen Brust verschränkt, spürte er den bewundernden Blick des anderen auf sich.
Ja, sie, die Panleos waren herrliche Geschöpfe aus beiden Welten. Und doch, was bedeutete die äußere Form schon, gemessen an der Verantwortung, die sie – vor allem er, als Anführer – zu tragen hatten. Es ging nicht nur darum, zu verhindern, dass die Anderwelt weiter Schaden nahm. Am schlimmsten war, dass deren Bewohner nicht wussten, was sie, über ihre eigene Vernichtung hinaus, tatsächlich anrichteten.
Ein vorsichtiges Räuspern des Wissenschaftlers ließ Zettan das Gespräch fortführen. »Nun, Professor, bisher haben wir bei der Chippung meist nur die Struktur einzelner Organe verändert.«
»Wir könnten aber viel, viel mehr, großer Zettan. Wenn ihr zustimmt, lässt sich das Genom so verändern, dass eine Weitergabe aller gewünschten Modifizierungen per Vererbung erfolgt.«
Sekundenlang herrschte spannungsgeladene Stille. Dann kam das donnernde »NEIN« des Alphaparders so unvermittelt, dass der Professor zusammenzuckte.
Zettans Mähne flog, während er heftig den Kopf schüttelte. »Nein. Ich will nicht, dass wir Panleos diese Verantwortung übernehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt jemals machen sollten. Es wäre schließlich die unaufhaltsame Veränderung von Millionen. Das kann, das will ich nicht entscheiden. Zumindest nicht mit der anstehenden Chippung.« Er neigte sich zu ihm, der drohende Unterton ließ keinen Widerspruch gelten: »Ich möchte aber die Einzelfallchippung optimieren, wie besprochen. Habt ihr alles dafür vorbereitet?«
»Ja, natürlich, alles ist veranlasst nach euren Wünschen, der Spezialchip liegt bereit«, beeilte sich der Professor zu
sagen.
»Das heißt, dass das autonome Programm – mit unbeschränktem Zugriff auch auf die Software der vorausgegangenen Chippungen – das Beste für den Probanden aus dessen ureigensten Anlagen entwickeln wird.« Es war keine Frage, der Panleo hatte nur zu sich gesprochen.
Aus dem Gesicht des Wissenschaftlers entwich alle Farbe. »Aber ist der unbestimmbare Faktor einer einzelnen Persönlichkeit nicht doch ein viel zu hohes Risiko? Und das würdet ihr allein tragen?«, flüsterte er, während eine unbestimmte Angst in ihm hochkroch.
»Ein großes Wagnis ja und natürlich darf der so gechippte unsere Welt nie verlassen. Ich werde mir noch eine Sicherung überlegen.« Der Alphapanleo beugte sich zu dem Wissenschaftler hinab, um ihm in die Augen zu sehen.
»Fürs Erste aber ist wichtig, dass niemand, wirklich niemand, jemals davon erfahren wird. Das muss dir klar sein!«
Unter dem Blick der Raubtieraugen erstarrte der Professor. Außer Stande auch nur zu flüstern, antwortete er mit einem leichten, fast unmerklichen Nicken, während ihm schwarz wurde vor Augen und eine gnädige Ohnmacht ihm die vollständige Wandlung Zettans ersparte.
EINS
Langsam, beinahe provozierend und doch erkennbar absichtslos schlenderte Christopher über den Marienplatz. Das Gefühl des Stolzes hob ihn um einige Zentimeter über seine sowieso schon stattliche Körpergröße hinaus. Endlich hatte er den so ersehnten Luxus errungen: Zeit für sich.
Wie angestrengt er auch überlegte, er konnte sich nicht erinnern, wann er diesen Platz derart bewusst und mit solch einem Wohlgefühl überquert hatte.
Mitten vor dem Rathaus blieb er stehen, ließ den Blick an der neugotischen Fassade hochstreichen, erfreute sich am zartblauen Himmel, der in all seiner Verletzlichkeit doch einen schönen Tag verhieß. Tief atmete er die kalte Luft der geliebten Stadt ein, wieder und wieder, bis das Atmen schmerzte.
Wie er so verweilte an einem Wintervormittag im März, erregte er die Aufmerksamkeit manch weiblicher Passantin. So blieb das eine oder andere Augenpaar an seiner Erscheinung förmlich hängen. Allein die dichten Haare, die sich, einem geheimen Code gehorchend, meist von selbst in gefällige Locken legten, kämmte Christopher nur sporadisch. Überhaupt kümmerte ihn sein Erscheinungsbild kaum, das hatte Mutter Natur großzügig für ihn besorgt. Man konnte ohne Übertreibung sagen, dass er ein attraktiver Mann war. Er selbst nahm es als gegeben hin, so wie man sich mit Sommersprossen oder zu großen Füßen abfindet, weil es weder besonders stört noch auffällt.
Dreiundfünfzig Jahre – die man seinem gut proportionierten und schlanken Körper nicht ansah – zählte er zwischenzeitlich. Selbst die leichte Schlampigkeit in der Kleidung wirkte, als sei sie beabsichtigt. Äußerlich verkörperte er damit den Typ des verletzlichen Jungen, der nie ganz erwachsen werden wollte. Auch die dunklen Augen passten in das Bild, sie faszinierten immer noch mit einer Spur Verträumtheit.
Diese Verschwendung der Natur an ihm blieb ohne Bedeutung für seinen Charakter. Nie setzte er das Aussehen bewusst ein, es schien, als hätte sein reiches Innenleben das einfach nicht nötig. Bei den unvermeidlichen Blicken in den Spiegel ärgerte er sich höchstens einmal über eine widerspenstige Stirnlocke oder ein bekleckertes Hemd.
Nachdem Christopher den optischen Hunger nach Schönheit gestillt hatte, meldete sich sein Magen zu Wort. Rasch steuerte er das Café Reber an. Hier schätzte er, dass man ihn in Ruhe ließ, nicht sofort einen sogenannten Stammkunden aus ihm machte. Denn er hasste es, kaum, dass er dreimal im selben Laden auftauchte, mit »ah, der Herr Mendelsson. Wie immer?«, angesprochen zu werden, und also genötigt wurde, über Jahre womöglich, das gleiche Gedeck zu wählen. Wie viele brave, widerspruchsfaule Gemüter hatte man so nicht selten zu ewigem Milchkaffee und Butterkuchen, oder was zum Teufel auch immer, verurteilt.
Um unter Schafen glücklich zu werden, musste man vor allem selbst eines sein, so Christophers Devise. Vor jeglichem Vereinsleben grauste ihm genau aus diesem Grunde. Was die meisten Menschen als willkommene Freizeitgestaltung betrachteten, weil sie ihnen nicht viel abverlangte an Eigeninitiative oder Kreativität, verabscheute er aus vollem Herzen. Das überwiegend gleiche Personenkonvolut, das einen weder forderte noch in irgendeiner Form jemals hinterfragte, in dem man sicher und aufgehoben seinen Verstand verdämmern konnte, erzeugte bei ihm ein Gefühl der Lähmung bis hin zur Atemnot. Allein die Vorstellung, regelmäßig Zeit mit sogenannten Gleichgesinnten verbringen zu müssen, ertrug Christopher nicht. Schon das Wort gleichgesinnt empfand er als Unwort, es hatte diesen bitteren Nachgeschmack von Konformismus. Genug Furchtbares war aus eben dieser Haltung heraus in der Vergangenheit geschehen. Nein, Gleichmacherei ekelte ihn, er – ein Individualist mit jeder widerspenstigen Herzensfaser.
Dass er Kindheit und Schulzeit trotzdem halbwegs unbeschadet überstanden hatte, schrieb er nicht nur dem Glück und einigen empathischen Lehrern zu. Vor allem meinte er, sei es der Verdienst liebevoller und kluger Eltern gewesen. Sie liebten das innerlich unangepasste Kind bedingungslos. Vielleicht bestärkte ihn diese Liebe in seiner Haltung, zumindest fragte er sich das in letzter Zeit manchmal.
Dass der Vater viel zu früh ging – ein grausamer Schicksalsschlag. Als auch die Mutter im November letzten Jahres starb, hatte Christopher beschlossen, einen kompletten Neuanfang zu wagen. Lebensentrümpelung nannte er es. Er meinte, dies nicht nur den Eltern zu schulden, es wurde höchste Zeit für ihn.
ZWEI
Seine Lieblingsecke im Café erwartete ihn bereits. Hier oben, vom dritten Stockwerk aus, konnte er den sich allmählich mit Menschen füllenden Marienplatz überblicken. Die innere Ruhe, die ihn dabei erfasste, tat gut. Er genoss diesen Zustand.
Beim desinteressierten Kellner, den er schon lange kannte, der trotzdem – wie nach einer wunderbaren aber nie erfolgten Absprache – stets vorgab, er sehe ihn zum ersten Male, bestellte er einen Earl Grey mit Milch. Dann wurde er unsichtbar hinter seiner Zeitung.
Für dieses Blatt hatte er die vergangenen zehn Jahre gearbeitet. Verrückt, sich das anzutun. Doch das müssen Normalsterbliche alle. Arbeit und Ärger bestimmen hauptsächlich das Dasein. Und wann gab es schon Erfolge? Natürlich hatte die Arbeit zwischendurch sogar Spaß gemacht, aber selten. Obwohl, speziell für diesen Laden tätig zu sein, so schlecht war es auch wieder nicht. Nur durfte man keinerlei Anerkennung erwarten. Dass nur erstklassige Texte erschienen, betrachteten die als Selbstverständlichkeit. Wie verdammt schwer es war, solch einem Anspruch täglich gerecht zu werden, pah, wen interessierte das schon. Gottlob musste er sich nur manchmal etwas aus den Rippen leiern, schließlich gab es genug Themen, die aufzurühren einem den Magen umdrehte, die also der Leser begierig aufnahm. Immerhin hatte er sich mit den meisten Kollegen dort gut verstanden. Die Redaktion vom ITZ dagegen – eine Schlangengrube. Himmel, dass er es da ganze fünf Jahre ausgehalten hatte? Aber was heißt aushalten, sollte man sein Leben nur aushalten? Oh, Mist, verdammter …
Er hatte sich den heißen Tee auf die Hose gekippt und versuchte, den Schaden mit der Serviette zu mindern. Die Folgen waren fatal, denn nun betonte der üppige Papierabrieb die nasse Stelle zusätzlich. Ohne Kleckern ging es selten bei ihm. Nie widmete er sich den Dingen des Alltags konzentriert, als fehlten ihm dafür die entsprechenden Synapsen im Gehirn. Sein Schlüssel blieb gerne da, wo er etwas aufsperrte. So fand er ihn zu seiner Überraschung an der Wohnungstüre, dem Kellerabteil oder dem Briefkasten. Manchmal rempelte er in Gedanken fremde Menschen an, stieß sich den Kopf an Glastüren, verlor immer wieder Schirme, Handschuhe und Schals. Diese Schusseligkeiten gehörten wie eine Art Markenzeichen zu ihm.
Das kleine Malheur mit dem Tee schien gleich vergessen, behaglich schlürfte er den in der Tasse verbliebenen Rest.
Hier zu sitzen, fühlte sich gut an. Einfach nur sein. Aus dem Fenster schauen, weder Zeitdruck noch Termine.
Erst wenige Wochen lebte er so. Die Stelle bei der Zeitung hatte er gekündigt. Dank der Erbschaft konnte er eine kleine Wohnung kaufen. Und für die nächsten vier bis fünf Jahre sollte das restliche Geld zum Leben reichen. Dass er seine Mittel damit aufzehren, ja im Wortsinn »verzehren« würde, egal. Unabhängig sein, zu Papier bringen, was er seit langem im Kopf herumtrug, das zählte für ihn. Keine noch so guten Gedanken an Geldanlage und Ähnliches sollten ihn an diesem Vorhaben hindern. Wann immer derartige Vernünftigkeiten auftauchten, er verdrängte sie erfolgreich.
Vernünftig. Auch so ein Wort, mit dem er haderte, weil es sein bisheriges Leben bestimmt hatte. Vernünftig, wie lange handelte er nicht schon danach. Hatte er nicht »vernünftig« gegessen, gearbeitet, gelebt? Zu vernünftig. Wie konnten Menschen das für erstrebenswert halten? Es schloss, und das schien ihm das Schlimmste daran, selbstauferlegte Unfreiheit ein, da gab es nichts zu deuten. Er setzte »vernünftig« gleich mit »nicht man selbst sein, sich anpassen, ja, im Einzelfall sich aufgeben«. Was vernünftig war, zeigte die Gesellschaft. Eine gesellschaftsfähige Existenz zu führen, bedeutete demnach, ein angepasstes Dasein zu fristen. Wollte man selbstbestimmt leben, musste man sich das leisten können. Finanzielle Unabhängigkeit schien ihm die Grundvoraussetzung dafür.
Ach, Mutschka, dass du gehen musstest, damit ich aufwache und mein Dasein überdenke. Könnte ich dich wieder lebendig machen, wäre mir mein bisschen Leben egal, das darfst du glauben. Mutschka, du da oben, dein Gegenstromschwimmer hier merkt jetzt erst, was er verloren hat.
Alles ist riesig, wenn man klein ist, andersherum schrumpft auch Unerhörtes in normale Proportionen mit zunehmenden Jahren. Ich frage mich, ob ich mein Leben, dauert es nur lange genug, einst als Nebensächlichkeit werde ablegen können. Ein schöner Gedanke … Wir legen alle unsere Lebensakte ab – irgendwann, es gibt also ein monumentales Archiv, Kafka lässt grüßen.
Wenn ich mich als Kind an dich kuscheln konnte, wurde alles erträglich. Du hast meine Angst weggelächelt, diese verdammte Unsicherheit. Was sind wir Menschen doch für anfällige, erbärmliche Wesen. Unsere Empfindsamkeit, genannt Sensibilität, steht uns ein Leben lang im Wege. Überholt werden wir von allen, die damit nicht geschlagen sind. Also von den derben Schwachköpfen dieser Welt, denn die kommen zum Zuge und damit ist unsere wunderbare Welt zum Scheitern verurteilt.
Er unterdrückte ein Lachen, hüstelte und schüttelte seinen Lockenkopf.
Immer dieselben Gedanken. Jetzt schreibe ich endlich meinen Roman. Bin ich auch Edgar schuldig, dem armen Kerl. So, zahlen und raus hier.
DREI
Mittags gab es Spargelsuppe mit angekohltem Brot. Die Dosensuppe hatte Christopher versehentlich aufgekocht. Sie war so brüllheiß, dass er sich mit dem ersten Löffel die Zunge verbrannte.
Früher war er gerne in die Kantine gegangen. Den Kopf voller endloser Redaktionskonferenzen hatte er irgendwelche Menüs verschlungen. Meistens wusste er hinterher nicht mehr, was er gegessen hatte.
Seit er direkt am Viktualienmarkt wohnte, änderten sich auch seine Essgewohnheiten. Statt des abendlichen Wurstbrotes holte er gerne etwas Käse vom Markt, dazu Trauben, Birnen und Wein. Wenn er an den Ständen vorüberschlenderte, staunend über die Vielfalt des Angebots, fragte er sich, was man wohl aus diesen herrlichen Waren alles zaubern könnte.
Richtig kochen müsste man können, ja, das wär´s.
Seine neue Wohnung entpuppte sich als Glücksfall. In einem um die Jahrhundertwende erbauten, komplett renovierten Altbau überblickte er vom Turmzimmer aus fast den gesamten Viktualienmarkt. Einen halben Stock tiefer gelangte man in die geräumige Wohnküche an der Hausrückseite und von da aus in ein kleines Schlafzimmer mit angrenzendem Bad. Einem Kollegen aus der Redaktion hatte er diesen Tipp zu verdanken, solche Schmuckstückchen gelangten meist gar nicht erst auf den freien Wohnungsmarkt. Christopher wusste sofort, dass diese Wohnhöhle sein Zuhause werden sollte. Schon bei der ersten Besichtigung spürte er, wie richtig es wäre, gerade hier zu wohnen. Auch um endlich das in den PC zu klopfen, was seit Jahren seine Gehirnfestplatte verstopfte.
Dieser gleichsam über dem Herzen Münchens schwebende Raum, obwohl nicht sonderlich groß, wirkte durch die Erkerform mit den hohen Fenstern luftig und hell. Altmodisch schön gefasste Scheiben tauchten, dank einer goldfarbenen Bleiverglasung im oberen Drittel, alles in warmes schmeichelndes Licht, dessen beruhigende Wirkung Christopher guttat.
Vom Schreibtisch am Fenster wanderte sein Blick langsam über den Turm des Alten Peter, den Maibaum und weiter zum darunterliegenden Biergarten. Seine Augen liebten genau diesen Spaziergang, eine nahezu therapeutische Wirkung ließ ihn ruhiger atmen, bis sich wohltuende Gelassenheit ausbreitete.
Die längste gerade Wand des Zimmers lag hinter ihm, sie diente als Bewahrer seiner Schätze: Bücher vom Boden bis zur Decke. Links an der Schräge unter dem Fenster hatte er das Ledersofa platziert, sonst gab es nur noch einen ausladenden Korbsessel. Der wurde meistens von Rättchen, Christophers Katze, frequentiert. Streng genommen hieß Rättchen Ratte. Ziska hatte sie vor Jahren mitgebracht.
»Oh Gott, was für eine Ratte schleppst du denn da an?«, hatte er gerufen, als er das Tier zum ersten Mal sah.
Objektiv betrachtet würde kaum jemand Rättchen als Schönheit bezeichnen – einohrig und mit diesem zu kurz geratenen Hinterbein, das ihr einen beschwipsten Gang verlieh. Doch schien sie Christopher auf den ersten Blick zu mögen, nahm nur noch von ihm das Futter und legte sich, wo immer er sich niederließ, sofort dazu. Nach wenigen Tagen fand er, sie sei die schönste Katze der Welt und nannte sie fortan Rättchen.
Als Ziska und er sich trennten, war klar, dass Rättchen bei ihm bleiben würde, schließlich hatte sie sich ihr Herrchen selbst ausgesucht.
Christophers Suppenmahlzeit war beendet, versonnen lauschte er dem Ticken der Wanduhr. Ein träger Blick streifte den leeren Katzennapf, das kleine Raubtier hatte sich mit voller Wampe verkrümelt. Er verschränkte die Arme auf dem Bauch und streckte die Beine unter den Tisch.
Ah, das ist Leben. Essen, wann es einem passt, faul sein ohne schlechtes Gewissen. Hier jetzt sitzen, kein Termindruck oder Mittagspausen-Stress, verdammt noch mal, tut das gut. Vorbei die Zeit-ist-Geld-Ära. Mist, alles Mist. Zeithaben ist Lebensqualität, so herum wird ein Schuh daraus. Menschsein muss der Mensch dürfen, um menschlich zu bleiben, Schluss, aus. Es geht immer seltener, wer kann sich schon rechtzeitig zurückziehen, leisten muss man sich den Rückzug können. Finanziell, aber auch intellektuell. Klingt gut: Sich den Rückzug leisten. Ich, Christopher Leonardo Mendelsson, leiste mir den Rückzug. Christopher Leonardo … wie Leonardo da Vinci. Ein Universalgenie, Schöpfer der geheimnisvollen Mona Lisa. Ach Mutschka, so etwas konnte nur dir einfallen. Einen tollpatschigen Jungen so zu nennen. Verrückte, kleine, ambivalente Mutschka. Deinen Lebensmut und zugleich diese Last am Leben, beides hast du mir vererbt. Ob ich es ohne diese Hinterlassenschaften leichter hätte in der Welt? Wer weiß das schon. Sicher ist, dass ich rechtzeitig aufgewacht bin und mich nicht vermahlen lasse in der gnadenlosen Mühle der sogenannten zivilisierten Gesellschaft. In der es nichtzivilisiert zugeht, weil alles materiell und ökonomisch definiert wird.
O, ich muss dankbar sein, ohne mein Erbe müsste ich mich weiter kommerziell vernutzen lassen, gäbe immer noch den Redakteur bei Münchens erster Zeitung, ha. Schön haben sie geschaut, als ich gekündigt habe, ganz nach Drehbuch… und diese Kommentare: »Auf die Butterseite gefallen, das Arbeiten nicht mehr nötig haben«, so ist das, Freunde, genau so. Ja, der Neid, das ehrlichste aller Komplimente, wie du immer gesagt hast, Mutschka. Nein, ich habe ihn tatsächlich nicht mehr nötig, den profanen Broterwerb. Zumindest für ein paar Jahre kann ich mich ausklinken, das Hamsterrad verlassen zum Durchatmen. Was ich aber bitter nötig habe, ist, zu leben. Nicht existieren, richtig leben. Denn wie leben denn achtundneunzig Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft? Fremdbestimmt, jawohl. Eingespannt in ein Geschirr, das sie nicht selbst wählen durften. Wer kann sich heute noch einen Job nach Neigung aussuchen? Das wäre lebenswert, nur das. Etwas machen, was der einzelne Mensch gerne tut. Daraus schöpft er Freude und Energie. Menschen arbeiten grundsätzlich gerne, sie wollen etwas schaffen. Das Passende aber muss es sein, wenigstens grob orientiert am Individuum. Die Realität sieht anders aus. Froh muss man sein, überhaupt einen Job zu ergattern. Und wofür das alles, für Geld zum Leben? Was für ein Leben? Nur, um zu arbeiten?
Arbeiten für ein Leben, das man so nicht führen möchte. Ichnenne das schizophren, das ist die Krankheit unserer Gesellschaft, Schizophrenie, jawohl. Die meisten wollen es nicht wahrhaben, es ist moderne Sklaverei. Die Angst vor dem Bewusstwerden dieser Daseinsform ist so extrem, dass wir alles verdrängen.
Bleibt die Frage, was stärken würde. Was könnte größer sein als unsere Angst? Machst du dir erst die Mechanismen der Noch-Wohlstandsgesellschaft bewusst, kannst du nur verzweifeln, resignieren. Deutschland verarmt, schon in wenigen Jahren wird man es auch auf den Straßen sehen. Noch scheint vieles heile Welt, pah, bald wird die dünne Schicht Komfortglasur brüchig sein, dann lässt sich nichts mehr vertuschen.
Falsche Politik, Öffnung der Grenzen, dass ich nicht lache. Zu Tausenden kommen sie in unsere Stadt, in unser Bundesland, nach Deutschland. Viele fliehen vor Krieg und Vernichtung, einige vor der Armut im Heimatland. Gewissenlos nehmen Schlepper den Tod unzähliger Menschen in Kauf, um schnelles Geld zu verdienen – Blutgeld. Mittlerweile sind hier so viele Flüchtlinge … wo sollen die alle hin, mein Gott? Weshalb hilft man den Menschen nicht da, wo es Sinn macht? Im eigenen Land. Die EU braucht Grenzen, um geregelte Hilfe leisten zu können. Sonst entstehen wieder nur Mauern. In den Köpfen waren sie nie weg. Und an den Stacheldrahtzäunen leiden und sterben die Menschen, als hätten wir alle nix gelernt aus unserer Geschichte. Das ist so ungeheuerlich, daskann niemand wollen. Dann sind da noch die jungen Männer aus Nordafrika, die ins Gelobte Land drängen auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie bringen manchmal falsche Werte mit, haben oft ein völlig antiquiertes Frauenbild. Es wird weiter Verfehlungen und Übergriffe geben, zwangsläufig. Kann der Staat die Bürger davor schützen? Ich bezweifle es. Nicht alle, die es bis zu uns geschafft haben, gehören zu den dankbar auf Hilfeleistungen Wartenden. Auch das will bedacht sein. Obwohl, vielleicht ist das gemein. Wer von uns ahnt auch nur, wie er reagieren würde, wenn es um sein Leben ginge. Nein, so urteilen dürfen wir nicht, das wäre unmoralisch. Wenn wir unsere Energie – und nur die sollten wir auf die Hilfestellung richten, darauf, dass den Bedürftigsten zuerst geholfen wird, dann bleibt für diese Überlegungen kein Raum.
Schreckliche Zeiten, weltweites Politikversagen. Da haben wir die Schuldigen …
Ein zynisches Auflachen durchschnitt die Ruhe, während er unwirsch durch seine widerspenstigen Locken fuhr.
Schon beim Verteilen der vielen Menschen duckten sich einige Länder weg. Doch als es darum ging, wirtschaftlich zu profitieren, da haben sich genau diese Länder lautstark gemeldet. So geht es nicht weiter, sonst gehören wir auch wieder zu den Armen, dann passt es,ha, zum Kollabieren verurteilt unser Staat. Wo kann der Einzelne also besser resignieren als im normalen Leben? Schon unsere Kinder sozialisieren wir, brechen ihren Willen. Natürlich denken viele, muss ja sein, sie sollen hier leben können, müssen also angepasst werden. An wen, an was? An uns Opportunisten, an uns Kopfnicker?
Früher gab es Menschen, die von anderen »Nigger« genannt wurden, das waren Sklaven. Heute sind die Nicker die Sklaven, ja, so ist das. Was für ein makabres Wortspiel.
Kinder sollten eine faire Chance haben, nicht versklavt zu werden. Nach dem Kindergarten die Schule. Schule in der jetzigen Form bedeutet Ende der Freiheit, der Fantasie. Ein Wettbewerbsmonstrum im scheinheiligen Bildungsmantel ist sie. Für nicht wenige, zu viele noch, Böswort, das die Kindheit verdunkelt. Nichts tun wir dagegen, immer schlimmer werden die Bedingungen für unsere Kinder. Immer unerbittlicher der Leistungsdruck, den von pädagogischen Prämissen meist unbelastete Beamte ausüben. Doch ist ein leichter Ruck zu spüren, Hoffnung in Sicht. Viele Lehrer sorgen sich ernsthaft um die Kinder. Lehrer, die erkennen, dass falscher und antiquierter Stoff nicht weitervermittelt werden darf. Dass Motivation statt Leistungsdruck Erfolg bringt. Doch die Trägheit unseres Bildungssystems lässt jeden guten Ansatz scheitern, echte Pädagogen geben oft enttäuscht auf.
Heute schießt es wieder verdammt heftig das feindlicheQuerfeuer in deinem Kopf, mein Lieber, würde Ziska sagen.
Bei diesem Gedanken an seine Exfreundin legte sich ein sanftes Lächeln auf seine Züge.
Trotzdem – ein Blick in die Historie unserer Schulbildung zeigt es klar. Wichtig war nur, was Krämerseelen brauchten: rechnen, schreiben. Wirklich Entscheidendes, wie ein starker Charakter, ein Gefühl für Unrecht, mitfühlen können, gemeinsam handeln, Konflikte friedlich lösen, Gut und Böse hinterfragen, weise agieren eben, das alles zählt meistens nicht im Schulbetrieb. Nur die Noten für die künftigen Händler und Schacherer, ja, die sind wichtig.
Wir lassen zu, dass Kinder krank werden, sich ausklinken, zurückziehen. Manche ein Leben lang als seelische Krüppel herumlaufen. Trösten uns damit, dass das eben – leider – lebensunfähige Menschen sind. Umgekehrt ist es, genau umgekehrt. Aber wenn du das einem ins Gesicht sagst, sehen die dich an … das bereust du sofort. Hätten unsere Vorfahren das Handeln und Schachern nicht zum Maß aller Dinge erhoben, könnten viele von uns vielleicht doch die Chance auf ein besseres Leben umsetzen.
Und noch ist es nicht zu spät, Schulen als Chance zu sehen. Sie müssten nur neue, richtige Prämissen setzen. Zum Beispiel, statt alle Arbeiten zu benoten, und die Kinder damit in den Wettbewerb zutreiben, lehren, wie man aufeinander zugeht, mit anderen friedlich zusammenlebt. Wie schön das ist, teilen ohne Neid, sich vertrauen, gegenseitig helfen, keinen im Stich lassen. Und die schlechten Noten gäbe es nur für die Ellenbogler, für die, die sich vordrängen, die ewigen Besserwisser. Aber es wird so weitergehen wie bisher. Quatsch, es wird schlimmer werden. Dieser Homo sapiens ist ein Flop, ein Riesenflop der Natur, ein Irrtum, ein Webfehler.
Tröstlich bleibt, dass er das selbst regulieren, sich selbst vernichten wird, da bin ich zuversichtlich. Ein organisches Etwas aus Kohlenstoff. Alles eine Frage der Zeit.
Mit beiden Händen griff er unter den Tisch und streichelte Rättchen, die schnurrend um seine Hosenbeine strich. Wie wohltuend sich das anfühlte, so ein unschuldiges Tier zu spüren, ein archaisches Gefühl und zugleich unendlich zart. Er bedauerte nur, dass die negativen Gedanken (gerade jetzt, wo es ihm doch endlich gut ging) nicht von ihm lassen wollten. Ja, sie schienen fest angedockt zu haben wie ein Geschwür, das es auf seine Seele abgesehen hatte.
VIER
Im ockerfarbenen Turm am Viktualienmarkt brannte um zwei Uhr zwanzig nachts das Licht in der Wohnküche des Christopher Leonardo Mendelsson. Gebeugt am Küchentisch sitzend spiegelten wirre Locken auf fatale Weise seinen Gesichtsausdruck wider. Lustlos stocherte er in der Tomatensauce seines Dosenfisches herum. Dabei dekorierte er, ohne es zu bemerken, Hemd und Hose mit hellroten Punkten.
Das dunkle Viereck des Küchenfensters zog ihn magisch an, das altbekannte Gefühl der Unwirklichkeit holte ihn einmal mehr ein.
Es kam ohne Vorwarnung. Ein Teil Leben, für das es in der Realität keine Entsprechung gab. Nun, die Zeit war gut dafür, er ließ es wirken. Ein angenehmes Entheben aus der eigenen Verantwortung, nichts schien real in diesem Augenblick, weder das Dasein noch er selbst. Also konnte in diesen Momenten auch nichts falsch laufen. Daran würde nicht einmal seine Schusseligkeit etwas ändern.
Mechanisch fuhr er mit den Fingern durch sein Haar. Auch diese Bewegung ließ seine widerspenstigen Locken unbeeindruckt.
Es lebte sich gut als Christopher L. Mendelsson, obschon er dieser Hülle längst entwachsen, diese Person also nicht mehr existent war. Manchmal fragte er sich, ob sie es je gewesen sei. Der beliebte, erfolgreiche Christopher Mendelsson hatte ihn in den letzten Jahren mehr und mehr verlassen. Sukzessive hatte er sich freigemacht. Von den vielen Bekannten, den sogenannten Freunden. Echte Freunde hatte er auch früher kaum gehabt, meistens solche, die etwas von ihm wollten, oder ihn mit ihren Problemen vollpackten. Und die Frauen, ja, da gab es einige, aber die falschen. Einmal hätte ihn eine ernsthaft interessiert, nur – die wollte von ihm nichts wissen. Vermutlich hatte er einfach die falsche Oberfläche für echte Liebe. Und die eine, die eine Richtige, konnte ihn deshalb nicht erkennen.
Wenigstens seine Ziska, sie blieb ihm treu. Doch ein Freund …? Er hatte das Thema Beziehung für sich abgehakt, einfach anmaßend zu denken, unter Millionen von Menschen den einzig passenden zu finden. Lächerlich. Außerdem eigneten sich Beziehungen grundsätzlich nicht für ihn. Wen hätte er mit seiner Schusseligkeit verärgern, wen mit kruden Ideen und Theorien beunruhigen wollen? Eine Frau, die er liebte? Sicher nicht. Es war also richtig, dieses Für-sich-Sein, die einzig lebbare Daseinsform. Hielt er diesen Christopher am Leben, schien seine Existenz gesichert, so konnte er ungestört er selbst bleiben.
Die Gesellschaft verlangte nach Fassaden, wer ihnen entsprach, blieb unbehelligt. Für einen halbwegs intelligenten Menschen also ein legitimes Mittel, wenn nicht die einzige Möglichkeit.
So konnte er ungestört arbeiten und sich mehr um Edgar, seinen behinderten Halbbruder, kümmern. Edgar, der nur wirres Zeug redete seit diesem mysteriösen Unfall. Eigentlich war es kein Unfall, erst vor einigen Jahren hatte ihm Mutter die Einzelheiten erzählt.
Edgars Schicksal (als Kind verschwand er drei Wochen lang spurlos, als hätte er sich aufgelöst in Nichts), hatte damals die Familie vernichtet. Keiner überstand dieses Erlebnis unbeschadet. Traumatisierte Einzelwesen blieben zurück.
Das Bemühen um Normalität nach außen glich einer Sisyphusarbeit, innerlich litt jeder für sich, es veränderten sich alle. Langsam, leise, unspektakulär, einfach so. Von einer normalen, ja stinknormalen Familie zu einer von Zombies. Nur als erstarrte Maske überlebte man sich, nur als solche konnte diese Täuschung gelingen. Denn das war es. Jeder verbrauchte sich im Vormachen einer Stärke, die er nicht hatte.
Warum nur? Bin mir nicht mehr sicher, ob ein ehrlicher Umgang nicht für alle besser gewesen wäre. So täuschte man nur etwas vor, am meisten sich selbst. Täuschte – was für ein Wort. Von tauschen? Ich tausche mein wahres Ich gegen – gegen was? Eine Maske …? Tausche Wahrheit gegen Unwahrheit, solange bis ich nicht mehr tauschen muss, weil mich die Lüge übernommen hat. Gehe weiter als Zombie durch mein Leben. Voilà.
Als man Edgar fand, auf freiem Feld unweit des Elternhauses, hatte er zahlreiche Knochenbrüche und schien völlig verwirrt. Vom Nabel des Kindes bis hoch zum Schlüsselbein lief eine Narbe, auf die sich die Ärzte keinen Reim machen konnten. Geheim- und Sicherheitsdienste aus höchsten Regierungskreisen legten der Mutter damals nahe, mit niemandem darüber zu sprechen, die Sache als Unfall zu betrachten und vor allem Journalisten gegenüber jegliche Auskunft zu verweigern.
Dafür würden von »staatlicher Seite« sämtliche Behandlungskosten und lebenslang alle nötigen Maßnahmen zum Wohle des Kindes übernommen werden. Aus Sorge um die Zukunft ihres Sohnes hatte sich die Mutter damals mit diesen Vorschlägen einverstanden erklärt.
Obwohl die Besuche bei Edgar für Christopher früher meist nur einer Art trauriger Anteilnahme am Schicksal des Bruders geschuldet waren – die er vor allem seiner Mutter zuliebe auf sich nahm, so besuchte er ihn seit ihrem Tod ausgesprochen gerne. Edgars wirrem Reden, das von langen Pausen unterbrochen war, ließ sich immer wieder ein passendes Teilchen für seine Theorie entnehmen. Es kam vor, dass er ihm lange zuhörte, ohne selbst ein Wort zu sagen. Edgar schien das gutzutun. Ja, Christopher meinte zu spüren, dass er sich über den Besuch freute, zumindest aber fühlte er keine Ablehnung.
Ich muss bald wieder rausfahren zu dem Kleinen. Eigentlich traurig, er lebt da an einem der schönsten Seen im Voralpenland und hat nichts davon. Ihh, der Dosenfisch kommt dauernd hoch … ach, Rättchen liegt auf meinem Fuß.
Die Müdigkeit lähmte ihn. Den Kopf auf den Armen schlief er am Küchentisch ein.
FÜNF
Monate später.
Zehn Uhr vormittags. Die Stadt schlummerte im Grau eines Frühsommernebeltages. Mehr war sie zu ahnen als zu sehen, so, als hätte jemand am Set für »The Fog« eine Einstellung vorbereitet.
Christopher duschte ausgiebig, brüllte mit »I´m singing in the rain«, gegen das Prasseln des Wassers an. Mit dunkler Jeans zum karierten Hemd wählte er schließlich ein kleckerfreundliches Outfit. Bewaffnet mit seinem letzten Schirm, rosafarben, Herkunft unbekannt, spazierte er gut gelaunt zur S-Bahn-Haltestelle.





























