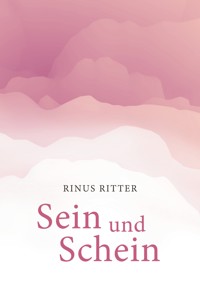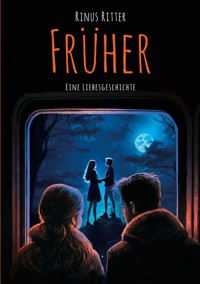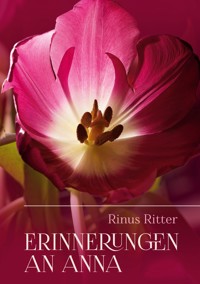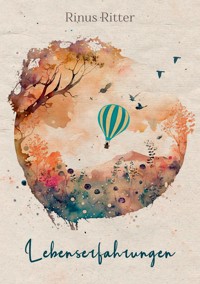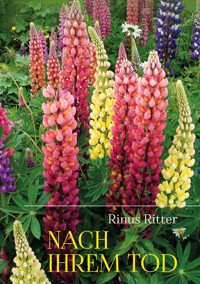
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Seit ihrem Tod frage ich mich: was ist Erinnerung, und wie geht Erinnerung? Ist Erinnerung die Kerze, die am Abend auf der Fensterbank von mir angezündet wird? Auf der Fensterbank vor jenem Fenster im Wohnzimmer unseres Hauses, vor dem das Krankenbett gestanden hat und von dem aus sie mit dem Blick auf unseren Garten ihre letzten Tage zubringen konnte? Ist Erinnerung das, was mir seit ihrem Tod durch den Kopf geht? Oder sind Erinnerungen die vielen wunderbaren und die wenigen schrecklichen Tage, die ich mit ihr erlebt habe, Tage, die es jetzt nicht mehr gibt, gute wie auch schlimme? Mein Herz ist voller Erinnerungen an den liebenswertesten Menschen, den ich gekannt habe, den ich lieben durfte, der mir seine Liebe geschenkt hat - und an den sich nach meinem Tod kaum noch jemand erinnern wird, weil unsere Familie so klein geworden ist. Das zu verhindern ist der tiefere Sinn der Verfassung von Erinnerungen und der Anlass, sie in diesem Buch festzuhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leg alles still in Seine Hände, das Glück, das Leid, den Anfang und das Ende
Inhaltsverzeichnis
In
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Out
Zeittafel Anna
Zu Annas Bildergalerie
In
Seit ihrem Tod frage ich mich: was ist Erinnerung, und wie geht Erinnerung? Ist Erinnerung die Kerze, die am Abend auf der Fensterbank von mir angezündet wird? Auf der Fensterbank vor jenem Fenster im Wohnzimmer unseres Hauses, vor dem das Krankenbett gestanden hat und von dem aus sie mit dem Blick auf unseren Garten ihre letzten Tage zubringen konnte? Ist Erinnerung das, was mir seit ihrem Tod durch den Kopf geht? Oder sind Erinnerungen die vielen wunderbaren und die wenigen schrecklichen Tage, die ich mit ihr erlebt habe, Tage, die es jetzt nicht mehr gibt, gute wie auch schlimme? Mein Herz ist voller Erinnerungen an den liebenswertesten Menschen, den ich gekannt habe, den ich lieben durfte, der mir seine Liebe geschenkt hat – und an den sich nach meinem Tod kaum noch jemand erinnern wird, weil unsere Familie so klein geworden ist. Das zu verhindern ist der tiefere Sinn der Verfassung von Erinnerungen und der Anlass, sie in diesem Buch festzuhalten.
An einer Wand meines Arbeitszimmers hängt eine Fahne aus kräftigem Papier mit zwei Bildern, ihren Daten und einem Spruch. Das Bild oben auf dieser Fahne zeigt einen reifen Löwenzahn, von dem schon eine Reihe Samen weggeweht werden. Dann folgen ihr Name, ihr Geburts- und Todesdatum und ein schönes Bild von ihr, das wenige Jahre vor ihrem Tod aufgenommen worden ist. Den Abschluss der Fahne bildet ein Spruch, von dem ich glaube, er passt zu ihrem Leben: Leg alles still in Seine Hände, das Glück, das Leid, den Anfang und das Ende.
Nicht nur diese Fahne befindet sich an jedem Tag vor meinen Augen; es ist das ganze Haus, das ihr Wesen und ihr Wirken atmet, ein Haus, das wir gerade erbaut vor über fünfzig Jahren erworben, ausgestattet und umgebaut haben, und das seit ihrem Tod vor sieben Jahren an ihr Leben erinnert. So sehr ich in diesen Jahren um sie getrauert habe: Ich liebe das Gedenken an sie, weil ich sie und ihre Gegenwart über alles geliebt habe, als sie noch gelebt hat. Erinnerungen an sie und ihre Liebe halten mich fest, halten mich noch am Leben, geben mir die Kraft, meine letzten Lebensjahre so zuzubringen, wie sie das auch für sich gewünscht hatte. Sie hat in ihrem Leben mit mir zusammen so manchen Schicksalsschlag hingenommen, an dem sie hätte verzweifeln können. Jene Unglücke, die sie noch hätte erleben müssen, hätte sie ihre Krebserkrankung überstanden, sind ihr Gott sei Dank erspart worden: mein völlig verändertes Dasein nach einer Herzoperation und zwei Operationen an meiner Wirbelsäule unmittelbar nach ihrem Tod – und vier Jahre später der plötzliche Tod eines unserer Kinder. Ihr Leben ist durch etliche Unglücke geprägt worden, zuletzt ihr Sterben nach einem fast fünf Jahre währenden Kampf gegen den Krebs. Ob sie das hätte erdulden können, was danach noch geschehen ist, weiß ich natürlich nicht. Ich befürchte, diese Ereignisse hätten den vorhandenen tiefen Spuren in ihrem Herzen weitere hinzugefügt, sie hätten ihre seelischen Kräfte und ihren wunderbaren Lebensmut auf eine weitere harte Probe gestellt. Jenen Lebensmut, den ich so sehr an ihr bewundert, den ich so sehr geliebt habe! Der schon in den Jahrzehnten zuvor unsere Familie immer wieder vor dem Absturz in die Verzweiflung bewahrt hat ...
Seit ihrem Tod lebe ich allein in unserem Haus, einem Haus, das wir einmal erworben haben, um es als Heimat für eine große Familie herzurichten. Als wir endlich zusammenleben konnten, haben wir von vier oder fünf Kindern geträumt, die wir großziehen wollten und die in ferner Zukunft selbst ihre eigenen Familien haben würden. Das waren wunderschöne Träume in einer sehr glücklichen Zeit. Was ist aus diesen Träumen geworden? Unser seit seiner Geburt schwerbehinderter Sohn hat keine eigene Familie gründen können, er lebt in einem Pflegeheim. Unsere ältere Tochter lebt mit ihrem Mann und zwei Enkelkindern weit entfernt in einer Millionenstadt. Sie hat in ihrer Ehe jedoch nicht ähnlich glücklich werden können wie ihre Mutter. Unsere geistig beeinträchtigte jüngere Tochter hat nur ein sehr eingeschränktes eigenes Leben führen können; sie ist vor über zwei Jahren an ihrem Lebensort an einem Gehirnschlag verstorben.
Seit sieben Jahren lebe ich jetzt allein. Was Alleinsein bedeutet, wie sich Alleinsein anfühlt, habe ich mir früher – eine kurze Zeit des Anfangs meines Studiums ausgenommen – nie vorstellen können. Ich habe auch nie Anlass gehabt, darüber nachzudenken, seitdem ich mit Anna zusammenleben konnte. Im ersten halben Jahr nach ihrem Tod habe ich mir gewünscht, das Schicksal möge mir einen schnellen Tod bescheren. Doch so unberechenbar, wie Anna und ich das Schicksal erlebt haben, hat es nicht entfernt daran gedacht. Das Gegenteil ist geschehen: drei Operationen unmittelbar nach ihrem Tod haben meine Trauer und meine Todesgedanken beiseite gefegt. Die letzten sieben Jahre habe ich mit einem Wirbelimplantat, mit mechanischen Versteifungen und Verschraubungen an meiner unteren Wirbelsäule, mit ständigen Schmerzen im Rücken, mit einem Rollator sowie mit einem Herzen, das nur noch die Hälfte dessen leisten kann, was notwendig ist, bewältigen müssen. Mir ist die Aufgabe geblieben, unser einstmals so mit vollem Leben erfülltes und jetzt so leeres großes Haus und unseren Garten zu erhalten. Wegen der körperlichen Behinderungen, die ich aus meinem Leben davor überhaupt nicht kenne, an dieser Aufgabe nicht zu verzweifeln, habe ich allein Anna zu verdanken, ihr und meinen Erinnerungen an sie.
Was mir in dieser neuen Lebenslage hilft, ist die finanzielle Unabhängigkeit, die wir uns im Lauf unseres Lebens nach Zeiten der Armut, nach Niederschlägen, nach beruflichen und nach familiären Problemen erarbeitet haben. Geldprobleme, die die Anfangszeit unserer Beziehung begleitet haben, sind in den letzten dreißig Jahren unseres gemeinsamen Lebens nicht mehr aufgetreten; auch jetzt im Alter gibt es sie nicht für mich. In meiner Kindheit, in meiner Studienzeit und noch etliche Jahre danach ist das anders gewesen, da sind immer wieder Zeiten vorgekommen, in denen jeder Groschen zweimal umgedreht werden musste, bevor er ausgegeben werden konnte. Ich weiß nicht, ob wir früher, als Anna noch gelebt hat, alles das, was uns passiert ist, hätten bewältigen können, hätten wir zu all den Sorgen, die das Schicksal für uns bereit gehalten hat, auch noch bleibende Geldsorgen gehabt! Denn dem zufolge, was das Schicksal für unsere Familie vorgesehen hat, hätten finanzielle Sorgen zu unserem Alltag gehören können, ja, gehören müssen. Doch im Unterschied zu vielen anderen Menschen auf der Erde haben wir in einer sozialen Gemeinschaft leben dürfen, die meiner Familie große Geldsorgen erspart hat. Wir haben drei Kinder, von denen zwei vom Schicksal mit einem Handicap versehen worden sind, das ihnen ein selbständiges Dasein unmöglich macht. Ihnen ein menschenwürdiges Leben und eine Teilhabe an unserer Gesellschaft bieten zu können, hätte unsere psychischen und unsere finanziellen Kräfte bei Weitem überfordert. Dass unsere Kinder, dass wir als Familie zu manchen Zeiten dennoch sorgenfrei leben konnten, dafür sind wir der sozialen Gemeinschaft, in der wir leben, immer sehr dankbar gewesen. Weder Anna noch ich konnten verstehen, wenn gedankenlose Menschen unser Sozialsystem wegen einiger Mängel in Bausch und Bogen verurteilt haben. Wir mochten uns gar nicht vorstellen, wie unser Leben ohne die uns gewährten Hilfen ausgesehen hätte.
1
„Leg alles still in Seine Hände, das Glück, das Leid, den Anfang und das Ende“. Was ich gerade noch als Schicksal bezeichnet habe, wird auch Gottes Wille oder Gottes Fügung genannt. Jetzt am Ende meines Lebens stelle ich mir nach dem, was uns und unserer Familie widerfahren ist, die Frage, ob wir eine Beziehung zu einem Gott, zu einer höheren Allmacht hatten. Ich bin mir keineswegs sicher, weiß aber, zu jenem von den protestantischen und den katholischen Kirchenkanzeln herab verkündeten strafenden Gott sicher nicht. Die im christlichen Abendland praktizierte Gestalt einer Religiosität gehört zu jenen Lebensformen, die mich früher wie heute eigentlich nur am Rande interessiert haben. Mein Verhältnis zu dem, was ich bei anderen als Gläubigkeit gesehen habe, ist deshalb immer ziemlich distanziert gewesen. Christliche Lebensauffassungen dagegen sind für mich immer unverzichtbare Bestandteile meines Wollens und Handelns gewesen.
Meine Beziehung zur Religion ist durch zwei Lebensphasen geformt worden: in meiner Kindheit und Jugend durch die Geschichte meiner Elternfamilie und in meiner Zeit als junger Erwachsener durch mein Studium der Naturwissenschaften, dann aber durch das stille und duldsame Verständnis Annas. Anna stammt wie ich aus einer protestantischen Familie, in der Religiosität keine sonderlich bedeutende Rolle gespielt hat. Jedenfalls nicht in den Jahrzehnten, in denen ich ihre Familie gekannt habe. Ihr jüngerer Bruder ist in den Jahren seiner schwierigen und unsteten Berufsfindung eine Zeit lang Diakon gewesen. Das hat sich aber nicht auf dessen Alltag in seiner eigenen Familie und auf die Beziehung zu seinen Eltern und Geschwistern ausgewirkt. Im Gegenteil, sein störrischer Charakter hat bald zu einer sehr unchristlich abgelaufenen Scheidung von seiner Frau und zur Trennung von seinen Kindern geführt.
Ob Anna in ihrer Kindheit und Jugend eine besondere Beziehung zu religiösen Fragen gehabt hat, entzieht sich weitgehend meiner Kenntnis. Von früher Kindheit an hat sie ganz andere Probleme in ihrer Elternfamilie erleben müssen, Probleme, unter denen sie zu leiden hatte. Soviel ich weiß, hat sie bis auf das kindliche Abendgebet keinen weiteren Trost im Glauben gesucht. Auch später, als das Schicksal es mit ihr, mit ihren Eltern und Geschwistern, später mit der zusammen mit mir gegründeten eigenen Familie wirklich nicht gut gemeint hat, hat sie keinen Gott für ihren Kummer verantwortlich gemacht. Vor dem Einschlafen haben wir zwar manches Abendgebet gesprochen oder gedacht, als Schicksalsschläge unsere Familie heimgesucht haben und wir zutiefst verzweifelt waren, mehr aber nicht. In den vielen Briefen, die sie mir nach dem stürmischen Beginn unserer Beziehung in der über zwei Jahre währenden Zeit unserer unfreiwilligen Trennung geschrieben hat, ist nur selten das Wort Gott vorgekommen. Dennoch muss in ihrem Herzen das Gefühl für eine höhere Allmacht vorhanden gewesen sein. Davon habe ich aber erst nach ihrem Tod erfahren, als ich ein Tagebuch von ihr vorgefunden habe, das aus der Zeit unseres Kennenlernens stammt und das mir vorher nicht bekannt gewesen ist.
In diesem Tagebuch hat sie nur wenige Jahre ihres Lebens festgehalten: zweieinhalb Jahre vor und ein Jahr nach unserem Kennenlernen. Es ist die Zeit der Suche nach einem Partner und die Zeit einer wilden Achterbahnfahrt ihres Gefühlslebens gewesen. Wie sie in ihrer ersten Eintragung geschrieben hat, wäre das Tagebuch vorwiegend dazu da, die Sorgen um ihre Familie, um ihre Eltern und ihre Geschwister und die Rolle der Partnerschaft in einem künftigen Leben aufzunehmen. In dieser Zeit hat Gott keine Rolle gespielt. Erst nach ihrem Vordiplomexamen, als sie gerade dreiundzwanzig Jahre alt geworden war und auf ihrer Suche nach einem Partner schon etliche Enttäuschungen hinter sich hatte, hat sie folgende Sätze in ihr Tagebuch geschrieben:
Ich danke Gott jeden Tag aufs Neue, dass er mir RiRi zugeführt und uns dieses Glück geschenkt hat. Ich fühle mich so sehr beschenkt und von Gott gesegnet, dass ich nicht zu danken weiß für diese unverdiente Güte. Mein innigster Wunsch ist nur, dass wir uns dieser Güte für würdig erweisen und sie stets dankbar zu schätzen wissen. Erst, seitdem ich RiRi liebe, kommt mir mein Leben sinnvoll vor, und ich weiß, dass nichts so schwer sein kann, als dass wir es nicht gemeinsam tragen können. Rings um mich herum zerbrechen Beziehungen, während ich so glücklich sein darf.
Erst viel später ist mir aufgefallen, dass Anna wie in ihrem Tagebuch auch in ihrem späteren Leben nur dann von Gott gesprochen hat, wenn sie glücklich gewesen ist. Das Negative, das sie erlebt hat, hat sie mir und auch anderen gegenüber nie einem Gott angelastet. Etwa ein Jahr, nachdem wir uns getroffen haben, bricht ihr Tagebuch ab; nie wieder in ihrem Leben hat sie dort eine Eintragung hinterlassen. Über diesen Sachverhalt habe ich jetzt in den letzten Jahren, nachdem sie verstorben war und ich ihr Tagebuch zum ersten Mal in der Hand gehabt habe, lange nachdenken müssen. Denn es hat in den sechsundfünfzig Jahren unseres Zusammenlebens wahrlich viele Gründe und Gelegenheiten gegeben, ihre Sorgen ihrem Tagebuch anzuvertrauen. Das ist aber nicht geschehen. Ich glaube, ihre Seele hat spätestens nach unserer Hochzeit ihre Ruhe finden können, hat spätestens dann ihren Frieden mit den Fügungen des Schicksals machen können. Dennoch hat mich nach dem Auffinden ihres Tagebuches sehr gewundert, dass die Schicksalsschläge, die sie und unsere eigene Familie nach unserer Hochzeit heimgesucht haben, zu keinem Zeitpunkt mehr Anlass zu einer Eintragung in ihr Tagebuch geworden sind. Nur vier Jahre nach der letzten Eintragung in ihr Tagebuch ist die katastrophale Geburt unseres ersten Kindes geschehen. Doch schon zu diesem Zeitpunkt hat ihre Seele keinen Trost mehr in ihrem Tagebuch suchen müssen, schon da sind ihr meine Gegenwart, meine Liebe und das Leben mit mir offenbar Halt und Trost genug gewesen.
Ich denke, meine Art der Beziehung zu Gott und meine Vorstellung vom Wesen einer höheren Allmacht haben ihr dabei helfen können. In unseren stillen Nachtstunden haben Anna und ich oft über die Fügungen des Schicksals nachdenken müssen. Doch nie hat es bei uns eine Diskussion über das Warum gegeben, warum das Schicksal diese Unglücke für uns vorgesehen hat. Wir hatten uns den Gebräuchen der damaligen Zeit angepasst: wir haben uns standesamtlich und kirchlich trauen lassen, unsere Kinder sind getauft, unsere Töchter sind konfirmiert. Obwohl wir absolut keine guten Kirchgänger gewesen sind, haben wir nie den Sinn und die soziale Bedeutung kirchlicher Institutionen in Frage gestellt. Erst recht nicht, als wir auf deren Existenz und Hilfe angewiesen waren. Ich bin überzeugt, dass die religiöse und vor allem die menschliche Sozialisation in meiner Elternfamilie dazu beigetragen haben, Anna mit einem festgefügten Katalog christlicher, ethischer und preußisch-protestantischer Lebenseinstellungen begegnen zu können. Ich glaube, mit meinen Ansichten zur Lebenswirklichkeit hat Anna nie ein Problem gehabt; ich denke, sie sind zusammen mit meiner Liebe zu ihr der Ruhepol geworden, von dem aus sie ihr Schicksal bewältigt hat, von dem aus sie mir so unglaublich viel Liebe hat zurückgeben können.
Denn ich bin mit christlichen Lebenseinstellungen aufgewachsen, in denen die Toleranz einen breiten Raum eingenommen hat, eine Toleranz, die in der religiösen Vorgeschichte meiner Elternfamilie wurzelt. Aus zwei Gründen bin ich mit dem Schisma des Christentums, der katholischen und der evangelischen Glaubensrichtung, seit meiner frühen Jugend vertraut gewesen. Mein Vater ist seit dem zwölften Lebensjahr Vollwaise gewesen, er stammt aus einer westfälisch-protestantischen Familie. Meine Mutter ist in einer streng konservativ-katholischen Familie des nördlichen Ruhrgebiets aufgewachsen, seit ihrem zehnten Lebensjahr als Halbwaise. Schon als Jugendliche ist sie durch einen festen Willen aufgefallen und hat als kritisch und manchmal auch aufsässig gegolten. Mit sechzehn Jahren ist sie aus dem kleinbürgerlichkatholischen Milieu ausgebrochen und hat in Berlin, dem protestantischen Sündenbabel der zwanziger Jahre eine Ausbildung zur Krankenschwester aufgenommen. Dort ist sie erwachsen geworden und hat nach etlichen Jahren, von denen ich nur wenig weiß, meinen Vater kennen und lieben gelernt. Sie haben evangelisch geheiratet, meine Mutter ist aus Überzeugung Angehörige der evangelischen Kirche geworden, ihre Kinder sind evangelisch getauft. An irgendwelche Diskussionen religiöser Art in meinem Elternhaus kann ich mich nicht erinnern, obwohl es in den verschiedenen Wohnorten meiner Elternfamilie an Auseinandersetzungen unter den Angehörigen beider christlichen Konfessionen nicht gefehlt hat. In meiner Elternfamilie hat Toleranz geherrscht, eine Toleranz, mit der ich erwachsen geworden bin.
In meiner Kindheit, der Zeit des zweiten Weltkriegs und der Notjahre danach haben meine Eltern in einem Teil Deutschlands gelebt, der vollständig katholisch geprägt war. Wir Protestanten aus Berlin waren echte Exoten. An einen evangelischen Religionsunterricht in der Schule ist überhaupt nicht zu denken gewesen. So habe ich als Protestant am katholischen Religionsunterricht teilgenommen, so habe ich im katholischen Kinderchor der Gemeinde mitgesungen, so habe ich katholische Gottesdienste besucht. Das alles ist deshalb kein Problem gewesen, weil nicht nur meine Eltern das für gut und richtig empfunden haben, auch der örtliche Pfarrer und der Religionslehrer haben mitgespielt. Ich habe gelernt, dort, wo Protestanten keine Gefahr für die katholische Mehrheit darstellen, ist man tolerant, werden sie geduldet – ganz im Gegensatz zu Gegenden Deutschlands, in denen wir später gewohnt haben, in denen Katholiken und Protestanten als etwa gleichstarke Religionsgemeinschaften noch lange Zeit hart aufeinander geprallt sind.
Als einziger Protestant unter Katholiken bin ich damals in der katholischen Kirchengemeinde zwar willkommen gewesen, an einigen Riten habe ich allerdings nicht teilnehmen dürfen: am Abendmahl und an der Beichte, ganz zu schweigen von der von uns Jugendlichen als Auszeichnung empfundenen Aufgabe als Messdiener bei Gottesdiensten. Ich erinnere noch, mich damals ausgeschlossen gefühlt zu haben. In dem Dorf, in dem wir lebten, hatte ich auch nur einen einzigen Freund, den ich verloren habe, als er bei einem unserer Kletterabenteuer von einem Baum gestürzt ist. Zuhause ist öfter über die Probleme mit unserer religiösen Umwelt gesprochen worden. Meine Eltern haben mir erklärt, woran das gelegen hat. Dennoch habe ich nie verstanden, weshalb es so etwas wie Auseinandersetzungen unter Christen geben kann.
Diese mir anerzogene Toleranz und die Haltung, die ich danach zu Fragen der Religion eingenommen habe, sind später hilfreich gewesen. Für Christen hat Gott viele Gesichter, strenge und liebevolle, strafende und barmherzige. Der christliche Gott straft, auch dann, wenn der Bestrafte gar nicht begreift, wofür er bestraft wird; er vergibt, auch dann, wenn der Sünder eine Strafe erwartet. Diese unterschiedlichen Bilder eines Gottes haben mich als junger Mensch verwirrt. Bis ich mich entschieden habe: Mein Gott ist ein liebender Gott und nicht jener strafende Gott, der damals von fast allen katholischen Kanzeln, aber auch von mancher protestantischen Kanzel herab verkündet worden ist. Was viele Jahre später gepredigt worden ist, hat mir deshalb besser gefallen, weil der Pastor oder der Pfarrer immer mehr bemüht gewesen ist, die menschliche Seite Gottes bewusst werden zu lassen. Mein religiöses Erwachsenwerden ist mit der Erkenntnis einhergegangen, dass das, was wir als Gott, als höhere Macht empfinden, nicht irgendwo oben im Himmel oder draußen im fernen Universum zu suchen ist, sondern in uns selbst, in unseren Herzen. Unser Herz weiß, was Gut und was Böse ist und wo die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft. Vielleicht ist das das wahre Vermächtnis des Reformators Martin Luther: es ist und bleibt in meiner Verantwortung, wie ich mit dem umgehe, was mein Herz mir sagt. Ob ich die Macht meines Herzens zur Unterdrückung anderer missbrauche, oder ob ich diese Macht zur Verantwortung für andere und zur Nächstenliebe einsetze – das entscheide ich allein, das entscheidet keiner sonst. Dafür trage auch nur ich allein die Verantwortung. Ich glaube, eine ähnliche weltanschauliche Lebensmaxime hat auch Anna immer bei sich gehabt, und beide haben wir sie, so gut es ging, gemeinsam verfolgt.
2
Neben dieser Einstellung zu religiösen Fragen ist eine weitere Frage für mich lebensbestimmend geworden: was ist das, was wir als Schicksal bezeichnen? Ich erinnere mich noch an das Buch ‚Zufall und Notwendigkeit‘: dieses Buch und die darin beschriebene Sicht des Nobelpreisträgers Jaques Monod von der Bedeutung des biologischen Sinns des Lebens hat mich zu einer Zeit gefesselt, als mein Leben von einem ersten Schicksalsschlag in meiner gerade gegründeten eigenen Familie geprägt worden war. In den Jahren vor diesem Schicksalsschlag hatte die damals bestmögliche Ausbildung zu einem Naturwissenschaftler hinter mir gelegen, vor Anna und mir hatte sich eine wunderbare Zukunft ausgebreitet. Jetzt, über fünfzig Jahre später, muss ich über Vieles nachdenken, auch über das, was an dem Schicksal, das uns bevorgestanden hat, Zufall und was Notwendigkeit gewesen ist. Aus heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand betrachtet bedarf manches, was Monod über seine Sicht unseres Daseins als Menschen geschrieben hat, einer Korrektur oder einer Ergänzung. Der Gedanke aber, das Wirken eines Gottes durch den naturwissenschaftlichen Begriff des Zufalls zu ergänzen, ist für mich zwar kein Trost, ist jedoch lange Zeit faszinierend gewesen. Nachdem ich ein ganzes Leben mit Anna hinter mir habe, ist mir erst richtig bewusst geworden, welche Rolle der Zufall in unserem Leben eingenommen hat.
Ich habe mich beispielsweise gefragt, ob die Art, wie Anna und ich zueinander gefunden haben, nur eine Kette von Zufällen gewesen ist, oder ob dahinter eine gleichwie geartete Absicht gesteckt hat. Schon Erinnerungen an die Zeit vor unserer ersten Begegnung, an jene vier Jahre, in denen wir unsere ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht haben, genügen, eine lange Reihe von Zufällen aufzuzählen, Zufälle, die geeignet gewesen waren, eine Begegnung von Anna und mir zu verhindern. Im letzten Jahr vor meinem Abitur hatte ich mich in ein sehr junges Mädchen verliebt. Es ist ein liebes Mädchen mit einem schon weit entwickelten Gefühlsleben gewesen, wir haben uns gut verstanden und gut zusammengepasst, unsere Eltern hatten gegen diese erste Liebe nichts einzuwenden. Unter anderen Umständen wäre ich mit meiner konsequenten und anhänglichen Art bestimmt bei ihr geblieben. Doch unsere Jugend, die große Entfernung zu meinem Studienort, die vielen Jahre bis zu ihrem Abitur und die Tatsache, dass wir uns in meinen Semesterferien nicht sehen konnten, haben das verhindert. Wären die Umstände günstiger gewesen, wäre der Briefkontakt nicht eingeschlafen, hätte ich mich später sicher nicht für Anna interessiert. Ich glaube, der Briefkontakt ist auch deshalb eingeschlafen, weil mir während des ersten Studienjahres klar geworden ist, einem so jungen Mädchen eine Trennung von mindestens vier Jahren, die sie bis zu ihrem Abitur noch vor sich hatte, nicht zumuten zu können. So hat die erste Liebe meines Lebens kein dramatisches, sie hat ein stilles Ende gefunden.
Zur selben Zeit hat ein nächster Zufall meinem Leben eine Richtung gewiesen. Mein Vater ist während meines letzten Schuljahres schwer erkrankt gewesen und hat ein Vierteljahr lang in einem Krankenhaus um sein Leben und um seine berufliche Stellung kämpfen müssen. Er hat nicht sterben müssen, er hat seine Arbeit behalten können und ich habe meine Träume nicht aufgeben müssen, ich konnte studieren. Zufall? Wäre das nicht so gewesen, wäre mein Vater gestorben oder hätte er seine Stellung verloren, ich hätte kein Studium aufnehmen können und Anna und ich wären uns nie begegnet. Es ist müßig, darüber nachzudenken, was stattdessen in meinem Leben passiert wäre. Vielleicht wäre ich nach meinem Abitur in jener Kleinstadt geblieben, die Beziehung zu meiner jungen ersten Liebe wäre nicht eingeschlafen, mein Leben hätte einen völlig anderen Verlauf genommen.
Als Anna ihr Abitur hinter sich hatte, hat sie sich zu einer Zeit, als das für Mädchen noch ziemlich ungewöhnlich gewesen ist, für ein Studium der Naturwissenschaften entschieden. Obwohl es in der Nachbarschaft ihres Wohnsitzes die eine oder andere Universität gegeben hat, an der sie ein solches Studium hätte aufnehmen können, hat sie eine von ihrem Elternhaus möglichst weit entfernt gelegene Universität gewählt. Warum hat sie das getan? Nach allem, was ich später über ihre Familie erfahren habe, hat sie den Problemen in ihrem Elternhaus entfliehen wollen – nicht nur in irgendein Studium, sondern in ein Studium weit weg. Hätte es die Auseinandersetzungen in ihrem Elternhaus nicht gegeben und wäre sie in einem Elternhaus ähnlich dem meinen aufgewachsen, hätte sie ein Studium in der Nähe aufgenommen. Hätte, hätte ... wir wären uns nie begegnet.
Schon am ersten Tag unseres Studiums haben Anna und ich uns im Hörsaal des mathematischen Instituts gesehen. Wegen der Überflutung der wenigen Universitäten in Deutschland durch die geburtenstarken Vorkriegsjahrgänge ist der Hörsaal übervoll gewesen. Als sie neben mir im Gang an der Fensterseite gestanden hat, habe ich ihr meinen Sitzplatz angeboten. Mit einem Lächeln hat sie dankbar angenommen. Welche Zukunft uns da noch bevorgestanden hat, habe ich nach dieser ersten Begegnung nicht im Entferntesten geahnt. In den Vorlesungen und Übungen danach habe ich sie immer wieder gesehen, habe sie aber nicht weiter beachtet. Denn als Exotin ist sie schnell von meinen älteren Kommilitonen umschwärmt worden. Als gerade noch achtzehnjähriger und damit viel zu junger Student hatte ich genug mit den Schwierigkeiten meines Studiums zu kämpfen. Zum Trost habe ich noch im Briefverkehr mit jener jungen Freundin aus meinem letzten Schuljahr vor dem Abitur gestanden, von der ich oben kurz berichtet habe.
Um der Einsamkeit zu entfliehen, habe ich mich einer Studentengruppe aller Fakultäten angeschlossen. Bei einer Tanzveranstaltung bin ich Anna als Tischdame eines Mitglieds dieser Gruppe wieder begegnet. Wir haben einmal miteinander getanzt. Diese Begegnung ist für mich jedoch nicht weiter bedeutsam gewesen, für Anna schon eher. Das habe ich sehr viel später ihren Tagebuchaufzeichnungen entnommen: Auf diesem Fest habe ich jenen jungen Studenten gesehen, der mir seinen Sitzplatz angeboten hat, und er hat mich zu einem Tanz aufgefordert. Unter allen anwesenden Studenten hat er mir noch am besten gefallen. Ob ich ihn mögen könnte? Ich weiß es nicht. Ich sollte aufhören, mir über die Liebe weitere Gedanken zu machen.
Keine weiteren Gedanken über die Liebe? Das Gegenteil war der Fall! In den ersten drei Jahren ihres Studiums hat sie viele Gelegenheiten und Erlebnisse gehabt, sich um die Liebe Gedanken zu machen. Ihr Gefühlsleben hat in diesen Jahren eine wilde Achterbahnfahrt absolviert. Wie leicht hätte sie dabei in eine ernste Beziehung hineingeraten können! Es hätte keine Chance mehr gegeben, uns jemals zu finden. Von diesen ersten drei Jahren habe ich eigentlich nichts mitbekommen. Erst nach ihrem Tod habe ich aus ihrem Tagebuch erfahren, was damals alles geschehen ist. Später, als wir uns kannten und zusammenlebten, hat sie zwar die eine oder andere Andeutung gemacht, doch was in diesen Jahren wirklich gewesen ist, habe ich zu ihren Lebzeiten nicht gewusst. Ich sollte schildern, welche Kette von Zufällen in diesen drei Jahren dazu geführt hat, dass wir uns schließlich doch finden konnten. Dazu ist ein längerer Bericht zu diesen drei Lebensjahren Annas erforderlich. Ich kann hier nur die wichtigsten Stationen ihrer Suche nach jemandem, der sie mag und den sie mag, nacherzählen. Hinter jeder dieser Stationen steckt ein Lebensabschnitt, dem sie viele Gedanken widmen und manches Herzblut opfern musste.
Zur Zeit ihres Studienbeginns war sie ähnlich wie ich noch mit ihrem Tanzstundenpartner aus ihrer Schulzeit befreundet. Nach einem missglückten Erlebnis hat sie diese Freundschaft dann aber beendet. Unter den Kommilitonen, die sich zu Beginn ihres Studiums um sie geschart und ihr bei den mathematischen Übungsaufgaben geholfen haben, war auch jemand, der sich in sie verliebt hat. Er sei ein „Intelligenzknubbel“, hat sie geschrieben. Nach ersten schöneren, später aber enttäuschenden Erlebnissen mit ihm hat sie geschrieben: Leider ist sein Besuch bei meinen Eltern eine große Pleite geworden. Ich hätte ihn nicht einladen sollen. Meine Mutter hat sehr unter seiner Anwesenheit gelitten, was sie mir auch gründlichst aufs Butterbrot geschmiert hat. Recht hat sie ja, dass er wenig unterhaltsam ist. Und gute Umgangsformen hat er auch nicht! Eigentlich bin ich froh, dass wir jetzt endgültig auseinander sind. Erst jetzt weiß ich genau, dass ich ihn nie würde lieben können. Vorher dachte ich schon einmal, aus meiner Sympathie könnte Liebe werden, aber was mich beeindruckt hatte, war doch nur seine überdurchschnittliche Begabung. Liebe ist eben mehr als nur Bewunderung! Um einen Menschen zu lieben, muss ich zwar immer etwas haben, was ich an ihm bewundern kann, aber dabei darf es nicht bleiben. Solange mir seine Fehler auf die Nerven gehen, kann von Liebe keine Rede sein. Ja, mein Lieber, du tust mir schrecklich leid! Wahrscheinlich hast du mich wirklich geliebt, oder tust es auch jetzt noch, aber wir würden uns nie verstehen. Ich kann deine Fehler einfach nicht liebhaben, und so müsste es bei der wahren Liebe doch sein. Du bist mir mit deinem Bedürfnis nach Zärtlichkeit, deiner Schweigsamkeit, deiner Weltverachtung, deinem linkischen Benehmen, deiner Rücksichtslosigkeit bei all deiner Liebe auf die Nerven gegangen ... . Diese Stelle ihres Tagebuchs ist eine jener Stellen, an denen sie einen Einblick in das gibt, was für sie Liebe zu einem Mann bedeutet. Obwohl es bestimmt einige Gelegenheiten gegeben hat, nie hat sie ein Abenteuer gesucht; die Liebe, die sie gesucht hat, ist für sie mehr als ein Abenteuer gewesen.
Zur selben Zeit in den Semesterferien, in denen sie als studentische Hilfskraft in einem Spektrallabor gearbeitet hat, um ihre schmale Kasse aufzubessern, schreibt sie über einen Arbeitskollegen: Zu allem Unglück habe ich auch noch erfahren müssen, dass er mich liebt. Es ist einfach furchtbar gewesen, und ich habe es auch jetzt noch nicht überwunden. Wie habe ich nur so unüberlegt sein können und seine Einladung angenommen. Manchmal bin ich wirklich zu naiv! Aber ich habe ja auch nicht ahnen können, dass er so viel für mich empfunden hat. Dass er mich hat gut leiden können, das habe ich ja schon lange bemerkt, aber dass er mich geliebt hat, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Auch jetzt noch glaube ich, geträumt zu haben, doch leider ist das nicht der Fall. Die glücklichen und dennoch so traurigen Stunden bei ihm waren wirklich und werden mir unvergesslich bleiben. Er ist der erste Mann, den ich liebe und der meine Liebe auch erwidert. Oder hat er mit mir gespielt, weil er meine Zuneigung gespürt hat? Nein, das glaube ich nicht, das wäre hässlich und gemein. Ich kann einfach nicht schlecht von ihm denken. Wenn ich ihn doch nur vergessen könnte! Er ist doch siebzehn Jahre älter als ich! Es hat doch keinen Sinn! Lieber Gott, hilf mir, ihn zu vergessen und verzeih mir! Ich habe schon genug geweint, lass endlich mein Herz still werden!
In der Studentengemeinde an unserem Studienort hat sie einen Mann kennen gelernt, der sie sehr beeindruckt hat. Sie schreibt in ihrem Tagebuch an mehreren Stellen über ihn und nennt ihn ‚Herrn T.‘. Ich wüsste schon jemanden, den ich heiraten würde, aber der will nichts von mir wissen. Jedenfalls habe ich den Eindruck, nachdem ich gerade vier Tage vergeblich auf Herrn T. gewartet habe. Eigentlich habe ich mich nur auf ihn gefreut, als ich an meinen Studienort zurückgefahren bin; doch er lässt sich nicht blicken ... Ich bedeute ihm nichts, wie könnte ich auch! ... Wie armselig sind doch Worte, wenn es gilt, das auszudrücken, was man fühlt! Alles klingt so banal, wenn man es aufschreibt. Lieber Herr T., ich liebe dich! Dieser Herr T. hat ziemlich lange eine Rolle in ihrem Gefühlsleben gespielt, die Rolle des Fernen und Unerreichbaren, den sie sich aber als Lebenspartner vorstellen konnte.
Die Beziehung zu ihrem Tischherrn jener Tanzveranstaltung, von der weiter oben berichtet worden ist, der ihr bis dahin gleichgültig gewesen ist, hat sich geändert. Doch seit dem vorigen Wintersemester bin ich in ihn verliebt. Es gibt doch nichts Schlimmeres als verliebt zu sein. Man hat keine ruhige Minute mehr. Wie schnell vergeht oft die Liebe! Ich darf gar nicht daran denken, dass er mich eines Tages nicht mehr gern hat, obwohl ich fest damit rechne. ... Habe ich mich denn mal lustig über ihn gemacht, dass er sich jetzt nicht mehr traut, mir das zu sagen, worauf ich schon lange warte, nämlich dass er mich liebt? Vielleicht liebt er mich gar nicht? Oder er ist sich über seine Gefühle selbst nicht im Klaren? Er hat so lange auf mich warten müssen und nun bin ich so ungeduldig!
3
Etwas später ist sie im anorganisch-chemischen Praktikum von einem wahnsinnig netten Assistenten betreut worden. Er hat mir so viel geholfen, dass ich mich in ihn verliebt habe. Eigentlich will ich nicht schon wieder in ein Gefühlschaos geraten, doch gegen meine Gefühle für ihn kann ich nicht ankommen. Obwohl ich weiß, dass es keine Chance gibt. Ich habe einen Brief an ihn geschrieben, den ich jedoch nicht abgesandt habe, den ich aber aufbewahren werde. ‚Mein liebster Zauberlehrling! Warum musste ich mich ausgerechnet in Dich verlieben? Weißt Du überhaupt, wie sehr ich Dich liebe? Ich kann es Dir nicht sagen und darf es ja auch nicht! Das macht mich furchtbar traurig, und dabei muss ich mit lachendem Gesicht mit ansehen, wie Du nur noch Augen für Deine kleine Prinzessin hast. Ist es sehr egoistisch, wenn ich wünsche, ich hätte sie Dir nie vorgestellt? Wahrscheinlich hätte es auch nichts daran geändert, dass Du aufgehört hast, mein Zauberlehrling zu sein. Gut, dass Du nicht siehst, wie ich um Dich weine. Aber vielleicht würdest Du nur lächelnd denken, das gibt sich wieder. Du hast mir so viele liebe Sachen gesagt, die ich nie vergessen werde.