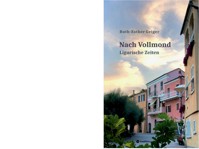
10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Neumond zum Vollmond , vom Vollmond zum Neumond. Der Mond steht für Wandel genauso wie für Wiederkehr. Um Wandel und Wiederkehr geht es auch in diesem Memoir, den sehr persönlichen Geschichten aus einem bunten Leben, dem Nachdenken über dieses Leben. Im Mittelpunkt: Ein Ferienhaus in Ligurien, ein Steinwurf von einem mittelalterlichen Dorf entfernt. Seit bald fünfzig Jahren verbringt die Autorin dort ihre Sommer, allein, zu zweit, mit wechselnden Lieben, mit der Familie oder mit Freunden. Immer verbunden mit dem Land, das sie liebt, das ihr vertraut ist und fremd zugleich. Von ihrem Erleben in Italien geht es oft in Assoziationen zu ihrem Leben zuhause, zur Kindheit in Berlin-Wannsee, zur wilden Studienzeit in Hamburg, zu ihrer Zeit als Tochter und als Mutter, als engagierte Journalistin und auch als Musikclubbesitzerin. Im Schreiben über Orte und Menschen erinnert sie sich an diese Zeiten: Was war, was ist davon geblieben? Und dann geschieht plötzlich jenseits 60 noch Unerwartetes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ohne Titel © Christopher Geiger
Ruth-Esther Geiger
Nach Vollmond
Ligurische Zeiten
© 2022 Ruth-Esther Geiger
Covergestaltung und Bildbearbeitung:
Inken Diercks, ICD-lebensbaum.de
Innenbild: Christopher Geiger, farbwerke-m6.de
Titelfoto: Gabriele Kreis
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-347-75437-9
Hardcover
978-3-347-75439-3
e-Book
978-3-347-75441-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ohne ihre Zustimmung ist unzulässig. Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin. Zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice",
An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Inhalt
1
Nach Italien des Wegs
Ewige Pionierin
Rauflust
Die Motor-Falci
Innen und außen
Konzert mit Fledermaus
Im August ist Italien faul
Metamorphose eines Patriarchen
Scheinbar freundliche Belagerung
Zwischen den Felsen
Susanne und Rose
Wie Frauen das Wasser begrüßen
Echte Angler baden nicht
Körpersignale
Anschläge
Soul
Das Testament
Die Mimose
2
Die Gefährliche Geliebte
Das Kind, das nicht traurig sein durfte
Bandiera Rossa
Oliven am Kopf
Oleanderbäume
Älter werden
Der Orchideenschock
Reisen 50 plus
Lieben sie uns?
Der Hundebiss
Die Folgen eines Hundebisses
Nach dem Vollmond
Der schöne Carabiniero
In der Hängematte
Blicken und Grüßen
Der Anwalt
Das Nachspiel
Die Mutter schweigt
3
Früher in Ligurien
Der Weg wird zum Ziel
Das Badezimmerfenster
Fremdkörper
Pollo arrosto
Morgens Dorfversammlung
Abendlicht
Das Meer weint
Großmutterstolz
Ballo in Costarainera
Spätsommer
Die Schweden im Swimmingpool
La Isola Servizio – die Müllinsel
Die Francobolli
Später Liebesversuch
Der Mann auf der Terrasse
Serpentinen im Blut
Starke Gefühle
Fast ertrunken
Palazzo Zenobio
Abschied und Veränderung
Es ist Zeit
sagt mein Herz
Ja,
ich werde mich
jetzt verändern
Wann – wenn nicht jetzt
ins Wolkenbett legen
Nach Worten suchen
Schwindel als Chance
Wie mancher Schmerz
Das Herz mir nach innen öffnen
Prolog
Eine Kamera hatte ich manchmal erträumt. Eine festmontierte Kamera, die jeden Urlaub festhält. Montiert unterm Dach über der urtümlichen Terrasse aus Natursteinen, die einmal ebenmäßig war und jetzt immer holperiger wird. Mit Einverständnis der Menschen natürlich. Der Freunde und Familienmitglieder, die hier ihre Ferien, ihre Auszeiten, ihre Lese- und Schreibzeiten, Flitterwochen, Kinderbespiel-Tage, ihre Altersbesinnlichkeit und ihre Abenteuerzeiten verbringen. In der weiß gestrichenen Casa mit dem spektakulären freien Ausblick über die Olivenhügel auf das Mittelmeer. Ein Dokumentarfilm ausschließlich mit Kameraton schwebte mir vor. Natürlich ist dies ein sonnenbeschienener Tagtraum geblieben.
Stattdessen ist diese Kamera nach innen gegangen und hat das Wichtigste aufgezeichnet, das ich hier in Jahrzehnten beobachtet, erlebt, empfunden und assoziiert habe.
Von dieser lieblichen und schroffen Landschaft zwischen Bergen und dem ligurischen Meer, von den Menschen, die sie bevölkern oder bereisen habe ich 20 Jahre lang schriftliche Skizzen mitgebracht, sie über die Zeit bearbeitet und schließlich mit autobiographischen Rücksprüngen zu einer Geschichte montiert.
Sie fängt mit meiner Mutter an, für die ich fremd war. Sie war für mich ein Mensch, an dem ich mich abarbeiten musste, ehe ich sie lieben konnte und dann auch loslassen. Sie hört mit einem Menschen auf, den ich immer noch entdecken darf, und der mir ermöglicht mich fallen zu lassen.
1
Nach Italien des Wegs
Da fuhr ich, innerlich ermüdet, aber mit dem Adrenalinschub eines Gefängnisausbrechers, der die Hand schon nach dem gesichteten Teil seiner Freiheit ausstreckt, durch den italienischen Norden. Neben mir hatte ich meine 80jährige Mutter sitzen, manchmal auch eher liegen, mit der ich in unserem Ferienhaus in Ligurien eine Zeit verbringen wollte. Beide wollten wir es nicht nur, wir hatten es dringend nötig, wir sehnten uns beide nach nichts anderem als nach diesem Einhalt.
Meine Mutter war erschöpft, von tiefer Verunsicherung gezeichnet, die sie in drei Monaten um mindestens drei Jahre voran geworfen hatte. Sie war diese Zeitspanne lang in einem evangelischen Damenstift mit einer psychisch schwer erkrankten Frau in ihrer nächsten Umgebung zusammen gewesen. Ich hatte sie mit Hilfe meiner Geschwister in einem unsäglich schwierigen Akt davon befreien können und wollte sie – wie mich selbst auch – nun langsam wieder zum freudigen Teil des Lebens zurückführen. Ich selbst hatte eine schwierige Zeit mit einem kleinen Unternehmen hinter mir, das ich mit Ach und Krach verkauft bekommen hatte.
Momentan ist richtig Momentan ist gut
Nichts ist wirklich wichtig
Nach der Ebbe kommt die Flut … Und es ist, es ist ok Alles auf dem Weg
Und es ist Sonnenzeit Unbeschwert und frei
Und der Mensch heißt Mensch Weil er vergisst Weil er verdrängt
Und weil er schwärmt und stillt
Weil er wärmt, wenn er erzählt
Grönemeyer tönt aus dem Radio. Ich stelle ihn so laut, dass er mich trägt, dass er mich fortbewegt. Und tröstet.
Die Bittersüße des Lebens kurbelt uns an, denke ich, während ich neben meiner jetzt schlafenden Mutter das Steuer bediene.
Meine alte Mutter konnte sich endlich etwas fallenlassen, verlor sichtbar und fast jetzt kindlich aussehend, alles Zusammengerissene.
Ich führe als ihre älteste Tochter ihr Auto, einen bequemen Mittelklassewagen, im zügigen Tempo, aber sicher durch die breiten Straßen mit den gut ausgeschilderten italienischen Regionen. Seit dem großen Bernardino-Tunnel hat meine Mutter Rose geschlafen. Bei Como hatten wir beschlossen, weil es dort regnete, bis zur Riviera durchzufahren und nicht in einer Pension in der Poebene Station zu machen. In Pavia hatten wir in einer Bar einen Aperitivo analcolico mit Chips, gemischten Nüssen und Oliven als Beilage genossen. Bei der nächsten Pause nahmen wir in einer Trattoria warmes Tomatenbrot mit Basilikum und einen doppelten Espresso zu uns. Neben unserem Auto hatte ich meine Yoga-Stretching-Übungen gemacht. Und auf ging es erneut Richtung Genua.
Mit drei bis vier Stunden in den Sommerabend hinein, rechne ich jetzt um zwanzig Uhr aus, kommen wir genau zum Schlafen im eigenen Häuschen an.
An einem Autobahnabzweig steht außer Genua auch Piacenza und Torino auf den Schildern. „Ich bin ja immer über Piacenza gefahren!“ Die mütterliche Betonung, sie ist inzwischen wieder aufgewacht, liegt auf immer. „Das ist viel kürzer.“ Ich setze den Blinker um und verärgere den Autofahrer hinter mir. Eigentlich habe ich als Richtung Genua ausgewählt, die Richtung, für die ich mich immer in den vergangenen Jahren, allerdings ohne die Begleitung meiner Mutter, entschieden habe. Sollte ich mich zwanzig Mal geirrt und immer einen Umweg gefahren sein? Aber Rose ist hier noch viel öfter unterwegs gewesen, zuerst mit ihrem Mann, dann selbstständig.
Ich biege ab. Das war gerade eben der Moment, in dem mein Unterbewusstes entschied – und mein Harmoniebestreben, mein Anlehnungsbedürfnis selbst bei einer offensichtlich geschwächten Mutter, das verdammte schlummernde Verlangen nach Geführt-Werden wieder einmal die Oberhand erlangt hat. Während ich nicht wie gewohnt Genuas Autobahn wählte sondern der Erfahrung meiner Mutter Tribut zahlen wollte, wusste ich doch sofort, dass es falsch war. Es war ein sehr heißer Tag gewesen, und so ist auch die Nacht. Plötzlich spüre ich meine Müdigkeit doppelt.
Die erste, die zweite, die dritte Abzweigung kommen mir völlig unbekannt vor. Als ich damit beginne, die italienischen Ortsnamen an den Abzweigungen laut von mir zu geben und immer dazu frage: „Aber du bist dir sicher?!“, wird meine alte Mutter, die zunächst darauf beharrt hatte: „ja, natürlich!“ immer stiller, immer unsicherer, bis ich bei der nächsten Tankstelle halte und draußen betont ruhig die Karte studiere. Und sehe, dass Piacenza viel zu weit südlich liegt und in eine falsche Richtung führt. Der Name aber hat mir immer wie eine gute Bekannte im Ohr geklungen, wenn ich ihn laut gesprochen habe: Piacenza – so ist es wohl auch Mutter Rose ergangen. Piacenza führt nach Venedig.
Als ich ins Auto zurückkehre, sitzt meine müde Mutter versteift wie ein erschrockenes Eichhörnchen auf ihrem Beifahrersitz und räumt sehr leise ein: „Es ist ja zehn Jahre her, dass ich zuletzt gefahren bin.“ Und nach einem Herunterrutschen im Sitz, dass sie Piacenza wohl mit Alessandria verwechselt habe. Ja, was eine Abkürzung gegenüber Genua sei, wenn man zum Schluss auf die Autobahn nach Ventimiglia wolle, ergänze ich besserwisserisch. Und versuche dann, jetzt selbst erschrocken über meine Haltung, das Eichhörnchen neben mir zu beruhigen.
„Ich wusste es eigentlich“, sage ich zu ihm. „Aber ich bin immer so harmoniesüchtig und wollte nicht rechthaberisch sein, weil ich das hasse.“ „Ach, du auch?“ „Es ist zwar jetzt eine Stunde Umweg in der Nacht, – aber es hätte Schlimmeres passieren können!“ „Das stimmt.“ Danach war eine halbe Stunde lang Ruhe, in der die ich den Irrweg zurückraste.
In dieser Zeit sprach ich nur innerlich mit mir selbst: Du willst es immer richtig machen und erreichst doch oft das Gegenteil: Das reicht jetzt eigentlich – mit 50 Jahren! Ab heute versuchst du in entscheidenden Situationen endlich auf dein Gefühl und deine Erfahrung mehr zu geben als auf die Äußerungen anderer – auch wenn du diese anderen noch so sehr liebst!
„Die nächste Zahlstation musst du aber übernehmen, eine kleine Strafe muss sein“, sage ich lachend nach der halben Stunde zur Mutter. Rosemutter grinst zurück, rutscht im Sitz hoch, streckt die Beine aus und öffnet ihre zusammengedrückten Hände: „Na klar, ich Trottel!“
Ich war dann nicht mehr wütend, nur ziemlich erschöpft, erschöpfter als meine alte Mutter, als wir nach 13 Stunden aus Köln in der Blechkarosse endlich ankamen auf einem Hügel in Ligurien über dem Meer, auf dem unser Haus steht. Die Frösche in den Zisternen begrüßten uns mitten in der Nacht in der lauen, würzigen Luft, die immer wie ein erotisierendes Parfum auf mich wirkt. Der Mond beschien den Wein in meinem Glas, den ich vorm Schlaf zu den schwarz-braun-grünen Oliven trank, während ich meine Mutter gerade noch davon abhalten konnte, die Terrasse sofort um zwölf Uhr nachts mit kompliziert anzubringenden Lampen hell zu erleuchten. Sie war schon dabei, die langen Elektroschnüre um die eigenen Beine zu wickeln.
Kurz vorm Einschlafen dachte ich noch: Entscheidungen. So hast du jüngst mit einer zu schnellen, freundschaftlichem Rat folgenden, Entscheidung einen Großteil deiner väterlichen Erbschaft fehlinvestiert. Was ist es, fragte ich mich, das dich gerade so traurig macht? Obwohl du hier doch eigentlich dein Glück zurückgestrahlt bekommst. Dass du oftmals aufs falsche Pferd gesetzt hast, wenn du anderen mehr als dir selbst trautest? Oder ist es das: dass du dir mehr trauen musst als denen, die du liebst?
Das zweite macht mich traurig, dachte ich in meinem schmalen Bambus-Bett, das mir sicher am nächsten Morgen, der schon deshalb freudig beginnen würde, den Blick auf eine sonnige Terrasse, auf Palmen, Olivenhänge und das Mittelmeer gewähren würde.
Es ist zwar schön, Selbst-Vertrauen zu haben. Aber nur noch das zu haben, ist auch der endgültige Abschied von der Kindheit. Vielleicht ist es das: ich verabschiede mich langsam von meiner Mutter. Und vielleicht zum letzten Mal von meiner Kindheit.
Es scheint notwendig. Meine Mutter lebt nicht mehr als Mutter, davon hat sie sich selbst schon gelöst, sogar eigentlich nicht mehr als Großmutter ihrer neun Enkel. Sie ist jetzt darauf angewiesen, dass wir manchmal auch Entscheidungen für sie treffen, obwohl es sie rebellisch macht. Und damit das, was sie eigentlich nie war, aus ihr herausholt! Und das darf mir, auch wenn ich noch so sehr dazu neige, nicht peinlich sein. Sie sollte mir nicht peinlich sein in ihrem Alter…
Wenn du für dich ganz und gar – und manchmal für sie mit – ganz selbstverständlich Verantwortung trägst, dann wird es keinen profunden Streit geben. Das sagte mir ein Gefühl, das schon aus dem Gebiet des Vorschlafes kam und mich mitnahm in ein tiefes und wie von einer großen Welle erzeugtes wohliges Wegtauchen. Schlafen war für mich immer eine Wonne gewesen.
Ewige Pionierin
Heute Nacht hat meine Mutter sehr viel gehustet. Im Sommer ist das nicht ungefährlich. "Ja, ich habe auch schon eine Woche lang so blöde Halsschmerzen“, sagt sie. „Ich gurgele nachher mal, das hilft bestimmt!“
„Was hast du denn für Gurgelzeug mit? Seit wann gurgelst du denn so etwa“, frage ich möglichst beiläufig.
„So eine Woche schon. Das ging in Köln los. Hab‘ mich wohl bei Kurt angesteckt, der hatte ’ne Grippe von der Dienstreise aus Russland mitgebracht. Ich nehme mein Vademecum.“
Ich beschloss, mit meiner sehr zart gewordenen Mutter zur deutschen Ärztin nach Imperia zu fahren, die ich sowieso schon lange kennen lernen wollte. Der Husten musste lieber bekämpft werden, ehe er zur Bronchitis wurde. Eine Woche Halsschmerzen ohne Linderung kam mir übermäßig lang vor, auch wenn man keine Hypochonder ist. „Na gut“, kam es aus dem Badezimmer, „wenn du sie mal kennen lernen willst. Ich habe ja meine Versicherungskarte dabei.“
Meine beiden Eltern haben Berufe gehabt, die mit dem Körper zu tun hatten. Sie war vor der Heirat Krankenschwester gewesen, er bis zu seinem frühen Tod Arzt. Auch mein Vater, dachte ich, als ich meine Mutter mit nacktem Oberkörper im Zimmer der deutschen Ärztin auf der Untersuchungsliege sitzen sah, hat sich um seinen Körper einen Schnurz, wie er sagen würde, gekümmert und lässig mit Medikamenten an sich selbst herumexperimentiert. Lieber das, als sich Kollegen auszusetzen. Er war nie als Patient in einem Krankenhaus. Sein Vater sei unter dem Messer gestorben, bei einer simplen Gallenoperation.
Mein Vater war mit 56 Jahren, zum ersten Mal seit seiner eigenen Geburt nach einem ‚Herzschlag‘, wie es hieß, im Krankenhaus gewesen, und das nur noch in der Pathologie.
Meine Mutter sitzt jetzt wie ein Vögelchen mit den Flügelenden im Schoß vor der rundlichen Ärztin mit dem freundlichen Lachen, die ihren Schlund beguckt und ihren Hals befühlt. Der Schlund ist sehr stark gerötet. Als ihr die Brust abgehört wird, atmet sie fast schüchtern. Brav lässt sie sich wie ein junges Mädchen aus anderen Zeiten die Antibiotika verschreiben, niemand merkt, dass sie selbst einmal Krankenschwester war. Obwohl sie dann, wieder angezogen, erzählt, dass sie in Berlin Diakonie-Schwester war. Sie kommt darauf, weil die Ärztin durch ihre Herkunft aus Berlin und ihren von dort vertrauten Humor, ihre ungekünstelte Art, ihr Vertrauen erweckt hat. Ihr Mann sei auch Arzt gewesen, sagt Rose jetzt fast nebenbei. Ich merke, dass dies ein Versuch ist, als Kollegengattin vielleicht gratis behandelt zu werden, wie es früher üblich war. Aber die Ärztin reagiert nicht darauf, und Mutter muss doch die 100 Euro zunächst selbst bezahlen, da ihre Krankenkasse erst im Nachhinein den Großteil der Rechnung begleicht. Die Frau Doktor ist angetan von der alten Dame, das merke ich sofort, sie nimmt jetzt alle Daten und Medikamente im Computer auf, weil sie hört, dass die Familie ein Haus oberhalb eines der alten Dörfer in der Gegend hat, die sie gut kennt. Wahrscheinlich wird die alte Berlinerin aus Wannsee noch öfter kommen.
Während der Datenaufnahme, die die beiden spielend ohne mich bewerkstelligen und dabei Hinweise auf Berlin damals und heute austauschen und dann bald auch – wie immer – über das preußische Damenstift geredet wird, in dem meine Mutter jetzt lebt, sinniere ich darüber, warum das Körperliche, nicht nur das Kranke, in einer Familie, deren Mutter eine solch körperliche, sinnliche Frau, eine Ex-Krankenschwester war, so wenig eine Rolle gespielt hat. Es stimmt nicht, denke ich, es hat eine große Rolle gespielt, aber es wurde negiert oder gering geschätzt.
Es musste Drogen geben, Depressionen, Verwirrungen, Abtreibungen, frühen Kindstod, Promiskuität und Herzschlag, Altersdemenz und angedeutete Manien, vielleicht weil es abgedrängt und niedergehalten oder auch niedergemacht wurde. All das Körperliche, das Sinnliche, das Erotische, aber auch das seelisch Ungeordnete, das psychisch Randständige, das in der Literatur für meinen Vater so interessant, im Leben aber so bedrohlich war, musste verdrängt werden. Und das in einem Haus, in dem der Vater nicht nur Neurologe, sondern auch Psychiater war.
Mit Macht brach sich das Seelische und Psychische durch die Körper und die psychischen Leiden Bahn. Und gleichzeitig war da eine fast verrückte Kraft, dem Scheiternden Form zu geben, der Einsamkeit einen individuellen Ausdruck, im Niedergang etwas neu Definiertes zu suchen. Diese Kraft zum Neuanfang, zum ganz anders machen, zum noch einmal anders von vorn, haben alle fünf Kinder, die teilweise längst wieder Eltern geworden sind, von ihren Eltern und Großeltern erhalten. Am meisten von ihrer Mutter allerdings, der ewigen Pionierin, denke ich vor mich hin, während meine Mutter sich ankleidet. Diese Kraft habe ich von der süßen Verdrängerin geerbt, der Frau, die „Is doch piepe, ganz egal, wurscht“ genauso gern sagt, wie „Ist das nicht wun-der-bar?!“
„Natürlich habe ich gut geschlafen – dafür lege ich mich hin!“ Oder „Ich bin doch nicht aus Zucker!“ sind auch solche Worte meiner Mutter. Ihr Leitspruch ist der von Erich Kästner, was ich erst sehr spät erfahren habe, ich weiß gar nicht, ob unsere Mutter die Herkunft kennt: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Aber auch etwas Anderes, im Alter immer deutlicher zusammengefasst: „Ich bin eben für Harmonie.“
Das hieß, denke ich, während ich ihr den Reißverschluss des langen orangefarbenen Leinenkleides, das sie sich von mir für den Stadtgang geborgt hat, zuziehe: Streit ist mir zuwider, ich beiße die Zähne zusammen, bis das Gewitter sich verzogen hat und ich endlich wieder mit der Sonne strahlen kann. Ich ziehe vielleicht vorübergehend ein bisschen den Kopf ein – und versuche, besonders liebenswert zu dem zu sein, der gerade das schlechte Wetter macht und die schlechte Laune, die ich eigentlich hasse, verbreitet.
Ich selbst kenne diese Haltung sehr gut, sie ist tief in mich hinein versenkt und träufelt sich wie Gift in Wiederholungssituationen in meine Venen.
Eins fällt mir hier sinnierend wieder ein, beim Autofahren an der Riviera-Küste entlang, nachdem wir in der Apotheke vor der Siesta gerade noch das Antibiotikum erhalten haben: Du bist untreu, meine schöne Mutter, bei aller Harmoniesucht untreu denen gegenüber, denen du eben noch alles recht machen wolltest, untreu denen gegenüber, die sich gerade sicher und geliebt bei dir fühlen, weil du sie so annimmst, wie sie sind, untreu nämlich, wenn ein anderer, dir wichtigerer Mensch auftaucht. Dann ist dieser dran, dann wird er sich bald als derjenige fühlen, der ganz so, wie er ist, von dir akzeptiert und überschwänglich angenommen wird. Der andere ist dann schnell vergessen, schlagartig unwichtig. Es scheint daher zu kommen, dass du es eben nur den anderen, nicht dir selbst recht machen willst. Es nicht anders gelernt hast. Nicht anders glaubst, geliebt zu werden. Und das gibst du bis heute weiter, das irritiert nun auch schon unsere Kinder an dir. Wann warst und bist du eigentlich wirklich aufgehoben und du selbst?
Wann warst du du selbst? Darüber werde ich wohl noch beim Tod meiner Mutter grübeln.
Ich muss sie noch zu ihrem Testament animieren, so wohl sie sich gerade fühlt, gerade hier in Italien, beschließe ich. Da haben wir Ruhe. Sie schiebt es immer wieder vor sich her, dabei will sie es. Ich habe selbst mein eigenes Testament in diesem Urlaub geschrieben, ich will es meinem Mann zuschicken, ehe wir Frauen die zweitägige Autofahrt nach Hause antreten. Mein Wille geschehe, geht es mir durch den Kopf. Wenigstens beim Testament!
Mein Wille geschehe. Von einem Onkel in mein Poesiealbum die Verse geschrieben: Ich will, das Wort ist mächtig, spricht‘s einer ernst und still – Die Sterne reißt‘s vom Himmel, das eine Wort: Ich will! Ganz leise gesprochen, aber innerlich laut – beim Schreiben, das ich von klein auf deshalb in der verrückten, lauten, lebendigen Großfamilie so brauchte und liebte. Dann gehörte ich mir. Es war der einzig mögliche Rückzug und der Ort meines stillen Eigensinns. Alles erschuf ich hier selbst, nichts war verbraucht und besetzt, alles voller Verheißung! Später erfuhr ich, dass dieser Großonkel Nazi war und auch im Inneren blieb. Seine Tochter ist es bis heute und sitzt für ihre Überzeugung sogar im Gefängnis.
„Weißt du, man wird doch jedes Jahr weniger“, sagt meine Mutter, als wir durch Riva Ligure, einen kleinen Ort ganz nah am Meer fahren. „Wenn ich denke, dass ich hier noch vor einem Jahr mit der Brasilianerin Samba getanzt habe, sie halbnackt und ich in Hosen. Wie die mich einfach mit sich riss bei diesem Straßenfest am Meer! Und heute gehe ich mit diesem Stock.“
Das war nicht vorigen Sommer, sondern vor zwei Jahren, ich war dabei, ja, ich weiß. „Das war schon klasse! Aber es war vor zwei Jahren. Du wirst nicht jedes Jahr weniger. Jetzt hast du erst mal eine lange Pause lang Zeit, denn man altert doch eher in Schüben.“ Habe ich jedenfalls beobachtet.
Rauflust
Eigentlich bin ich eine Pflanzenbewahrerin und eher Sammlerin von Pflanzen, um sie in meinen heimischen Staudengarten zu versetzen. Aber an diesem Nachmittag siegte die eruptive Lust, mir einen optimalen Freiluftarbeitsplatz zu schaffen. Nachdem ich die Oleanderbüsche im Garten über dem Meer von braunen, trocken-verschrumpelten Blüten befreit hatte, wozu ich die bloßen Hände nahm, obschon ich weiß, wie giftig die Blüten sind, fiel mein Auge auf einen Durchblick ins Hinterland auf ein Dorf, das mir sofort sagte: Hier in diesem Oleanderhain, den niemand einsehen kann, mit dieser Aussicht auf das mittelalterliche Dorf Lingueglietta am anderen Oliventerrassenhang, hier ist der ideale Arbeitsplatz!
Eben noch war ich eher wie ein alerter Prominentenfriseur mit den Händen zart durch die Oleanderköpfe gegangen und hatte so die noch aufgehwilligen rosa Blüten gerettet. Jetzt hatte ich Rauflust im Blut. Und zwar störten mich plötzlich die abgestorbenen, trockenen Zweige einer Mimose, die hinter dem Oleanderbusch genau dort stand, wo der ideale Arbeitsplatz mit seinem präzisen Weitblick begann.
Ich konnte es nicht mehr erwarten, hier einen Tisch hinzustellen und mein Schreibwerkzeug zu holen, der Gang hoch ins Haus, dann in den Keller, um eine Säge zu holen, war plötzlich eine vergewaltigende Zumutung. Die schwarzen Zweige der Mimose mussten weg und zwar sofort! So knickte ich und brach und bog und drehte mit der Hand, sodass die Mimose, ausgerechnet eine Mimose, mal leicht, fast erleichtert nachgab, mal trocken splitterte und fast ein Stöhnen von sich gab, mal anklagend widerstand und trotz Trockenheit mit einem Rest von Saft im Zweig wieder hochschnellte zum Ausgangspunkt der Zweigbiegung.
Am Ende hatte ich mir den Durchgang zum Arbeitsplatz tatsächlich geschaffen, unter dem Baum lag ein Haufen trockener Zweige. Die Mimose sah jetzt aus, als hätte ein pubertärer Sturm in ihr gewütet, der für die Manneskraft eines Orkans schon einmal geprobt hat.
Und plötzlich fühlte ich tiefes Mitleid mit ihr – und schlechtes Gewissen.
Ein Glück, dass der Gärtner morgen kommt, sagte ich mir, er kann die Spitzen, Stümpfe und Splitter sicher absägen, und ich werde sie dann mit gelbem Baumwachs bestreichen. Wie konnte ich nur gerade einer Mimose so etwas antun, dachte ich schuldbewusst.
Weil ich eben selbst keine Mimose bin, ich tu mir ständig so etwas an! Im Grunde ist mein ganzes Leben von solch wütenden Stürmen durchzogen, … die ich nicht selten selbst ausgelöst habe.
Doch ehe ich mich nun unter die Mimose in der Nachmittagsbrise und zwischen die niedrigeren Oleanderbüsche auf den leeren und anregenden Platz setzte, sammelte ich Mimosenzweige auf, schnitt die wenigen noch grünen Spitzen ab, die es gab, und füllte die braune Bodenvase aus Terracotta, die aussah wie eine ausgegrabene Amphore, mit den zarten Zweigen. Die kamen so auf der Terrasse ganz anders zur Geltung als am Ende von schwarzen absterbenden Ästen. Der starke wie zarte Baum hatte sich, eingeschränkt durch Oleanderzweige, die in ihn hineinwuchsen, im unteren Teil nicht mehr entfalten können. Das beruhigte mein schlechtes Gewissen etwas.
So ist es gut, dachte ich, atmete aus und konnte endlich die ersten Sätze über meine verwundete Mimose schreiben.
Die Motor-Falci
Niemand hat je als Gärtner einen solchen Wüterich engagiert, denke ich, als ich, wie eine amerikanische Siedlerfrau vor dem Angriff marodierender Horden, am nächsten Morgen die schwere breite Terrassenjalousie herunterziehe, weil Steinchen in Massen gegen die großen Glasfenster zacken.
Schon wieder ein Fehler! Aber er hält sich in Grenzen, der Mann muss geführt werden, beschließe ich. Wir hatten ihn selbst gestern bestellt.
Und, heute züchtig im wadenlangen weißen Leinenkleid, beobachte ich aus geringer Entfernung im Motorlärm einer Falci (motorbetriebene Sichel) den italienischen Scheingärtner, denn er ist eigentlich Maurer von Beruf, der das Gerät vor seinem Bauch zum Abschleifen jeglichen Grases und Krautes bohren, wegputzen und fressen lässt. Auf diesen hinter seinem Gesichtsschutz aus klarsichtigem Plastik geschützten jungen, schwitzenden Mann in Gummistiefeln schreite ich jetzt gerade entschlossen zu. Die rotierende Scheibe, die Steine, Sand und Holzreste um sich schmeißt, scheint den Mann mehr zu führen als er sie. Da muss man, auch wenn es lästig ist, auf Tuchfühlung bleiben! Diesen Entschluss spiegelt mein Gesicht mit den zusammengezogenen, eher feinen Augenbrauen, die ihm aber durchaus etwas Grimmiges geben können.
Zu spät – schon hat er die Regenrinne skalpiert und schleift gerade den zart an einem toten Pinienstamm hochrankenden Jasmin. Nun entdecke ich in seinem, so scheint es, schmerzverzerrten Gesicht, die Augen sind nur noch Schlitze: eine Zigarette. Der Rauch steigt dem Bekämpfer der natürlichen Widersacher in die Augen. Hinter dem Schutzpanzer für das Motorölfreie Atmen raucht er, bei seiner schweißtreibenden Arbeit!
Ich kann es nicht glauben und muss plötzlich lachen. Das muss ich festhalten, denke ich, und wäre am liebsten, als sei mir gerade ein wichtiger Einkauf eingefallen, zu Zettel und Stift geschlichen.
Der Italiener aber hält mich in Atem, denn er erledigt, stämmig, rotblond und mit angehender Vollglatze, seine Arbeit im Garten molto rapido. In zwei Stunden wird alles hinter uns liegen. Als er gerade die abgesägten Äste einer toten Pinie, wozu er naturgemäß eine Kettensäge benutzt, die schon läuft, als er von seinem dreirädrigen Wagen, einer Ape, den Häuserhügel hinauf robotert, als er die Pinienäste gerade über die Oleanderhecken der Nachbarin in deren liebevoll aus Deutschland importierten Staudengarten werfen will, stoppe ich den Roboter in mangelhaftem Italienisch, aber gebieterisch: „No, mi dispiace! È il giardino de la signora soppra. Non è possibile! Molto rumoroso!“ Womit ich andeuten will, dass es großen Ärger geben würde. Rumoroso ist einfach ein Lieblingslautwort von mir, ob es passt, weiß ich gerade überhaupt nicht. Macht aber nichts. Er versteht auf alle Fälle, stoppt schwitzend, überlegt kurz, jachtet dann hinter die Oleanderhecken, um die dicken Zweige wieder zurückzuschnappen und sagt achselzuckend etwas von „Okay….brucciare“. Brucciare? Verbrennen?
„Si, io faccio un fuoco, domani!“ Dabei fuchtelt er mit den Armen von unten nach oben.
Ein Feuer also, nun gut, nicht hier. – Im August, denke ich erstaunt und sage: „Si, grazie! E quant’è tutto?“ Wieviel kostet alles?
Ich denke mir schon, dass Falci, Kettensäge, das Feuer und davor der Abtransport an einen geeigneten Ort nicht billig sein werden.
Alles zusammen 100 – „Cento E-oro!“ höre ich dann. – Glück gehabt. „Va bene, das geht. Grazie!“
Das Neupflanzen eines Jasmins, das Ersetzen eines Stückes Regenrinne muss ich allerdings drauflegen… Nicht so kleinlich, meine Gute, sage ich mir, als ich wieder in meine alten schwarzen Rauhleder-Shorts steige, du hast ja gerade noch einen Nachbarschafts-Streit mit anschließenden Transport- und Beseitigungskosten, wenn nicht gar Gerichtskosten verhindern können. Denn die runde Summe von 100 Euro hätte der Mann ja eh genommen. Er will schließlich nächste Woche mit Familie nach Gargano in den Urlaub fahren.
Nun ist unser hügeliger Garten schön kurz gemäht, etwas gerupft. Aber Oleander und Ginster, auch die Marone auf der Terrasse sind von unten wieder gut zu sehen, wenn man auf der unteren Sonnenterrasse nach oben auf die nachmittags im Schatten liegende obere blickt. Und auch der Blick auf’s rombenförmig zusammengedrängte, abschüssige Dörfchen mit seinem sandfarbenen mittelalterlichen Kirchturm ist wieder fast freigelegt.
Innen und außen
Mit dem dritten Auge sehen, das sollte man üben – hatte ich in einem Ratgeber-Buch gelesen. Erfolgs-Coaching ist das neue Muss. Ich las das Buch, hauptsächlich, weil ich die Autorin kannte.
Ich sehe in Italien, – denn das ist tiefes Weg-Sein für mich – wenn ich nicht gerade das Auto steuere oder Leute beobachte, wenn ich nicht lese oder koche, immer auch mit dem Dritten Auge. Es ist das träumerische, das LoslassAuge. Ich schweife so von der Terrasse über die Hügel ans Meer, ich schwebe vom Meeressaum an den Horizont. Ich sehe eine Gruppe von Tanzenden auf Dorfbällen wie ein sich bewegendes Gemälde aus den dreißiger Jahren. Obwohl das auch beim Lesen passieren kann. Ich erfasse dann nicht, ich will es nicht genau wissen, ich nähere mich an. Eher durch biografisch-assoziierte als hirngeleitet nachdenkliche Reaktionen. Das somnambule, vieles gleichzeitig umfassende, träumerische, das wie mit einem Weichzeichner Schauen kenne ich seit Kindheitstagen. „Sie muffelt gerade mal wieder“, hieß das früher bei meiner Familie. Fremde sagten, warum guckst du denn so traurig, Kleine? In entspannter Verfassung gehen meine Mundwinkel automatisch runter. Die Brauen türmen sich über sinnierenden Augen manchmal schräg.
Später erst, viel später habe ich durch Bücher über Wahrnehmung oder das Sehen erfahren, dass ich schon immer mit dem Dritten Auge parallel zu meinen anderen beiden, durch die Dinge hindurchgeschaut oder -geahnt hatte. Das war vielleicht mein Glück bei meinem Erfahrungshunger. Ich liebe es Menschen zu beobachten, sie wahrzunehmen – oder aufzunehmen, wäre vielleicht besser gesagt.
Ohne zu sezieren, ohne sie stören zu wollen, sie zu beglotzen: Standbein-Spielbein, der Blick geht vom Weichzeichner kurz in die Schärfe und wieder zurück. Nur manchmal guckt jemand kritisch in der U-Bahn oder dreht sich sogar auf seinem Weg oder an der Ampel herum, weil er sich von hinten von mir angeschaut fühlt.
Mit meinen Fragen war es schon früh genauso. Manchmal hatten in meiner Jugend Leute, auch älter als ich, mit Erstaunen, manchmal auch mit Befremden festgestellt, dass sie mir „jetzt alles über sich erzählt“ hatten. Eigentlich, ohne es zu wollen. Und dabei hätten sie jetzt gar nichts über mich erfahren!
Mit den Jahren hatte ich dann, weil wenige mich über mich zurück befragten, ein bisschen immer auch über mich selbst eingestreut. Meist war das dann gutes Stichwortmaterial für die weitere eigene Rede der Gegenüber gewesen. Doch die Menschen hatten sich dadurch ganz anders gefühlt. Nicht ganz so auf dem Präsentierteller. Obwohl manche das Einstreuen meiner eigenen Erfahrungen auch gar nicht gern mochten, es sie vom eigenen Assoziationsfluss ablenkte. Das merke ich heute schnell und stelle sofort meine Einschübe ein.
Mit dem Dritten Auge kann man auch sich selbst betrachten. Man sieht sich, obwohl wie durch einen Schleier, gleichzeitig klarer: mit Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verknüpft. Ich sehe mich dann als Teil eines Ganzen und als Einzelne. Angeschlossen außerdem an die Wünsche und Vorstellungen, die ich jung oder ganz jung von mir hatte.
Du siehst und fühlst gleichzeitig, fühlst die Aura, die jeden Menschen, auch den eigenen Körper umgibt. Oder den ‚Äther-Leib‘, wie Rudolf Steiners Anhänger sagten. Meine Großeltern aus Hamburg kannten Rudolf Steiner noch und hatten die Christengemeinschaft mit seinem Weggefährten Rittelmeyer mit aufgebaut.
Als viele meiner ehemaligen linken politischen Wegbegleiter auf Öko-Kurs umschwenkten, plötzlich wie verordnet ganzheitlich dachten, schickten sie ihre Kinder auf Walldorf-Schulen und ließen sie, manchmal auch sich selbst mit Eurythmie therapieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Lehren der Steiner-Anhänger und Christengemeinschafts-Priester längst nur noch als einen spirituellen Fond, als eine der Möglichkeiten zur Erklärung kosmischen Wirkens in meinem Erziehungsschatz, durch meine anthroposophisch angehauchte Großmutter vermittelt und vorgelebt.
Parallel zu Trotzki, Marx und Rosa Luxemburg hatte ich als Studentin immer auch Erich Fromm, Hesse und ein paar Zen-Schriften gelesen, auch als Jungkommunistin und Kommunardin, außerdem Gedichte von allen Autorinnen und Poeten, die ich durchs Studium und Elternhaus kannte und die mir zugetragen wurden.
Nach der agitatorischen Politikphase, in der ich mich engagiert immer fremd gefühlt hatte, war bei mir dann die selbstanalytische Phase mit einer Therapie in den 30er Jahren gekommen, als meine ehemaligen Genossen noch auf alles, was Psycho war, schimpften. Ich blieb dort gut drei Jahre in der Selbstreflexion, die nötig war, strebte jedoch selbst auf keinen Fall – wie manch andere Analysierte – plötzlich den Beruf der Therapeutin an. Während der Psychotherapie trennte sich mein langjähriger Freund von mir, nach sieben Jahren Liebe, in drei unterschiedlichen Wohngemeinschaften gelebt. Das heißt, ich warf ihn aus der Wohnung. Es war nicht das verflixte siebte Jahr gewesen, obwohl eine andere Frau in das Leben meines Freundes getreten war. Eine Entwicklung, die sieben Jahre gedauert hatte, war einfach mit 34 Jahren abgeschlossen gewesen. Eine Trennung von uns war nur konsequent. Trotzdem war es ein tiefer Abschiedsschmerz von diesem Mann – Schmerz, dass wir es nicht zusammen geschafft hatten. Schmerz, dass mir Zweisamkeit, die ich so ersehnte, so schwer fiel. Es tat auch weh zu sehen, wie eine andere Frau sich unbedingter auf ihn einlassen und ihm wirklich helfen konnte. Ich nicht.
Trennungen: Gleich nach der Geburt von meiner Mutter, weil sie mit Tuberkulose in eine Lungenheilstätte kam, für fünf lange Monate. Ich blieb mit meinem älteren Bruder bei den Großeltern, bei denen wir in Hamburg nach dem Krieg untergekommen waren. Mein Vater war als Sanitätsarzt aus englischer Gefangenschaft und meine Mutter als Kriegskrankenschwester auf der Flucht vor den Russen nach Hamburg gekommen.
Mit 16 wurde ich später von der Berliner Großfamilie entfernt, weil man mich in einem Internat streng evangelisch erziehen und mir die erste sexuelle Beziehung austreiben wollte. Mit knapp 19 verließ ich das Elternhaus und zog mit einem Mann in Hamburg zusammen, um frei von Bevormundung zu sein.
Mit 21 habe ich mich von diesem Dauerverlobten, einem Künstler, getrennt und nacheinander einige junge Männer kennen gelernt und geliebt, bis ich mich mit 26 Jahren länger band. In diesem 27. Lebensjahr hat mein Vater uns alle verlassen, weil er plötzlich gestorben ist. Er war für mich mit 55 Jahren damals alt. Und ich fühlte mich jung und frei und war gerade neu verliebt, in den Mann, an den ich mich sieben Jahre lang band.
Heute war ich allein in St. Paul de Vence in der Provence. Ich wollte allein sein. Es war leicht gewesen, dies allein zu planen. Meine Mutter war schon dreimal dort gewesen und wollte den Tag nutzen, um die letzten der 50 Briefe und Karten zu schreiben, die von Italien aus an Freunde, Verwandte und Bekannte geschrieben werden mussten. Es gab Briefschulden, wie sie sich ausdrückte. Nicht nur, dass ihr Geburtstag, bei ihren alten Freunden in Köln begangen, mit vielen postalischen Gratulationen hinter ihr lag, sie hatte auch sonst regen Briefverkehr.
„Meinen 50. Brief habe ich gerade beantwortet“, würde sie am Abend sagen, wenn ich aus der Provence wieder ankommen würde.





























