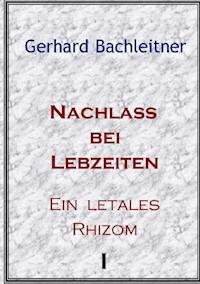
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Ein gebildeter, aber sozial ausgegrenzter jüngerer Bruder von H. C. Andersen, - ein Dorian Gray, dessen Traum von der ewigen jugendlichen Schönheit nochmals anders als bei O. Wilde enttäuscht wird, - ein künstlerisch hochbegabter weißer Rabe, der seinen Entdecker nicht nur zum Staunen bringt, - und eine makabre Kontrafaktur auf Kafkas bereits ausreichend makabre "Strafkolonie", auch als "komponierte Interpretation" seines "Prozess"-Romans zu lesen, dies sind Personen und Schauplätze der hier versammelten Erzählungen, die auf formal zuweilen ungewohnten Wegen ihre letale Erfüllung finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
TETRALOGIE DER AUSSENSEITER
E
IN ANDERES
A
NDERSEN
-M
ÄRCHEN
D
AS
B
ILDNIS DES
D
ORIAN
G
RAY
D
ER
R
ABE VOM
S
EE
I
N DER
L
USTKOLONIE
A
NHANG
Vorwort
Der Titel Ein letales Rhizom impliziert eine wertende und eine strukturelle Aussage. "Letal" läßt an eine tödliche Krankheit denken, Rhizom meint eine bestimmte vegetative Wurzelwuchsform und findet sich bei französischen Philosophen im übertragenen Sinne als Bezeichnung für eine Denk- und Argumentationsform. Das erstere Attribut wurde in manchen Phasen dieses Lebens und dieser Autorschaft tatsächlich in einem emphatischen Sinne verstanden, und in vielen der folgenden Erzählungen und Reflexionen erscheint der Tod als zentrales Motiv. Insgesamt betrachtet läßt sich die vorliegende Werksammlung jedoch auch neutral als Spiegelung jener philosophischen Einsicht lesen, die das Leben als Sein zum Tode bestimmt hat.
Rhizomatische Form hat dieses Werk unabsichtlich, aber auch ungehindert angenommen. In den Erzählungen dieses ersten Bandes hat sich die Verschränkung wie von selbst ergeben, und in den diskursiv-philosophischen Texten der folgenden Bände erfordert eine Problemannäherung sinnvollerweise ohnehin Multiperspektivität. Im übrigen erleichtert die rhizomatische Form die Texterstellung, weil keinem vorgefaßten Ziel zugearbeitet werden muß, sondern immer nur so viel angelagert und verknüpft wird, als jeweils nötig und verantwortbar erscheint.
Ein anderes Andersen-Märchen
Hans Christian Andersen hatte einen jüngeren Bruder, Hans Parvus getauft. Er selbst deutete das H.P. jedoch gewöhnlich als Hans Pauper.
Hans Christian sperrte ihn in den Kleiderschrank ein und ließ ihn nur heraus, wenn sie beide unbeobachtet waren. So blieb der arme Mensch den Zeitgenossen und auch der forschenden Nachwelt verborgen. Daß der kleine Hans nicht am sozialen Leben teilnehmen konnte, führte freilich zu immer wiederkehrenden Streitgesprächen.
"Es ist schlimm genug, daß ich meine Visage mit dir teilen muß," jammerte Parvus etwa, "und jeden Tag mein Spiegelbild leibhaftig vor Augen habe. Wie soll da etwas aus mir werden?"
"Ich muß mit oder trotz dieser Visage unter die Leute, mich beliebt machen und Geld verdienen, vergiß das nicht," wies ihn Hans Christian zurecht.
So übte der Dichter zwar Macht über seinen Bruder aus, doch half ihm das in seinen eigenen Angelegenheiten trotzdem nicht.
Als Hans Christian wieder einmal sein trauriges Dasein beklagte, das auch seinen Märchen oft einen traurigen Ton verleihe, schlug der kleine Hans zurück.
"Weshalb beklagst du dich, daß dir keine Frau zu willen sei? Du vermerkst doch jeden Geschlechtsakt rot in deiner Kladde?"
Hans Christian: "Das will nichts heißen. Es sind vorgestellte Geschlechtsakte," gestand Hans Christian seufzend zu, "und vielleicht nicht einmal das. Ein Organ will sich betätigen - oder betätigt werden -, doch wie unendlich weit ist der Weg von einem solchen Gefühl zu einer ausgearbeiteten Choreographie mit einem anderen, fremden Wesen eigenen Rechts! Ich muß mir auch die Liebe erdichten."
"Oder aus den Fingern saugen," vergröberte HP patzig diese Selbstdarstellung.
"In meinem Bildungsgang war nicht vorgesehen, Liebe zu erlernen," "Deshalb hast du einschlägige Studienreisen nach Paris unternommen, weg vom prüden, protestantischen Kopenhagen in den Sündenpfuhl der Liebe."
"Immerhin gehört dies auch zum bürgerlichen Habitus. Ich folgte nur den Konventionen meines Standes."
"Du bist ein larmoyantes Glückskind des Schicksals, Hans Christian, denn du hast es wenigstens versuchen können und die Gelegenheit aufgesucht. Bei mir ist überhaupt nicht abzusehen, wie ich auch nur zu einem Geschlechtsakt gegen Entgelt kommen könnte, geschweige, daß sich mir ein anderer Mensch von sich aus zuwenden möchte."
"Ach HP, Du baust Dir unnötige Hürden auf. Das ist schließlich nur ein Geschäftsakt. Nachdem du mit einer von ihnen handelseinig geworden bist, sorgt sie schon für den Rest."
"Aber warum markierst du jeden Erfolg mit einem Kreuz im Kalender, wenn der Erfolg schon garantiert ist?"
"Ich trage im Haushaltsbuch ja auch die größeren Einkäufe ein."
"Aber Hans Christian, du kannst in diesen fremden Kammern doch nicht wirklich das finden, was sich deine Fantasie vorstellt. In Wirklichkeit bist du schwul, weil du ja erst einmal deinen eigenen Körper erwerben müßtest, ehe du ihn gegenüber dem anderen Geschlecht einsetzen könntest, und das lernt sich nur mit einem gleichartigen."
Hans Christian war leicht zusammengezuckt, was Parvus nicht entging und ihm signalisierte, daß sich sein Bruder durchschaut fühlte. Anmerken ließ er sich jedoch nichts, sondern griff mit dem Werkzeug seiner Einbildungskraft seinem tatsächlichen Leben weit voraus.
"Armer HP. Es ist ein wunderlich Ding um die Liebe. Wirklich sind nur die Eltern-, Geschwister-, Gottesliebe, vielleicht auch, wie nach uns ein Philosoph sagen wird: die Fernstenliebe. Die erotische Liebe ist ein Popanz. Er wird um so größer, je weiter man von ihm entfernt ist. Je näher man ihm kommt, desto geringer wird er, und wenn man vor ihm steht, erkennt man ihn kaum noch, so unscheinbar ist er geworden, so gewöhnlich wie ein Pflasterstein in der Straße oder ein Grashalm auf der Wiese."
"Um so schlimmer, Hans Christian. Dann leide ich Phantomschmerzen um ein Phantomglück."
"Es ist kein Glück, sondern Vollzug der Zugehörigkeit."
"Es ist immerhin jenes Glück, um dessentwillen Engel und Meerjungfrauen auf ihre Unsterblichkeit verzichten."
"Das bilden sich die Menschen ein. Sie mußten ja der Vertreibung aus dem Paradies auch etwas abgewinnen. Wie du dich erinnerst, datiert die Fleischeslust erst seitdem. Man will Proselyten machen."
"Auf mich sind sie dabei aber nicht gestoßen."
"Du bist ja auch kein Engel, HP."
"Mein Heiligenschein erdrückt mich. Siehst du nicht das goldene Wagenrad über meinem Haupte?" Parvus machte eine übertriebene Armbewegung, die Hans Christian belustigte.
"Wenn ich boshaft wäre," erwiderte er amüsiert, "könnte ich dich auf mein Märchen über den Engel verweisen. Dort finden das tote Mädchen und der tote Knabe tatsächlich zusammen, wenngleich erst im Himmel. Und nicht die Meerjungfrau ist unsterblich, sondern die Menschen haben eine unsterbliche Seele."
"Ja, was für ein Hohn. Und noch ein Phantom. Wenn ich ebenfalls boshaft wäre, würde ich aus der Bibel zitieren, oder vielmehr dem Symbolum Nicaeum: Et incarnatus est, auch er hat Fleisch angenommen, wollte leibhaftig lebendig sein."
"Na, was aber auch für ein Fleisch: de Spiritu Sancto. Es ist übrigens nicht überliefert, daß er Sex gehabt hätte."
"Kazantzakis hat es behauptet (oder vielmehr: wird es behauptet haben)."
"Der hat wohl auch et homo factus est mit und er ist schwul geworden übersetzt."
"Sei nicht albern, Hans Christian, als Grieche war er für die Vulgata nicht zuständig. Aber er fand das Interesse für Maria Magdalena etwas auffällig."
H.C. war seinem Bruder etwas unterlegen, was Bildung anging. Kein Wunder, denn während HP immerzu lesen konnte, mußte Hans Christian seinen Trieben nachgehen und an seinem Ruhme arbeiten. Allerdings lernte er viele Leute kennen und machte auch genügend menschliche Erfahrungen, daß er nicht nur seine Literatur damit speisen konnte, sondern seinem verkümmerten Bruder Belehrungen erteilen konnte.
"Man bekommt nie die Konstellation, die einem die eigene Fantasie vorspiegelt. Das sind Fata Morganen, und dein Unglück ist, daß du daran festhältst." fuhr er bei nächster Gelegenheit, vor dem Spiegel des Kleiderschrankes stehend, fort, während HP zum Fenster hinaussah. Dieser drehte sich um und zeigte einen gequälten Gesichtsausdruck.
"Aber was habe ich davon, wenn ein Anderer als ich Anderes erlebt? Man kann eine Rolle spielen, gewiß, und als Autor kann man sich eine andere Welt ausdenken, aber man kann nicht als Anderer empfinden. Was nicht auf eigene Rechnung geht, geht mich nichts an."
"Und weil das so ist, lebst du im Wandschrank, HP."
"Nach uns wird einer eine verborgene Tür darin entdecken, und sie wird ins Königreich Narnia führen."
"Du bist gut unterrichtet, HP, aber dann weißt du auch, daß es dort keine Menschen mit Unterleib gibt. Ich kenne auch jemanden, der eine Kleiderpuppe in den Schrank stellen wird, die das einzige Wesen sein wird, an das er seine Gefühle richten kann."
"Weißt du, was? Ich bin die Kleiderpuppe. Ich bin aus Styropor, formstabil, geschmacksneutral, biologisch nicht abbaubar."
"Soll ich dir eine Styroporin besorgen (oder nennt man das Styroporeuse?), mit Loch. Es wird aber schrecklich quietschen."
"Wie kommt es, daß du in deinen Märchen herzzerreißendes Unglück schildern kannst und als Mensch einen so kranken Ehrgeiz entwickelst? Als ob ich dir im Wege stünde. Du könntest mich wenigstens bedauern, wie deine zahllosen armen und verwaisten Kinder."
"Das will ich auch stets, denn du bist ja mein armer Bruder, aber wie ich schon sagte: man bekommt nie die Konstellation, die einem die eigene Fantasie vorspiegelt. Ein Elend, das sich rhetorisch zu behaupten weiß, ist nicht mehr bedauernswert, sondern wird Gegenstand einer Auseinandersetzung. Was glaubst du, warum ich meine Erlebnisse in Paris suche? Natürlich, das Angebot ist unvergleichlich viel besser als in Kopenhagen."
"Und nicht auszudenken, wie schnell hier die Runde machen würde, welches Werkzeug du wie eingesetzt hast", warf HP hämisch ein.
"Vor allem aber," überging Hans Christian den Einwurf, "halte ich mich in einer Fremdsprache auf. Ich muß nicht verstehen, was die Dienstleisterinnen sagen, und alles, was sie mir sagen können, mag unwahr oder falsch verstanden sein. Meine Vorstellung wird so jedenfalls am wenigsten beeinträchtigt."
"Grauenhaft. Ich hasse dich und deinesgleichen. Du hast es dir eingerichtet, deine Bedürfnisse an das Marktangebot angepaßt. Ich aber bleibe stets ausgeschlossen."
"Eingeschlossen, um genau zu sein."
"Genau, und du bist noch egoistisch genug, als mein Totengräber aufzutreten. Warum erschlägst du mich nicht gleich ganz? Das wäre ehrlicher."
Hans Christian fand es an der Zeit, den aufgebrachten Bruder etwas zu beruhigen. "Ich behaupte ja nicht, daß ich mir auf meine Weise Liebe verschaffen kann. Aber zumindest bin ich unterwegs und kann - für großes Geld in Scheinen - wenigstens das Kleingeld der Liebe bekommen, ein offenes Ohr und ungeteilte, obschon befristete Gegenwart."
Verachtung schnaubend erwiderte HP: "Einander zu lieben, kann doch nur heißen, sich von jemandem berühren zu lassen, der einem wert ist. Du betreibst genau das Gegenteil. Sperr mich wieder in den Wandschrank. Für heute habe ich genug."
Und Hans Christian sperrte seinen armen Bruder wieder in den Wandschrank.
2
Eines ferneren Tages - und dies war keines der von ihm erfundenen Märchen - ging es mit dem Leben des Hans Christian Andersen zu Ende. Seines Bleibens war hier länger nicht, und seiner Liebe oder seines Begehrens danach war niemand mehr bedürftig. HP vergoß eine Träne über den Tod als menschliches Schicksal und grausame Laune der Natur, keine jedoch über den Bruder, der ihm gegenüber ja stets bevorzugt gewesen war. Der Rummel bei Aufbahrung und Beisetzung ging ihm gehörig auf die Nerven, zumal in der Hitze des Augustanfangs, an dem man üblicherweise nicht starb, und froh war er, als der Geschichtenerfinder, der seinen Nachnamen trug, unter der Erde lag.
Behaglich nahm Parvus die Wohnung für sich in ungeteilten Besitz, ohne freilich Nennenswertes zu verändern. Er setzte sich in Hans Christians Lehnstuhl und blickte auf die Photographie, die Hans Christian von sich zuletzt hatte anfertigen lassen und an die Wand gehängt hatte. Im Bücherschrank standen Hans Christians Bücher mitsamt den vielen Übersetzungen. Parvus verstand diesen Erfolg nur teilweise. Die meisten Werke hatte er mit Hans Christian besprochen und viel an ihnen auszusetzen gehabt. Sein Bruder hatte sich aber selten etwas sagen lassen, und dem Erfolg schienen diese Mängel keinen Abbruch zu tun. "Merkt ihr denn nicht, wie umständlich das erzählt wird, wie gewunden die Handlung vor sich geht?" wollte Parvus den Lesern zurufen, "und dann wieder schlampt er und schaut nur noch darauf, rasch fertig zu werden, weil ihn das Sujet selbst schon langweilt. Alle seine Konstruktionen wirken gezwungen, ausgedacht, schief, unnatürlich, und er kann nur Märchen schreiben, weil er nie zu einem vollständigen Menschen herangewachsen ist, der mit seinesgleichen gleichrangigen Umgang gehabt hätte. Weil er selbst keine Person ist, kann er auch keine Person schildern und sie mit anderen in Verkehr bringen, und wenn er mal menschliche Fundamentalzustände trifft, hat er einfach sein Ego und dessen Mängel verlängert. Stört euch denn nicht, wie grausam und böse er immer wieder ist - wenn er gut ist -, weil er grausam und böse sein muß, von keiner liebenden Hand je berührt, ein Torso von einem Menschen? Glaubt ihr denn, ein solcher Krüppel, den man erst zu einem solchen gemacht und dann auch noch zu erschlagen vergessen hat, müsse sich nicht rächen?"
Hans Christian hatte sogar - Parvus wußte es wohl, weil er bei dem betreffenden Beisammensein gelauscht hatte - seinen Freund Chamisso um seinen Schlemihl-Stoff bestohlen. Dieser konnte sich nicht mehr wehren, denn er moderte schon seit Jahrzehnten in der Erde Berlins. Parvus fiel jetzt aber auf, daß Hans Christian mit seinem Schattenmärchen eigentlich die gegenwärtige Konstellation hellsichtig vorausgeahnt hatte. Er selbst, Parvus, war der Schatten, den sein bisheriger Herr so lange von oben herab behandelte, bis dieser ihn überflügelte und in der Gesellschaft diskreditierte. Am Ende verlor der Herr sein Leben, und der Schatten blieb übrig. Auch Hans Christian hatte sein Leben verloren, und Parvus war der Überlebende. Auf ihn strahlte das Licht der Sonne, während der Bruder in der lichtlosen Unterwelt verdämmerte. Parvus sah sein Leben jetzt erst wirklich beginnen.
Er durfte und konnte für sich selbst sorgen und atmete die Luft der Freiheit. Das nötige Geld hatte er vorher im noch gemeinsamen Haushalt bereits beiseite geschafft - schon deshalb, damit es nicht dem offiziellen Erben Collin in die Hände fiel, der es nun wirklich nicht brauchte. Im gesellschaftlichen Umgang hatte er freilich keine Erfahrung und hielt sich schon viel darauf zu Gute, überhaupt die Wohnung zu verlassen und durch einige Straßen Kopenhagens zu spazieren.
Das Tageslicht traf ihn wie ein Keulenschlag, als er aus dem Hause trat, und er zog sich den Hut tiefer ins Gesicht. Er meinte den Energieschwall der Sonne wie eine wuchtige Welle auf seinem Körper zu spüren. Und wieviele Details dadurch ausgeleuchtet wurden! Wer wollte oder sollte das alles so genau wissen? Jetzt begriff er immerhin besser, weshalb die berühmten Autoren der Zeit, die er zuhause gelesen hatte und welche die Wirklichkeit realistisch wiedergeben wollten, Dickens, Hugo, Balzac, Tolstoi usw., soviele Einzelheiten schilderten. Die Sonne brachte alles an den Tag.
Scharf schaute er sich die Passanten an, die ihm darob verwundert nachblickten, denn sie kannten ihn nicht und waren nicht gewohnt, in Frage gestellt zu werden. Tatsächlich fragte jeder seiner Blicke den Anderen, wer er sei und wozu er lebe, wie er zu der gesittet einhertrippelnden Gattin an seiner Seite und dem im Matrosenanzug albern präparierten Knaben neben sich gekommen war oder wie er die Erbauung, die ihm gerade in der Kirche zuteil geworden, wieder in seine übliche, übrige und üble Niedertracht überführen werde.
Die Gemüseweiber auf dem Markt befremdeten ihn ebenfalls. Was hatte ein Kohlkopf damit zu tun, daß ihn die eine Bäuerin für 12, die andere für 10 Öre verkaufen wollte? Parvus fühlte zwischen sich und der Natur eine Phalanx geifernder Händler gestellt. Die Kohlköpfe brauchten auch keine Verteidiger, Mäzene oder Laudatoren. Sie bedurften überhaupt keiner Worte, sondern waren genug, indem sie waren, was sie waren.
Im Hafen beschaute er sich die mächtigen, mittleren und mickrigen Schiffe, eine bunte Sammlung von Riesenspielzeug verschiedener Bauart, aber alle wie seit den Urzeiten des Menschengeschlechtes dem Zweck dienend, Landbewohner und Frachten übers Wasser zu bringen. Parvus bewunderte die vielgliedrigen Takelagen, in denen die Seeleute jedem Fetzen Segeltuch einen eigenen Namen zu geben wußten, und er bewunderte die christliche Seefahrt überhaupt, weil sie einen so erfolgreichen Verbund aus den Naturgesetzen, dem Fahrzeug und einer dieses betreibenden Mannschaft darstellte. An Land gab es freilich noch einen vierten Beteiligten, das finanzierende Geld. Es war kein Zufall, daß man den abstrakten Staat gerne als Staatsschiff verbildlichte. Wohin aber wollte es unterwegs sein? Und wer mußte das Deck schrubben?
Parvus ertappte sich bei dem Wunsch, auf einem der Schiffe mitzufahren, um mehr von der Welt zu sehen. Verführerisch war der Gedanke, daß es nur einiger Wochen Zeit bedurfte, um in einem anderen Erdteil und eine andere Kultur zu gelangen. Die Vielgestalt der menschlichen Verhältnisse war keine Einbildung, sondern auf dem Wasserwege erreichbar und erfahrbar. Daß es nicht einmal vierhundert Jahre, fünf Menschenleben, her war, seit man alle Meere zu befahren gewagt hatte, gab ihm freilich zu denken. Dieser Wagemut und Drang zum Unbekannten war dem Menschen nicht angeboren. Heute jedoch schien Fernweh normal und unvermeidlich geworden zu sein. Jeder Staat verschaffte sich Kolonien, und in der Gegenrichtung wanderten viele Eurpäer aus, teils aus Not, teils aus Geschäftssinn. Die Welt war in Bewegung geraten - und er sollte auf Dauer in dem hübschen, aber langweiligen Kopenhagen sitzen bleiben?
Die Klänge der verschiedensten Sprachen, die er oft nicht einmal identifizieren konnte, streiften sein Ohr, von Reisenden oder Matrosen gesprochen, gesittet oder leidenschaftlich, ruhig oder erregt, melodisch oder scharfkantig. Wozu dieser Aufwand an Verschiedenheit? Schon zu Babels Zeit hätte man Einheitlichkeit vorgezogen. Aber die Klage war müßig und falsch. Wozu hatte der Schöpfer hunderte von Wasservogelarten und nacktsamigen Pflanzen in die Welt gesetzt? Linnaeus hatte den Überfluß und die Ordnung der Natur schon vor hundert Jahren so eindrucksvoll aufgeblättert, ohne auf diese Frage aber wirklich eine Antwort zu geben.
Und war nicht schon innerhalb der eigenen Sprache die Unterschiedlichkeit so groß, daß man sich nur allzu oft mißverstand? Kinder verstanden die Erwachsenen nicht, der Bauer mißverstand den Grundherrn, der Kleriker den Krieger, der Ingenieur den Dichter. Auch in Hans Christians Märchen wütete das Unverständnis. Sogleich fiel Parvus die Meerjungfrau ein, die ihre falschen Erwartungen vom Menschengeschlecht bitter büßen mußte. Ihm wurde jetzt auch klar, wie bequem sich Hans Christian eine Liebschaft gedacht hatte. Hier im Hafenbecken, so hatte er sich sicherlich ausgemalt, möge ein williges Weib auftauchen und ihn begehren. Sie sei seines unsterblichen Geistes bedürftig, da selbst nur bloßes Naturwesen. Und den moralischen Pferdefuß dieser Phantasie hatte er ihr in Gestalt eines Fischschwanzes angedichtet, Fleisch gewordenes Scheitern, Leib gewordene Verfehlung.
Das Hafenmilieu war natürlich etwas anrüchig, doch das war immer und überall so. Hier konzentrierten und exponierten sich männliche Bedürfnisse. Als Attraktion in einer Hafenbar wäre die Meerjungfrau sicher ein großer Erfolg gewesen, deutete Parvus das Märchen um. Sie hätte jeden Kapitän haben können und wäre mit ihm zur See gefahren, wenn sie lange genug an Land gewesen wäre. Ja, wenn man am richtigen Ende anfinge, an der leiblichen Existenz und nicht am Wahngebilde der Seele, käme man auch zu wirklichem Glück.
Hier, als Fremder unter Fremden, als Verschiedener unter Verschiedenen, sah Parvus auch für sein Leben noch den Weg in ein bescheidenes Glück. Da er aber weder Seefahrer war noch ein auswärtiges Reiseziel hatte, eröffnete ihm diese Empfindung keine leichtere Zukunft. Er mußte erst einmal hier in Kopenhagen seinen Platz finden, und hier war er ratlos, weil ihm der gesellschaftliche Umgang bislang verschlossen gewesen war. Vielleicht sollte ich mich als Südseerückkehrer einführen, dachte er, ein Geschäftsmann, den es in die Heimat zieht, um dort am heimeligen Herd und im Hafen der Ehe Ruhe zu finden. Aber sie werden mir den Überseemenschen nicht abnehmen, wandte er gegen sich ein. Diese weltläufigen Gestalten haben eine charakteristische Überlegenheit an sich, eine Sicherheit im Anspruch auf Wertschätzung und Liebe, die man nicht spielen kann. Ich habe in meinem Leben noch kein Ziel erfolgreich verfolgt, wurde er sich mit Schrecken bewußt. Die unfreiwillige Klausur in der symbolischen Welt hatte ihn behindert und beschädigt.
Ausweg sah er vorerst keinen, doch nahm er sich vor, Exkursionen wie die heutige fortzusetzen, um vielleicht mal auf der Uferpromenade oder in einem Park eine zufällige Bekanntschaft zu machen. Er müßte in jedem Falle etwas unternehmen und das Lebensgefühl seiner Gefangenschaft hinter sich lassen. Auf dem Heimweg begann er die Passanten auch schon mit wohlwollenderen Blicken zu betrachten: es waren alles Leute, mit denen er zumindest formal schon auf gleicher Stufe stand und denen er sich bei Bedarf in jedem gewünschten Grade erklären konnte.
3
Schon einige Tage, nachdem er seine Spaziergänge im Tageslicht angefangen hatte, bemerkte Parvus im Spiegel eine Veränderung in seinem Gesicht. Die Haut schien durchsichtig zu werden, sich beinahe aufzulösen. Dies beunruhigte ihn, und nachdem er beim ersten Anblick noch eine Salbe aufgetragen hatte, wagte er es später nicht mehr, die Haut auch nur zu berühren, aus Angst, sie könne ihm unter den Fingern zerfallen. Die Finger selbst, seine beiden Hände, waren freilich ihrerseits in der Auflösung begriffen, ohne daß ihre Beweglichkeit im Geringsten beeinträchtigt gewesen wäre. Er getraute sich jedoch kaum noch, irgend einen Gegenstand kräftig anzufassen.
Allmählich machten sich rote Striemen in seinem Gesicht bemerkbar, so daß er sich auf den Spaziergängen den Hut immer schräger und schützender auf den Kopf setzte. Mit einigem Schrecken wurde ihm vor dem Spiegel dann klar, daß es sich bei seinen Entstellungen um die durchscheinenden Muskelstränge handelte. Die Haut auf seinem Gesicht und den Händen löste sich unaufhaltsam ab. Hervortrat das rote Fleisch der Muskeln, das die Knochen umkleidete, das Geflecht der Sehnen, das pulsierende Geäder der Arterien und Venen und die Steuerungsinfrastruktur der Nervenbahnen. Weshalb sein Inneres nur an diesen Stellen nach außen trat, wußte er nicht, vermutete aber, daß es eine Folge des Tageslichtes sein müsse. Vielleicht hatte der ultraviolette Anteil des Sonnenlichtes seine Haut, die dem aus irgend einem pathologischen Grunde nicht standhalten konnte, weggebrannt. Sicherlich war er zu lange im Wandschrank verweilt und des Lichtes entwöhnt worden. Sein Organismus hatte sich zurückentwickelt und ermangelte nun eines natürlichen Schutzes gegen das Licht des Tages, das manche mit dem Licht der Wahrheit ineins setzten.
Er war dadurch aber erneut gesellschaftsunfähig geworden. Niemand wollte sein Inneres sehen, jedenfalls nicht so, wie es sonst nur ein Chirurg zu sehen bekäme. Ein unvorbereiteter Augenzeuge seiner Erscheinung konnte zweifellos nur erschrecken, denn Parvus sah zerfallen, wenn nicht gar wie ein lebender Toter aus. Pathologen mochten so ihre Leichen für die Studenten der Medizin präparieren. Parvus selbst war anfangs ja auch erschrocken, gewöhnte sich aber allmählich an den neuen Zustand, als er bemerkte, daß keine unmittelbare Lebensgefahr davon ausging. Im selben Maße nahm seine Verwunderung zu, daß ein anatomisch richtiger Zustand seiner Inwendigkeit abstoßend sein müsse. "Was ist daran falsch, zu zeigen (oder zu sehen), was auch sonst immer schon dagewesen und notwendig gewesen war?", fragte er sich, "wollen die Menschen nicht mit ihrer Menschennatur bekannt werden?"
Ihm wurde dann aber klar, daß diese Menschennatur durchaus nur allgemein zu haben war. Seine Physiognomie war mitsamt der Haut verloren gegangen, und damit hatte sich auch die süße Illusion der Person verflüchtigt. Man konnte ihn nur noch anhand des Türschildes vor seiner Wohnung identifizieren, doch da er früher ja auch schon nicht in Gesellschaft anzutreffen gewesen war, kannte man die Person nicht einmal, die jetzt verloren war. Doppelt unmenschlich mußte er also seinen Mitmenschen erscheinen. Er selbst fühlte sich freilich sehr ungerecht behandelt. Elefantenmenschen oder andere Mißgebildete mochten sich mit Tüchern maskieren, um ihre Umwelt nicht mit einer Entartungsanatomie des Menschlichen zu quälen. Er aber trug nichts anderes als eine Enthüllungsanatomie, nichts anderes als sein wahres Inneres zur Schau, die Voraussetzungen dessen, womit man sonst gedankenlos wie mit der vermeintlichen Sache selbst hantierte. Nur ein Vorhang war die Haut, ein trügerischer Überzug, der schönen Schein hervorrufen wollte.
Auf seinen Spaziergängen fing er immer mehr und immer erstauntere Blicke der Entgegenkommenden auf. Bürgerliche Ehepaare zeigten sich befremdet, der Mann angewidert, die Frau fast entsetzt, die Kinder gruselten sich und fragten ihre Eltern ungeniert, was der Mann habe. Wenn Parvus eine junge, reizende Dame sah, auf einer Parkbank, vor einem Hutgeschäft, ihren Hund ausführend oder mit ihrem kleinen Bruder an der Hand auf dem Weg zum Tivoli, wandte sie sich bestenfalls beschämt ab und entfernte sich so taktvoll wie möglich. Die Gassenjungen, sobald sie ihn erspäht hatten, verfolgten ihn und riefen ihm Schmähungen nach: Vogelscheuche, Menschenfresser, Vampir. Sie griffen sich in den Mund, zogen die Lippen auseinander und verzerrten ihr Gesicht zur Fratze. Sie ahmten seinen verhuschten Gang nach, und weil er anfangs vergeblich versucht hatte, zu ihnen zu sprechen - worauf sie gar nicht gehört hatten -, imitierten sie auch seine vermeintliche Sprachunfähigkeit, gurgelten rohe Laute hervor und stellten sich, als ob mit größter Mühe einen Satz äußern wollten, ohne ihn aber herauszubringen. Parvus wurde allmählich klar, daß er in der Öffentlichkeit nicht mehr gelitten war. Man ertrug seinen Anblick nicht und wünschte seine Person hinweg - weil es keine Person mehr war.
Tatsächlich - man sah nicht mehr, wer er war, sondern nur noch, was er war, eine Ansammlung funktionaler Konstruktionselemente. Wer ihn anschaute, anzuschauen wagte, hatte den Eindruck, als wolle er auf einer Uhr die Uhrzeit ablesen, bekäme statt dessen aber nur das Räderwerk präsentiert, das zwar in irgend einer logisch korrekten Weise auch die richtige Uhrzeit darstellte - oder vielmehr sogar erst herstellte -, sie aber gerade in dieser offengelegten Herstellung dem Blicke verbarg. Wenn Parvus sprach, sah man seine Gesichtsmuskeln sich bewegen, und seine Worte zerfielen vor den Augen des Betrachters in die Laute, die zu ihrer Übermittlung nötig waren. Es war, als liefe ähnlich wie die Braille-Zeile für Blinde hier ein phonetisches Alphabet mit, mit lauter Einzelheiten, die man gar nicht wissen wollte.
"So, wie ich aussehe," dachte Parvus, "sehen vielleicht auch die Gedanken in der Werkstatt des Gehirns aus, bevor sie nach oben an die hochmögende Herrschaft weitergereicht werden, bekleidet, kostümiert, maskiert, camoufliert. Niemand will sie roh sehen. Aber die Gedanken sind es doch, die uns denken - so wie es die Worte des Dichters sind, die eine Welt erschaffen. Wir sind nur, wozu uns diese Gedanken den Stoff geben. Und der Knecht ist in Wirklichkeit der Herr, weil der Herr ohne ihn hilflos wäre und von ihm alles Lebenswichtige bereitgestellt bekommen muß. Trotzdem bleibt der Knecht ein Knecht und gelangt nie auf die Höhe des Menschseins, trägt kaum einen Namen, wird sofort nach seinem Verschwinden vergessen." Parvus kannte natürlich den deutschen Philosophen, der manche Wahrheit so klug erkannt hatte, diese Einsichten aber in ein Gebäude aus trügerischem Optimismus gesteckt hatte. Als sei er der Nachmieter von Leibnizens barockem Palast aus Vernunft und Schöpfungsglaube. Näher lag Parvus der traurige Pessimismus seines Landsmannes Sören, der, dabei sein eigenes Leben verzehrend, den Graben zwischen Glauben und Natur unüberwindbar aufgerissen hatte.
"Ich bin die nackte Natur," versetzte sich Parvus in Sörens Denkbewegungen, "und werde daher mißachtet. Ich bin eine natura naturata, aber keine natura naturans, eine Natur als Mangel, aber nicht als Eigenwert, Wille oder Trieb. Ich bin mehr als ein Tier und weniger als ein Mensch. Ich bin die Natur, die in sich zu erkennen der Mensch sich weigert. Und indem er mich ablehnt, macht er mich handlungsunfähig und lebensunfähig. Vielleicht bin ich das Gegenstück zu Sörens Verführer."
Und noch eine unangenehme Überraschung erlebte, wer sich mit Parvus unterhielt. Die Faszination von der ewig gültigen Mechanik, dem naturgesetzlich vorgegebenen Hebel- und Räderwerk, die man sich von einer Gliederpuppe, einer Marionette, erfüllt dachte, zerstob in der Wirklichkeit. Die zweckgerichtete Bewegung der Apparatur erzeugte keine Schönheit, keine Anmut und führte schon gar nicht durch die Rückseite wieder ins Paradies zurück, sondern führte lediglich ins langweilige Maschinenhaus. Die Worte waren aus Lauten gebildet, und unterhalb der Laute gab es nur mehr den Lautbildungsapparat. Die Gedanken wurden aus Worten gebildet, aber der Geist, der die Gedanken bildete, war nicht mehr der Rede wert.
4
Man wollte ihn also nicht sehen, wie er war, immer gewesen war. Er konnte vorerst das Haus nicht mehr verlassen, sondern mußte die Hilfe einer Bediensteten in Anspruch nehmen, die für ihn einkaufen sollte. Er legte sich auf die Lauer und verschaffte sich, hinter der Gardine durchs Fenster schauend, einen Eindruck, welche Mägde in den Nachbarhäusern Dienst taten. Zuerst wählte er nach Attraktivität und Vitalität, aber als er eine solche Magd gefunden hatte, fiel ihm ein, daß sie ihn ja gar nicht sehen durfte oder schlimmer noch, nicht würde sehen wollen. So hielt er nach Abgeklärtheit und Sachlichkeit Ausschau. Als er eine zuverlässig erscheinende Person gefunden zu haben vermeinte, fiel ihm ein, daß es nicht gut anging, sie durchs Fenster gleichsam anonym anzurufen und herbeizitieren zu wollen.
Er verfiel darauf, einen Boten auszuschicken, und dachte an einen der vielen Knaben, die sich spielend auf den Straßen herumtrieben oder von ihren Eltern mit kleinen Geschäften beauftragt wurden. Parvus glaubte, daß Kinder, wenn sie noch an Märchen glaubten, zumal an diejenigen von Hans Christian Andersen, auch auf allerlei Ungeheuer und menschliches Leid gefaßt sein müßten. Er, Parvus, wäre dann einfach eine lebende Märchenfigur. So rief er eines Tages einen Knaben an, der gerade nahe seinem Hause vorbeiging, streckte eine alte Zeitung aus dem Fenster und bat ihn, ihm das aktuelle Exemplar dieser Zeitung zu beschaffen. Er selbst sei leider krank und könne das Haus nicht verlassen. Für den Botendienst werde er auch etwas bekommen. Der Knabe, dessen Name Morten war, schaute zunächst etwas verwundert, ergriff dann die Zeitung, die Parvus mitsamt dem Geld auf das Fensterbrett gelegt hatte, und sagte zu, eine neue zu besorgen. Er lernte in der Schule gerade lesen, konnte den Titel der Zeitung auch schon entziffern, aber im Rest der Bleiwüste ging er noch unter. Er wußte auch schon, wo es Zeitungen zu kaufen gab und konnte tatsächlich das gewünschte Exemplar besorgen. Für das kleine Bewußtsein der kleinen Person war das ein durchaus aufregendes Ereignis.
Inzwischen fragte sich Parvus, ob er den Kleinen nach seiner Ankunft einlassen oder ihn am Fenster abfertigen sollte. Letzteres wäre sicherer, und vielleicht hätte der Knabe auch Scheu, zu einem Fremden in die Wohnung zu gehen. Andererseits verlangte es Parvus nach Gespräch und menschlicher Anteilnahme. Auch wollte er sehen, ob die von seinem Bruder erdachten Märchen wirklich so wirkten, wie es der Erfolg in den Buchhandlungen zu glauben nahelegte. Die oft traurigen Geschichten wurden eifrig gekauft und sicherlich auch gelesen. Was konnten die Kinder, denen sie vorgelesen wurden, von der Hinfälligkeit und Niedertracht des menschlichen Lebens wissen? Und sollte man es ihnen so sagen? Wie würden die Mütter die bösen Schicksale aus- oder umdeuten? Und was hielten die Kinder von jenem Manne, der diese Geschichten erdacht hatte? Würden sie wissen wollen, wer er gewesen war und welche Sehnsüchte ihn wirklich geplagt hatten?
Es läutete an der Türe. Parvus, der sich aufs Sofa gelegt hatte, rief, sie sei offen zum Eintreten, und zog sich die Decke weit über den Kopf. Morten öffnete langsam die Türe, betrat die Wohnung und fand seinen Auftraggeber auf dem Sofa liegen. "Danke, Morten," sagte Parvus mit etwas gespielter Kränklichkeit, "Dein Botenlohn liegt auf dem Tisch. Ich bin leider so krank, daß ich dir nicht gegenübersitzen kann. Aber wenn es dir nichts ausmacht, kannst du dich gern in den Sessel dort setzen." Morten wollte nicht unhöflich sein und setzte sich in den Sessel, nachdem er die Zeitung hingelegt und das schöne Geldstück an sich genommen hatte. Die fremde Wohnungseinrichtung beschäftigte ihn viel mehr, als ihn die kaum sichtbare Gestalt des Kranken auf dem Sofa hätte beunruhigen können. Krankheit war ein häufiger Zustand in jener Zeit, und weil die Medizin kaum etwas gegen natürliche oder zufällige Zerstörungen des Leibes aufzubieten hatte, wurde auch allenthalben sichtbar gelitten.
Parvus entschuldigte sich nochmals für seinen Zustand und kam auf Mortens Interesse an den Einrichtungsgegenständen zu sprechen. Daß jemand etwas so aufmerksam betrachtete, worauf er selbst schon lange keinen Gedanken mehr verschwendete, bereitete ihm Freude und vielleicht auch Genugtuung. Andererseits langweilte es ihn, jetzt jeden Gegenstand und jedes Kunstwerk zu erläutern, denn er fühlte sich keineswegs als Museumsführer. Und was hätte der Knabe schon davon gehabt, zu erfahren, daß hier eine Replik eines Murillo aus dem 17. Jhdt. hing und dort ein Kupferstich des Forum Romanum, dessen Bauwerke oder vielmehr Ruinen 2000 Jahre alt seien. Was waren für ein Kind 2000 Jahre? Was waren sie selbst für Erwachsene? Nicht mehr als 40 oder 50 Generationen.
Parvus fragte den Knaben nach seinen Schulerlebnissen, seinem genauen Wohnort und seiner Familie. Von sich teilte er ebenso beiläufig einige Äußerlichkeiten mit, die Vertrauen erwecken sollten. Schließlich fragte er Morten, ob er Geschichten kenne, Märchen, die ihm vielleicht seine Mutter vorlese. Tatsächlich bekam der Knabe Märchen vorgelesen oder vorerzählt und las auch selbst welche, freilich in meist vereinfachten und gekürzten Versionen.
"Ich bin der Bruder von Hans Christian," erläuterte Parvus dem Knaben seine Stellung zum Autor der verbreiteten Märchensammlungen, "aber man kennt mich nicht, und jetzt lohnt es sich wohl auch nicht mehr, mich zu kennen. Wenn man dich fragt, brauchst du meinen Nachnamen nicht zu erwähnen. Du brauchst mich damit übrigens auch nicht anzureden. Ich bin einfach Hans Parvus."
Morten fand diese Erklärung und Regelung ganz in Ordnung und war beflügelt von der Aussicht, einige Fragen zu verschiedenen Märchen stellen zu können, die er nur teilweise verstanden hatte. Parvus bemerkte für sich zufrieden, daß er eine tragfähige Konstellation für seine Bedürfnisse eingerichtet hatte und ihm das Kind als Bote und Gesprächspartner erhalten bliebe, soweit es die vorrangigen familiären Verpflichtungen zuließen. Er setzte das Gespräch auch nicht zu lange fort, um in diesem kleinen Leben nicht gleich eine Revolution zu verursachen, sondern schickte Morten bald nach Hause. Allerdings bemühte er sich, den Erwartungshunger auf Geheimwissen eines Märchenonkels - als den sah sich Parvus realistischerweise - einerseits zu dämpfen, um kein Gerede in der Stadt hervorzurufen, andererseits aber aufrecht zu erhalten, um das Kind zum regelmäßigen Wiederkommen zu bewegen.
5
Beim nächsten Besuch horchte ihn Parvus daher vorsichtig aus, was er zuhause erzählt habe und wie es aufgenommen worden sei. Man schien ihn für eine Art Lehrer im Ruhestand zu halten, denn welcher ernsthafte Mann würde sich sonst näher mit Kindermärchen beschäftigen? Damit war Parvus einverstanden. Dem Kind aber wollte er die Hinfälligkeit der Literatur aus dem entgegengesetzten Blickwinkel begreiflich machen. Die Literatur und die Phantasie waren nicht deshalb unterlegen, weil das reale Leben so viel wichtiger und besser war, sondern so erfolgreich und lebensgestaltend sie sein mochten, mußten sie doch an entscheidenden Stellen immer wieder an den nichtliterarischen Seiten des Lebens gemessen werden.
"Die Märchen meines Bruders," führte Parvus also aus, "und die Bücher der anderen Dichter können beliebig lange gelesen werden und in Gebrauch bleiben, überleben also ihren Autor, der irgendwann einmal stirbt." Daß auch die Sprache nach einigen Jahrhunderten verschimmelt war und aus dem Verkehr der Gegenwart gezogen wurde, verschwieg Parvus, um nicht zuviele Komplikationen ins Spiel zu bringen. Er verkündete jedoch den Tod der Literatur, der unvermeidlich sei, weil ihr Schöpfer sterblich sei. "Hans Christian liegt auf dem Friedhof. Deshalb gibt es keine weiteren Märchen mehr." Hans Parvus wollte seiner Binsenweisheit Nachdruck verleihen und schlug Morten vor, dieses Ende der Literatur selbst aufzusuchen. Er solle zu Hans Christians Grab gehen, für den Toten vielleicht, wenn ihm danach sei, ein Gebet sprechen, und daran denken, was von jenem Menschen übrig geblieben sei, in dessen Worten er sich aufhalte, wenn er seine Märchen höre.
Natürlich mußte er ihm den Weg genau beschreiben, zwar nicht zum Friedhof selbst, der Morten bekannt war, aber die Lage des Grabes, das sonst nicht leicht zu finden gewesen wäre. Der später aufgestellte Grabstein mit dem eingemeißelten Zitat stand noch nicht, und das für neue Gräber charakteristische Kranzgebirge war mittlerweile sicherlich entfernt worden. Parvus zeichnete ihm einen Lageplan und legte Morten den Grabbesuch auch insofern nahe, als er, Parvus, sich selbst ja keinen Augenschein verschaffen könne. So schickte er den Knaben weg.
Beim nächsten Besuch fragte er zunächst auch nach diesen Äußerlichkeiten und erhielt die gewünschten Details berichtet. Dann näherte sich Parvus dem Gefühl des Kindes angesichts der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. "Hast du Hans Christian einen Gruß - von mir oder von dir - übermittelt?"
Morten hatte vor der Gestaltlosigkeit des Grabes die Literatur erst einmal vermißt. Die farbigen, meist auch farbig ausgemalten Figuren aus den Büchern waren dort weit weg. Nur stumpfe Erde lag da, wie sie überall auf Wegen und in Gärten lag. Er habe sich aber vorgestellt, daß der Tote im Grab erfreut sein müsse, wenn er, Morten, durch den jüngeren Bruder Parvus einen so wichtigen Überlebenden und kundigen Fortsetzer gefunden habe.
Parvus staunte ein wenig, merkte dann aber, daß das Kind weniger über seine Person sagen, sondern einen Anhaltspunkt am Leben finden wollte. Daß der Leib der Literatur sterblich war und in diesem Grab gerade vermoderte, war dem Kind noch nicht ganz bewußt. "Ich will meinen Bruder nicht fortsetzen," warf Parvus ein, "sein Werk ist seine Sache, und auch, wenn ich sein Leben geteilt habe, ist mein Leben immer noch meine Sache. Ich kann nicht einfach das sein, was er zu leben versäumt hat."
Morten fühlte sich von einem kalten Hauch der Fremdheit angeweht, wie er ihn schon auf dem Friedhof verspürt hatte. Etwas ganz anderes als dasjenige, worumwillen er hingegangen war, hatte er dort vorgefunden. Und jetzt bekam er es mit einer vermutlich unerfreulichen Konkurrenz zwischen Brüdern zu tun, die er nicht erwartet hatte und auch nicht für erfreulich und wünschenswert hielt.
"Ein fremdes Leben läßt sich nicht fortsetzen," beharrte Parvus unangenehm, "vielmehr muß das eigene wahrgenommen und gefunden werden. Wohl auch erfunden".
Für Morten war Leben natürlich noch nichts eigenes, sondern ein ihn zuverlässig umgebendes Gehäuse. Daß man Arbeit und Gefahr dabei haben müsse, es auszuüben, und dann doch nur im Tod enden könne, mißfiel ihm gründlich.
"Was ist der Tod?". stellte er den aus seiner Sicht alten Herrn zur Rede.
Parvus war nicht überrascht von dieser großen Frage dieses kleinen Menschen. "Schön, daß du mir zutraust, das zu wissen, Morten," lobte er den unbefangenen Fragesteller, der ihn aufmerksam ansah. "Ich weiß auch tatsächlich mehr als jeder andere davon, ausgenommen natürlich unseren toten Freund Hans Christian. Erinnerst du dich, wie er im Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern den Tod beschrieben hat?"
"Ja," sagte Morten, "aber im Grab liegt das Mädchen nicht."
"Ganz recht," erwiderte Parvus, "den Tod, der in den Gräbern liegt, hat mein Bruder nicht darstellen wollen oder können. Statt dessen läßt er einfach die Großmutter erscheinen, und beide schweben dann zu Gott. Als ob es so etwas gäbe!"
"Ich möchte schon auch einmal fliegen können," wandte Morten ein. Parvus stutzte ein wenig und änderte sein Gesprächsziel. "Ach ja," meinte er nachsichtig, "das wirst du schon noch, vielleicht nimmt dich mal ein Naturforscher in einem Ballon mit. Oder vielleicht baut dir ein genialer Erfinder Flügel an deine Arme, mit denen du dich in die Luft erheben kannst. Aber du wirst wahrscheinlich rasch Angst bekommen, denn die Luft hat keine Balken, und du weißt, daß du sofort tot bist, wenn du herunterfällst."
Damit hatte Parvus von der kindlichen Fantasie auf die ursprüngliche Frage zurückgelenkt, wollte sich aber auch mit ihr nicht näher beschäftigen. "Der Tod, nach dem du gefragt hast, ist etwas ganz Fremdes, so fremd, daß ich dir das gar nicht sagen kann. Schau, Morten. Du weißt noch gar nicht, was Leben ist. Du fängst gerade erst damit an, und niemand weiß, wie weit du damit kommen wirst, zu welchem Menschen du einst heranwachsen wirst. Alles, was ich dir jetzt sage, wirst du in 10 Jahren vergessen haben - und das ist für mich, wie du dir denken kannst, keine schöne Aussicht. Warum mache ich mir die Mühe dann?" Morten wollte widersprechen, aber Parvus ließ ihn nicht zu Wort kommen.
"Immerhin wirst du dich an meine Person erinnern, das ist gewiß, und was später dein Ich sein wird, wird in diesen Gesprächen den ersten Lichtstrahl der Aufklärung empfangen zu haben überzeugt sein. Aber um dich nicht ganz im Unklaren zu lassen," sprach Parvus wieder vom Tod, "kann ich dich auf einen einfachen Sachverhalt aufmerksam machen, der dir auch jetzt schon einleuchtet. Der Tod ist ganz verschieden, je nach dem, von welchem Leben aus er erreicht wird. Jeder Mensch ist anders - und ich bin besonders anders, wie du weißt -, und später wirst du dich noch wundern, wie schrecklich anders Menschen sein können. Jetzt bist du vielleicht der Meinung, deine Mutter und beispielsweise deine Lehrerin oder deine Tante seien nicht besonders unterschiedlich, nur daß sie dir unterschiedlich nahe stehen. Wenn du eine Schulklasse mit Mädchen auf der Straße bei einem Unterrichtsgang in den botanischen Garten siehst, werden sie für dich ziemlich gleich ausschauen und dir bloß wie ein Haufen gackernder Hühner vorkommen. In 10 Jahren aber wirst du sie völlig verschieden wahrnehmen.
Man sagt zwar, der Tod mache alle Menschen gleich, aber das stimmt nicht. Er läßt sie so ungleich, wie sie bis dahin schon waren, oder macht sie noch ungleicher. Der eine wird 80 und stirbt im Schlaf, den nächsten holt die Schwindsucht mit 23. Ein anderer wird von Cholera mit 32 dahingerafft, wieder ein anderer fällt mit 45 als Dachdecker vom Dach. Eine Frau stirbt mit 28 im Kindbett, eine andere mit 57 an der Zuckerkrankheit, eine dritte vergiftet ihren ungetreuen Gatten und wird hingerichtet. Der Tod ist die Ernte des jeweiligen Lebens, ohne daß dem Betreffenden bewußt ist, was er vorher gesät hat."
Parvus ließ dem Knaben etwas Zeit zum Nachdenken, kümmerte sich aber ansonsten wenig darum, daß er ihn geistig teilweise überforderte. Werden wir nicht alle vom Leben überfordert, hatte ihm einst sein Bruder auf eine Vorhaltung geantwortet, und Parvus hatte sich diese bequeme Einstellung angeeignet.
"Willst du einen Apfel?" griff er dann seine Rede von der Ernte auf: Der Knabe nickte und hatte mit diesem Gespräch seine Fassungskraft erschöpft und seine Neugier gestillt.
6
Parvus hatte den Knaben für den anderen Tag bestellt, wieder die Zeitung besorgen lassen und setzte sich, nachdem er einen gelangweilten Blick auf die Titelseite geworfen hatte, zu einem Gespräch mit dem Knaben hin. Er fragte ihn nach seinen Erlebnissen in der Schule und tastete vorsichtig ab, wie er das erste Zusammentreffen mit ihm, der Ungestalt, verarbeitet hatte. Für den kleinen Menschen war alles noch ein Abenteuer, und deshalb verging seine Zeit auch langsam. Seine eigenen Kräfte waren gering im Vergleich zu den Anforderungen der Welt, so daß er auch für jeden neuen festen Bezugspunkt von außen dankbar war. Daß ein so offenkundig kluger Mensch wie Parvus allein, ohne Familie und Dienstboten sein Leben fristen mußte, beeindruckte den Knaben nicht wenig.
Dies war unversehens der Anlaß, der Parvus zu diesem Gespräch führte und Morten eine weitere Aufgabe bescherte. Parvus sprach davon, daß er sich mit Nahrung versorgen (lassen) müsse, weil er nicht selbst auf den Markt gehen könne. Die Zubereitung der Speisen könne er sich wohl zutrauen, in aller Einfachheit und Frugalität natürlich. An Fleisch werde er sich nicht heranwagen, sondern auf Gemüse und Brot beschränken. Er brauche Butter, Käse, Fisch, gelegentlich Getränke, um nicht immer nur Wasser oder Tee trinken zu müssen, und müsse selbstverständlich auch mit Brennholz für den Herd und den Ofen versorgt werden.
Morten staunte, was alles für die Aufrechterhaltung eines Lebens im Alltag nötig war und hätte sich von der Vielzahl dieser Aufgaben überfordert gesehen. Parvus beruhigte ihn aber sogleich mit der Erläuterung, daß er, Morten, nur die Verbindung zu einer Magd herstellen solle, welche die gewünschten Besorgungen ausführen solle. Nachdem er seine Bereitschaft erklärt hatte, beschrieb ihm Parvus das weitere Vorgehen, und Morten fühlte sich wichtig, bei einer sozusagen lebensentscheidenden Aufgabe mitwirken zu dürfen. Allerdings beunruhigte ihn ein wenig die Vorstellung, eine fremde Frau ansprechen und in den passenden Worten das Anliegen vortragen zu sollen. Von ihm hinge letztlich ab, ob Parvus sein ohnehin eingeschränktes Leben überhaupt fortsetzen könne.
Parvus ging während des Gesprächs immer wieder einmal ans Fenster, um zu sehen, ob die in Aussicht genommene Magd zufällig vorbeikäme, und Morten erzitterte bei den Gedanken, daß er den Auftrag vielleicht schon gleich würde ausführen müssen. Er müßte darauf gefaßt sein, daß sie sein Anliegen nicht richtig verstünde oder ihm nicht glaubte, oder daß er umgekehrt auf Einwände stieße, die er nicht beurteilen konnte, oder daß sie sich einfach nur schwer verständlich ausdrückte, weil sie vom Land kam und Dialekt sprach. Parvus beruhigte ihn, er werde ihm einen Zettel mit der Adresse mitgeben, damit er etwas in der Hand habe.
Die beiden hatten Glück, Parvus sah die Magd auftauchen und sich beiläufig mit einer anderen unterhalten. Er sagte Morton nochmals den Wortlaut seiner Wünsche vor und schickte ihn hinaus. Durch das Fenster beobachtete er, wie sich das Kind der bezeichneten Person näherte, ihre Aufmerksamkeit gewann und auf den Zettel verwies. Die andere Magd, die wohl zu ihren Geschäften eilen mußte oder vielleicht auch nur die Gelegenheit ergriff, das Gespräch zu beenden, verabschiedete sich, und Morten setzte seine Instruktionen fort. Nach mehreren Wortwechseln setzten sich die beiden in Richtung des Hauses in Bewegung, und Parvus legte sich auf das Sofa, um mit abgewandtem und tunlichst verhülltem Gesicht die Ankunft der Magd zu erwarten.
Morten führte sie herein, die stehen blieb und bereits wußte, daß sie einen kranken Auftraggeber vor sich hätte. Parvus erklärte, daß er sehr krank sei, ihr deshalb seinen Anblick ersparen wolle, aus dem gleichen Grunde aber ihre Hilfe benötige. Sie möge ihm alle paar Tage einige Dinge besorgen, weil er das Haus nicht verlassen könne. Die Magd hatte Krankheit und Tod genug in ihrem Leben mitbekommen und wunderliche Herrschaften dazu. Sie war einverstanden, bedang sich lediglich aus, daß die Bedienung ihrer jetzigen Herrschaft Vorrang habe und Parvus' Aufträge in günstig gelegenen Zwischenzeiten erledigen werde. Da sie den Zusatzverdienst gut brauchen könne, war sich Parvus sicher, daß die Magd, die übrigens Maren hieß, sich hinreichend um seine Belange kümmern werde.
Er trug ihr dann auch schon eine erste Besorgung auf, womit Mortens Besuch ebenfalls beendet war. Während sie von ihren Einkäufen zurückkehrte, wurde ihr allmählich klar, daß sich hier ein einsamer älterer Herr selbst zu versorgen gedachte. Dies war doch etwas ungewöhnlich, denn üblicherweise zogen in solchen Fällen Verwandte in die Wohnung, eine Schwester, Tante, Base oder vielleicht eine Studentin vom Land, die von Verwandten in Pflege gegeben wurde. Maren zweifelte ein wenig an Parvus' Fähigkeiten, sich sinnvoll zu ernähren, aber da er ohnehin krank war, spielte das wohl keine große Rolle. Allerdings wunderte sie sich, daß sie nichts aus der Apotheke zu bringen hatte.





























