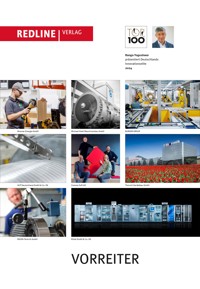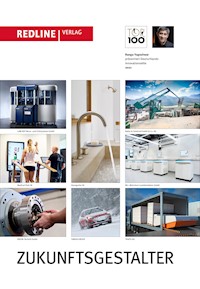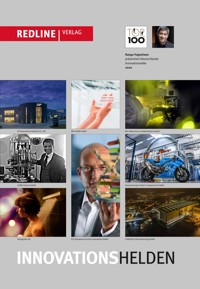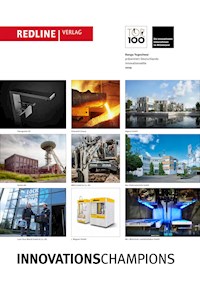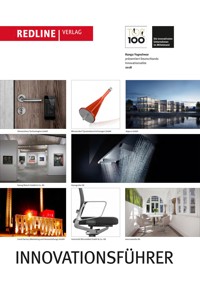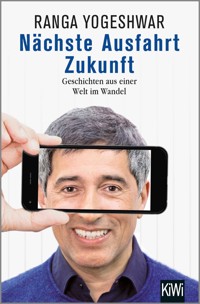
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein frischer Blick auf unserer Welt im Wandel – die erweiterte E-Book-Ausgabe des Bestsellers. Für Ranga Yogeshwar ist die eigene unmittelbare Erfahrung entscheidend. Aus dieser Sicht blickt der bekannte Wissenschaftsjournalist auf eine zunehmend globalere Welt, die digitalen Umbrüche oder die Veränderungen der Medien, betrachtet die neue Rolle der Frau oder den Wert alter Kulturgüter. Ein informatives, aber auch sehr unterhaltsames Buch. Wir befinden uns inmitten eines epochalen Wandels: Die digitale Revolution, Fortschritte in der Gentechnik oder die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz greifen auf fundamentale Weise in unser Leben ein. In dieser Welt des Umbruchs gibt es durchaus besorgniserregende Entwicklungen. In einigen Bereichen wird es dringend Zeit, dass wir den momentan eingeschlagenen Kurs überdenken und ändern. Doch ein reflektierter Fortschritt birgt auch eine großartige Chance: Zum ersten Mal in der Geschichte ist es uns möglich, die eigene Welt auf direkte Weise zu verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Ranga Yogeshwar
Nächste Ausfahrt Zukunft
Geschichten aus einer Welt im Wandel
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Ranga Yogeshwar
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Ranga Yogeshwar
Ranga Yogeshwar, geboren 1959, Diplom-Physiker, arbeitete von 1987 bis 2008 als Wissenschaftsredakteur beim WDR in Köln und ist inzwischen als freier Journalist und Autor tätig. Er entwickelte und moderierte zahlreiche Sendungen (u.a. »Quarks & Co«, »Die große Show der Naturwunder« und »Wissen vor acht«), in denen Wissenschaft populär vermittelt wird. Ausgezeichnet mit über 50 Ehrungen und Preisen, darunter der Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Journalistik (1998), der Grimme-Preis (2003) und der Deutsche Fernsehpreis (2011) und viele Journalistenpreise in verschiedenen Kategorien, wurde Ranga Yogeshwar 2009 die Ehrendoktorwürde der Universität Wuppertal verliehen. Seine Bücher »Sonst noch Fragen?« (KiWi 1103), »Ach so!« (KiWi 1188) und »Nächste Ausfahrt Zukunft« – die Hardcoverausgabe stand auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste – wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Ranga Yogeshwar ist verheiratet und Vater von vier Kindern.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Für Ranga Yogeshwar ist die eigene unmittelbare Erfahrung entscheidend. Aus dieser Sicht blickt der bekannte Wissenschaftsjournalist auf eine zunehmend globalere Welt, die digitalen Umbrüche oder die Veränderungen der Medien, betrachtet die neue Rolle der Frau oder den Wert alter Kulturgüter. Ein informatives, aber auch sehr unterhaltsames Buch.
Wir befinden uns inmitten eines epochalen Wandels: Die digitale Revolution, Fortschritte in der Gentechnik oder die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz greifen auf fundamentale Weise in unser Leben ein. In dieser Welt des Umbruchs gibt es durchaus besorgniserregende Entwicklungen. In einigen Bereichen wird es dringend Zeit, dass wir den momentan eingeschlagenen Kurs überdenken und ändern. Doch ein reflektierter Fortschritt birgt auch eine großartige Chance: Zum ersten Mal in der Geschichte ist es uns möglich, die eigene Welt auf direkte Weise zu verändern.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Einleitung
1 Das Neue
Ein defekter Kaffeeautomat
Die digitale Revolution
Und sie irren sich doch
Von Ochsenkarren und Supercomputern
2 Entdecken
»Wer jemals die Kamelglocken hörte, den lassen sie nie wieder los!«
Wie ich beschloss, Mondastronaut zu werden
Was bleibt vom Menschen?
3 Irrwege
Das gespaltene Atom
Tschernobyl – Protokoll einer Drehreise
Fukushima – Bericht aus dem Inneren der Katastrophe
Die Träume unserer Väter
4 Zusammenleben
In wie vielen Sprachen kann man küssen?
Fairness
Maria hat aufgehört zu schweigen
5 Zaubern
Autonome Maschinen
Das Ende der Kausalität
Das Fortschrittsparadoxon
Machine Learning
Mensch und Computer – wer programmiert wen?
Fake Science
Ground Facebook!
6 Privatsphäre
Das Buch verrät den Leser
Das Buch liest Sie!
Ihr Handy weiß, ob Sie tanzen
Mein digitaler Verrat – ein Überwachungsselbstversuch
Wofür wir jetzt kämpfen müssen
7 Angst
Das Müsli war alle
Nur noch mit Schutzbrille
8 Wissen
Was wir alles nicht wissen
Unser Bestreben, mehr zu verstehen
Verpasste Chancen
Würden wir die Bücher vermissen?
What’s in for me?
9 Austausch
Heavy Roses – Die Zukunft der Bilder
Der Apparat sieht mehr als wir
Bilder verändern ihren Betrachter
Der Apparat interpretiert die Bilder
Der Apparat betrachtet uns
Sie atmet nicht! Die Zukunft der Stimme
Lügenpresse! Die Zukunft der Information
10 Evolution
Die zweite Natur
Ich bin kein Roboter
11 Handeln
Wir haben nur einen Planeten
»Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit«
Resümee
Dank
Anhang
Dokumente
Für Frank Schirrmacher, den ich jeden Tag vermisse
Ich suche nicht – ich finde.
Suchen – das ist Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem im Neuen.
Finden – das ist das völlig Neue!
Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt.
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer!
Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die in die Ungewissheit, in die Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht – menschlich beschränkt und eingeengt – das Ziel bestimmen.
Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen: Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.
Pablo Picasso[1]
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Wenn man ein Buch zum Thema Zukunft schreibt, dann wird die fortschreitende Gegenwart schnell zum Lackmustest der eigenen Gedanken. Welche Prognosen erweisen sich als richtig, welche Entwicklungen hat man präzise erkannt, und wo lag man womöglich daneben? Und wo überrascht die Zukunft uns mit Unvorhergesehenem? Nach dem Erscheinen der Hardcoverausgabe im Oktober 2017 erlebte ich, wie manches, was ich beschrieb, tatsächlich immer konkretere Gestalt annahm. Im Buch spreche ich zum Beispiel im Detail von der »Zukunft der Stimme«, und tatsächlich präsentierte Google im Frühjahr 2018 einen Sprachassistenten namens Google Duplex, der per Telefon selbstständig einen Termin in einem Friseursalon vereinbart. Der Mensch spricht mit einer Maschine, ohne zu merken, dass sein Gegenüber ein kalter Apparat ist. Denn die künstliche Stimme klingt vollkommen natürlich, streut zum Beispiel immer wieder ein »Hm« ein. Ich hatte eine solche Entwicklung zwar erwartet, und doch berührte mich die Nachricht – es besteht eben ein großer Unterschied zwischen dem Formulieren einer möglichen Zukunft und dem Eintreten des Ereignisses in der Wirklichkeit.
Ähnlich erging es mir, als die gezielte Verwertung von Kundendaten bei US-amerikanischen Wahlkämpfen im Skandal von Facebook und Cambridge Analytica ans Licht trat. Wie konkret die selbstschädigende Gefahr von Fake News inzwischen ist, erfuhr ich während einer Vortragsreise in Japan. Jedes Jahr erkranken dort etwa 27000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, 3000 von ihnen sterben daran. Mit der HPV-Impfung gibt es einen wirksamen Schutz gegen diesen Krebs – vorausgesetzt, man lässt sich in jungen Jahren impfen. Doch Falschinformationen in den absurden Erregungsspiralen sozialer Netzwerke entwickelten in Japan offenbar eine weit größere Wirkung, als ich es mir hätte vorstellen können: Die Impfquote gegen Gebärmutterhalskrebs in Japan ist innerhalb von nur vier Jahren von 70 Prozent (2013) auf unter 1 Prozent (2017) kollabiert. Fake News töten also Menschen!
Zudem erkennen wir zunehmend die destabilisierende Wirkung dieser Netzwerke auf demokratische Systeme: In manchen Ländern wie in Brasilien, Kenia oder Indien, aber auch in den USA und Europa setzt ein Umdenken ein. Die zunehmende Erregungsbewirtschaftung und die rein kommerzielle Grammatik der Medien wird von immer mehr Bürgern als Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaften erkannt. Aus diesem Grund habe ich die vorliegende Taschenbuchausgabe auch um einige Gedanken zur Dynamik von Fake News erweitert.
Inzwischen wurde das Buch auch in andere Sprachen übersetzt. Ich war gleichermaßen überrascht und erfreut, welche spannenden Debatten dadurch ausgelöst wurden; ein Indiz dafür, dass der Wandel in vielen Ländern ähnliche Fragen aufwirft. Doch bei allen kritischen Herausforderungen bleibe ich zuversichtlich und folge nicht den Dystopien anderer Autoren. Vergessen wir nicht: Eine Dystopie ist auch nur ein Narrativ, und manche finden halt Gefallen an dunklen Narrativen. Doch ist Fortschritt kein schicksalhafter Mechanismus, der über die Menschheit hineinbricht, er ist kein Vulkanausbruch oder Meteoriteneinschlag, sondern eine Aktivität des Homo sapiens, der selbst etwas vorantreibt. Wir haben daher die großartige Chance, unsere Zukunft aktiv zu gestalten und dabei auch die Sinnhaftigkeit unserer Ziele auszuloten. Es geht mir um etwas, das ich reflektierten Fortschritt nenne. Dieses Buch ist meine Einladung an Sie, sich an diesem spannenden Diskurs über Zukunft zu beteiligen.
Einleitung
Alles Gewesene welkt dahin vor dem heißen Atem der neuen Zeit
– Stefan Zweig –
Als Kind wollte ich einen Regenbogen fangen. Ich schlich mich an und rannte auf ihn zu, doch stets war er schneller als ich und hielt sich, wie ein scheues Tier, auf Distanz. Egal wie weit ich mich ihm näherte, er blieb für mich unerreichbar, so als wolle er sein Geheimnis für sich behalten.
Mit der Zukunft verhält es sich ähnlich. So gewissenhaft wir uns mit ihr auseinandersetzen und so präzise wir einzelne Entwicklungen vorherzusagen versuchen, die Zukunft selbst lässt sich nicht fassen. Beim Regenbogen begriff ich später, dass er eine optische Erscheinung ist, die man nicht mit Händen greifen kann. Das Sonnenlicht wird durch die unzähligen Regentropfen in seine Spektralfarben gebrochen und reflektiert. Die Bogenform ergibt sich aus der festen Winkelbeziehung von Sonne, Wassertropfen und Betrachter. Dieser feste Winkel ist die Ursache seiner Unnahbarkeit, aber auch seiner Einzigartigkeit, denn es gibt ihn nicht: den Regenbogen. Jeder von uns sieht in diesem optischen Wechselspiel seinen eigenen Regenbogen. Wenn zwei Menschen also gemeinsam das Naturphänomen bewundern, sieht jeder einzelne Mensch, streng genommen, etwas anderes.
Ebenso unterschiedlich wird die Zukunft betrachtet. Während der eine sich davon großartige Chancen erhofft, fürchtet der andere sich vor einer düsteren Dystopie. Fragt man, ob diese Welt, alles in allem, in Zukunft eine bessere wird, dann ist die überwiegende Mehrheit davon überzeugt, dass sich die Dinge eher zum Schlechteren hin entwickeln. Einer internationalen Studie entnehme ich, dass gerade mal vier (!) Prozent der Befragten in Deutschland daran glauben, dass sich in Zukunft unser Leben verbessern wird.[2] Ähnlich pessimistisch fallen die Antworten in den USA, in Frankreich, Großbritannien oder Dänemark aus.
Wieso aber blicken wir derart verunsichert in die Zukunft? Bewegen wir uns tatsächlich auf ein Zeitalter der Auflösung zu, in dem der Mensch sich selbst durch den technischen Fortschritt als aktiven Produktionsfaktor abschafft? Werden Maschinen uns eines Tages beherrschen, und erweist sich der Fortschritt selbst als Bedrohung? Ist es um unsere Zukunft tatsächlich so schlecht bestellt, oder ist diese düstere Sicht vielleicht auch das Ergebnis unserer begrenzten Perspektiven?
In der Geschichte ging das Neue anfänglich stets mit Orientierungslosigkeit einher. Nach der Einführung der Eisenbahn oder des Automobils herrschten zunächst auch Skepsis und Furcht vor. Auch das Zeitalter der Moderne war geprägt von tiefer gesellschaftlicher Verunsicherung. Doch mit dem Aufkommen der Turbomoderne – unserer Zeit – reißt das verbindende Band zwischen Vergangenheit und Zukunft gänzlich. Zukunft, so formuliert es der Literaturprofessor Hans Ulrich Gumbrecht, »ist für uns kein Horizont von Möglichkeiten mehr, sondern eine Dimension, die sich zunehmend allen Prognosen verschließt und die zugleich als Bedrohung auf uns zuzukommen scheint«.[3]
In diesem Buch beschreibe ich, wie unsere Gegenwart durch die Digitalisierung zu einem Provisorium wird, zu einem Auslaufmodell mit baldigem Verfallsdatum, denn morgen schon erwachen wir in einer neuen Welt. Doch was ändert sich, und was bleibt? Wohin führt uns das Neue? Welche Gesetzmäßigkeiten bestimmen diesen Wandel? Wo ist unser Platz in dieser Zukunft? Oder zählen wir zu einer Scharniergeneration, die im Übergang vom Gestern zum Übermorgen verloren geht?
Das alles sind keine abstrakten Fragen. Ich zeige an konkreten Beispielen, wie Algorithmen nicht nur Prozesse verändern, sondern zunehmend unser Verhalten prägen. Sie könnten sogar unsere Gesellschaft erschüttern und die Demokratie gefährden.
In fast allen Lebensbereichen erleben wir eine wachsende Verunsicherung. Obwohl es den meisten Menschen hierzulande materiell gut geht, machen sich diffuse Zukunftsängste breit. In einer Studie von 2015 heißt es: »In Deutschland sagen 57 Prozent der Befragten, die Geschwindigkeit, mit der neue Geschäftsideen entwickelt werden und sich Produktwelten verändern, sei ihnen zu hoch. Auch global stehen die Menschen der sich immer schneller verändernden Technologielandschaft skeptisch gegenüber: 51 Prozent der Meinungsführer von insgesamt 33000 Befragten in 27 Ländern gehen Veränderungen zu schnell.«[4] Heute, so scheint es, steht die Zukunft selbst auf dem Prüfstand.
Als Wissenschaftsjournalist habe ich seit Jahren einen direkten Blick auf die Quellen dieses Wandels: vom Forschungslabor für künstliche Intelligenz in Schweden bis hin zur Ruine eines Atomkraftwerks in Japan, vom Klonlabor in Südkorea bis hin zur Fahrt im Prototyp eines autonomen Fahrzeugs in Hannover. Manchmal stehe ich unmittelbar an der Bugwelle des Fortschritts und kann verfolgen, wie das Neue sich ausbreitet und unsere Lebenswelten erfasst. Diese Direktheit und das unmittelbare Erleben haben meine Perspektive geprägt.
Allen Zukunftsängsten und allem Alarmismus zum Trotz ist es an der Zeit, wie ich finde, dass wir einen neuen und frischen Blick auf unsere Welt im Wandel werfen. Genau dieses versuche ich in diesem Buch. Ausgehend von vielen persönlichen Erfahrungen blicke ich nicht nur auf die digitalen Umbrüche oder die Veränderungen der Medien, sondern hinterfrage auch unsere Sicht auf eine zunehmend globalere Welt, betrachte die neue Rolle der Frau oder den Wert alter Kulturgüter. Bei dieser thematischen Vielfalt stoße ich auf frappierende Gemeinsamkeiten. Es gibt zum Beispiel erstaunliche Parallelen zwischen dem Boom im Silicon Valley und der Entstehungsgeschichte der historischen Vakuumpumpe.
In dieser Welt des Umbruchs begegnen uns durchaus besorgniserregende Entwicklungen, auch darauf will ich ausführlich eingehen. In einigen Bereichen wird es dringend Zeit, dass wir den momentan eingeschlagenen Kurs überdenken und ändern. Doch ein reflektierter Fortschritt birgt, wie ich finde, auch eine großartige Chance: Zum ersten Mal in der Geschichte ist es uns möglich, die eigene Welt auf direkte Weise zu verändern. Wo alle Generationen vor uns sich noch in Geduld üben und häufig Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte warten mussten, bis etwas Neues in die Welt kam, werden wir mit einer neuen Freiheit beschenkt.
Wenn wir also den Mut besitzen, unsere Perspektive zu verändern, dann entdecken wir im Umgang mit dem Neuen aussichtsreiche Chancen. Es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein. Wir werden zu Gestaltern unserer Welt, und genau darin liegt unsere Chance.
1Das Neue
Zukunft – eine Frage der Perspektive
Ein defekter Kaffeeautomat
»Warum braucht diese blöde Kaffeemaschine einen Mikroprozessor? Das ist mir alles viel zu kompliziert!« Meine Frau ist sauer, denn der Automat funktioniert nicht mehr und muss schon wieder zur Reparatur.
Ich ziehe den Netzstecker, warte einen Moment und schließe das Gerät wieder an. Manchmal hilft das, doch diesmal bleibt das Display dunkel. Keine Aufforderung »Kaffee bereit«, kein Surren der Mühle, kein Glucksen der Wasserpumpe. Der Elektronikhändler vor Ort kann auch nichts machen. Die Maschine muss eingeschickt werden, so wie vor anderthalb Jahren, als sie schon einmal aus unerklärlichen Gründen aufhörte, ihrer Bestimmung zu gehorchen und Kaffee zu machen.
Auf dem Herd kocht Wasser. Eine Filtertüte, eine Kaffeekanne, aufschütten. Geht doch! Während mir der Kaffeeduft in die Nase steigt, frage ich mich, warum wir den Vollautomaten überhaupt angeschafft haben. Chic sieht er aus, silbern glänzend, und der Kaffee wird frisch gemahlen, per Knopfdruck kann man sogar auswählen, wie stark er werden soll. Eine Tasse darunterstellen – und fertig.
Doch unser Wunderteil macht keinen Mucks und schon gar keinen Kaffee. Ich schütte erneut Wasser nach. Das Fließgeräusch des durchlaufenden Filterwassers ist mir vertraut, von früher. Zunächst strömt es schnell und dann immer langsamer, bis es anfängt zu tropfen. Der angefeuchtete Kaffee im Filter sieht aus wie nasse Blumenerde.
Mir fällt auf, dass ich beim Vollautomaten nichts vom Prozess des Kaffeemachens mitbekomme. Das Mahlen der Bohnen, das Aufheizen des Wassers, das Dosieren und Filtern, alles geschieht im Verborgenen. Was ich bekomme, ist lediglich das Endprodukt. Vielleicht soll das ja so sein, denn so wird jeder Kaffee zu einem kleinen Wunder. Doch bei aller Bequemlichkeit werde ich um ein vertrautes Ritual gebracht. Wer selbst Kaffee aufschüttet, ist beteiligt an einem Prozess, ist aktiv und gestaltet; doch der Automat macht mich zu einem bloßen Knopfdrücker.
Überhaupt steht die Ordnung von Subjekt und Objekt plötzlich auf dem Kopf: Der Automat befiehlt, und ich muss gehorchen. Manchmal fordert er mich auf, das Wasser nachzufüllen. Das geht ja noch, doch wehe, es heißt im grünen Display: »Trester leeren«. Dann gilt es, eine kleine Schublade mit den Überresten vorheriger Kaffeebereitungsfreuden herauszunehmen. Das Tropfgefäß will ebenfalls ausgeleert werden. Beim Gang zur Spüle verschütte ich dann regelmäßig das braune Restwasser. Danach muss ich also auch noch den Boden wischen. Übrigens passiert das wohl vielen Menschen, und vielleicht hat das sogar System: Bei dieser einzig verbleibenden Aktion soll uns Menschen die eigene Fehlbarkeit vorgeführt werden. Es ist so, als würde mir der Vollautomat zuflüstern: »Siehst du, lieber Mensch, du bist viel unbeholfener als ich. Es ist besser, du überlässt mir das Kaffeemachen, bevor du noch mehr herumkleckerst!«
Niemand aus meiner Familie steht auf »Trester leeren«. Es ist die Loser-Karte des Vollautomaten. Besonders irritierend ist die schicksalhafte Zufälligkeit, mit der diese Nachricht auftaucht. Keine Vorwarnung, kein Indiz, es passiert immer unerwartet und meistens dann, wenn man ohnehin in Eile ist. Oder die erste Tasse füllt sich problemlos, und dann blinkt plötzlich »Trester leeren«, und der Nächste hat das Nachsehen.
»Wieder mal typisch! Immer trifft es mich«, höre ich dann von meiner Frau. Wir haben uns deshalb schon fast gestritten, weil mein Kaffee durchging und ihr Kaffeewunsch mit einem »Trester leeren« quittiert wurde. Sie unterstellt mir, ich hätte ganz genau gesehen, dass die Maschine geleert werden musste! Beim Wassertank kann ich das nachvollziehen, doch »Trester leeren« bleibt ein Geheimnis. Ich glaube auch nicht an diskriminierende Präferenzen des Apparates, glaube nicht, dass er zum Beispiel etwas gegen Frauen hat. Es trifft mich genauso häufig wie sie; ich sollte vielleicht mal eine Strichliste führen.
Am leidigsten ist die Prozedur des »Tresterleerens« am frühen Morgen. In diesen Momenten verfluche ich den Vollautomaten. Absurd, oder? Ein neuer Tag bricht an, ich stehe auf, und das Erste, was mir passiert: Ich werde von einem Vollautomaten herumkommandiert: »Leere mich, sonst kriegst du keinen Kaffee!« Ich gebe zu, ich bin ein Morgenmuffel, das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter geerbt. Nach dem Aufstehen sagte sie immer: »Rede mit mir, aber frage mich nichts!« Doch der Kaffeevollautomat fragt nicht nur, er erpresst mich, und das vor meiner ersten Tasse Kaffee!
Der Kaffeevollautomat ist nur ein kleines Beispiel für die übertechnisierte Welt, die uns immer mehr umgibt. Automotoren werden heute so abgekapselt, dass man nicht mehr daran herumschrauben kann. Selbst Scheinwerferlampen lassen sich ohne Spezialwerkzeug nicht auswechseln, sodass man gezwungen ist, eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
An Mobiltelefonen sucht man vergeblich nach Schrauben, und ohnehin ist die technische Entwicklung so rasant, dass sich jede Reparatur erübrigt. Die Apparate wehren sich gegen den Versuch einer Reparatur mit splitternden Plastikteilen oder reißenden Membranen. Wir Konsumenten werden rausgehalten aus der Innenwelt des Fortschritts, werden degradiert zu Tastendrückern und Mausbedienern. Das alles geschieht bewusst: Steve Jobs, der Apple-Gründer, ließ Spezialwerkzeuge entwerfen, damit niemand das Macintosh-Computergehäuse mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher öffnen konnte.[5] Niemand außerhalb der Apple-Welt sollte Einblick in diesen Kasten bekommen. Die Zauberer des Neuen lassen sich nicht in die Karten schauen, denn die Magie ihrer Maschinen lebt vom Geheimnis um deren Innenleben.
In nur ein, zwei Generationen sind wir als ehemals fast autarke Selbstversorger zu abhängigen Konsumenten geworden. Dies ist nur ein Symptom eines Fortschritts, wie ihn die Welt in dieser Tiefe und in dieser Geschwindigkeit noch nie erlebt hat.
Unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter haben Zukunft noch als langsamen Prozess erlebt. Ihre Welt wurzelte in der Vergangenheit, und sie konnten sicher sein, dass Gegenwart und Zukunft kontinuierlich aus dem Gegebenen erwachsen würden. Die Menschen hatten also viel Zeit, sich anzupassen. Die Stetigkeit der Zeit verband dabei Alt und Neu zu einem Kontinuum.
Innovationen wie das elektrische Licht brauchten Jahrzehnte, bis sie sich in den Gesellschaften verbreiteten. 1882 erhellten erstmals elektrische Straßenlaternen die Leipziger Straße in Berlin. 30 Jahre später waren jedoch erst 3,5 Prozent der Berliner Wohnungen an das Stromnetz angeschlossen, und noch Ende der Zwanzigerjahre verfügte nur jeder zweite Berliner Haushalt über Elektrizität.[6] Selbst ein halbes Jahrhundert nach dem Aufkommen der ersten elektrischen Straßenlaternen in Berlin lebte noch immer ein Viertel der dortigen Bevölkerung ohne Strom.[7] Es dauerte manchmal Generationen, bis das Neue die Welt eroberte. Es gab eine Synchronität zwischen dem individuellen Altern und der Veränderung der Welt, die uns umgab. Die Zyklen der Technik verliefen in vergleichbaren Zeiträumen wie die Generationenfolge der Menschen. Die Zukunft wuchs aus der Vergangenheit empor, ein organisches Wachsen, so wie junge Bäume, die sich zaghaft nach oben recken, um sich nach Jahrzehnten ihren festen Platz im Wald zu sichern.
Aus einer Zukunft, die noch gestern eine Projektionsfläche für unsere Sehnsüchte und Hoffnungen war, ist inzwischen ein »disruptiver« Wandel geworden, bei dem Innovationen bestehende Realitäten nahezu schlagartig verdrängen. Niemand nimmt ihn wahr, bis er plötzlich mit aller Heftigkeit in unsere Realität einschlägt, wie ein Blitz aus dem Nichts.
2007 wurde das erste Smartphone eingeführt. Nur zehn Jahre später wird es bereits von der Hälfte der Weltbevölkerung genutzt. Das klassische Telefon brauchte noch 75 Jahre, bis 100 Millionen Menschen es nutzten. Zum Vergleich: Beim Mobiltelefon waren es nur noch 16 Jahre, bei Facebook lediglich 4,4 Jahre, bei WhatsApp und Instagram 2,2 Jahre, und das Online-Videospiel Candy Crush Saga benötigte gerade einmal 1,3 Jahre, um die 100-Millionen-Nutzergrenze zu durchbrechen.[8] Die Zahl der Facebook-Nutzer überschritt in nur sechs Jahren seit der Einführung des sozialen Netzwerks die Milliardengrenze. Dieses Tempo der Veränderung ist eine neue Qualität. Bei diesem globalen Hyperwachstum greifen selbstverstärkende Netzwerkeffekte, und so verändern sich ganze Geschäftszweige innerhalb einer Zeitspanne von weniger als einem Jahrzehnt.
Das, was wir für beständig hielten, löst sich auf: Unsere bisherige Arbeitswelt zerbricht, ganze Wirtschaftszweige geraten ins Wanken, Berufsbilder werden über Nacht ersetzt, und die neue Kommunikation verändert das Miteinander von Familien. Plötzlich legt sich über alles ein beschleunigter Alterungsprozess, und manche zerbrechen fast an dem rasenden Fortschritt.
Wir erleben einen nie da gewesenen Umbruch. Es gibt keinen geschützten Raum mehr, in dem wir uns darauf vorbereiten könnten, was auf uns zukommen wird, keine Zeit mehr, die Vor- und Nachteile des Neuen zunächst abzuwägen, bevor es bei uns Einzug hält. Moderne Entwicklungen erfassen alle Industrienationen auf unserem Planeten gleichzeitig. Wir erleben in dieser Hinsicht keinen Unterschied mehr zwischen den Metropolen New York, Berlin, Dubai, Singapur, Tokio oder Shanghai.
Die Strahlkraft der digitalen Revolution reicht in nahezu alle Bereiche hinein. Wie ein Virus infiziert sie die Medizin, den Finanzsektor, Medien, Maschinenbau oder den Dienstleistungssektor. Hierbei kommt es zu wechselseitigen Verstärkungsprozessen, die das Tempo des Umbruchs nochmals beschleunigen. Der Einfluss der Digitalisierung auf Entwicklungen in der Genforschung, den Fortschritt in den Materialwissenschaften oder auf die elektronische Miniaturisierung im Medizinsektor sind Beispiele dieser synergetischen Beschleunigungseffekte. Die Innovationen verändern die Arbeitsweisen, und diese wiederum fördern weitere Innovationen. Das eine bedingt das andere, und so erleben wir neuartige Resonanzeffekte des Fortschritts. Eben deshalb wird jede Prognose schwierig, denn niemand vermag die Folgen dieser gegenseitigen Beeinflussung vorherzusagen.
Zukunft bedeutet Veränderung. Der Einfluss der Elektrifizierung führte dazu, dass mehr Menschen lesen und schreiben lernten, und hatte somit einen Einfluss auf die Bildung unserer Gesellschaft. Die Nutzung des Kühlschranks verbesserte nachweislich unsere Ernährung. Das waren gravierende, aber einfache Vorgänge im Vergleich zur Komplexität des heutigen Wandels. Noch vor wenigen Jahrzehnten las man auf Telefonzellen den Spruch: »Fasse dich kurz!« Heute, im Zeitalter der Dauerkommunikation, mutet dieser Satz an wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Epoche und macht deutlich, wie schnell technische Innovationen auch unser eigenes Verhalten beeinflussen. Der Mensch der Zukunft denkt und fühlt anders, seine Träume und Ideale werden anders sein, ebenso seine Sprache, seine Gepflogenheiten und seine Selbstsicht. Das künftige Betriebssystem unseres Miteinanders wird so grundverschieden sein von heutigen Gepflogenheiten, dass schon allein aus diesem Grund Zukunftsprognosen unmöglich erscheinen.
Der »Klebstoff« unserer Gesellschaft löst sich auf, wenn wir in Gruppen zerfallen, in »Digital Natives« und »Digital Immigrants«, in Generation X, Y oder Z. Schon die Differenz weniger Lebensjahre bedeutet einen relevanten Unterschied im Verhalten, bei den Vorlieben oder der Erwartung der jeweiligen Gruppe. Binnen weniger Jahre werden ganze Verhaltensmuster zu einer neuen Selbstverständlichkeit. Wie zum Beispiel verändert der Onlinehandel die Struktur unserer Innenstädte? Wir unterschätzen die normative Kraft des Entstehenden. Mütter verstehen ihre Töchter nicht mehr, und die Träume unserer Väter lösen sich mit einer unfassbaren Rasanz auf.
Die digitale Auflösung der Privatheit, der wachsende Gebrauch von Algorithmen in allen Lebensbereichen, vom Bankkredit bis zur Partnerwahl, oder die fundamentale Veränderung des Menschenbildes durch die fortschreitende Medizin, all das geschieht, ohne dass wir gefragt werden. Die Zukunft ist plötzlich da.
Können wir also überhaupt den Lauf der Dinge beeinflussen, oder sind wir inzwischen Gefangene einer verborgenen Logik, deren Kraft jeden Folgeschritt bestimmt und die keine Abweichungen mehr duldet? Ist Zukunft zu einem Zwang geworden, zu einem verpflichtenden Automatismus für uns alle? Schaffen wir die Zukunftsvisionen, oder erschafft sich die Zukunft selbst und macht uns zu einem bloßen Passagier auf einer Reise ins Ungewisse?[9]
Wir erleben diese schrille Dissonanz zwischen dem Gestern und dem Morgen, zwischen Beharren und Erneuerung, zwischen Alt und Neu. Alte Regeln und Konventionen verlieren ihre Gültigkeit, ohne dass es im Vorfeld zu einer gesellschaftlichen Diskussion darüber kommt. Wir werden hinausgeworfen aus unserem vertrauten Haus voller Traditionen und Konventionen und stehen plötzlich orientierungslos mitten auf der Straße des Fortschritts. Der neue Mensch muss sich »im Ungeborgenen geborgen wissen« (Picasso), und diese paradoxe Anforderung ist für viele von uns kaum erträglich.
Manche bleiben an der Abrisskante des Neuen stehen, andere springen aus Verzweiflung. Ist es nicht sonderbar? Wir scheinen diesen Wandel als gegeben hinzunehmen wie ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch, gegen den wir nichts ausrichten können. Der Fortschritt erscheint vielen von uns wie ein Naturgesetz. Seine Regeln scheinen unverrückbar. Wie sagte der US-Wissenschaftsberater John Gibbons schon in den Neunzigerjahren: »Go online or decline«, gehe ins Netz oder stirb. Jedes Zögern oder Abwarten löst Ängste aus, man könne als Individuum, Unternehmen oder als Nation den Anschluss verpassen oder wirtschaftlich das Nachsehen haben, und so laufen wir dem Fortschritt hinterher, ohne recht zu wissen, wohin sein Weg uns führen wird.
In den letzten Jahren wurden unsere Gene entschlüsselt, und die Mauern unserer körperlichen Privatheit werden eingerissen. Im stillen Einverständnis geben wir unsere Kundendaten preis und räumen den Arbeitsplatz für seelenlose Maschinen.
Unser Freiheitskorridor scheint sich immer mehr einzuengen, unsere Arbeitsabläufe werden immer genauer quantifiziert und evaluiert. Unser Leben wird in einzelne Prozesse aufgespalten, und jeder davon wird bis ins Letzte optimiert. Gefangen im globalen Wettstreit, geben wir das Heft immer mehr aus der Hand. Das Machbare zwingt uns in eine Schablone, und die völlige Transparenz offenbart jenen schwindenden Rest, der uns von Automaten unterscheidet. Haben wir das Streben der Aufklärung nach der Freiheit und der Gestaltungsmacht des Einzelnen aufgegeben, oder pocht womöglich eben diese Aufklärung auf ihre eigenen Gesetze und macht uns zu Gefangenen einer höheren Logik?
Ohne Zweifel hat es noch nie in der Geschichte eine Zeit solch radikaler Umbrüche und Zäsuren gegeben; Berechenbarkeit, Effizienz oder Effektivität haben sich zu Werten an sich entwickelt, zu Selbstläufern. Das ökonomische »Höher, Schneller, Weiter« wird auf die Spitze getrieben. Der Zeittakt hat sich vom Herzschlag gelöst und wird unhörbar durch unsere Maschinen bestimmt: High-frequency trading, Just-in-time-Produktion, Fast Lane, Express Delivery, Highspeed … und das 24/7, ohne Atempause, ohne Bedenkzeit, ohne Ausstiegsmöglichkeit. Fortschritt heißt schneller – aber was tun in der ersparten Zeit?
Unsere Kaffeemaschine jedenfalls ist defekt und geht für die nächsten Tage in Kur. Wir filtern wie früher, als es noch keine Mikroprozessoren gab, keine Maschinen, die Menschen herumkommandieren, und keine grünen Anzeigen, auf denen »Trester leeren« aufblinkt.
Vielleicht haben diese Maschinen eine heimliche Abneigung gegenüber bestimmten Menschen? Meine Mutter jedenfalls glaubte fest daran, dass ihr kleines Auto eine »Seele« habe. Als sie den Wagen kaufte, veranstaltete sie eine kleine Zeremonie, ein »Pujaa«: In Indien ist es üblich, Busse, Lkws oder Motorräder zu segnen, und so streute meine Mutter etwas Currypulver und Reis auf ihren neuen Wagen und fuhr anschließend in Anwesenheit der ganzen Familie über eine Zitrone. Das sollte Glück bringen. »Leilaloo«, wie sie den Wagen taufte, wurde sehr alt und setzte mit der Zeit Rost an, doch meine Mutter brachte es nicht übers Herz, sich von ihrem beseelten Gefährt zu trennen. An kalten Tagen, wenn der Motor beim Starten hustete, sprach sie »Leilaloo« gut zu, zog Zündhebel, betätigte Schalter, tätschelte das Lenkrad, bis der Wagen irgendwann keuchend ansprang. »Braves Mädchen!« Wahrscheinlich hätte meine Mutter auch mit unserem Kaffeevollautomaten geredet …
Die digitale Revolution[10]
Mein Vater schrie, meine Mutter weinte, und im Telefonhörer vernahm ich durch das Rauschen die ferne Stimme meiner Großmutter: »Frohe Weihnachten, mein Junge!« In meiner Kindheit waren Ferngespräche von Luxemburg nach Indien sündhaft teuer. Man musste jedes Gespräch anmelden, erst nach mehreren Stunden Wartezeit kam die verrauschte Verbindung zustande, und für wenige Minuten stand der direkte Draht zwischen den Kontinenten. An Ostern und Weihnachten wurde telefoniert, ansonsten schrieben wir uns Briefe, die erst nach wochenlanger Reise ihr Ziel erreichten.
In der digitalen Welt hingegen sind wir ständig »on«, egal auf welchem Kontinent wir uns gerade befinden. Selbst in den entfernten Regenwäldern Vietnams hatte ich einen passablen Handyempfang und erschrak, als ein Teamkollege mit seinem Anruf die Exotik der Wildnis entweihte.
Kommunikation, Einkaufsverhalten, Bankgeschäfte, Reisen, Medien, Fertigungstechniken, Politik oder Produktionsabläufe … überall verändern sich Prozesse auf fundamentale Weise. Wir stehen gerade am Anfang dieser digitalen Revolution. Wohin das Ganze führen wird, vermag niemand zu sagen, denn die Zukunft lässt sich nicht in die Karten blicken, und selbst Experten liegen mit ihren Prognosen meist daneben. Wir betrachten das Neue mit alten Augen und unterschätzen, dass diese Entwicklung uns selbst verändert, unsere eigene Sicht und unser Bild von uns selbst.
Verhaltensmuster, Einkaufsroutinen, Such-, Interessens- und Bewegungsprofile werden protokolliert – der Run auf »Big Data« hat begonnen. Wir alle füttern bereitwillig die hungrige Datenmaschinerie mit unseren intimsten Geheimnissen. 84 Prozent der Smartphonebenutzer geben inzwischen an, unmittelbar nach dem Aufwachen eine App auf ihrem Mobiltelefon zu checken.[11] Fitnessbänder übertragen Herzschlag und tägliches Laufpensum an die Cloud, und die allgegenwärtige Spracherkennung entziffert unsere Wünsche und merkt sich unsere Muster. Darf diese App auf Ihren Aufenthaltsort zugreifen? Täglich fallen so 2,5 Milliarden Gigabyte an Daten an: Abbuchungen, besuchte Webseiten, Kurznachrichten, Bestellungen, Reiserouten, Musiktitel, Suchergebnisse …[12]
Der größte Teil der Daten wird gesammelt, und noch sind 80 Prozent davon unstrukturiert, doch der weltweite »Analytics«-Boom belegt, welches Potenzial dieser Datenrohstoff besitzt. Unser Verhalten wird durch aufwendige Rechenprozesse zunehmend vorhersagbar, mehr noch, die Daten werden unser Verhalten immer genauer beeinflussen. Wenn Sie also demnächst von schönen Kleidern oder Fernreisen träumen, dann sollten Sie einen Moment darüber nachdenken, ob es wirklich ihr eigener Traum ist oder vielleicht doch ein eingepflanzter Wunsch. Der frühere Google- und heutige Alphabet-Chef Eric Schmidt brachte es auf den Punkt: »Wir wissen, wo Sie sind, wir wissen, wo Sie waren, und wir wissen mehr oder weniger, woran Sie denken.«[13] Schon heute kennen Internethändler ihre Kunden so gut, dass sie die gezielte Werbung mit ein paar Zufallsinseraten verschleiern, da sich die Kunden sonst beobachtet fühlen.
Big Data ist im 21. Jahrhundert das, was im 18. Jahrhundert die Dampfkraft oder im 19. Jahrhundert die Elektrizität war: eine fundamentale Revolution. Die Vernetzung erfasst dabei nicht nur Smartphones oder Laptops, sondern potenziell sämtliche Apparate, die uns umgeben. Dank der stets schrumpfenden Elektronik können Sensoren in jedem beliebigen Gegenstand verbaut werden – die Kosten dafür liegen im Centbereich. Man schätzt, dass schon heute über zehn Milliarden Objekte und Apparate auf unserem Planeten miteinander vernetzt sind, vom Thermostat bis zum Ersatzreifen, vom Kaffeeautomaten bis zum Staubsauger, von den Schuhen bis zum Automobil, von der Werkzeugmaschine bis zum Sturmgewehr.
Mediziner werden bislang nur aktiv, wenn der Patient erkrankt; Strafverfolgung setzt erst ein, wenn eine Straftat vorliegt. Doch die Reihenfolge könnte sich umkehren, denn die Datenalgorithmen haben unsere Welt auf den Kopf gestellt: Gesunde Menschen werden operiert, nur weil medizinische Daten auf ein mögliches Krankheitsrisiko hinweisen, und unschuldige Bürger werden verdächtigt, weil sie demnächst angeblich straffällig werden könnten. So der Ansatz des EU-Forschungsprogramms CAPER, das sich auf der Basis von »offenen und privaten Informationsquellen« der Prävention von organisierter Kriminalität widmet.[14] Als die Versicherungsgruppe Generali ankündigte, als erster großer Versicherer in Europa Fitness, Ernährung und Lebensstil ihrer Kunden über eine App zu erfassen, wirkte das wie ein Tabubruch.[15] Doch die Logik ist nachvollziehbar: Wer gesund lebt, kostet den Krankenversicherer weniger, und willige Kunden werden mit Rabatten gelockt. Die totale digitale Transparenz wird unseren Lebensstil nachhaltig beeinflussen. Schon bald joggen wir, weil die App uns dazu auffordert, und essen Obst statt Pommes, weil sonst die Krankenversicherungstarife steigen. Aus dem »freiwilligen Datenteilen« wird so allmählich ein Zwang zur Selbstoptimierung.
Ist es nicht eine Frage der Zeit, bis Autos die Geschwindigkeitsprofile ihrer Fahrer weiterleiten? Radarfallen gehören dann der Vergangenheit an. Steuererklärungen erfolgen automatisch, da doch jede Finanztransaktion elektronisch erfasst werden kann. Das wahre Potenzial von Big Data versteckt sich in diesen unzähligen kleinen Datenschnipseln, die miteinander kombiniert und korreliert werden können. Eine tiefe Auswertung lässt erahnen, ob ein Mensch etwa zu Depressionen neigt, ein Ehepaar sich auseinanderlebt oder ein Arbeitnehmer sich zunehmend weniger für sein Unternehmen engagiert. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte würden Maschinen uns dann besser verstehen, als es uns selbst gelingt. Die Entwicklung läuft im Eiltempo in diese Richtung, und Analytics-Firmen sprießen wie Pilze aus dem Boden. Alleine IBM hat in den vergangenen Jahren über 24 Milliarden Dollar in diesen Bereich investiert, und auch die Internetgiganten Google, Amazon und Facebook verfolgen ähnliche Ziele.
Die digitale Revolution wurzelt in der tiefen Annahme, dass sich die Vielfalt unseres Lebens auf messbare Zahlenströme übertragen lässt. Diese Abstrahierung der Wirklichkeit, bei der Algorithmen natürliche Prozesse nachbilden, macht aus einer erfahrbaren Realität einen berechenbaren Prozess.
Die Ursprünge dieses Denkens liegen in ferner Vergangenheit. Historikern ist es bislang nicht gelungen, den genauen Ort und das Datum für die Erfindung der ersten mechanischen Uhr eindeutig festzulegen, doch es muss ein magischer Moment gewesen sein. Zum ersten Mal erschuf der Mensch einen Apparat mit einem eigenen Herzschlag. Wo Sonnenschatten und Sterne einst den Lauf des Lebens bestimmten, war es nun ein raffiniertes Gefüge aus Zahnrädern, Federn und Zeigern, welche in sich einen regelmäßigen Takt erzeugten. Anfangs fehlte es den Zeitmaschinen noch an Genauigkeit, doch mit der Umsetzung des Pendelprinzips verband Christiaan Huygens Mitte des 17. Jahrhunderts das mechanische Zählwerk mit einem universellen Naturphänomen, der Bewegung des Pendels. Seine Periode ist konstant und wird lediglich durch seine Länge bestimmt. Jede Pendeluhr zählt also nur die Schwingungen und überträgt diese auf ein Zählwerk, das dann durch abgestimmte Übersetzungen die Zeiger der Uhr weiterbewegt. In der Pendeluhr vereinen sich so die Naturgesetze mit der Handwerkskunst, verschmelzen Realität und Künstlichkeit. Auf einen Schlag war Huygens’ Zeitmesser allen anderen Uhren überlegen.
Diese Bändigung der Zeit faszinierte mich derart, dass ich mehrere Tage damit zubrachte, Zahnräder zu berechnen und aufzuzeichnen. Erst nach einigen Anläufen verstand ich das genaue Prinzip der Hemmung, welche die Energie des Gewichts in einem Stop-and-go-Prozess aufspaltet, um sie auf die einzelnen Zähne des Zahnrads zu übertragen und dabei gleichzeitig die Schwingung des Pendels am Leben zu halten. Ich verschwand eine ganze Woche in meiner Werkstatt, sägte Zahnräder aus Holz, baute mit großer Vorsicht eine Hemmung und experimentierte stundenlang, bis ich schließlich eine funktionierende Pendel-»Uhr« aus Holz hergestellt hatte. Das Motiv meiner handwerklichen Eskapade war mein tiefer Wunsch, diesen magischen Moment des künstlichen Herzschlags bis ins letzte Detail nachzuvollziehen. Während ich feilte und bohrte, wuchs mein Respekt für die frühen Uhrmacher, die mit bescheidenen Mitteln ihre ersten Apparate bauten.
Die Pendeluhr trat im 17. Jahrhundert ihren Siegeszug an. Turmuhren erhielten, nachdem sie zuvor lediglich die Stunde anzeigten, einen Minutenzeiger. Aufschlussreich übrigens, wie unterschiedlich damals die Nationen auf diese folgenreiche Innovation reagierten. In seinem Buch: Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit beschreibt Thomas de Padova[16], wie die in Zünften organisierten Uhrmacher in Deutschland aufgrund ihrer starren Regeln diese Möglichkeit der fruchtbaren Synergie von Wissenschaft und Handwerk verpassen. Augsburg, wo zwischen 1550 und 1650 mindestens 182 Uhrmachermeister zugelassen waren, verliert seine führende Stellung, und London wird zur neuen Metropole der Zeitmaschinen. Dort erschaffen der Physiker Robert Hooke und der Handwerker Thomas Tompion eine präzise tickende Taschenuhr und übertragen dabei das Pendelprinzip auf eine hin- und herschwingende Feder. Die Zeitmaschine wird also mobil, und ihr universeller künstlicher Herzschlag wird fortan zum Motor des Fortschritts.
Das einstige Kontinuum der Zeit wird zerschnitten in abzählbare Teile. Der Lauf der Sonne wird in einem linearen Prozess durch diskrete Zahlen abgebildet. Den diffusen Zeitbegriffen wie Dämmerung, Einbruch der Nacht, Mitternacht oder Morgengrauen werden präzise Zahlen in Form der Uhrzeit zugeordnet. Die Zeitkultur der Menschen wird digitalisiert, die Zeit wird zur Zahl. Dieser fundamentale Wechsel vom Diffusen zum Diskreten verändert unseren Alltag. Er wird fortan mit Terminkalendern geordnet, Geschäfte, Fabriken und öffentliche Einrichtungen richten ihre Aktivitäten nach dem numerischen Zeittakt, und die Anzeigen der Bahnhofsuhren werden zur Referenz wachsender Mobilität. Bei sportlichen Wettkämpfen wird die digitalisierte Zeit selbst zum Gegner. Rekorde werden von nun an in Zahlen formuliert. Ende des 19. Jahrhunderts testet der Ingenieur Frederick Taylor mit einer Stoppuhr, wie sich Fertigungsprozesse effizienter gestalten lassen, und legt damit die Grundlagen für die industrielle Fließbandfertigung. Der Zeittakt beschleunigt sich immer weiter und mündet ein Jahrhundert später in den unhörbaren Takt des Hochfrequenzhandels.
Die Uhr wurde zum ersten Apparat, den Menschen ständig bei sich tragen – bis sie vom Smartphone ersetzt wurde. Beide folgen demselben Grundgedanken: Die Wirklichkeit wird in einer Zahlenwelt abgebildet. Heute entstehen ganze Flugzeuge zunächst im Computer. Jedes einzelne Teil des Rumpfes oder des Flügels wird dabei als Mosaik aus diskreten Einzelelementen zusammengesetzt. Kein Mensch wäre alleine in der Lage, die Belastungen und Festigkeiten eines derartig komplexen Gebildes zu überschauen, geschweige denn vorherzusagen. Erst durch die Übertragung realer Phänomene in das Universum der Zahlen werden diese gigantischen Objekte möglich. Mit der Digitalisierung, also der Übertragung der Wirklichkeit in die Welt der Zahlen, kommt es so zu einer Überhöhung. Das Berechenbare übertrifft unsere kühnsten Fantasien. Es prägt unser Denken, und der künstliche Herzschlag des Apparats bestimmt unser Miteinander.
Wir erleben derzeit eine epochale Scharnierphase so wie einst, als das Mittelalter durch die Renaissance abgelöst wurde oder die Moderne die Gesellschaft erschütterte. In solchen historischen Epochen veränderten technische Neuerungen die Gesellschaft und die Selbstsicht des Menschen. Die digitale Revolution wird uns ebenfalls verändern, und es liegt bei uns selbst, ob wir diesen Fortschritt als Getriebene erleben oder als Gestalter. Vielleicht werden spätere Generationen uns um diese Phase des Umbruchs beneiden und mit derselben Bewunderung zurückblicken wie wir auf die Renaissance.
Und sie irren sich doch
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
– Helmut Schmidt –[17]
Wie werden wir in Zukunft wohnen? Was ändert sich durch die zunehmende Globalisierung? Werden Roboter uns kontrollieren? Stehen wir am Anfang einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz?
Es gibt viele Zukunftsinstitute, Vordenker, Futurologen und Experten für das Übermorgen. In bunten Vorträgen erzählen sie uns von dem, was auf uns zukommt. Hierbei hört man neue Modewörter wie z.B. »Over-novation«, »Medien-Exodus«, »Response Shift« oder »Digital Shapers«[18], und so mancher im Publikum fühlt sich anschließend wie ein stehen gebliebener Ignorant, dem gerade dämmert, dass er die Zukunft verschläft. Kein Tag vergeht, ohne dass Innovationsworkshops, Transformationsseminare oder Changekonferenzen zur Teilnahme einladen unter dem Motto »Willkommen in der Welt von morgen!«
Natürlich vergessen wir irgendwann, was die Apologeten des Neuen uns prophezeit hatten. Doch wäre es nicht eine reizvolle Idee zu prüfen, ob ihre Thesen tatsächlich zutreffen? Vielleicht könnte man eine Geld-zurück-Garantie einführen, die nach zehn Jahren fällig wird, falls es doch anders kommt als behauptet. Ich stoße jedenfalls auf viele Beispiele, die belegen, dass selbst ausgewiesene Fachleute bei der Einschätzung der Zukunft grundlegend irrten.
Ein Klassiker ist das Zitat von Ken Olsen aus dem Jahre 1977: »Es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte.«[19] Olsen hatte 1957 die Computerfirma Digital Equipment Corporation (DEC) gegründet; in Forschungsinstituten waren die DEC-Minicomputer, wie etwa das Modell PDP-11, weitverbreitet. In den Achtzigerjahren war Digital Equipment der zweitgrößte Computerhersteller der Welt mit über 100000 Angestellten.[20] Als junger Student war ich fasziniert von den leistungsstarken und lauten Schränken voller Lüfter und blinkender Leuchtdioden. DEC-Rechner waren der Standard, und Olsen wurde vielfach ausgezeichnet. Wie aber konnte ein Profi wie er dennoch die Zukunft seiner Branche so falsch einschätzen? Wenn einer Einblick in die neuesten Entwicklungen hatte, dann doch er!
Anfang der Neunzigerjahre gab es bei DEC einen »unerwarteten« Umsatzrückgang. Acht Jahre später wurde der Computergigant aufgelöst. Man hatte die Zukunft falsch eingeschätzt, geblendet vom Erfolg und von der eigenen Größe. David hatte Goliath bezwungen, der Personal Computer veränderte die Welt der Großrechner, und nur ein Jahr nach dem Verschwinden von DEC überschritt die Zahl der weltweit verkauften PCs erstmals die 100-Millionen-Marke.[21]
Der Untergang von Digital Equipment ist kein Einzelfall. In dem großartigen Roman »Hundert Jahre Einsamkeit« meines Lieblingsautors Gabriel García Márquez macht der Zauberer Melchíades den Sonderling José Arcadio Buendía mit einem besonderen Geheimnis bekannt: einem Block Eis. Man begreift Buendías Erstaunen, denn Eis war inmitten der tropisch schwülen Welt von Macondo vollkommen unvorstellbar.
Doch beim Blick in die Geschichtsbücher stieß ich auf ein bemerkenswertes Kapitel: Im 19. Jahrhundert etablierte sich in den USA eine gigantische Natureis-Exportindustrie. Der Kühlschrank war noch nicht erfunden, und Eis war in den schwülen Metropolen der tropischen Kolonien nicht vorhanden. Frederic Tudor, Sohn eines Anwalts aus Boston, kam mit gerade 23 Jahren auf die spleenige Idee, Natureis aus den gefrorenen Seen um Boston zu ernten, um es dann in die ganze Welt zu exportieren. Nach mehreren Versuchen gelang ihm das Unmögliche: Die Eisblöcke überstanden in Heu, Sägemehl und Decken eingewickelt selbst die lange Reise nach Indien. An der Ganges-Mündung angekommen, war zwar ein Teil der Ladung geschmolzen, doch die verbleibenden 100 Tonnen Eis sorgten für Furore. Wahrscheinlich bestaunten die Hafenarbeiter das kalte Wunder so, wie es die Figuren im Roman von Márquez tun.
Tudor perfektionierte seine Ernte- und Lagertechnik und besaß weitreichende Konzessionen. Eine große Flotte lud in den nächsten zwanzig Jahren ihre eisige Fracht in den Häfen von Madras, Bombay und Kalkutta ab, wo sie in speziell dafür errichteten Eishäusern zwischengelagert wurde. In der Blütezeit verfügte der »Eiskönig« über 150 Schiffe und machte alleine mit seinen Eislieferungen nach Kalkutta innerhalb von zwei Jahrzehnten eine Viertelmillion Dollar Gewinn. Andere folgten seinem Beispiel, und Ende des 19. Jahrhunderts zählte die Eisindustrie zu den größten Exportindustrien der USA.
Die Spezialisten verschätzten sich allerdings. Trotz des Aufkommens erster Kühlmaschinen hielt man an der alten Technologie fest. Um die Jahrhundertwende hatten sie das Rennen verloren. Die Natureisindustrie brach zusammen. Hundert Jahre später sollte es dem Fotofilm ähnlich ergehen.
Eastman Kodak, das weltbekannte Unternehmen, das einst die Fotografie revolutionierte, verpasste ebenfalls die Ausfahrt in die Zukunft. Vielleicht erinnern Sie sich an die gelbe Verpackung der Filmrollen, die wir auf unseren Urlaubsreisen mitführten. 1988 beschäftigte das Unternehmen 144000 Menschen, und noch zur Jahrhundertwende prahlte man mit exorbitanten Umsätzen. Ich erinnere mich, wie Fachverkäufer damals auf mich einredeten und mir versicherten, dass Digitalkameras niemals das Auflösungsvermögen und die Empfindlichkeit eines Films erreichen würden. Unvorstellbar, dass auch hier nach über 110 Jahren die traditionsreiche Firmengeschichte enden sollte. 2013 stellte Kodak die Filmproduktion komplett ein.
Je schneller die Entwicklung wird, desto wichtiger ist eine realistische Einschätzung der Zukunft, doch offensichtlich versagen viele bei diesem Unterfangen. Ich erinnere mich an einen Bekannten, der durch den Verkauf von Großrechneranlagen reich geworden war. Er beschäftigte über zweihundert Mitarbeiter und belieferte viele Institutionen in Deutschland. Auch er verkannte die Zeichen der Zeit, und der Siegeszug des PCs ließ seine Geschäfte einbrechen. Als ich ihn traf, hatte er nur noch einen einzigen Mitarbeiter. Die beiden bauten gemeinsam die Großrechner ab, die sie einst verkauft hatten. Die schwere körperliche Arbeit beim Schleppen der großen Technikschränke setzte dem Mann sichtlich zu. Als Sechzigjähriger demontierte er seine eigene Biografie. Warum hatte er sich derartig geirrt? Warum hatte er nicht rechtzeitig umgestellt?
Die Fehlbarkeit der Prognosen hat damit zu tun, dass wir unsere Zukunft nicht mehr als linearen Entwicklungsprozess begreifen können, der sich aus der Vergangenheit heraus entwickelt, sondern mit Brüchen konfrontiert werden. Das Neue ist ein Außenseiter, der oft nicht dem Kerngeschäft entspringt.
Dem Natureislieferanten Tudor war die Welt der thermodynamischen Kältemaschinen genauso fremd wie den Filmproduzenten von Kodak die Welt der digitalen Sensoren. In ihrer Welt chemischer Emulsionen und großer Entwicklungsapparate gab es kein Verständnis dafür, dass man Bilder auch mithilfe von elektronischen Bauteilen einfangen konnte. Die Erfolge der Vergangenheit machen blind für den nötigen Perspektivwechsel, zumal das Neue zunächst als unvollkommener Entwurf einen alternativen Weg aufzeigt.
Die ersten PCs wirkten im Vergleich zu den glänzenden Großrechnern zusammengeschustert, und niemand ahnte, wie rasant der Wechsel kommen würde. Ob wir wollen oder nicht, wir halten uns an Bewährtes und trauen uns nicht loszulassen. Wie oft höre ich den Satz: »Wenn ich in Rente gehe, könnt ihr ja alles verändern!« Innovation wird als Bedrohung der eigenen Position und der eigenen Kompetenz empfunden.
Plötzlich verändern sich die Spielregeln, und ehemalige Fachleute werden zu Ignoranten des Neuen. Kodak besaß sicherlich ausgezeichnete Chemiker, doch ihr Wissen war wertlos für die Digitaltechnik. Sollte der Chef plötzlich zum Lehrling werden? Welch ein Statusverlust! Unser ganzes Arbeitsleben, all die Stationen unseres Aufstiegs, das gesammelte Know-how, die Netzwerke unserer Industriepartner, all das kann doch nicht von heute auf morgen überflüssig werden. Veränderung ist ein schmerzhafter Prozess, für ganze Unternehmen und für jeden Einzelnen von uns, und zwingt uns, herabzusteigen vom Thron vergangener Erfolge. Wer will schon sein bisheriges Berufsleben auf den Müll werfen, um ganz von vorne anzufangen?
Diese verständlichen Beharrungskräfte verhindern einen Neuanfang und sperren sich gegen jede Störung von außen. Wir leben alle in einer »Ingroup«, einer unsichtbaren Blase an Gleichgesinnten, verkehren mit Kollegen aus demselben Stall, die alle unter denselben Ängsten leiden. Unbewusst beginnen wir also damit, uns selbst zu täuschen. Wir reden die fremde Entwicklung klein und finden damit Zuspruch bei unseren Kollegen. Mit der Zeit stimmen alle in denselben Chor ein. Nein, das wird nicht kommen, das kann gar nicht kommen! Wir können uns beim Anblick der großen Maschinenhallen und Fertigungsanlagen partout nicht vorstellen, dass all dies schon morgen vorbei sein könnte. Ganze Branchen unterliegen diesem Mechanismus der Selbsttäuschung, und dasselbe Lied ist bei Banken, Medienunternehmen oder der Autoindustrie zu hören.
Wäre es möglich, dass ein gewaltiger Zweig wie die Automobilindustrie verschwindet oder zumindest dramatisch schrumpft? Alleine in Deutschland sind in diesem Industriesektor rund 750000 Menschen direkt beschäftigt.[22] Wenn ich in der Generation meiner Kinder den Wandel hin zu Carsharing und anderen Mobilitätskonzepten betrachte, werde ich nachdenklich. Die nächste Generation nutzt sporadisch ein Fahrzeug, ohne es besitzen zu müssen.
Autos sind kein natürliches Bedürfnis von uns Menschen, sonst würde die deutsche Autobranche wohl kaum jedes Jahr etwa zwei Milliarden Euro für Werbung ausgeben.[23] Auf bunten Werbetafeln und in Fernsehspots läuft das ewige Auto-Mantra und erzählt uns das Märchen von Freiheit und Selbstverwirklichung. Doch wie viel CO2 muss ein Mensch produzieren, um glücklich zu sein?
Der Autokauf ist, wie ein befreundeter Händler mir mal sagte, eine rein emotionale Sache, doch Emotionen können sich eben auch ändern. Manche Menschen stottern ihr Auto ab und machen sich nicht klar, dass sie mehrere Monate im Jahr nur dafür schuften. Autos sind teuer in ihrer Anschaffung und auch im Gebrauch. Die Benzin-, Versicherungs- und Wartungskosten summieren sich. Bei rationaler Betrachtung verändert sich das Bild vom eigenen Pkw. Zudem wird die wachsende Stau- und Umweltproblematik in Megastädten den Individualverkehr ohnehin in den kommenden Jahren stark einschränken. Die Zeichen der Zeit weisen in eine andere Richtung, doch die Autobranche gibt sich immer noch zuversichtlich und verweist auf die momentan guten Umsätze. Ironischerweise akzeptieren wir den Wandel in anderen Branchen, doch dann, wenn es uns selbst betrifft, mangelt es uns an Vorstellungskraft.
Mit jeder Innovation verschieben sich zudem Schwerpunkte, ändern sich Sichtweisen, und dieser Perspektivwechsel macht es uns so schwer, vom Heute in das Morgen zu extrapolieren.
Stellen Sie sich einen Moment vor, Sie lebten am Ende des 19. Jahrhunderts, Sie sind geprägt von den Werten und Konventionen der Zeit. Und nun blicken Sie auf eine Szene an einem Urlaubsstrand des 21. Jahrhunderts: Mädchen in Bikinis bräunen sich, Urlauber joggen am Strand, während andere zum Klang ihrer Kopfhörer tanzen. Fast alles, was Sie sehen, widerspricht den Konventionen des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts. Die Bikinis zeigen so viel Haut, dass Ihnen die Badegäste fast nackt vorkommen. Ende des 19. Jahrhunderts war sittsame Kleidung angesagt, die Bademode bestand aus Röcken und Blusen mit langen Ärmeln. Zudem widerspräche das Bräunen dem damaligen Schönheitsideal. Noble Blässe war angesagt, während sonnengebräunte Haut das Merkmal armer Menschen war, die sich ihren Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit z.B. auf dem Feld verdienen mussten. Das Joggen käme Ihnen völlig abwegig vor. Warum laufen Menschen ohne jede Notwendigkeit? Sport war im 19. Jahrhundert, abgesehen von Turnverbänden, noch nicht en vogue. Die grellen Leuchtfarben der Badehosen würden Ihnen auffallen und vielleicht die kleinen Ohrstöpsel, aus denen auf wundersame Weise Musik erklingt. Nur das regelmäßige Anrollen der Wellen käme Ihnen vertraut vor.
Aus der Perspektive des späten 19. Jahrhunderts ist unsere heutige Welt radikal anders. Betrachtet man ältere Darstellungen, die eine Vision der Zukunft ausmalen, spürt man, bei aller Kühnheit der Autoren, wie sehr die jeweiligen Fiktionen in ihrer Zeit verwurzelt bleiben. Fliegende Autos, rasende Dampfschiffe, gigantische Unterseeboote oder Ferienkolonien auf dem Mars – immer übertrug man die zeitgebundene Sicht der Dinge auf ein Übermorgen. Man träumte zum Beispiel von Autos mit Atomantrieb, die mit 1000 km/h auf Überlandstraßen unterwegs sind[24], doch in den Darstellungen tragen die Damen in diesen Atomgefährten der Zukunft noch dieselben Kleider, mit denen sie einst in Postkutschen unterwegs waren. Das Neue lässt sich nicht aus dem Alten entwickeln, und die Zukunft von gestern zeigt uns, wie sehr wir irren bei diesen Extrapolationen.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass Lehrer ihre Schüler mit dem Schlagstock züchtigten, Chirurgen auf Klinikfluren rauchten, Kinder ohne Sicherheitsgurt auf der Autorückbank saßen, oder dass Atommüll einfach im Meer versenkt wurde. Was selbstverständlich schien, hat sich verändert, und das wird auch in Zukunft so sein. So sehr wir uns die Kristallkugel, mit der wir in die Zukunft blicken, auch wünschen, wir würden ihre Bilder nicht deuten können, weil auch wir im Übermorgen zu anderen Menschen geworden sein werden.
Von Ochsenkarren und Supercomputern
Die Frage ist, wissen Sie, wieso Sie hier sind?
– Der Merowinger in »Matrix Reloaded« –
Während meiner Kindheit in Indien erlebte ich eine einzigartige Gleichzeitigkeit: Das dortige Straßenbild war ein Sammelsurium verschiedenster Zeitepochen, die alle ineinanderzufließen schienen: Hupende Autos überholten Rikschas, halb nackte Sadhus reckten sich, während Geschäftsleute im Anzug in ihre Büros eilten. Straßenhändler verkauften geröstete Erdnüsse wie vor Hunderten von Jahren, während direkt daneben moderne Stores in ihren klimatisierten Räumlichkeiten westliche Waren anpriesen.
Sieht man in Indien eine Frau im Sari, die gerade ein Mobiltelefon benutzt, ist man sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass diese Szene gleich mehrere Jahrhunderte überspannt. Ein Mobiltelefon in der Hand und noch immer die gleiche Kleidung wie vor 4800 Jahren? Wer sich auf der dritten Etage des Nationalmuseums in Delhi die historischen Sarisammlungen ansieht, wird überrascht sein, denn man hat den Eindruck, man blicke in das Schaufenster eines heutigen Stoffgeschäfts. Saris sind offenbar zeitlos.
In Indien scheint das Neue das Alte zu ergänzen, anstatt es zu ersetzen. Manche Häuser verfügen über Elektrizität, wohingegen man in einfachen Tonhütten die Dunkelheit noch mit Öllampen vertreibt. Archaische Holzpflüge lassen sich ebenso wenig von modernen Landwirtschaftsmaschinen vertreiben, wie Barden ihren Gesang angesichts lärmender Transistorradios einstellen. Diese Koexistenz unterschiedlicher Epochen durchzieht den gesamten Subkontinent bis heute mit einer irritierenden Selbstverständlichkeit.
Als ich 1985 ein knappes Jahr in Indien verbrachte, stand ich eines Abends an der Mahatma Gandhi Road in Bangalore. Ein bunter Ochsenkarren zog vorbei, dessen Ladung aus Dutzenden nagelneuen Computern bestand. Welch ein Anachronismus: Die Vergangenheit beförderte die Zukunft! Diese Kombination erschien mir derart grotesk, dass ich später einen meiner Vorträge an der Universität Mysore »from bullock carts and supercomputers« (»von Ochsenkarren und Supercomputern«) betitelte.
Diese Koexistenz von Alt und Neu ist auch Ausdruck einer Zweiklassengesellschaft. Die einen sind reich, genießen eine gute Ausbildung, orientieren sich eher an westlichen Maßstäben, wohingegen an anderen der Fortschritt vorbeigeht. Die Hälfte der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft, und in manchen Dörfern kommt es einem vor, als stünde die Zeit seit Jahrhunderten still.
Auf dem Subkontinent erlebt man eine Welt der Gegensätze: Mittelalter neben Hightech, Armut neben Reichtum, Gier neben Großherzigkeit, Maschinen neben Göttern, Kühe neben Luxuslimousinen, Blechhütten neben Luxushotels. Manchmal hat man den Eindruck, als würden alle Seiten eines Geschichtsbuchs gleichzeitig zum Leben erwachen. Man begegnet Sultanen, die von Dorfbewohnern mit derselben Hingabe verehrt werden wie zu Zeiten der Mogulherrscher, oder trifft auf Kamelkarawanen, die noch immer die Wüsten Rajasthans durchqueren, so als hätten sie sich im Jahrhundert geirrt. In klimatisierten Räumen programmieren IT-Ingenieure an selbstlernenden Maschinensteuerungen, und wenn sie aus dem Fenster schauen, fällt ihr Blick auf ein Flussufer, an dem Frauen bunte Stoffe waschen und dabei das feuchte Tuch auf den glatten Fels klopfen, so wie man es schon vor tausend Jahren tat.
Während die Fischer in Kerala sich in ihren winzigen Einbäumen aufs offene Meer hinauswagen, summt im benachbarten Krankenhaus ein Kernspintomograf. In den Tempeln duftet es nach Jasmin und Rosen, und Öllampen beleuchten mit Blumen geschmückte, bunt glänzende Steinfiguren. Dazu erklingen die gleichen Gebete wie vor Tausenden von Jahren, und über dem Ganzen zerteilen die Kondensstreifen vorüberziehender Flugzeuge den Himmel.
Zugegeben, die Infrastruktur ist marode, die Armut oft unerträglich und die chaotische Ineffizienz kaum auszuhalten, doch während im Westen die Zeugnisse vergangener Kulturen oft abgerissen wurden, um dem Fortschritt Platz zu machen, hat sich das Neue in Indien dazugesellt wie ein Feriengast, der geblieben ist. Fortschritt und Wohlstand werden im Einklang mit Kultur, Ökonomie, Spiritualität, Ethik und Natur als ein Ganzes begriffen. Wachstum und Effizienz sind nicht die allein bestimmenden Werte. Für manchen Besucher ist dieser Mix befremdlich: Inmitten des dichten Straßenverkehrs schläft eine Kuh auf der Fahrbahn, und niemand stört sich daran. Eine neue Maschinenfabrik wird eingeweiht unter Berücksichtigung des Horoskops, Konferenzen beginnen mit dem Ritual der Öllampe, und wichtige Gäste werden mit Blumengirlanden begrüßt. Die Stimme des Gelehrten wird in der Gesellschaft ebenso gehört wie die des Geschäftsmanns oder des Priesters. Mahatma Gandhi ist vielleicht der prominenteste Vertreter dieser vielschichtigen spirituellen Haltung, die einem in Asien noch heute begegnet. Hier zählt nicht alleine die Ökonomie.
1972 wurde im Nachbarland Bhutan nicht Wachstum, sondern Glück zum obersten Ziel der nationalen Politik ausgerufen. Das »Bruttonationalglück« ist in der Verfassung verankert und ruht auf vier Pfeilern: der Bewahrung traditioneller kultureller Werte, einer gerechten wirtschaftlichen Entwicklung, der Förderung einer guten Regierungsführung und dem erklärten Schutz der Umwelt. Trotz ihrer Armut fühlen sich die Menschen eingebunden in die Entwicklung ihrer Zukunft.
In vielen unserer Industrienationen wird Zukunft hingegen als konsequente Folge des technisch-ökonomischen Fortschritts verstanden. Die Mehrdimensionalität der Optionen mit ihrer zugrunde liegenden Spiritualität weicht zunehmend der Eindimensionalität wirtschaftlicher Kategorien. Der säkulare Fortschritt durchtrennt unsere Nabelschnur zur Vergangenheit und begründet diesen Schritt mit dem Versprechen einer zukünftigen Verbesserung unserer Lebensverhältnisse.
Vergangene Erfolge bei der Bekämpfung von Krankheiten, die beachtliche Steigerung der Produktivität und der sichtbare materielle Wohlstand begründen diesen Ansatz. Es gibt also gute Gründe, diesen Weg fortzusetzen. Das ehemalige Heilsversprechen der Religion, die unsere irdischen Mühen mit dem himmlischen Paradies belohnt, wurde ersetzt durch das technisch-ökonomische Versprechen einer besseren Zukunft auf Erden.
Wir sollen also die Turbulenzen des Wandels aushalten, im Vertrauen darauf, dass wir nach der schmerzlichen Reise in einer besseren Welt landen werden. Wir sollen an diesen Fortschritt glauben wie an einen Gott, auch wenn wir seine Konturen nicht genau erkennen können. Wie ein Reisender, der seine Heimatstadt zurücklässt, trennen wir uns von unseren Wurzeln und Traditionen und begeben uns auf eine Reise ins Ungewisse. Selbst die Rückbesinnung auf unsere eigene Geschichte erscheint sinnlos, da sie keine Antworten in der völlig veränderten Welt geben kann.
Wir folgen dem Kompass des Wirtschaftswachstums. Die Ökonomie wird dabei zum Religionsersatz. Bankenhochhäuser überragen Kathedralen. Jeder noch so schmerzliche Schritt, den man uns auf dem Weg zu mehr Wachstum abverlangt, wird mit der ökonomischen Notwendigkeit begründet. Hier schwingt stets auch die Sorge mit, im globalen Wettbewerb zu unterliegen. So warnt man uns, dass wir den Anschluss verpassen, wenn wir den Wandel nicht rasch genug gestalten. Zögern oder gar innehalten bedeuten den Untergang.
Wir erleben einen Modernisierungszwang. Unsere Zukunft ist also keine Option mehr, kein offenes Angebot einer Weiterentwicklung, kein Ergebnis eines breiten Dialogs über Werte und Qualitäten, dem dann Taten folgen. Die getroffenen Entscheidungen leiten sich weniger nach unseren Bedürfnissen ab, fragen nicht nach der Sinnhaftigkeit der Folgeschritte, sondern werden uns als notwendig und alternativlos vorgegeben. Diese Eindimensionalität, bei der die Ökonomie das Steuer übernimmt, führt allmählich zu einem demokratischen Kontrollverlust. Kulturzentren, Hochschulen, Kunst oder Medien unterliegen immer mehr einem wirtschaftlichen Diktat. In diesem Prozess verblassen alternative Zukunftsentwürfe, und so verlieren wir allmählich jegliche Gestaltungsfreiheit.