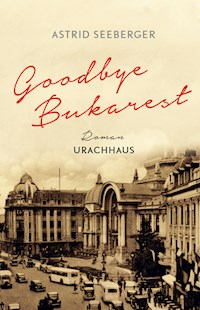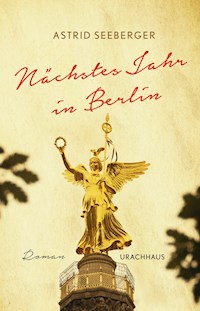
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine Mutter stirbt – eine Tochter, die bis dahin auf Distanz zu ihr gegangen ist, wird so mit der Vergangenheit konfrontiert. Hinzu kommt die überraschende Enthüllung eines Bekannten, die alle eigenen Erinnerungen und die Erzählungen der Mutter in ein neues Licht rückt. Das Schicksal der Mutter während des Zweiten Weltkriegs – auf der Flucht aus Ostpreußen und im Deutschland der Nachkriegszeit – wird mit ungeheurer Intensität, Bildkraft und Dichte geschildert. Eng mit "Goodbye, Bukarest" – dem bereits erschienenen Teil der Familiengeschichte – verwoben, bietet "Nächstes Jahr in Berlin" eine für sich abgerundete, bewegende Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies ist eine Geschichte, die erzählt werden muss: die Geschichte, die eine Tochter ihrer verstorbenen Mutter schuldet. Sie erzählt das Schicksal einer deutschen Familie aus Ostpreußen, geprägt von Verlust, Hoffnung und der Suche nach einem neuen Leben in den politischen Wirren des 20. Jahrhunderts.
Aus Astrid Seebergers Feder fließt diese Geschichte bildgewaltig, klug und poetisch dicht. Sie beschwört Orte der Sehnsucht, Zufluchtsorte in ihrer einmaligen Zauberkraft herauf und skizziert ihre Charaktere mit genauem Blick.
Nächstes Jahr in Berlin ist der erste Teil ihrer groß angelegten, autobiografisch inspirierten Familiengeschichte, die mit Goodbye, Bukarest bereits viele Leser begeistern konnte.
»Dieses Buch ist ein literarisches Glanzlicht.«
Dagens Nyheter
»Dieses Buch gehört zweifellos zu den besten des Jahres 2020.«
Netgalley, Buchhändlerstimme zu »Goodbye, Bukarest«
Astrid Seeberger, 1949 in Süddeutschland geboren, zog mit 17 Jahren allein nach Schweden und studierte dort Philosophie, Theater- und Filmwissenschaften sowie Medizin. Sie ist Ärztin am renommierten Stockholmer Karolinska Institut und eine international gefragte Fachreferentin. 2010 veröffentlichte sie ihr erstes essayistisches Buch Schamlose Neugier. Von der Kunst des heilsamen Gesprächs, das bewies, dass sie auch eine begnadete Erzählerin ist. Im Verlag Urachhaus ist bereits ihr Roman Goodbye, Bukarest erschienen, der einen weiteren Teil ihrer autobiografisch inspirierten Geschichte erzählt und eng mit Nächstes Jahr in Berlin verknüpft ist.
Astrid Seeberger
Nächstes Jahr in Berlin
Aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek
für Lech
Inhalt
Auf der Insel, den 22. Dezember 2012
Stuttgart, den 24. November 2007
Stuttgart, den 25. November 2007
Auf der Insel, den 29. Dezember 2012
Stuttgart, den 26. November 2007
Auf der Insel, den 1. Januar 2013
Stuttgart, den 26. November 2007
Auf der Insel, den 13. Januar 2013
Stuttgart, den 26. November 2007
Auf der Insel, den 18. Januar 2013
Stuttgart, den 27. November 2007
Auf der Insel, den 2. Februar 2013
Stuttgart, den 28. November 2007
Stuttgart, den 5. Dezember 2007
Auf der Insel, den 20. April 2013
GESCHICHTEN DES SEHNENS
Von der Gans und Stalingrads Ratten
Vom Engelskind
Von den Kartoffeln in Gumbinnen und den Schwalben
Vom Puppenmacher
Von der Stoffgans und einer gewölbten Hand
Von Haselnussblättern
Von Alice im Wunderland
DIE GESCHICHTE VON DER KLEINEN DÜNNEN PERSON
GESCHICHTEN VOM PARADIES
Vom Hut des Zauberers und der Flamme in Berlin
Vom König in Augustenruh
Von einem, der fast ein Prophet war
Von der Schlange im Paradies
Von den immer wieder zerschlagenen Träumen
Von der Siegesgöttin in der Schachtel
Auf der Insel, den 10. Dezember 2013
Auf der Insel, den 15. Dezember 2013
DIE GESCHICHTE, DIE ALLES VERÄNDERT HAT
Vom Suchen im Dunkeln
Von der Schwarzmalerin und dem Wolfspelz
Von dem Brief, der nie hätte geschrieben werden sollen
Von den offenen Augen auf dem Frischen Haff
Auf der Insel, den 15. Juni 2014
Zitatnachweis
Aber ich schrieb eine Musik, die nicht lockerlässt.
Zwischen den zerfetzten Blättern finden sich Phrasen,
die sich von selbst niederkritzeln: unterstützt
von allem, was gesagt werden will. Ich entsinne mich auch
des Lichts, des goldenen Lichts. Das schreibt sich fort,
Note um Note, und trotzt der Nacht.
Kjell Espmark, aus »Das Gotlandquartett«
Auf der Insel, den 22. Dezember 2012
Es schneit. Der See, der mit Eis bedeckt ist, leuchtet weiß. In dem großen Jasminbusch vor meinem Fenster hocken kleine Vögel, dick aufgeplustert, als könnte das bisschen Wärme in ihrem Gefieder gegen die Kälte helfen. Es ist sieben Grad unter null. Nachts soll es noch frostiger werden.
Als Kind hatte mir Mutter von einer Kälte erzählt, die es früher einmal gab, einer Kälte jenseits aller Vorstellung. Die Vögel waren hilflos, sagte sie, sie fielen wie Eiszapfen von den Bäumen. Es klirrte, wenn sie auf dem Boden aufschlugen. Und wenn man sie hochnahm, sah man, dass ihre Augen offen standen und eine dünne Eisschicht sie bedeckte. Vielleicht war es in dem Jahr, als Großvater seinen Wolfspelz kaufte, einen Pelz für einen König, lang, mächtig und schön.
Mutter verabscheute Wölfe. Sie heulen, sagte sie, verstummen nie, nicht einmal, wenn sie zu Pelzen geworden sind. Erst wenn sie auch noch das Letzte vom Menschen verschlungen haben, sein zitterndes Herz. Ich erinnere mich an ihre Augen, als sie das sagte, sie wirkten hart. Wie das Gehäuse, in dem sich die Schnecke versteckt, sagte Lech.
Ich höre ihn. Draußen auf der Verandatreppe stampft er den Schnee von den Stiefeln. Er hat Holz aus dem Schuppen geholt. Hält unsere Kachelöfen am Brennen, sorgt dafür, dass wir es warm haben. Ich möchte vom Schreibtisch aufstehen und zu ihm gehen, mich an ihn lehnen. Nur eine Weile still dastehen und seinen Atem spüren.
Auf dem Bildschirm steht das, was eine Geschichte werden soll, nur wenige Sätze, über die Begegnung im Kühlraum. Es gibt Dinge im Leben, die man in Einklang bringen muss.
Ich kriege es nicht zusammen, sagte ich zu Lech, als er mich vorige Woche von Stockholm-Arlanda abholte. Ich war aus Stuttgart gekommen, wo ich Alois getroffen hatte, einen engen Freund von Vater, obwohl Alois katholischer Priester war und Vater Protestant. Als mein erstes Buch in Deutschland erschienen war, hatte sich Alois bei mir gemeldet. In einem Brief an den Verlag hatte er mitgeteilt, er müsse mich treffen. Es gebe etwas, das ich über meine Mutter erfahren sollte.
Lech saß am Steuer. Ich legte meine Hand auf sein Bein. Zu beiden Seiten der Straße türmten sich Schneewälle auf. Der Winter in diesem Jahr war maßlos, Schnee, unter dem alles begraben wurde. Wie die Winter in Ostpreußen, als Mutter noch ein Kind war. Als Großvater und sie in seinem Wolfspelz Platz fanden.
Es fiel mir schwer, meine Gedanken zu ordnen. Ich sah Mutter vor mir, wie sie tot im Kühlraum lag, die Brustwarzen hart wie Nagelköpfe. Der Tod aber ist nicht endgültig. Die Toten bleiben in unserem Leben zurück.
Lech sagt manchmal, er könne noch immer die große, warme Hand seines Vaters spüren. Ich kann mich an die von Mutter nicht erinnern, nur an die von Vater, seine Hand war leicht und klein. Der ganze Mann war feingliedrig. Nur sein Buckel war groß und klobig. Einmal sah ich, wie Mutter ihn schrubbte. Es muss an einem Freitagabend gewesen sein. Wir haben immer freitags gebadet, in einer großen Zinkwanne in der Küche, damals, als ich klein war und wir in Waldstadt wohnten. Wenn Mutter und Vater badeten, musste ich den Raum verlassen. Einmal aber habe ich ihn durch eine Türritze gesehen: Er saß nackt in der Wanne. Und Mutter schrubbte wie besessen auf seinem Buckel herum. Als sie geheiratet hatten, war sein Rücken vollkommen gerade gewesen.
Hätte ich doch ihr Hochzeitsbild noch! Ich erinnere mich deutlich daran. Es hing in einem Rahmen an der Schmalseite des Schlafzimmers, gleich neben dem Fenster, während sich über ihrem Bett ein Kruzifix mit dem gekreuzigten Jesus befand. Vater war damals noch größer als Mutter. Er stand neben ihr, klapperdürr, bekleidet mit einem viel zu weiten Anzug, den er von einem Kameraden ausgeliehen hatte. Große Augen mit intensivem Blick. Und sein braunes Haar stand nach allen Seiten ab, als wäre er in einen Sturm geraten. Er wirkte ungemein jung. Wäre da nicht der kleine Schnurrbart gewesen, hätte man ihn für einen Jugendlichen halten können.
Mutter stand neben ihm, mit ihrem Flüchtlingsgesicht. Das schwere schwarze Haar wallte auf ihre Schultern hinunter. Sie war mit mir schwanger, das blaue Seidenkleid spannte überm Bauch, als hätte sie einen Globus darunter versteckt. Sie hielten sich bei der Hand. Vielleicht war das der Grund, warum sie so seltsam hilflos aussahen.
Ich muss es in Einklang bringen. Mutters Brustwarzen, die an meinen Handflächen scheuerten. Und den Wolfspelz, der sie in die Arme genommen hatte, bevor er jemand anderen umarmte. Und Vaters Rückgrat, das einem Fragezeichen glich.
Ich höre Lechs Schritte. Er kommt zu mir, legt die Arme um meine Schultern. Und ich lehne mich zurück, lege den Kopf an seine Brust. »Ich habe mit dem Schreiben angefangen«, sage ich.
Stuttgart, den 24. November 2007
Während wir zum Kühlraum gingen, redete der Diensthabende ununterbrochen. Ich erinnere mich nicht mehr, was er sagte, nur an sein Sächsisch. Dieses Blöken, hätte Mutter gesagt. Mutter aber gab es nicht mehr. Sie war am Tag zuvor gestorben, hatte einen Herzinfarkt erlitten. Ich war nicht rechtzeitig da gewesen. Von Stockholm nach Stuttgart zu fliegen erfordert Zeit.
Als ich im Krankenhaus ankam, lag Mutter nicht mehr auf der Intensivstation. Man hatte sie bereits fortgebracht. Es war obendrein Samstag, nur ein Angestellter hatte Dienst, ein blasser Mann mittleren Alters mit schütteren dunklen Haaren, auch auf den Handrücken. Er habe es nicht geschafft, Mutter für das Verabschiedungszimmer zurechtzumachen, sagte er. Da ich aber Ärztin sei, könne ich sie trotzdem sehen. Als Arzt sei man schließlich an den Tod gewöhnt, nicht wahr? Als würde das helfen, wenn es darum ging, die eigene Mutter tot zu sehen.
Boden und Wände des Raums waren gefliest. Die Leuchtstoffröhren an der Decke warfen ein scharfes Licht. Als müsste alles klar und deutlich zu sehen sein, all die Kühlzellen aus glänzendem Metall, dreifach übereinander gefügt, mit nummerierten, leicht austauschbaren Namensschildern. Mutter lag in einem der oberen Fächer. Der Diensthabende fuhr eine gabelstaplerähnliche Vorrichtung heran, mit der man die Toten aus ihren Fächern zog.
Der Gabelstapler rasselte und quietschte, als sich seine Metallarme in Bewegung setzten. Am Ende schaffte er es, in Mutters Fach und nach der Bahre zu greifen. Worauf diese sich ebenso rasselnd und quietschend senkte. Seitdem weiß ich, es gibt Geräusche, die schneiden einem ins Herz.
Auf der Bahre lag ein schmächtiger Körper, der Puppe eines Schmetterlings ähnlich, umhüllt von einem Laken. Der Diensthabende zerrte den Fuß der Puppe hervor und kontrollierte, was auf dem Schild stand, das am großen Zeh hing. Dann schlug er das Laken mit Schwung zurück und ging. Er wolle nicht stören, sagte er.
Es war ein Kinderkörper, der dort lag, mit spindeldürren Armen und Beinen. Überhaupt keine Brüste, nur kleine, starre Brustwarzen unter dem Krankenhaushemd, bei einer Berührung wie Nagelköpfe. Und das Gesicht. Es dauerte eine Weile, bis ich es anschauen konnte. Lech hatte einmal gesagt, wer ein Flüchtlingsgesicht bekommen habe, werde es sein Leben lang mit sich herumschleppen müssen. Er sagte nicht, dass es das letzte Gesicht eines Menschen sein kann. Als ich es nun vor mir sah, musste ich mich auf den Boden setzen und die Arme um die Knie schlingen.
Ich saß auf dem Rücksitz im Taxi, unterwegs zu einem Hotel. Es war unmöglich, vom Krankenhaus sofort in Mutters Wohnung zu fahren. Man ist vollkommen schutzlos, wenn man auf dem Boden eines Kühlraums gehockt hat.
Der Taxifahrer, ein älterer Ausländer, spielte arabische Musik, bei der eine Frauenstimme von einem hitzigen Saiteninstrument gejagt wurde. Er hielt das Steuer fest umklammert, saß vorgebeugt da und starrte auf die Fahrbahn. Es regnete leise. Der Asphalt glänzte. Das graue Novemberlicht hatte alles mit einer bleiernen Schicht überzogen.
Es war zweieinhalb Monate her, dass ich Mutter zuletzt gesehen hatte. Ich wollte den Zug nach Echterdingen nehmen, zum Stuttgarter Flughafen. Wir standen auf dem Bahnsteig der S-Bahn, und ich ahnte nicht, dass es unsere letzte Begegnung war. Mutter sah aus, als würde sie frieren, obgleich es warm war. Sie hatte die Schultern hochgezogen und die Hände in den Taschen ihrer schwarzen Strickjacke vergraben. Der Stoff ihrer dunkelroten Seidenhose flatterte wie ein Segel am Mast. Wir standen wortlos da, so als wäre bereits alles besprochen. Dann sagte sie plötzlich, vielleicht nicht einmal zu mir: »Könnte mich doch jemand umarmen.«
Und ich legte die Arme um sie, doch bekam ich ihren Körper nicht zu fassen. Oder war mein eigener Körper ausgewichen? Ich erinnere mich nicht daran, nur an Mutters Duft. Sie duftete nach Lavendel, wie immer. Im Kühlraum jedoch nicht. Da roch sie nach Tod, Mutters eigenen Worten zufolge der schlimmste Geruch, den es gibt. Der bleibt immer und ewig haften, lässt sich nie abwaschen, hatte sie gesagt.
Ich fragte den Taxifahrer, woher er komme. Aus der Türkei, sagte er, aus einer Stadt in den Bergen, die Van heiße.
Ich fragte, wie Van aussehe.
Er wisse es nicht, sagte er, das, was er gekannt habe, sei durch ein großes Erdbeben zerstört worden. Alles, außer dem See. Der See sei blau und friere nicht zu, nicht einmal im Winter, obwohl es eisig kalt werden konnte, das Wasser sei so salzig, salziger als menschliche Tränen.
Er schwieg. Ich ebenfalls und auch die singende Frau. Nur das Saiteninstrument spielte triumphierend weiter, als hätte es über etwas gesiegt, was auch immer das sein mochte. Mir fiel auf, dass ich meine Knie erneut umschlungen hielt.
Ich bekam ein Hotelzimmer im siebzehnten Stock. Es hätte überall liegen können: dasselbe anonyme Design wie in Chicago oder Shanghai. Man konnte weit blicken, nirgendwo aber gab es einen Fluss. Nur Häuser in Reihen, angetreten wie zur Verteidigung. Und die Autowerke am Rand der Stadt, größer als früher, wie eine hemmungslos wachsende Geschwulst, mit Schornsteinen, die Rauch in den Himmel bliesen. Säße Gott da oben, würden ihm die Augen brennen, hatte Vater einmal gesagt. Vater aber war tot, so wie Mutter. Ich war ein elternloses Kind.
Ich zog mich aus und duschte. Doch schon vorher war mein Gesicht nass.
Dann legte ich mich aufs Bett, nackt, in ein weißes Handtuch gewickelt. Ich sehnte mich nach Lech, ich hätte Ja sagen sollen, als er mich herbegleiten wollte. Hätte ihm die Schornsteine mit ihrem ewigen Rauch zeigen sollen. Und ihm erzählen sollen, dass alle, die hier wohnten, sich ein bisschen schwarz färbten.
Mutter ist in Ostpreußen geboren, auf einem Hof nahe Pieniężno, das damals Mehlsack hieß. Ihre Geburt war für diesen Tag noch nicht geplant, doch ein durchgegangenes Pferd hatte ihre Mutter erschreckt. Das erklärt alles, sagte Mutter immer. Ich habe nie gefragt, was sie damit meinte.
Manchmal sagte Mutter, ich sei ihr Ein und Alles. Und dass Waldstadt, wo wir in meiner Kindheit wohnten, eine Strafe für sie sei. Man sei zwischen steilen Bergen eingeklemmt. Das sei nicht wie in Ostpreußen, wo man sich frei und leicht bewegte. Dort gab es eine sanft gewellte Landschaft, die Gott mit streichelnder Hand geformt hatte, darüber einen weiten Himmel an einem schimmernden Meer. Anschließend hatte er alles mit goldenem Licht übergossen. Vielleicht war das Pferd vom goldenen Licht geblendet worden. Weshalb sonst sollte man in einem gelobten Land durchgehen, das Ostpreußen nach Mutters Worten war.
Ich bin nie in Ostpreußen gewesen. Doch als ich einen Kongress in Warschau besuchte, stieß ich auf ein Foto von Mehlsack. Ich war in ein Antiquariat gegangen. Als ob Bücher erreichen könnten, dass man sich in einer fremden Stadt weniger fremd fühlt, auch wenn man die Sprache nicht versteht.
Der Inhaber, ein hagerer alter Mann, der sich ruckartig bewegte, so als müsste er sich jedes Mal einen Stoß geben, zeigte mir ein Buch mit diesem Bild. Jemand, der Adam Górnik hieß, hatte das Foto 1983 aufgenommen. Man sah die Reste des alten Stadtkerns von Mehlsack: Hausfundamente, die hartnäckig zurückgeblieben waren in der Wüstenei um die katholische Kirche, das einzige Gebäude der alten Stadt, das den Zweiten Weltkrieg überdauert hatte. Man könne auf den Gedanken kommen, sagte der Antiquar, der ein altertümliches Deutsch sprach, dass die Flammen, die die Wohnungen der Menschen zerstört hatten, vor dem Gotteshaus im letzten Augenblick innegehalten hatten.
Ich schaute das Bild mit der Kirche lange an. Mutter musste dort das Vaterunser gebetet haben: »Erlöse uns von dem Übel.« Als Kind ging sie jeden Sonntag in die Kirche. Vielleicht war ihr Gebet zu schwach gewesen. Oder das Übel war zu stark. Das sagte ich auch zu dem Mann. Als ich das Buch dann kaufen wollte, reichte er es mir und weigerte sich hartnäckig, Geld dafür anzunehmen.
Mutter und ich hatten davon gesprochen, nach Ostpreußen zu reisen. Daraus war nichts geworden. Ich hatte es nie ernsthaft in Betracht gezogen. Als hätten wir noch unendlich viel Zeit. Obwohl ich sah, wie Mutter magerer wurde. Und obwohl sie sagte, wenn sie im selben Tempo weiter an Gewicht verlöre, wäre sie in zehn Jahren verschwunden. Ich weiß noch genau, wann sie das sagte. Es war, bevor wir zur S-Bahn gingen, beim letzten Mal. Sie sagte es, als sie ihre schwarze Strickjacke anzog. Ich erinnere mich an jedes einzelne ihrer Worte. Und dass ich nur einen Gedanken hatte, ich wollte weg.
Langsam senkte sich die Dämmerung herab. Der Rauch der Autowerke wurde schwärzer. Lampen wurden in der Stadt angeschaltet, schnurgerade Lichterketten entlang der Straßen, als könnten sie die Menschen von Irrwegen abhalten.
Ich erinnerte mich an den Pastor, mit dem ich ins Gespräch gekommen war, als ich am Tag vor Mutters Tod Visite auf der Station machte, für die ich zuständig war. Er litt unter einer schweren Gefäßentzündung, die seine Nieren geschädigt hatte. Er lag in seinem Bett, bleich und abgemagert, um den Kopf einen Kranz weißer, dünner Haare. Als ich ihn fragte, wie es ihm gehe, sagte er, es sei wichtig, die Kategorie des Jubels lebendig zu halten. Er sagte es mit äußerst schwacher Stimme, ich musste ihn bitten, das Gesagte zu wiederholen.
Mutter jubelte selten. Vater indes häufig, besonders, wenn er Waldhorn spielte. Alois sagte, Vater sei einer der großen Lobpreiser gewesen. Als wir in Waldstadt wohnten, pries Vater alles, vor allem Mutter und mich. Und die Blumen. Es gab niemanden in Waldstadt, der die Blumen so liebte wie er. Sie seien ein Wunder, sagte er, jede einzelne von ihnen. Und Vater kniete in den Wiesen und betrachtete sie eingehend. Wenn das Gras hoch stand, sah man nur seinen Buckel. Solange es die Wiesen gab, hinderte er ihn nicht am Jubeln.
In Stuttgart war es um das Jubeln schwieriger bestellt. Vielleicht war der Rauch daran schuld, er überzog alles mit Ruß. Oder die Wiesen fehlten. Es gab nur Rasen, mit Klopfstangen für Teppiche. Für Vater war Waldstadt der Ort des Lobpreisens, Stuttgart wurde das nie. Obwohl er es nach oben geschafft hatte, wie Mutter sagte, Abteilungsleiter geworden war, in der Stuttgarter Filiale des Pfäffle Verpackungswerks. Und wir nun die Mittel hatten, uns Teppiche zu kaufen, große Perser mit verschlungenen Blumenranken. Auf ihnen aber kniete Vater nie. Nicht einmal, wenn Mutter sie ausgeklopft hatte und die Blumen klar und prächtig leuchteten.
Vielleicht lag es daran, dass Vater geschrumpft war. Es hatte bereits in Waldstadt angefangen. Er bekam eine seltsame Krankheit, die Syringomyelie, bei der sich Zysten im Rückenmark bilden, was zur Krümmung des Rückgrats führt. Vater bekam einen Buckel, der von Jahr zu Jahr größer wurde. Doch niemand redete darüber, obgleich sein Buckel schließlich alle Buckel an Größe übertraf.
Erst als ich Medizin studierte, lernte ich den Namen der Krankheit kennen. Und begriff plötzlich: Die Syringomyelie war es, die das Temperaturempfinden von Vaters Händen ruiniert hatte. Vater spürte nicht, ob etwas warm oder kalt war.
Es gibt Erinnerungen, die sitzen wie Nägel im Körper fest: Rauch bleibt im Ofenrohr zwischen Kohlenherd und Schornstein hängen und quillt in die Küche. Und Mutter schimpft, als wäre Vater daran schuld. Und Vater steht auf und macht sich mit bloßen Händen ans Abschrauben des Ofenrohrs, des glühend heißen Ofenrohrs. Ich habe den Geruch nach verbranntem Menschenfleisch wahrgenommen. Ich habe gesehen, wie es aussieht. Habe gehört …
Vater schrie nicht. Er wurde bleich. Und taumelte zum nächsten Stuhl, auf den er sich mit einem Rumsen fallen ließ. Dann starrte er seine Hände an, als würden sie nicht ihm gehören. Mutter stand noch immer am Abwaschtisch und schrie, so als wäre sie es, die sich verbrannt hatte. Sie schrie und schrie. Als müssten all die Schreie der Kriegsjahre, der Gestank all der verbrannten Leichen endlich heraus.
Im Hotelzimmer breitete sich Dunkelheit aus. Ich schloss die Augen. Ständig sah ich das Bild vor mir, wie Mutter im Kühlraum lag. Irgendwie wäre es leichter gewesen, wenn sie auch im Tod große Brüste gehabt hätte. In meiner Kindheit waren Mutters Brüste groß und weiß gewesen. Sie schimmerten, wenn sie sich morgens, vor einer Schüssel stehend, am Küchentisch wusch.
Vielleicht begannen Mutters Brüste zu schrumpfen, als Vater gestorben war. Lech hat mir einmal ein Gedicht von Lars Gustafsson gezeigt:
Ein ungeliebter Körper ist nicht weniger wahr.
Er ist nur weniger wirklich. Unterwegs
zwischen Schatten und Licht, im Dämmerdunkel,
verharrt er gleich einem vergessenen Stein,
die Schrift dem Schatten zugewandt, ungelesen.
Ich hatte mich nicht darum gekümmert, Mutters Zeichen zu lesen. Hatte wie eine Verrückte gearbeitet. Und mit Lech geschlafen. Lech liest ununterbrochen meine Zeichen. Und er versteht.
Stuttgart, den 25. November 2007
Am nächsten Tag fuhr ich zu Mutters Wohnung. Dorthin war sie mit Vater gezogen, als das Mietshaus, in dem ich aufgewachsen war, abgerissen werden sollte. Das neue Haus glich dem alten, ein Betonblock, der ebenso gut in einem Moskauer Vorort hätte stehen können.
Das Aufschließen der Tür ging nur langsam voran. Daran war nicht der Schlüssel schuld. Es lag an dem Geruch des Treppenhauses: Es roch nach Rauch und Reinigungsmitteln. Ich erkannte ihn wieder. Es gibt Gerüche, die sind vollkommen lähmend.
Das Erste, was ich sah, als ich das Licht im Flur anschaltete, war mein Gesicht im Garderobenspiegel. Ich schaute weg. Das dort war nicht ich. Solche aufgerissenen Augen hatte ich nicht. Im Flur hingen keine Kleidungsstücke, nur leere Bügel. Oben auf der Ablage lag Mutters Hut, er war groß und schwarz und mit einer kleinen gesprenkelten Feder geschmückt. Ich zog den Mantel aus und hängte ihn auf, es war mein weicher brauner, den ich in Berlin gekauft hatte, als ich zusammen mit Lech dort war.
Dann ging ich ins Wohnzimmer. Darin war es kalt. Mutter hatte die Heizung abgestellt, wie immer, wenn sie aus dem Haus ging. Ich drehte sie voll auf. Was ich danach tun sollte, wusste ich nicht recht.
Ich betrachtete die Nappaledercouch. Sie stand da, als wäre nichts geschehen, dunkelblau wie der Abendhimmel, darauf zwei hellblaue Kissen, die Mutter mit Blumenranken bestickt hatte. Solange es den Kreuzstich und das Kreuzworträtsel noch gibt, sagte sie zuweilen. Dann verstummte sie, als wüssten wir anderen, wie das Ende des Satzes zu lauten hatte. Oder sie wusste es selbst nicht. Über der Couch hing das Bild, das Mutter zu ihrem fünfzigsten Geburtstag bekommen hatte. Vaters Cousin Heinz hatte ein Schiff gemalt, das dem stürmischen Meer trotzt. Als Vater das Bild zu Gesicht bekam, runzelte er die Stirn. Ihm könne das Meer gestohlen bleiben, sagte er. Er hatte die Nordsee im Zweiten Weltkrieg erlebt. Sein Meer glich nicht Mutters schimmerndem, gesegnetem Gewässer. Sein Meer verschlang, war abgrundtief und schwarz.
Neben der Couch stand Mutters Gummibaum, kerzengerade wie ein preußischer Soldat. Ich entfernte ein Blatt, das bereits gelb geworden war, und legte es auf den Couchtisch, mitten auf das runde Spitzendeckchen, das an den Heiligenschein der Engel von Fra Angelico erinnerte. Ich hatte es Mutter, die Spitzendeckchen liebte, geschenkt. Als könnten diese Deckchen den schweren Mahagonischrank aufhalten, der die ganze Wand gegenüber der Couch einnahm und sich allem in den Weg stellte.
Ich brachte es nicht fertig, die anderen Zimmer zu betreten, nicht sofort. Es war richtig, dachte ich, dass ich Lech nicht mit hergebracht hatte. Und plötzlich fiel mir etwas ein: Als wir das erste Mal miteinander geschlafen hatten und ich glücklich in seinen Armen lag, hatte er leise gesagt: »I am like a pelican in the wilderness.« Ich wusste nicht, ob er der Pelikan war oder eher ich. Und ich habe nicht nachgefragt. Es spielte keine Rolle, damals nicht.
Ich ging ans Fenster. Hätte man im Haus gegenüber Kanonen auf die Balkone gestellt, hätte man es für eine Festung halten können. Auf dem Hof wuchs Rasen, der Wind blies die Samen der Pappeln, die die Straße säumten, dorthin. Zuweilen sah es aus, als wäre das Gras von grauweißem Schaum bedeckt. Diesen Pappelschaum hatte einmal jemand in Brand gesteckt. Und Mutter hatte wie besessen geschrien, das Lodern habe sie um den Verstand gebracht, sagte sie mir später am Telefon.
Ich ging zurück zum Mahagonischrank. Auf einem Absatz stand die Stereoanlage, die Mutter ein halbes Jahr nach Vaters Tod gekauft hatte. Eine CD steckte darin, vielleicht die letzte, die Mutter gehört hatte: Bruckners siebte Symphonie. Die Hülle lag daneben, darauf ein Bild von Karajan, den die Frauen vergöttert hatten, dachte ich, während Bruckner niemals jemanden in die Arme schließen konnte. Auch dass der Kaiser von Bruckners Musik so begeistert war, dass er ihn in seinem Schloss wohnen ließ, hatte nichts daran geändert. Nicht einmal ein Prunkbett hilft, wenn man einen plumpen, unförmigen Körper hat.
Bei einem meiner letzten Besuche hatte Mutter diese CD abspielen lassen. Ich lag schon im Bett, als ich Musik hörte. Kurze Zeit später stand ich auf. In ihrem langen weißen Baumwollnachthemd saß Mutter auf der Couch. Sie hatte kein Licht angemacht, nur der schwache Schein der Straßenlaternen fiel ins Zimmer. Ich setzte mich zu ihr und fragte, ob etwas sei. »Alles gut«, sagte sie. Sie saß vollkommen reglos da, nur ihre Lippen zitterten. Wir lauschten der Musik. Nach dem zweiten Satz, dem Adagio, stand sie auf und schaltete die Anlage aus.
»Genug damit«, sagte sie. Und blieb mit hängenden Armen stehen, als wüsste sie nicht, was sie tun sollte. Dann sagte sie, ich könne die CD mitnehmen, sie habe sie jetzt oft genug gehört.
Dann setzte sie sich auf den Hocker neben der Couch, zog die Schultern hoch, so als friere sie. Ich fragte, ob es eine besondere Bewandtnis mit der Musik habe. Sie gab keine Antwort, nicht sofort, erst, als ich wissen wollte, warum sie sich die Bruckner-Symphonie denn zugelegt habe. Mir sei bisher nicht aufgefallen, dass sie seine Musik möge.
Das habe nichts mit mögen zu tun, sagte Mutter. Doch als sie diese Musik das erste Mal gehört habe, sei ihr klar geworden, dass Bruckner etwas über Einsamkeit wusste.
Es war in Alfdorf gewesen, einem Flecken in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, wo sie nach der Flucht aus Ostpreußen gelandet war. Ich wusste, dass sie dort Arbeit bei einem Kerzenmacher gefunden hatte. Doch hatte sie nie über diese Zeit sprechen wollen und war auch nie wieder nach Alfdorf gefahren. Obgleich ihre Stimme stets einen warmen Ton bekam, wenn sie den Kerzenmacher zufällig erwähnte. Einmal sagte sie, er sei ein guter Mann gewesen, doch was vorbei sei, sei vorbei. Jetzt erzählte sie. Als sei die Musik eine Art Türöffner.
Es war an einem späten Abend gewesen, sagte sie, als der Chef und sie Kerzen für eine eilige Lieferung gegossen hatten. Im Radio spielte Musik, das Adagio aus Bruckners Symphonie. Und es rührte etwas in ihrem Herzen an, was sie an jenen Abend erinnerte, als sie mit Tausenden anderer Flüchtlinge über schneebedecktes, schimmerndes Eis gezogen war, nur ganz schwach schimmernd, als versuchte es, ein Fünkchen Tageslicht zurückzuhalten. Mit einer großen schmerzenden Leere in der Brust war sie dahingestapft. Sie hatte alles verloren, ihre Familie mit dem Vater, der einem König glich, und ihr Zuhause, wo man in einem Lichtstreifen von Zimmer zu Zimmer gehen konnte. In Bruckners Musik hatte es eine ähnliche Leere gegeben.
Ich schaute sie an. Man konnte meinen, auf ihrem Gesicht läge der Widerschein des Eises, nicht der der Straßenlaternen. Ihre Lippen zitterten heftig, was sie zu einer Pause zwang. Dann schien sie sich wieder zu fassen.
Es gibt Augenblicke, an die man sich genau erinnert, sagte sie, in denen jedes Detail so ungemein stark ist, dass es dem Vergessen widersteht. Der Kerzenmacher und sie hatten soeben den Tauchkorb aus dem Wachsbad gehoben, als das Adagio verklang und eine Stimme im Radio mitteilte, Hitler sei tot. Sie hatten vollkommen reglos dagestanden, während das Wachs von den Kerzen tropfte. Beim Auftreffen der Tropfen ertönte ein schwacher, weicher Laut. Sie konnte ihn noch immer hören, er glich dem Schlag eines kleinen Herzens. Als das Tropfen aufhörte, sagte der Kerzenmacher, nun ginge der Krieg zu Ende. Und es käme die Zeit, in der alle Leerräume auszufüllen wären. Jetzt, wo der schlimmste Verursacher von Leere gestorben war.
Beim Erzählen schaute Mutter die Schrankwand an, nicht mich. Ich wusste, dass sie auch mich zu ihren Leerräumen zählte. Ich war in ein neues Land verschwunden, hinein in eine neue Sprache. Für mich sei das Deutsche wie eine alte Schlangenhaut gewesen, die ich zurückgelassen hatte, stand in einem Brief von ihr, als sie noch Briefe an mich schrieb. Ich sagte Mutter, dass ich die CD mitnehmen würde. Das zu sagen war leicht, das andere zu sagen war zu schwer.
Ich setzte mich auf einen Hocker, der mit dem gleichen Nappaleder wie die Couch bezogen war. Er gehörte mir. Alles gehörte jetzt mir. Ich war das einzige Kind, die einzige Erbin all der Dinge, die Mutter hinterlassen hatte. All der Dinge, die Mutter und Vater besessen hatten, auch ihrer Erinnerungen.
Der Autor W. G. Sebald hatte einmal in einem Interview gesagt, dass man, je älter man wird, immer mehr vergisst. Dass aber das, was in Erinnerung bleibt, eine merkwürdige Verdichtung erfahre, ein spezielles, äußerst hohes Gewicht erhalte. Zuweilen könnten die Erinnerungen von solcher Schwere sein, dass sie einen in bodenlose Tiefe rissen.
Ich dachte, dass ich nun auch noch die anderen Räume betreten müsste. War aber nicht dazu imstande, konnte auch die Mappe nicht hervorholen mit der Liste all der Dinge, die nach Mutters Tod zu erledigen waren. Sie hatte sie mir bei meinem letzten Besuch gezeigt. Die Mappe lag in der untersten Schublade des Schreibschranks in einem großen Umschlag, auf dem mein Name stand. Schon damals war es mir schwergefallen, sie auch nur zu sehen.
Vielleicht, weil ich begriffen hatte, dass auch Mutter zur Leere werden wollte. So eine Leere fühlt nichts. Ich spürte, wie Weinen in mir aufstieg. Als könnte man die Leere, die die eigene Mutter hinterlässt, mit Rotz und Wasser füllen.
Vater hatte immer gesagt, man solle das tun, was ansteht. Ein Hinterbliebener habe sich um die Hinterlassenschaft des Toten zu kümmern, selbst wenn es sich nur um einen Haufen Feldsteine handelte. Am besten fängt man mit dem Schwierigsten an, dachte ich, dem Schlafzimmer, wo Mutter in ihrem großen Ehebett gelegen hat, schlaflos angesichts all der Leere, mit Vaters unbenutzter Betthälfte neben sich. Es galt, sich zusammenzureißen und die Tür zu öffnen.
Ein schwacher Lavendelduft hing im Raum. Mutter hatte Lavendelblüten getrocknet und sie jeden Herbst in kleine Stoffbeutel gefüllt. Die sie zwischen Wäsche und Kleidungsstücke stopfte. Dieser Duft hatte Vater und sie umgeben. Auch mich, als ich ein Kind war.
Das Ehebett der Eltern stand noch immer an derselben Stelle, sorgfältig bezogen, obgleich Vater seit fünf Jahren tot war. Jeden Freitag hatte Mutter die Bettwäsche gewechselt, auch Vaters, nachdem sie beider Kopfkissen und Daunendecken gelüftet hatte. Als könnte man die Leere, die Vater hinterlassen hatte, mit Daunen füllen. Nachdem alles andere saubergewischt war, hatte sie das Kruzifix abgestaubt, das über ihren Betten hing.
Es war ein großes, massives Kreuz aus dunklem Holz mit einem imposanten Bronze-Jesus, der ohnmächtig zu sein schien, was verständlich war, wenn einem jemand drei große Nägel durch den Körper gejagt hatte, zwei durch die Hände und einen durch die über Kreuz gelegten Füße. Ich habe nie begriffen, wie sein Vater das tun konnte. Wie kann man sein Kind sterben lassen, verzweifelt und einsam? Wie kann man vor dem Rufen des eigenen Kindes die Ohren verschließen? Als Allmächtiger kann man die Rettung der Menschheit doch wohl auf besserem Wege regeln. Es stimmt nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt, ja, nicht einmal die Auferstehung.
Mir fiel ein, dass das Kruzifix jetzt mir gehörte. Wäre es wenigstens ein handliches Kreuz gewesen, wie das goldene, das Alois bei den Prozessionen trug. Alois liebte Prozessionen: das Umherziehen, das Singen und – das Beste von allem – das Segnen. Er segnete alles mit dem gleichen Enthusiasmus – die neu errichteten Häuser, die junge Saat auf den Feldern, die Blüte der Bäume. Und die Gemeinde zog singend mit, auch ich. Ich lief mit den anderen Kindern ganz vorn, die Körbe voller Blumen, die wir auf die Wege streuten. Sodass der goldene Jesus über einen Blütenteppich getragen wurde.
Ich begab mich zu der Kommode neben dem Bett. Auf einem Spitzendeckchen stand eine Vase mit Stoffblumen, daneben Porzellanfigürchen von Hummel. Mutter sammelte sie, fröhliche rotwangige Kinder, die unverdrossen Geige oder Ziehharmonika spielten oder sangen.
Ich zog die oberste Schublade auf. Der Anblick der sorgfältig gestapelten Unterwäsche, der blendend weißen BHs mit den kleinen Körbchen und der ebenso weißen Baumwollschlüpfer, gab mir das Gefühl, ich würde mich an Mutter vergehen. Auch der alles durchdringende Lavendelduft. Ich suchte nach den Beuteln und fand sie, obendrein anderes: Andachtsbildchen mit Gott und seinen Heiligen, Bildchen, die in der Kirche verteilt worden waren.
Auf einigen stand ein Datum. Sie waren aus den Fünfzigern, als ich noch ein Kind war. Eins zeigte die Madonna mit winzig kleinen Menschen, die sich wie erschrockene Küken unter ihrem Rocksaum drängten, und darunter stand eine verblüffende Textzeile: »Muttergottes, rette Deutschland und Russland.« Auf einem anderen Bild sah man einen weißbärtigen Gott mit ausgestreckten Armen auf einer Wolke stehen, fast wie ein Seiltänzer. Unter der Wolke stand: »Aus der Tiefe rufe ich zu Dir.« Ich legte das Bildchen zur Seite. Sah Mutter rufen, als sie auf der Autobahnbrücke stand und sich über das Geländer beugte, das ihr bis zur Taille reichte. Aus ihrem Mund aber kam kein Ruf, sie sagte nur leise: »Wenn ich doch nicht so feige wäre.« Es gibt Worte, die ein Kind nie vernehmen sollte, nicht einmal, wenn es bereits erwachsen geworden ist.
Ich sammelte die Bildchen ein und legte sie neben die Hummel-Figuren: Gott und seinen Sohn und den Heiligen Geist. Und Maria und die Engel. Und die furchtsamen Kükenmenschen. Alles roch nach Lavendel. Auch meine Hände.
Ich ging ins Badezimmer und wusch sie gründlich, wie vor einer Operation. Dann zog ich die Tür hinter mir zu, ließ die Wohnung zurück, wie sie gewesen war. Es gibt Augenblicke, da muss man durch die Straßen rennen.
Wer war es, der gesagt hat: Der Tod verstärkt die Kraft der Fragen, so als drehte man die Lautstärke am Radio auf, wenn die Antworten längst verklungen sind. Vielleicht aber waren die Antworten auch da, so wie die Kükenmenschen, die sich unter Marias Rock versteckten. Irgendwo, während man durch die Straßen rennt. Und die Rauchfahnen der Autowerke sich ausbreiten. Und der Ruß fällt. Wenn wenigstens Vater noch am Leben wäre und Waldhorn spielte. Ich muss mir ein Waldhorn kaufen. Und es an die Wand hängen, statt des verlassenen Sohnes, der am Kreuz ohnmächtig wird, nicht vor Schmerz, sondern vor Verzweiflung.
Auf der Insel, den 29. Dezember 2012
Es herrscht Tauwetter, nicht wie im Vorfrühling, mit Knospen an den Zweigen und Erdgeruch, sondern ein Wintertauwetter mit den nagenden Zähnen des Morastes. Und der Schnee wehrt sich, ballt sich fest zusammen und leistet Widerstand.
Lech und ich sind vor neun Monaten hergezogen. In ein altes Haus, umarmt von großen, alten Bäumen, auf einer Insel, umarmt vom weiten, schimmernden See. Darüber ein Himmel gleich einer gewölbten Hand. Und voller Schweigen. Und voll von großem Gesang. Im Frühjahr singen die Nachtigallen wie besessen. Wie in Augustenruh. Ich bin heimgekehrt.
Ich muss an einen Geistlichen denken, dem ich begegnet bin, als ich mein erstes Buch vorgestellt und etwas über einen Patienten vorgelesen habe, der sterben wollte. Der Geistliche erzählte mir von einem Gespräch, das er mit einem alten Seemann geführt hatte, der unheilbar krank im Krankenhaus lag. Der Seemann hatte gesagt, er habe jeden Halt verloren, alle Fixpunkte seien aus seinem Leben verschwunden. Vor ein paar Jahren hatte seine Frau ihren Todeskampf ausgefochten und sich an Gott festgeklammert. Und Gott hatte sich nicht aus ihrem Griff befreien können und war ebenfalls im Grab gelandet. Der Pfarrer sagte, ihm sei es nicht gelungen, die Frau oder Gott dort herauszuholen. Trotzdem hatte der Seemann nach dem Gespräch gesagt: »Jetzt sind die Falten meiner Seele geglättet.«
Wie hier auf der Insel, dachte ich. Hier ist die Seele wie ein großes schimmerndes Stück Seide ohne die geringste Falte. Ganz besonders, wenn ich mit Lech zusammen bin.
Stuttgart, den 26. November 2007
Als verwaistes Kind muss man sich wappnen, besonders, wenn man vor einem deutschen Klinkerhaus steht, an dem ein großes Schild neben dem Eingang verkündet: »Häberles Bestattungsinstitut – Leben endet, Liebe nie«. Mutter hatte sich an die Firma gewandt, als Vater gestorben war, und mit ihr vereinbart, dass sie auch ihr Begräbnis ausrichten sollte. Sie hatte mir die Übereinkunft gezeigt, bevor sie gestorben war. Sie wollte eingeäschert werden. Sie scherte sich nicht um das, was ich sagte: Denn Erde bist du, und zu Erde sollst du wieder werden. Sie wollte wie Pappelschaum lodern.
Als ich auf den Klingelknopf drückte, wurde die Tür von einem Mann geöffnet, der aussah, als hätte er sich gerade den Bierschaum von den dicken, glänzenden Lippen gewischt. Er ergriff meine Hand und sprach mir devot und routiniert sein Beileid aus. Er erinnere sich an meine Eltern, sagte er, sie seien wirklich nette Menschen gewesen, was auch immer er darüber wissen konnte. Dann führte er mich in einen Raum, der wie ein normales Büro aussah. Wenn die Glasschränke an den Wänden nicht mit Urnen vollgestanden hätten.
Ich musste an einem breiten, stabilen Schreibtisch Platz nehmen, auf einem breiten, stabilen Stuhl. Er würde seine Frau holen, sagte der Mann, die kümmere sich um die Bestellungen. Und er gab mir eine Broschüre, die ich mir in der Zwischenzeit ansehen könne. Auf dem Umschlag sah man einen schwarzen Berg, der aus einem blauen Wald ragte. Über dem Ganzen segelte eine weiße Taube, auch über der Textzeile zuunterst: »Wir sind Tag und Nacht für Sie da.«
Ich legte die Broschüre beiseite. In meiner Kindheit in Waldstadt gab es keine Tauben. Die wurden gefangen, sobald sie sich zeigten. Und nie haben die Leute aus Waldstadt sie gefangen, die Flüchtlinge waren es. Obwohl es bereits Anfang der Fünfziger war, also mehrere Jahre nach Kriegsende, kamen Monat für Monat neue Flüchtlinge an. Sie mussten in einem großen Magazingebäude wohnen, das aus irgendwelchen Gründen die Jalousie hieß. Dort lebten sie auf Matratzen in kleinen Verschlägen mit Wänden aus Kartonplatten, einem Geschenk von Vaters Chef, dem Besitzer von Pfäffles Verpackungswerken.
Auf eine Kartonplatte hatte ein Mann, der nach Mutters Worten durch irgendetwas, das er im Krieg gesehen hatte, stumm geworden war, einen Bauernhof gemalt. Er hatte ihn sorgfältig dargestellt, mit Wasserfarben, auch die Stiefel, die auf der Vortreppe standen, ein kleines Paar und zwei Paar große. Eins der großen Stiefelpaare war voller Lehm, der in Klumpen daran festklebte. Die beiden anderen Paare glänzten, das kleine ganz besonders.