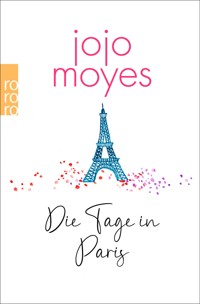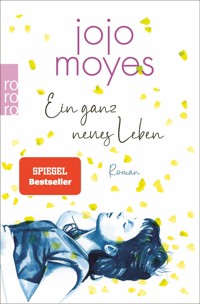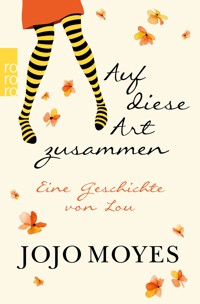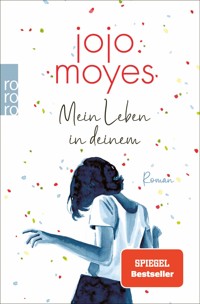9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine überraschende und mitreißende Liebesgeschichte in einem kleinen Fischerort an der Küste Australiens. Bestsellerautorin Jojo Moyes schreibt über die Kraft der Natur – und die oft zerstörerischen Tendenzen der Menschen. Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entfliehen kann. Doch in dem kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay an der Küste Australiens hat sie ein Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten Strände, der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die majestätischen Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und bietet Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen, die sich nach Silver Bay verirren. Als der Engländer Mike Dormer anreist und sich in der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das beschauliche Leben in Gefahr. Der gutaussehende Fremde in den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver Bay, und niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den kleinen Fischerort für immer verändern könnten. Dies ist die Neuausgabe von «Dem Himmel so nah».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Jojo Moyes
Nächte, in denen Sturm aufzieht
Roman
Über dieses Buch
Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entfliehen kann. Doch in dem kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay an der Küste Australiens hat sie ein Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten Strände, der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die majestätischen Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und bietet Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen, die sich nach Silver Bay verirren. Als der Engländer Mike Dormer anreist und sich in der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das beschauliche Leben in Gefahr. Der gutaussehende Fremde in den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver Bay, und niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den kleinen Fischerort für immer verändern könnten.
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die «Sunday Morning Post» in Hongkong und den «Independent» in London gearbeitet. Ihr Roman «Ein ganzes halbes Jahr» war ein internationaler Bestseller und eroberte weltweit die Herzen von über 16 Millionen Leser:innen. Zahlreiche weitere Nr.-1-Romane folgten. Jojo Moyes hat drei erwachsene Kinder und lebt in London.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel «Silver Bay» bei Hodder & Stoughton, a division of Hodder Headline, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien zuerst unter dem Titel «Dem Himmel so nah» im Verlag Page und Turner, Verlagsgruppe Random House.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Judith Schwaab liegen beim Verlag Page und Turner, Verlagsgruppe Random House GmbH
«Silver Bay» Copyright © 2007 by Jojo Moyes
Redaktion Johanna Schwering
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Silke Schmidt
ISBN 978-3-644-40644-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Lockie
für alles, was er ist
und was er sein wird
Prolog
Mein Name ist Kathleen Whittier Mostyn, und im Alter von siebzehn Jahren wurde ich für den Fang des größten Fisches in ganz New South Wales berühmt. Es war ein grauer Ammenhai, und selbst nach zwei Tagen öffentlicher Zurschaustellung blickte er mich mit einem Auge immer noch so böse an, als wollte er mich in Stücke reißen. Damals tat man in Silver Bay kaum etwas anderes als Sportfischen, und ganze drei Wochen lang war jener Hai bei uns Thema Nummer eins. Ein Zeitungsreporter nahm sogar die Anfahrt aus Newcastle auf sich und machte ein Bild von mir und dem Fisch. Obwohl mich der Fotograf schon gebeten hatte, meine höchsten Schuhe zu tragen, war das Vieh immer noch ganze dreizehn Zentimeter größer als ich.
Was man auf dem Foto sieht, ist ein hochgewachsenes, eher finster dreinblickendes Mädchen, das besser aussah, als es ihm selbst bewusst war, mit – zum Leidwesen seiner Mutter – sehr breiten Schultern und einer vom Einholen und Befestigen der Leinen so schmalen Taille, dass sie nie ein Korsett benötigte. Und da stand ich nun und platzte fast vor Stolz, weil ich noch nicht wusste, dass ich bis ans Ende meiner Tage selber am Haken dieses Monstrums hängen würde, als wären wir verheiratet. Was man auf dem Foto allerdings nicht erkennen kann, sind die beiden Drähte, an denen mein Vater und sein Geschäftspartner, Mr. Brent Newhaven, den Hai in der Vertikalen hielten. Das war dann doch etwas zu schwer für mich.
Trotzdem war mein Ruf durch diesen Vorfall zementiert. Jahrelang war ich nur als das «Haimädchen» bekannt, auch als ich längst kein Backfisch mehr war. Meine Schwester Norah zog mich immer damit auf, angesichts meiner äußeren Erscheinung wäre der Name «Seeigel» wohl angebrachter, doch mein Vater glaubte fest daran, dass mein legendärer Fischzug dem Silver Bay Hotel zum Durchbruch verhalf. Zwei Tage nach Erscheinen meines Konterfeis in der Zeitung waren wir restlos ausgebucht, und das blieben wir auch bis ins Jahr 1962, als der Westflügel des Hotels einem Brand zum Opfer fiel. Männer reisten an, weil sie meinen Rekord überbieten wollten: Wenn schon ein Mädchen in der Lage war, einen solchen Brummer an Land zu ziehen, was konnte dann wohl erst ein richtiger Sportangler in dieser sagenhaften Bucht ausrichten? Ein paar von ihnen machten mir sogar einen Heiratsantrag, aber mein Vater pflegte zu sagen, bei denen hätte er schon Lunte gerochen, noch bevor sie Port Stephens erreichten. Also schickte er sie zum Teufel. Die Frauen kamen, weil sie es bis dato nicht für möglich gehalten hatten, dass sie auch angeln könnten, geschweige denn eine Beute, mit der sie in Konkurrenz zu den Männern treten könnten. Und die Familien schließlich kamen, weil Silver Bay mit seiner geschützten Bucht, den endlosen Sanddünen und der ruhigen See einfach ein wunderbarer Ferienort war.
Um es mit dem zusätzlichen Bootsverkehr aufzunehmen, wurden rasch zwei neue Molen gebaut, und jeden Tag war die Luft erfüllt vom Klicken der Riemen und dem Brummen der Außenbordmotoren, während die See in- und außerhalb der Bucht von Anglern und Sportfischern durchforstet wurde. Bis spät in die Nacht hinein hörte man am Hafen das Aufheulen von Automotoren, leise Musik und Gläsergeklirr. Während der fünfziger Jahre gab es wohl kaum einen Ort in der Gegend, der angesagter gewesen wäre als Silver Bay.
Heute haben wir immer noch unsere Boote und unsere Molen, obwohl wir nur noch eine Anlegestelle benutzen, und die Beute, der die Leute hinterherjagen, hat sich geändert. Ich selbst habe fast zwanzig Jahre lang keine Angelrute mehr in der Hand gehabt. Das Töten von Lebewesen jedweder Art interessiert mich nicht mehr.
Das Leben hier verläuft selbst im Sommer in ruhigen Bahnen. Die meisten Urlauber verschlägt es heutzutage in die Clubs und die mehrstöckigen Hotels, an schickere Badeorte wie Coffs Harbour oder Byron Bay, und uns ist das, um die Wahrheit zu sagen, nur recht so.
Den Rekord von damals halte ich immer noch. Er ist in diesem Wälzer verzeichnet, der sich angeblich wie geschnitten Brot verkauft, obwohl man keinen kennt, der jemals einen erworben hat. Ab und zu rufen die Herausgeber mich an, um mir mitzuteilen, dass mein Name auch im nächsten Jahr wieder drinstehen wird. Es kommt vor, dass Schulkinder bei mir klingeln und mir erzählen, sie seien in der Bibliothek auf meinen Namen gestoßen, und ich tue jedes Mal so, als wäre ich überrascht, weil ich ihnen eine Freude machen will.
Jawohl, den Rekord von damals halte ich bis heute. Das sage ich nicht, weil ich damit prahlen oder im Alter von sechsundsiebzig Jahren das Gefühl genießen will, wenigstens einmal im Leben etwas Bemerkenswertes vollbracht zu haben. Nein, wenn man wie ich in einer Welt voller Geheimnisse lebt, tut es einfach gut, wenigstens ab und zu eine Sache beim Namen zu nennen.
Kapitel 1
Man brauchte bloß die Hand bis zum Gelenk hineinzustecken, um in der Keksdose der Moby One auf mindestens drei verschiedene Sorten Plätzchen zu stoßen. Yoshi sagte, die Besatzungen der anderen Boote seien bei den Keksen geizig und kauften immer nur die billigste Sorte mit Pfeilwurz, die in Großpackungen im Supermarkt erhältlich ist. Sie hingegen war der Meinung, wenn jemand hundertfünfzig Dollar dafür bezahlt, mit einem Boot auf Delphinjagd zu gehen, dann könne er auch einen anständigen Keks als Snack an Bord erwarten. Aus diesem Grund kaufte sie meistens Double Chocolate Anzacs, fingerförmige Shortbreads oder hauchdünne Pfefferminzplätzchen, in Folie gehüllt, und ab und an sogar selbstgebackene Kekse. Lance, der Skipper, meinte, sie kaufe nur deshalb anständige Kekse, weil das so ziemlich alles sei, was sie überhaupt zu sich nehme. Er sagte auch, wenn ihr Chef jemals dahinterkäme, wie viel Geld sie für Knabberkram ausgab, würde er einen Tobsuchtsanfall bekommen. Ich starrte die Plätzchendose an, als Yoshi den Passagieren Tee und Kaffee anbot, während die Moby One langsam in die Bucht hinausfuhr. Ich hoffte inständig, sie würden nicht alle Anzacs aufessen, bevor ich die Gelegenheit hatte, mir einen zu schnappen. Am Morgen hatte ich mich ohne Frühstück aus dem Haus gestohlen und erst erfahren, dass Yoshi mich mitfahren lassen würde, als wir ins Cockpit gegangen waren.
«Moby One an Suzanne. Sag mal, Greg, wie viele Bierchen hast du gestern eigentlich gezischt? Du hältst Kurs wie ein einbeiniger Besoffener.»
Lance saß am Funkgerät. Während er weiterredete, steckte ich die Hand in die Keksdose und angelte mir den letzten Anzac heraus. Der Bordfunk zwischen den beiden Booten knisterte, und eine Stimme brummelte etwas vor sich hin, das ich nicht verstehen konnte.
Lance versuchte es wieder: «Moby One an Sweet Suzanne. Reiß dich jetzt besser zusammen, Mann. Vier von deinen Fahrgästen hängen schon über der Reling.»
Yoshi trat zu ihm und reichte ihm einen Pott Kaffee. Ich duckte mich hinter ihr. Die Gischttropfen auf ihrer marineblauen Uniform glitzerten wie Pailletten.
«Hast du Greg gesehen?», brummte Lance.
Sie nickte. «Ich durfte ihn bewundern, bevor wir losgefahren sind.»
«Er ist so besoffen, dass er nicht geradeaus lenken kann.» Lance zeigte durch das wasserverspritzte Fenster auf das kleinere Boot vor uns. «Ich sag dir was, Yoshi, die Passagiere werden ihr Geld zurückverlangen. Der mit dem grünen Hut hat kein einziges Mal den Kopf gehoben, seit wir Break Nose Island passiert haben. Was zum Teufel ist denn in ihn gefahren?»
Yoshis Haar war das schönste, das ich jemals gesehen hatte. Es hing wie ein dicker, schwarzer Vorhang rund um ihr Gesicht und war trotz Wind und Meerwasser niemals zerzaust. Ich nahm eine meiner eigenen kümmerlichen Locken zwischen die Finger. Obwohl wir erst eine halbe Stunde auf See waren, fühlte sie sich bereits klebrig an. Meine Freundin Lara sagte, wenn sie erst vierzehn war, also in vier Jahren, würde ihre Mutter ihr Strähnchen erlauben. Genau in diesem Moment fiel Lance’ Blick auf mich. Irgendwann hatte es ja passieren müssen.
«Was machst du denn hier, Mäuschen? Deine Mami macht mir die Hölle heiß, wenn sie das erfährt. Hast du keine Schule?»
«Ferien.» Ich trat ein wenig verlegen hinter Yoshi.
«Sie kommt dir schon nicht in die Quere, keine Sorge», sagte Yoshi. «Sie wollte bloß so gerne die Delphine sehen.»
Ich schaute Lance an und zog mir die Ärmel bis über die Handgelenke.
Er erwiderte meinen Blick und zuckte schließlich mit den Schultern. «Dann zieh aber eine Schwimmweste an.»
Ich nickte.
«Und steh mir nicht im Weg rum.»
Ich legte den Kopf auf die Seite. Als würde ich das je tun.
«Ach, was soll’s. Hauptsache, deine Mutter gibt nicht hinterher mir die Schuld. Und hör mal, Mäuschen, das nächste Mal steuerst du die Moby Two an, okay – oder besser gleich das Boot von jemand anderem.»
«Jetzt reg dich ab. Sie ist überhaupt gar nicht hier», sagte Yoshi. «Und übrigens, Gregs Steuerkünste sind noch längst nicht das Beste.» Sie grinste. «Warte nur, bis er wendet, dann siehst du, was er mit seinem Bug angestellt hat.»
Während wir langsam die Bucht verließen, sagte Yoshi, es sei ein guter Tag für eine Tour. Die See war ein wenig kabbelig, aber es blies nur ein mäßiger Wind, und die Luft war so klar, dass man die weiße Gischt auf den Brechern meilenweit sehen konnte. Ich folgte Yoshi auf das Hauptdeck, wo sich auch das Restaurant befand, glich mühelos mit den Beinen das Auf und Ab des Katamarans unter mir aus und fühlte mich gleich ein bisschen wohler, weil der Skipper wusste, dass ich an Bord war.
Das hier, hatte Yoshi mir gesagt, war der anstrengendste Teil der heutigen Delphinbeobachtungstour, die Zeit bis zur Ankunft in dem geschützten Gewässer rund um die Bucht, wo man oft ganze Schulen von Großen Tümmlern antreffen konnte. Während die Passagiere auf dem Oberdeck Platz nahmen und, in dicke Schals gehüllt, die frische Juniluft genossen, baute Yoshi das Buffet auf, reichte Getränke herum und bereitete, wenn die See unruhig war, wie meistens in dieser Zeit kurz vor dem Winter, das Desinfektionsmittel und die Eimer für diejenigen vor, die seekrank wurden. Man könne es ihnen so oft sagen, wie man wollte, brummte sie vor sich hin und schaute zu den gut gekleideten Asiaten, die den größten Teil der morgendlichen Kundschaft ausmachten – sie blieben trotzdem unter Deck, sie aßen und tranken trotzdem zu schnell, und sie gingen auch trotzdem auf die Toilette, um sich zu übergeben, und machten sie damit unbenutzbar, anstatt sich einfach über die Reling zu beugen. Und wenn es sich um ihre Landsleute, die Japaner, handelte, fügte sie mit einem Hauch boshaften Vergnügens hinzu, verbrachten sie den Rest der Fahrt in einem Zustand still verzweifelter Demut, versteckt hinter dunklen Sonnenbrillen und hochgeschlagenen Krägen, die aschgrauen Gesichter stoisch aufs Meer gerichtet.
«Tee? Kaffee? Kekse? Tee? Kaffee? Kekse?»
Ich folgte ihr hinaus aufs Vordeck und schloss meine Jacke am Hals. Der Wind hatte sich ein wenig gelegt, aber die eisige Brise war immer noch zu spüren und pfiff um meine Nase und Ohren. Die meisten der Passagiere wollten nichts – sie unterhielten sich laut, um sich über das Motorengeräusch hinweg verständlich zu machen, starrten auf den weit entfernten Horizont hinaus oder machten Fotos voneinander. Ich tauchte dafür meine Hand umso öfter in die Keksdose.
Die Moby One war der größte Katamaran in Silver Bay. Normalerweise arbeiteten zwei Stewards auf einem Kat, doch mit abnehmenden Temperaturen kamen auch weniger Touristen, weshalb Yoshi den Job so lange alleine machte, bis es wieder mehr Buchungen gab. Mir war das nur recht, denn so war es leichter für mich, sie davon zu überzeugen, mich an Bord zu lassen. Ich half ihr dabei, die Tee- und Kaffeekannen in ihre Halterungen zurückzustellen, dann traten wir wieder auf das schmale Seitendeck hinaus, lehnten uns mit dem Rücken fest gegen die Fenster und blickten auf die See hinaus, wo das kleinere Boot vor uns immer noch seinem unsteten Kurs über die Wellen folgte. Selbst auf diese Entfernung war deutlich zu erkennen, dass mittlerweile die meisten der Fahrgäste über der Reling der Suzanne hingen.
«Zehn Minuten Pause sind drin. Da.» Yoshi öffnete eine Dose Cola und reichte sie mir. «Hast du schon mal was von der Chaostheorie gehört?»
«Hmm.» Das sollte so klingen, als wäre es durchaus möglich, dass ich davon gehört hatte.
«Wenn diese Leute da drüben bloß wüssten», sie zeigte mit einem Finger hinüber, während wir spürten, wie das Boot langsamer wurde, «dass ihre lang ersehnte Fahrt zu den wild lebenden Delphinen durch eine Frau ruiniert wird, der sie niemals über den Weg laufen werden, und durch einen Mann, der mittlerweile zweihundertfünfzig Kilometer entfernt von hier in Sydney mit ihr zusammenlebt und der festen Überzeugung ist, lila Radlerhosen seien im Alltag ein akzeptables Kleidungsstück.»
Ich nahm einen Schluck von meiner Cola. Das Prickeln der Kohlensäure im Hals trieb mir Tränen in die Augen, und ich schluckte schwer. «Du meinst, dass die Touristen auf Gregs Boot kotzen müssen, hat etwas mit der Chaostheorie zu tun?» Ich hatte gedacht, der Grund dafür sei die Tatsache, dass er am Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken hatte.
Yoshi lächelte. «In etwa, ja.»
Die Maschinen waren gestoppt worden, die Moby One kam zur Ruhe, und rundherum wurde es still bis auf das Geplauder der Touristen und das Klatschen der Wellen am Rumpf. Ich liebte es, hier draußen zu sein, liebte es zuzuschauen, wie mein Zuhause langsam zu einem winzigen weißen Punkt wurde, der sich von dem schmalen Streifen Strand abhob und schließlich ganz hinter den endlosen Buchten verschwand.
Lara besaß eine Jolle, mit der sie ganz alleine hinaussegeln durfte, solange sie sich an die Bojen hielt, die die alten Austernbänke markierten, und darum beneidete ich sie sehr. Meine Mutter erlaubte mir nicht, in der Bucht herumzuschippern, obwohl ich doch schon fast elf war. «Alles zu seiner Zeit», murmelte sie jedes Mal, wenn ich fragte. Wenn es nach ihr ginge, würde ich überhaupt nie raus aufs Wasser kommen.
Lance tauchte neben uns auf: Gerade war er mit zwei kichernden Teenagermädchen abgelichtet worden. Junge Frauen baten ihn oft, für sie zu posieren, und er lehnte nie ab. Aus diesem Grund trug er auch so gerne seine steife Kapitänsmütze, sagte Yoshi, selbst wenn die Sonne so heiß vom Himmel brannte, dass ihm darunter das Hirn wegschmolz.
«Was hat er denn da auf die Seite des Bootes geschrieben?» Lance kniff die Augen zusammen, um Gregs Kreuzer aus der Ferne besser zu erkennen. Offenbar hatte er mir verziehen, dass ich mich an Bord befand.
«Ich sag’s dir, wenn wir wieder an der Mole sind.» Yoshi zog eine Augenbraue übertrieben hoch und nickte mit dem Kinn in meine Richtung.
«Ich kann sowieso lesen, was da steht, weißt du», sagte ich. Die Suzanne, die bis gestern noch Sweet Suzanne geheißen hatte, war über Nacht in ein böses Schimpfwort umgetauft worden, von dem Yoshi mir außerdem gesagt hatte, es sei biologisch unmöglich.
Yoshi wandte sich Lance zu und senkte, soweit möglich, die Stimme, als glaubte sie wirklich, dass ich sie dann nicht hören konnte. «Seine Frau hat ihm mitgeteilt, dass es doch einen anderen Mann in ihrem Leben gibt.»
Lance stieß einen Pfiff aus. «Das hat er doch schon längst gewusst. Aber sie hat es immer geleugnet.»
«Es war wohl auch besser, es nicht zuzugeben, weil sie genau wusste, wie er reagieren würde. Außerdem ist er selber ja wohl auch nicht gerade ein Unschuldslamm …» Sie warf mir einen Blick zu. «Jedenfalls hat sie sich nach Sydney abgesetzt und verlangt die Hälfte des Bootes.»
«Und was sagt er dazu?»
«Ich denke, das steht deutlich genug auf dem Boot.»
«Ich kann gar nicht fassen, dass er damit Touristen spazieren fährt.» Lance hob seinen Feldstecher, um sich die hingeschmierte rote Schrift genauer anzuschauen.
Yoshi bat mit einer Handbewegung um das Fernglas. «Heute Morgen war er so blau, dass ich mir nicht sicher bin, ob er überhaupt noch weiß, was er getan hat.»
Auf dem Oberdeck wurden aufgeregte Rufe der Touristen laut. Sie drängten alle in Richtung Bug.
«Jetzt geht’s los», murmelte Lance, richtete sich auf und grinste mich an. «Die Fahrt hat sich gelohnt, Mäuschen. Wir müssen wieder an die Arbeit.»
Manchmal, sagte Yoshi, fuhren sie die ganze Bucht ab, aber die Tümmler wollten sich einfach nicht zeigen, und ein Boot voller unzufriedener Delphin-Fans sei ein Boot voller Gratis-Fahrten und Fünfzig-Prozent-Rückzahlungen, die den Boss irgendwann garantiert in den Ruin treiben würden.
Heute jedoch stand eine Gruppe Touristen dicht gedrängt mit surrenden Kameras im Bug, und alle versuchten, die glänzenden grauen Körper, die unter uns durch die brechenden Wellen sprangen, für immer auf ein Bild zu bannen. Ich spähte ins Wasser, um festzustellen, wer da gekommen war, um mit uns zu spielen. Unter Deck hatte Yoshi eine ganze Wand mit Fotos der Finnen aller Delphine vollgehängt, die in der Gegend gesichtet worden waren, und ihnen Namen gegeben: Zigzag, One Cut, Piper. Die Crews der anderen Boote hatten anfangs über sie gelacht, aber mittlerweile konnten alle die verschiedenen Fluken voneinander unterscheiden – schon das zweite Mal, dass wir diese Woche Butterknife zu Gesicht bekommen, hieß es dann zum Beispiel.
Ich kannte alle Namen auswendig.
«Sehen aus wie Polo und Brolly», sagte Yoshi und beugte sich über die Seite. «Ist das Brollys Junges?»
Wie stille graue Bögen umrundeten uns die Delphine, als wären sie die Touristen, die uns bestaunten, und nicht umgekehrt. Jedes Mal, wenn einer von ihnen die Wasseroberfläche durchstieß, klickten die Kameras. Was dachten die Tiere wohl, wenn wir sie so anstarrten? Ich wusste, dass sie so klug waren wie Menschen. Oft stellte ich mir vor, wie es wäre, sie hinterher bei den Felsen zu treffen, wo sie in Delphinsprache über uns lästerten – weißt du noch, der mit dem blauen Hut? Und der mit der komischen Brille?
Lance’ Stimme kam über den Lautsprecher. «Meine Damen und Herren, bitte laufen Sie nicht alle auf eine Seite des Bootes, um die Delphine zu beobachten. Wir machen eine langsame Wende, damit jeder einmal eine gute Sicht auf sie bekommt. Wenn Sie alle auf eine Seite gehen, kentern wir. Und Delphine mögen keine Boote, die umkippen.»
Als ich aufblickte, entdeckte ich zwei Albatrosse, die für einen Moment in der Luft stillzustehen schienen und dann ihre Flügel anlegten und nach unten schossen, wo es nur ganz wenig spritzte, als sie aufs Wasser trafen. Einer tauchte gleich wieder auf und kreiste in der Luft, auf der Suche nach irgendeiner unsichtbaren Beute, dann gesellte sich auch der andere zu ihm, und sie schwebten eine Weile über der Bucht, um schließlich zu verschwinden. Ich blickte ihnen lange hinterher. Während die Moby One langsam ihre Position änderte, beugte ich mich über die Seite und schob die Kappen meiner neuen Turnschuhe unter der Reling durch, damit ich sie bewundern konnte. Yoshi hatte mir versprochen, bei wärmeren Temperaturen würde sie mir erlauben, mich in das Netz zwischen den Kufen zu legen, damit ich die Delphine berühren und vielleicht sogar ein Stück mit ihnen schwimmen konnte. Aber nur, wenn meine Mutter einverstanden war. Ich seufzte. Wir alle wussten, was das bedeutete.
Als das Boot ein plötzliches Manöver machte, stolperte ich fast. Dann wurde mir klar, dass der Motor wieder angeworfen worden war. Erschrocken hielt ich mich an der Reling fest. Ich war in Silver Bay aufgewachsen und wusste, dass es bei den Beobachtungstouren ein paar Regeln gibt, die man befolgen muss. Wenn man Delphine spielen sehen will, muss man den Motor ausschalten. Sind sie in Bewegung, hält man am besten parallel zu ihnen Kurs und lässt sich von ihnen führen. Die Delphine zeigen einem sofort, was Sache ist: Wenn sie dich mögen, kommen sie näher, oder sie halten sich in einer gleichbleibenden Entfernung. Wenn sie ihre Ruhe haben wollen, schwimmen sie davon. Yoshi schaute mich stirnrunzelnd an, und als der Katamaran einen Satz machte, griffen wir nach den Rettungsleinen. Ich sah bestimmt genauso verwirrt aus wie sie.
Plötzlich beschleunigte das Boot und schoss vorwärts. Über uns wurden kreischende Touristen in ihre Sitze zurückgeschleudert.
Lance sprach ins Funkgerät. Während wir hinter ihm ins Cockpit kletterten, sahen wir die Sweet Suzanne in der Ferne an uns vorbeijagen. Sie sprang wie wild über die Wellen, ohne auch nur im Geringsten auf die zunehmende Anzahl von seekranken Passagieren Rücksicht zu nehmen, die über der Reling hingen.
«Lance! Was machst du denn da?» Yoshi hielt sich an einer Handleine fest.
«Wir sehen uns, Kumpel … Sehr verehrte Damen und Herren …» Lance verzog das Gesicht und streckte den Finger nach dem Einschaltknopf des Lautsprechers aus. Ich brauche eine Übersetzung, bedeutete er Yoshi wortlos. «Heute Morgen haben wir eine Sensation für Sie. Eine zauberhafte Begegnung mit unseren Silver-Bay-Delphinen konnten wir Ihnen schon bieten, aber wenn Sie noch ein wenig Geduld haben, möchten wir Ihnen etwas ganz Besonderes zeigen. Wir haben bereits die ersten Wale dieser Saison gesichtet, etwas weiter draußen auf See. Dabei handelt es sich um die Buckelwale, die jedes Jahr auf ihrer langen Wanderung nach Norden aus der Antarktis an uns vorbeiziehen. Ich kann Ihnen versprechen, dass dies ein Anblick ist, den Sie nie vergessen werden. Also, nehmen Sie bitte Platz oder halten sich gut fest. Es könnte jetzt etwas rauer werden, da der Seegang von Süden her zunimmt, aber ich will Sie rechtzeitig zu den Walen bringen. Wer vorne im Boot sitzen möchte, dem empfehle ich, sich bei uns eine wasserdichte Jacke auszuleihen. Im hinteren Teil des Bootes gibt es jede Menge davon.»
Er kurbelte am Steuerrad und nickte Yoshi zu, die das Mikrophon übernahm. Sie wiederholte das, was er gesagt hatte, auf Japanisch und dann in verkürzter Version auch auf Koreanisch. Ich blickte angestrengt auf die See. In meinem Kopf hallte ein einziges Wort nach: Wale!
«Wie weit noch?» Yoshi spähte konzentriert auf das glitzernde Wasser hinaus. Die entspannte Atmosphäre von vorher war wie weggeblasen. Mein Magen krampfte sich vor lauter Aufregung zusammen.
«Vier, fünf Meilen vielleicht? Keine Ahnung. Der Touristenhubschrauber ist drüber weggeflogen und hat gesagt, sie hätten zwei Tiere ein paar Meilen vor Torn Point gesichtet. Ist ein bisschen früh für die Jahreszeit, aber …»
«Letztes Jahr war es der vierzehnte Juni. So lange ist es nicht mehr bis dahin», sagte Yoshi. «Verflucht und zugenäht! Schau dir Greg an! Bei dem gehen noch ein paar Fahrgäste über Bord, wenn er in dem Tempo weitermacht. Sein Boot ist einfach nicht groß genug, um es mit so hohen Wellen aufzunehmen.»
«Er will eben nicht, dass wir vor ihm da sind.» Lance schaute auf den Geschwindigkeitsmesser. «Volle Fahrt voraus. Dieses Jahr ist die Moby One als Erste da, dafür werde ich sorgen. Endlich mal.»
Die Mitglieder der Crews arbeiteten aus den verschiedensten Gründen auf den Booten. Manche machten den Job, um ihre Pflichtstunden an Bord zu absolvieren, damit sie später auf größeren Schiffen und zu besseren Bedingungen anheuern konnten. Einige, wie Yoshi, hatten damit als Teil ihrer Ausbildung begonnen und einfach Gefallen daran gefunden. Aber egal, aus welchem Grund jemand hier war – ich hatte schon lange begriffen, dass von der ersten Walsichtung der Saison ein ganz besonderer Zauber ausging, als könnte man erst dann an eine Rückkehr der Meeresriesen glauben, wenn man sie zum ersten Mal wieder erblickt hatte.
Eigentlich machte es keinen großen Unterschied, wer den Wal als Erster sah. Hatte sich die Neuigkeit erst mal wie ein Lauffeuer verbreitet, schalteten alle fünf Boote, die von der Walmole aus starteten, sofort von der Delphinbeobachtung auf Walbeobachtung um. Doch den Besatzungen war es keineswegs egal. Um genau zu sein, sie drehten fast durch im Bestreben, als Erste zu den Walen zu gelangen.
«Schau dir bloß diesen Idioten an! Ist schon komisch, dass er plötzlich doch einen geraden Kurs halten kann», stieß Lance wütend hervor. Greg war backbord von uns und schien noch an Tempo zuzulegen.
Yoshi angelte sich eine wasserdichte Jacke und warf sie mir zu. «Da! Nur für den Fall, dass wir vorne rausgehen müssen. Wird ziemlich nass.»
«Verflucht noch mal, ich glaub’s einfach nicht.» Lance zeigte auf ein weiteres Boot am Horizont. «Da ist Mitchell! Könnte wetten, dass der den ganzen Morgen am Funkgerät gesessen hat, und jetzt taucht er einfach auf, mit einer Handvoll Passagieren an Bord. Irgendwann kriegt die faule Ratte von mir noch mal eine auf die Zwölf, das sag ich dir.»
Über Mitchell Dray gab es immer Beschwerden. Im Gegensatz zu den anderen machte er sich gar nicht erst die Mühe, nach Delphinen Ausschau zu halten; er hörte seelenruhig einfach den Funkverkehr zwischen den Schiffen ab und fuhr dann schnurstracks dorthin, wo alle hinfuhren.
«Werde ich wirklich einen echten Wal sehen?», fragte ich. Unter unseren Füßen klatschte der Bug des Schiffes mit einem lauten Knall auf die Wellen, und ich musste mich am Kartentisch festhalten. Durch das offene Fenster waren die aufgeregten Rufe der Touristen zu hören, das Gekreische derjenigen, die bei besonders hohen Wellen einen Schwall Wasser abbekommen hatten.
«Wenn wir Glück haben, schon.» Yoshis Augen ruhten immer noch konzentriert auf dem Horizont.
Ein echter Wal. Ich hatte noch nie im Leben einen gesehen.
«Da … Da! Ach nein, das ist nur Gischt.» Yoshi suchte jetzt mit ihrem Feldstecher das Wasser ab. «Kannst du nicht den Kurs ändern? Es blendet so.»
«Nicht, wenn wir als Erste da sein wollen.» Lance schwenkte das Boot trotzdem ein wenig nach steuerbord, damit die Sonne in einem anderen Winkel auf die Wellen schien.
«Wir sollten die Küste anfunken. Nachfragen, wo der Hubschrauber den Wal gesichtet hat.»
«Hat keinen Sinn», sagte Lance. «Der kann mittlerweile schon zwei Meilen weiter sein. Und Mitchell hört mit. Ich gebe diesem Scheißkerl keine weiteren Informationen mehr. Der schnappt uns schon den ganzen Sommer über die Passagiere weg.»
«Halt einfach Ausschau nach dem Blas.»
«Aye, aye. Und nach dem kleinen Schildchen, auf dem steht: Wal.»
«Ich wollte nur helfen, Lance.»
«Da!» Ich hatte den Umriss gesehen, wie ein großer schwarzer Kiesel, bevor er in der Ferne ins Wasser untertauchte. «Nordnordost. Schwimmt direkt auf Break Nose Island zu. Ist gerade abgetaucht.» Mir war ganz schlecht vor Aufregung.
Hinter mir hörte ich, wie Lance anfing zu zählen. «Eins … zwei … drei … vier … Wal!»
Eine unverwechselbare Fontäne stieg fröhlich am Horizont hoch. Yoshi quiekte vor Begeisterung.
Lance schaute zu Greg, der den Wal aus seiner Position offenbar noch nicht entdeckt hatte. «Wir haben sie!», stieß Lance hervor. Für ihn waren alle Wale weiblich, so wie alle Kinder für ihn «Mäuschen» waren.
Wal. Ich nahm das Wort in meinen Mund und ließ es mir genüsslich auf der Zunge zergehen. Dabei verlor ich die Wasseroberfläche keine Sekunde aus den Augen. Die Moby One änderte ihren Kurs, und der riesige Katamaran knallte jedes Mal aufs Wasser, wenn er nach einer Welle wieder landete. Ich stellte mir vor, wie der Wal hinter der Insel aus dem Wasser sprang und der Welt seinen weißen Bauch zeigte, so unbändig und voller Freude, am Leben zu sein.
«Ein Wal», flüsterte ich.
«Wir sind die Ersten», murmelte Yoshi aufgeregt. «Endlich sind wir mal die Ersten da draußen.»
Ich sah, wie Lance das Steuer herumriss und leise vor sich hin zählte, um festzustellen, wie oft der Wal blies. Wenn mehr als dreißig Sekunden zwischen den Blasen lagen, würde er wieder tief hinabtauchen. Dann hatten wir ihn verloren. Lag weniger Zeit dazwischen, hatten wir eine Chance, ihm zu folgen.
«Sieben … acht … Jetzt ist sie oben. Jaaaa.» Lance schlug mit der Hand auf das Steuerrad und griff dann nach dem Mikrophon. «Meine Damen und Herren, wenn Sie dort hinüber nach rechts schauen, können Sie den Wal erkennen, der gerade auf dem Weg hinter die Landzunge ist.»
«Jetzt hat Greg gemerkt, wo wir hinfahren.» Yoshi grinste. «Bloß einholen kann er uns nicht mehr. Sein Motor ist nicht stark genug.»
«Moby One an Blue Horizon. Mitchell», brüllte Lance in sein Mikrophon, «wenn du das Schätzchen da draußen sehen willst, musst du aufhören, an unseren Rockschößen zu hängen.»
Mitchells Stimme kam über den Sender. «Blue Horizon an Moby One. Ich wollte bloß dafür sorgen, dass jemand die Leute aufnimmt, die bei Greg über Bord gehen.»
«Ach, geht es dir etwa gar nicht um den Wal?», antwortete Lance knapp.
«Blue Horizon an Moby One. Das Meer ist alt und groß, Lance. Ist genug Platz für alle da.»
Ich umklammerte die hölzerne Kante des Kartentischs so fest, dass meine Fingerknöchel ganz weiß wurden, während ich zusah, wie die Landzunge größer wurde. Ich fragte mich, ob der Wal dort langsamer werden und uns gestatten würde, näher an ihn heranzukommen. Möglicherweise würde er den Kopf heben und uns beäugen, und vielleicht würde er sogar an das Boot heranschwimmen und uns sein Junges zeigen.
«Zwei Minuten», sagte Lance. «In etwa zwei Minuten sind wir um die Landzunge herum. Hoffentlich kommen wir noch näher heran.»
«Na los, Mädchen. Zeig uns, was du draufhast», sprach Yoshi wie zu sich selbst, den Feldstecher immer noch vor den Augen.
Wal, sprach ich leise zu dem Tier, warte auf uns, Wal. Ich fragte mich, ob er mich bemerken würde. Ob er spüren würde, dass gerade ich unter all den Menschen auf dem Boot eine besondere Beziehung zu Meerestieren hatte. Ich war mir ziemlich sicher, er würde es spüren.
«Ich – kann – es – einfach – nicht – glauben.» Lance hatte seine Schirmmütze abgenommen und starrte finster aus dem Fenster.
«Was denn?» Yoshi beugte sich zu ihm.
«Da hinten.»
Ich folgte ihrem Blick. Während die Moby One langsam die Landzunge umrundete, wurden wir alle still. Nur eine halbe Meile draußen auf See, kurz vor der Landzunge, mitten im tiefblauen Wasser, lag die Ishmael vor Anker. Der frisch gestrichene Rumpf des Bootes glänzte in der Mittagssonne.
Am Ruder stand meine Mutter, lässig über die Reling gebeugt, das Haar zerzaust unter der ausgebleichten Mütze, die sie immer trug, wenn sie aufs Meer hinausfuhr. Milly, unser Hund, lag zu ihren Füßen. Meine Mutter sah so aus, als hätte sie schon seit Jahren dort auf den Wal gewartet.
«Wie zum Teufel hat sie das geschafft?» Lance fing Yoshis warnenden Blick auf und bedachte mich mit einem entschuldigenden Achselzucken. «Sorry, Mäuschen, aber – Mann …»
«Sie ist immer zuerst da.» Yoshis Reaktion war halb amüsiert, halb resigniert. «Ich komme jedes Jahr hierher. Und immer ist sie schon da.»
«Von einer verdammten Engländerin geschlagen. Schlimmer kann’s nicht mehr kommen.» Lance zündete sich eine Zigarette an und warf das Streichholz verärgert über Bord.
Ich trat auf das Deck hinaus. Genau in diesem Moment tauchte der Wal auf. Während wir ihn bestaunten, schlug er mit der Fluke flach auf und blies eine gewaltige Fontäne in Richtung der Ishmael. Die Touristen an Deck der Moby One brachen in Jubel aus. Das Tier war gigantisch und so nah, dass wir die mit Seepocken bewachsenen Auswüchse an seinem Körper und den gerillten weißen Bauch sehen konnten; so nah, dass ich ihm kurz ins Auge blicken konnte. Dabei war es unglaublich flink – wie konnte etwas, das einen so gewaltigen Körper hatte, bloß so wendig sein?
Mir stockte der Atem. Ich hielt mich mit der einen Hand an den Rettungsleinen fest, hob mit der anderen den Feldstecher vor meine Augen und schaute hindurch – nicht auf den Wal, sondern auf meine Mutter. In diesem Moment hörte ich nichts mehr, weder die erstaunten Ausrufe über die Größe des Tieres noch über die Dünung, die es vor dem kleineren Boot hervorrief, und ganz kurz vergaß ich auch, dass ich mich nicht an Bord der Moby One sehen lassen durfte. Selbst aus der Entfernung konnte ich erkennen, dass meine Mom lächelte, während sie mit zusammengekniffenen Augen nach oben blickte. Diesen Gesichtsausdruck zeigte sie an Land nur selten – wenn überhaupt.
Tante K. ging zum Ende der Veranda und stellte eine Schüssel Garnelen, einen Teller mit Zitronenschnitzen sowie einen großen Brotkorb auf den gebleichten Holztisch. Eigentlich war sie meine Großtante, aber sie meinte, wenn ich sie so nenne, fühle sie sich wie eine alte Schachtel, deshalb sagte ich Tante K. zu ihr. Hinter ihr schimmerte die weiße Holzverkleidung der Hotelfassade in der Abendsonne, die sich wie leuchtend rote aufgereihte Pfirsiche in den acht Fenstern spiegelte. Der Wind hatte etwas aufgefrischt, und das Hotelschild schwang quietschend in der Brise hin und her.
«Womit haben wir uns das denn verdient?» Greg nahm genüsslich einen Schluck aus seiner Bierflasche und hob den Kopf. Er hatte seine Sonnenbrille abgenommen und ziemlich dunkle Ringe unter den Augen.
«Ich hab gehört, Sie könnten was Ordentliches in den Magen vertragen», sagte Tante K. und knallte eine Serviette vor ihm auf den Tisch.
«Hat er Ihnen erzählt, dass vier Fahrgäste ihr Geld zurückverlangt haben, als sie die Aufschrift an seinem Schiffsrumpf gesehen haben?» Lance lachte. «Tut mir leid, Kumpel, aber das war wirklich keine geistige Glanzleistung. Ausgerechnet so was da hinzuschreiben.»
«Sie sind ein feiner Kerl, Miss M.» Ohne Lance zu beachten, griff Greg nach dem Brot.
Tante K. warf ihm einen ihrer berühmten Blicke zu. «Und das wird sich grundlegend ändern, wenn Sie noch einmal so was hinschreiben, wo die kleine Hannah hier es sehen kann.»
«Aufgepasst! Die Hai-Lady hat immer noch ihre scharfen Zähne.» Lance machte eine schnappende Bewegung in Richtung Greg.
Tante K. beachtete ihn nicht. «Hannah, iss ordentlich. Ich könnte wetten, dass du zum Mittagessen mal wieder keinen Bissen zu dir genommen hast. Ich hole noch den Salat.»
«Sie hat jede Menge Kekse gegessen», sagte Yoshi und schälte fachmännisch eine Garnele.
«Kekse.» Tante K. schnaubte verächtlich.
Wie an den meisten Abenden saßen wir zusammen mit den Leuten von der Walmole vor der Hotelküche. Es kam nur selten vor, dass sich die Besatzungen der Boote nicht auf ein oder zwei Bier trafen, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Manche der jüngeren Crewmitglieder, so pflegte Tante K. oft zu sagen, schauten dabei so tief ins Glas, dass sie es gar nicht mehr nach Hause schafften.
Während ich in eine der saftigen Tigergarnelen biss, bemerkte ich, dass die Heizpilze draußen standen. Nur wenige Gäste des Silver Bay Hotel wollten im Juni im Freien sitzen, aber die Besatzungen der Walbeobachtungsboote tauschten sich hier über die Ereignisse des Tages aus, ganz gleich, wie das Wetter war.
Die Zusammensetzung der Mannschaften änderte sich von Jahr zu Jahr, weil die Leute die Jobs wechselten oder aufs College gingen, aber Lance, Greg und Yoshi bildeten schon lange einen festen Bestandteil meines Lebens. Normalerweise schaltete Tante K. die Heizpilze Anfang Juni ein, und bis September brannten sie fast jeden Abend.
«Habt ihr viele Leute an Bord gehabt?» Tante K. stellte den Salat auf den Tisch. Mit ein paar geschickten Handbewegungen mischte sie ihn durch und schaufelte eine große Portion auf meinen Teller, noch bevor ich Einwände erheben konnte. «Bei mir im Museum war heute kein Mensch.»
Yoshi zuckte mit den Achseln. «Die Moby One war ziemlich gut besetzt. Viele Koreaner. Bei Greg hing fast die Hälfte über der Reling.»
«Dafür hatten sie eine gute Sicht auf den Wal.» Greg nahm sich noch ein Stück Brot. «Keine Beschwerden. Haben Sie noch ein Bier, Miss M.?»
«Sie wissen ja, wo die Bar ist. Hast du ihn gesehen, Hannah?»
«Er war riesengroß. Ich konnte seine Seepocken erkennen.» Irgendwie hatte ich erwartet, dass die Haut ganz glatt aussehen würde, aber sie war zerfurcht, gerillt und mit anderen Meerestieren besetzt, als wäre der Wal eine lebendige Insel.
«Er war sehr nah. Ich hab ihr gesagt, dass das etwas Besonderes war», sagte Yoshi. «Normalerweise kommen wir nicht so nah heran.»
Greg kniff die Augen zusammen. «Wenn sie bei ihrer Mutter auf dem Boot gewesen wäre, hätte sie ihm die Zähne putzen können.»
«So, so.» Tante K. guckte streng. «Kein Wort», flüsterte sie mir zu. «Das war eine absolute Ausnahme.»
Ich nickte gehorsam. Es war schon die dritte absolute Ausnahme in diesem Monat.
«Ist dieser Mitchell aufgetaucht?», fragte Tante K. laut. «Auf den solltet ihr ein Auge haben. Man munkelt, er bandelt mit den großen Booten von der Reederei aus Sydney an.»
Alle blickten auf.
«Ich dachte, die Leute von der Naturschutzbehörde hätten die endgültig abgeschreckt», meinte Lance.
«Auf dem Fischmarkt», sagte Tante K., «hat man mir erzählt, eins von diesen Booten sei ganz weit draußen am Kap gesichtet worden. Voll aufgedrehte Musik, tanzende Leute an Deck. So ’ne Art schwimmende Diskothek. Der ganze Fang der Nacht war dahin. Aber als die Leute von der Naturschutzbehörde rauskamen, waren sie längst weg. Unmöglich, denen was nachzuweisen.»
Das mit dem Gleichgewicht war in Silver Bay sehr kompliziert. Kamen zu wenige Touristen zur Walbeobachtung, liefen die Geschäfte schlecht; kamen aber zu viele, wurden die Tiere gestört und ließen sich nicht blicken. Auch Lance und Greg waren bereits auf dreistöckige Katamarane mit plärrend lauter Musik und voll besetzten Decks gestoßen, die von der anderen Seite der Bucht kamen, und ihre Meinung war einhellig.
«Die sind der Tod für uns alle», schimpfte Lance. «Unverantwortlich. Sind bloß scharf aufs Geld. Genau das Richtige für Mitchell.»
Ich hatte gar nicht gemerkt, wie hungrig ich war. Ich aß sechs Riesengarnelen hintereinander und begegnete am Schluss noch Gregs Fingern, die ebenfalls in der leeren Schüssel herumsuchten. Er grinste und winkte mir mit einem Garnelenkopf zu. Ich streckte ihm die Zunge heraus.
«Aye, aye, da ist sie ja. Unsere Walprinzessin.»
«Sehr lustig.» Meine Mutter schmiss ihre Schlüssel auf den Tisch und ließ Yoshi ein wenig beiseiterücken, damit sie sich neben mich auf die Bank quetschen konnte. Sie gab mir einen Kuss auf den Kopf. «Hast du einen schönen Tag gehabt, Liebes?» Sie roch nach Sonnencreme und salziger Luft.
Ich warf meiner Tante einen Blick zu. «Alles prima.» Dann beugte ich mich schnell hinab, um Milly an den Ohren zu kraulen, damit meine Mutter nicht sehen konnte, wie rot ich geworden war. Mir schwirrte immer noch der Kopf vom Anblick dieses Wals. Ich hatte das Gefühl, man müsse mir das auch ansehen, aber meine Mutter griff nur nach einem Glas und schenkte sich etwas Wasser ein.
«Was hast du denn gemacht?», fragte sie mich.
«Ja. Was hast du eigentlich heute gemacht, Hannah?» Greg zwinkerte mir zu.
«Sie hat mir mit dem Bettenmachen geholfen.» Tante K. warf ihm einen finsteren Blick zu. «Wie man hört, hattest du ja auch einen schönen Nachmittag, Liza.»
«War nicht schlecht.» Meine Mutter stürzte das Wasser hinunter. «Gott, hab ich einen Durst. Hast du denn heute genug getrunken, Hannah? Hat sie genug getrunken, Kathleen?» Ihr englischer Akzent war selbst nach all den Jahren in Australien immer noch deutlich zu hören.
«Sie hatte reichlich zu trinken, ja. Wie viele hast du denn gesehen?»
«Sie trinkt nie genug. Nur den einen. Großes Weibchen. Hat mir einen ganz schönen Schwung Wasser in die Tasche befördert, als es mit der Fluke schlug. Schaut mal.» Sie hielt ihr Scheckbuch hoch, das an den Kanten ganz gekräuselt und krumm war.
«Na ja, typischer Anfängerfehler.» Tante K. seufzte verächtlich. «Hattest du denn niemanden mit draußen?»
Meine Mutter schüttelte den Kopf. «Ich wollte mal das neue Ruder ausprobieren und schauen, wie es sich hält, wenn die See rauer ist. Auf der Werft haben sie mich gewarnt, es könnte klemmen.»
«Und dabei bist du rein zufällig auf einen Wal gestoßen», sagte Lance.
Sie nahm noch einen Schluck Wasser. «Genau.» Ihr Gesicht war plötzlich verschlossen.
Ein paar Minuten lang aßen wir schweigend vor uns hin, während am Horizont langsam die Sonne unterging. Zwei Fischer kamen an uns vorbei und winkten uns zu. Einer von ihnen war Laras Dad, aber ich war mir nicht sicher, ob er mich gesehen hatte.
Meine Mutter aß ein Stück Brot und ein winziges Tellerchen voll Salat, noch weniger als ich, und Salat mag ich gar nicht. Dann schaute sie zu Greg hoch. «Ich habe das von Suzanne gehört.»
«Halb Port Stephens hat das von Suzanne gehört.» Gregs Augen waren müde, und er sah aus, als hätte er sich eine ganze Woche nicht rasiert.
«Ja. Nun … es tut mir leid.»
«Leid genug, um am Freitag mit mir auszugehen?»
«Nee.» Sie stand auf, schaute auf die Uhr, schob ihr durchnässtes Scheckbuch in die Tasche zurück und machte sich auf den Weg in Richtung Küchentür. «Mit dem Ruder stimmt wirklich was nicht. Ich muss die Werft anrufen, bevor die alle wieder weg sind. Zieh deinen Pullover über, wenn du noch draußen bleibst, Hannah. Es kommt Wind auf.»
Ich schaute ihr hinterher, wie sie wegging, gefolgt von ihrem Hund.
Keiner sagte etwas, bis wir die Fliegentür zuknallen hörten. Dann lehnte sich Lance in seinem Stuhl zurück und schaute auf die Bucht hinaus, wo ganz hinten am Horizont ein Kreuzer vorbeizog. «Unser erster Wal der Saison, und Gregs erster Vollrausch. Passt irgendwie gut zusammen, findet ihr nicht?»
Er bückte sich blitzschnell, während ein Stück Brot an der Stuhllehne hinter ihm abprallte.
Kapitel 2
Das Walfangmuseum war in der alten Walverarbeitungsanlage untergebracht, seit man in den frühen Sechzigern in Port Stephens mit dem Walfang aufgehört hatte. Es lag nur ein paar hundert Meter vom Silver Bay Hotel entfernt. Als touristische Attraktion im modernen Sinne hatte es nicht viel zu bieten: Das Gebäude selbst erinnerte an eine große Scheune, mit einem verdächtig rötlich braunen Boden und Holzwänden, die immer noch nach dem Salz rochen, mit dem man das Walfleisch früher gepökelt hatte. Draußen im Hinterhof gab es einen Lokus, und für durstige Kehlen stand jeden Tag ein Krug mit selbstgemachter Limonade bereit. Speisen, so war einem Schild zu entnehmen, seien im Hotel erhältlich. Immerhin konnte die Anlage bei aller Schlichtheit mit etwa doppelt so vielen «Objekten» (wie es heute heißt) aufwarten wie noch zur Zeit meines Vaters.
Unsere Hauptattraktion war ein Teil des Schiffsrumpfes der Maui II, eines kommerziellen Walfängers, der im Jahre 1935 glatt in zwei Hälften zerbrochen war, als ein Minkewal das Schiff auf seiner Schwanzflosse in die Höhe hob. Glücklicherweise war ein Fischtrailer in der Nähe gewesen, hatte die Besatzung gerettet und konnte auch ihre Geschichte bestätigen. Schon seit vielen Jahren besuchten die Menschen der Umgebung das Museum und wurden Zeugen dessen, was die Natur dem Menschen antun kann, wenn sie findet, er habe genug Raubbau an ihr betrieben.
Seit dem Tod meines Vaters im Jahr 1970 hielt ich das Museum geöffnet und erlaubte den Besuchern, auf die Reste des Schiffsrumpfes zu klettern und mit den Fingern über das gesplitterte Holz zu streichen. Dabei beobachtete ich ihre Gesichter, wenn sie sich vorstellten, wie es wohl sein mochte, für ein paar Momente auf der Fluke eines Walfischs zu reiten, und erzählte ihnen alles über die ausgestopften Fische, die die Glasvitrinen an den Wänden zierten. Vor langer Zeit hatte ich sogar für Fotos Modell gestanden, wann immer ein besonders Scharfäugiger in mir das Haimädchen aus den gerahmten Zeitungsartikeln erkannte.
Heutzutage interessierte das alles kaum noch jemanden. Die Touristen, die im Hotel abstiegen, verbrachten meist aus Höflichkeit eine Viertelstunde im Museum, wanderten in den staubigen Räumen umher, gaben ein paar Cent für Walpostkarten aus und setzten vielleicht ihre Unterschrift unter eine Petition gegen die Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs. Doch oft kamen sie nur herein, weil sie auf ein Taxi warteten, weil eine starke Brise herrschte oder weil es regnete und folglich draußen auf dem Wasser nichts zu tun war.
Ich selbst war der Meinung, dass man ihnen eigentlich auch keinen Vorwurf daraus machen konnte. Die Maui II verfiel immer mehr zu einem Haufen Treibholz, und es kam nur noch selten vor, dass Leute einen Walknochen oder ein Stück Bartenplatte in die Hand nahmen, bevor der Minigolfplatz und die Spielautomaten im Surf-Club wieder ihre ganze Aufmerksamkeit forderten. Schon seit Jahren riet man mir zu umfassenden Modernisierungen, aber ich ignorierte diese Ratschläge erfolgreich. Wozu das alles? Der Hälfte der Leute, die im Museum herumliefen, schien es peinlich zu sein, etwas zu bewundern, das heutzutage als illegal gilt. Vielleicht wusste nicht einmal ich selbst, warum ich das Museum immer noch geöffnet hielt, aber andererseits war der Walfang ein Teil der Geschichte von Silver Bay, und Geschichte ist das, was gewesen ist, auch wenn sie ihre unappetitlichen Seiten hat.
Ich rückte die Harpune der Maui II, die aus mir entfallenen Gründen Old Harry genannt wurde, an ihrem Wandhaken gerade. Anschließend nahm ich eine Angel in die Hand, fuhr mit meinem Staubwedel darüber und drehte an der Kurbel, um zu prüfen, ob sie noch funktionierte, was eigentlich keinerlei Bedeutung mehr hatte, aber ich mochte es, zu wissen, dass die Dinge noch funktionstüchtig waren. Ich zögerte. Und schleuderte – vielleicht einen Moment lang von dem vertrauten Gefühl in meiner Hand in Versuchung geführt – die Schnur nach hinten, als wollte ich sie auswerfen.
«Hier wirst du wohl keinen großen Fang machen.»
Ich fuhr mir mit der Hand an die Kehle. «Nino Gaines! Jetzt hätte ich vor Schreck fast die Angel fallen lassen!»
«Bestimmt nicht.» Er nahm seinen Hut ab und kam von der Tür aus bis in die Mitte des Raumes. «Ich habe jedenfalls noch nie gesehen, dass du dir einen Fang entgehen lässt.» Als er lächelte, blitzte in seinem Mund eine Reihe schiefer Zähne auf. «Hab ein paar Kisten Wein draußen im Truck. Vielleicht hast du Lust, beim Mittagessen eine Flasche mit mir zu köpfen. Würde mich interessieren, wie du ihn findest.»
«Meine Bestellung sollte eigentlich erst nächste Woche kommen, wenn ich mich recht erinnere.» Ich hängte die Angel an die Wand zurück und wischte mir die Hände an der Vorderseite meiner Moleskin-Hose ab. Eigentlich war ich über das Alter hinaus, in dem solche Überlegungen eine Rolle spielten, aber es fuchste mich, dass er mich unfrisiert und in meiner Arbeitshose erwischt hatte.
«Ist ein guter Tropfen. Würde wirklich gerne wissen, was du davon hältst.» Er lächelte noch immer. An den Falten in seinem Gesicht waren all die Tage abzulesen, die er in seinen Weinbergen verbracht hatte, und an der Röte rund um seine Nase all die Abende danach.
«Ich muss noch ein Zimmer für einen Gast fertig machen, der morgen kommt.»
«Meine Güte, wie lange kann es schon dauern, ein Laken unter die Matratze zu klemmen?»
«So kurz vor dem Winter kommen nicht mehr viele Besucher. Dann soll es hier nicht aussehen wie in einer Bruchbude.» Als ich die Enttäuschung in seinem Gesicht sah, gab ich nach. «Na gut, ein paar Minuten kann ich wohl erübrigen, solange du nicht erwartest, dass ich ein großartiges Essen zaubere. Die Lebensmittellieferung vom Großhandel steht noch aus. Dieser verdammte Bursche kommt jede Woche zu spät.»
«Daran habe ich auch gedacht.» Er hob eine Papiertüte in die Höhe. «Hier sind ein paar Pies drin, und zwei Mangos zum Nachtisch. Weiß doch, wie es bei Karrierefrauen wie dir zugeht. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit … Jemand muss wohl dafür sorgen, dass du bei Kräften bleibst.»
Ich musste lachen. Nino Gaines hatte immer schon so mit mir geredet, seit er während des Krieges zum ersten Mal bei uns aufgetaucht war und angekündigt hatte, er wolle sich hier niederlassen. Damals war die gesamte Bucht fest in der Hand von australischen und amerikanischen Soldaten gewesen, und mein Vater hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, deutliche Anspielungen auf seine Treffsicherheit mit dem Gewehr zum Besten zu geben, wenn ich hinter der Bar stand und die jungen Männer mir hinterherriefen und -pfiffen. Nino nahm sich zwischen ihnen fast wie ein Gentleman aus: Stets hatte er seine Mütze abgenommen, während er darauf wartete, bedient zu werden, und er versäumte es niemals, meine Mutter «Ma’am» zu nennen. «Trau ihm trotzdem nicht», hatte mein Vater gemurmelt und alles in allem wahrscheinlich sogar recht damit gehabt.
Draußen auf See sah es hell und ruhig aus, ein guter Tag für die Leute auf den Walbooten. Als wir uns setzten, sah ich die Moby One und die Two, die gerade aus der Bucht schipperten. Meine Augen waren nicht mehr so gut wie früher, aber von hier aus schien es, als hätten sie eine beträchtliche Anzahl von Passagieren an Bord. Liza war schon früher hinausgefahren; sie veranstaltete wie jeden Monat eine Gratisfahrt für die Pensionäre vom Reservistenverein, obwohl ich ihr schon oft genug gesagt hatte, es sei töricht, das Geld so aus dem Fenster zu werfen.
«Machst du den Laden über den Winter dicht?»
Ich schüttelte den Kopf und biss in den Blätterteigkuchen.
«Nein. Die von den Mobys versuchen gerade, einen Deal mit mir auszuhandeln – Unterkunft, Verpflegung und eine Walbeobachtungsfahrt zu einem festen Preis, plus kostenlosem Eintritt ins Museum. So ähnlich, wie ich es mit Liza mache. Sie haben schon ein paar Broschüren gedruckt und stellen das Ganze auf eine Tourismus-Website für New South Wales. Angeblich soll das gut fürs Geschäft sein.»
Ich hatte gedacht, er würde etwas über die neuen Technologien in seinen Bart murmeln, die ihm völlig schleierhaft seien, aber Nino meinte: «Gute Idee. Ich verkaufe online mittlerweile vierzig Kisten Wein pro Monat.»
«Du bist im Internet?» Ich schaute ihn über meine Brille hinweg an.
Er hob sein Glas, außerstande, seine Genugtuung darüber zu verbergen, dass er mich überrascht hatte. «Es gibt noch eine ganze Menge Dinge, die du nicht über mich weißt, Miss Kathleen Whittier Mostyn, ganz gleich, was du vielleicht denkst. Ich bin schon seit Jahren im Cyberspace zu Hause. Frank hat das alles für mich eingerichtet. Und um die Wahrheit zu sagen, macht es mir sogar ziemlichen Spaß, ein bisschen herumzusurfen. Hab mir schon alles Mögliche online gekauft.» Er zeigte auf mein Glas – ich sollte endlich den Wein probieren. «Ist ziemlich hilfreich, sich anzuschauen, was die großen Winzer im Hunter Valley so zu bieten haben.»
Ich versuchte, mich auf meinen Wein zu konzentrieren, auch weil ich unmöglich zugeben konnte, wie sehr mich Nino Gaines’ offenkundige Vertrautheit mit der neuen Technik aus dem Konzept gebracht hatte. Irgendwie fühlte ich mich überrumpelt, so wie es mir oft auch im Gespräch mit jungen Leuten ging, als wären da irgendwelche lebenswichtigen neuen Kenntnisse in Umlauf, von denen nur ich gerade mal wieder nichts mitbekommen hatte. Ich schnupperte an meinem Glas, nahm einen kleinen Schluck, und das Aroma des Weines erfüllte langsam meinen ganzen Mund. Er war ein wenig zu jung und fruchtig, was ihm aber keinen Abbruch tat. «Der ist sehr lecker, Nino. Ein Hauch von Himbeere ist auch drin.» Wenigstens von Wein verstehe ich immer noch etwas.
Er nickte erfreut. «Dachte mir schon, dass der dir schmecken könnte. Wusstest du übrigens, dass du auch einen Eintrag hast?»
«Was für einen Eintrag?»
«Das Haimädchen. Frank hat deinen Namen mal in eine Suchmaschine eingegeben, und da warst du – mit Bild und allem Drum und Dran. Aus den Zeitungsarchiven.»
«Ein Bild von mir ist im Internet?»
«Im Badeanzug, ja. So hast du immer besonders niedlich ausgesehen. Außerdem gibt es auch noch ein paar Artikel über dich. Irgendein Mädel von der Victoria University hat dich in ihrer Doktorarbeit über Frauen und die Jagd erwähnt. Eine ziemlich beeindruckende Arbeit – voller Symbolismus, Bezügen zu den Klassikern und Gott weiß was noch alles. Ich habe Frank gebeten, es mir auszudrucken, aber leider vergessen, es mitzubringen. Ich dachte, du könntest es vielleicht im Museum aufhängen.»
Jetzt fühlte ich mich erst recht aus der Bahn geworfen. Ich stellte mein Glas auf den Tisch zurück und fragte noch einmal: «Es gibt ein Foto von mir im Badeanzug im Internet?»
Nino Gaines lachte. «Jetzt beruhig dich mal wieder – es ist ja nicht gerade der Playboy. Komm einfach morgen vorbei, und ich zeige es dir.»
«Das finde ich aber gar nicht lustig. Ich bin da draußen im Internet, und jeder kann mich anschauen.»
«Es ist das gleiche Foto wie das im Museum. Da macht es dir doch auch nichts aus, wenn die Leute es anschauen.»
«Aber das – das ist etwas anderes.» Noch während ich es sagte, wusste ich, dass diese Unterscheidung jeglicher Logik entbehrte. Doch das Museum unterstand einzig und allein mir, ich konnte bestimmen, wer hineindurfte und wer was zu sehen bekam. Der Gedanke hingegen, dass wildfremde Leute in der Lage waren, in mein Leben, in meine Geschichte einzudringen, so beiläufig, wie sie die Pferdesportseiten in der Zeitung durchblätterten, gefiel mir überhaupt nicht.
«Du solltest ein Foto von Liza und ihrem Boot ins Netz stellen. Vielleicht kriegst du dann ein paar mehr Besucher. Vergiss die Werbung für das Hotel durch die Mobys – ein gutaussehendes Mädchen wie sie könnte, denke ich, viel mehr erreichen.»
«Ach, du kennst doch Liza. Sie möchte selbst bestimmen, wen sie mit aufs Boot nimmt.»
«Geschäftstüchtig ist das nicht, klar, aber warum konzentriert ihr euch nicht auf euer eigenes Kapital? Unterkunft, Verpflegung und eine Fahrt auf der Ishmael mit Liza. Ihr beide würdet Anfragen aus der ganzen Welt bekommen.»
«Nein.» Ich begann, den Tisch abzuräumen. «Glaube ich nicht. Es ist sehr nett von dir, Nino, aber das ist wirklich nichts für uns.»
«Wer weiß. Vielleicht findet sie so sogar einen Mann. Zeit wäre es jedenfalls, dass sie sich mal umschaut.»
Es dauerte ein paar Minuten, bis er meinen Stimmungsumschwung endlich bemerkte. Das brachte ihn aus dem Konzept, und er versuchte herauszufinden, was er Falsches gesagt hatte. «Wollte dich wirklich nicht kränken, Kate.»
«Hast du auch nicht.»
«Na, irgendwas stimmt doch nicht. Du bist plötzlich so hibbelig.»
«Ich bin überhaupt nicht hibbelig.»
«Aber sicher. Man sieht es doch ganz deutlich.» Er zeigte auf meine Hand, die ruhelos auf dem gebleichten Holz Klavier spielte.
«Seit wann ist es ein Verbrechen, mit den Fingern zu klopfen?» Ich legte meine Hand fest in meinen Schoß.
«Was ist los, Kathleen?»
«Nino Gaines. Ich muss noch ein Zimmer vorbereiten. Wenn du mich jetzt also bitte entschuldigen möchtest, ich habe schon den halben Tag verplempert.»
«Ach, komm, Kate, du hast noch nicht mal dein Glas ausgetrunken. Was ist denn los? Ist es wegen meines Witzes über dein Foto im Internet?»
Niemand außer Nino Gaines nennt mich Kate. Aus irgendeinem Grund gab mir diese kleine Vertrautheit den Rest. «Ich habe wirklich noch eine Menge zu tun.»
«Ich schicke denen eine E-Mail, dass sie es rausnehmen sollen. Vielleicht können wir sagen, es geht ums Copyright.»
«Hörst du jetzt endlich mit dem Geplapper über dieses bescheuerte Foto auf? Ich gehe jetzt rein. Wir sehen uns.» Ich wischte mir ein paar nicht vorhandene Krümel von der Hose. «Danke fürs Mittagessen.»
Er schaute zu, wie ich – die Frau, die er seit über einem halben Jahrhundert liebte und die ihn ebenso lange immer wieder zurückwies – aufstand (weniger schwerfällig, als man es in meinem Alter erwartet hätte), mit zielstrebigen Schritten auf die Küche zumarschierte und ihn mit einem kaum berührten Glas seiner besten Auslese zurückließ. Auf dem Weg ins Haus spürte ich, wie sich sein Blick in meinen Rücken bohrte.
Vielleicht empfand er endlich einmal einen Hauch von Ärger über die Ungerechtigkeit und Willkür, mit der er, wie so viele Male zuvor, behandelt worden war, denn ich hörte, wie er aufstand. Wenigstens dieses eine Mal gelang es ihm nicht, sich zu beherrschen.
«Kathleen Whittier Mostyn – du bist die garstigste Person, der ich jemals begegnet bin», rief er mir hinterher.
«Es hat dich keiner gebeten, herzukommen», gab ich zurück. Und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir nicht einmal die Mühe machte, den Kopf zu drehen.
Vor langer Zeit, als meine Eltern starben und mich mit der Leitung des Silver Bay Hotels allein ließen, hatten mir viele Leute gesagt, ich solle die Gelegenheit für eine Modernisierung nutzen, die Zimmer endlich mit eigenen Badezimmern ausrüsten und Satellitenfernsehen einrichten, so wie man es auch in Port Stephens und in Byron Bay getan hatte, und ich solle auch mehr Werbung für die Schönheit unseres kleinen Küstenstreifens machen. Ihnen allen schenkte ich gerade mal zwei Minuten Gehör – unser Mangel an Kundschaft hatte schon lange aufgehört, mir Sorgen zu machen, und ich vermutete, den anderen in Silver Bay ging es nicht anders. Wir hatten erlebt, wie sich unsere Nachbarn an den Küstenstreifen nördlich und südlich von uns eine goldene Nase verdienten, nur um sich dann mit den unerwarteten Folgen des Erfolges herumschlagen zu müssen: dichter Verkehr, betrunkene Feriengäste, ein endloser Wettlauf um ständige Renovierungen und Neuinstallationen. Und der Verlust ihres Friedens.
Mir gefiel der Gedanke, dass wir in Silver Bay gerade noch das Gleichgewicht hielten – genügend Besucher, um ein Auskommen zu haben, aber nicht so viele, um überrannt zu werden. Seit Jahren beobachtete ich nun, wie sich während der Hochsaison im Sommer die Einwohnerzahl fast verdoppelte, um dann in den Wintermonaten wieder zu sinken. Ab und zu hatte das gestiegene Interesse an der Walbeobachtung zu einem außerplanmäßigen Aufschwung geführt, aber im Allgemeinen war es ein gleichmäßiges Geschäft, das uns weder reich machen noch allzu viel Aufsehen erregen würde. Letztlich blieben wir mit den Delphinen und den Walen unter uns. Und das war den meisten nur recht so.
In Silver Bay war man nie besonders gastfreundlich gewesen. Als im späten achtzehnten Jahrhundert die ersten Europäer hier eintrafen, hatte man den Ort mit seinen Felswänden, seinem Buschland und den Wanderdünen für unbewohnbar gehalten – zu schroff und unfruchtbar, um Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. (Aborigines wurden damals vermutlich erst gar nicht als Menschen betrachtet.) Auch die Untiefen und Sandbänke vor der Küste schreckten Interessenten eher ab, weil sie so manches Boot auf Grund schickten, bevor die ersten Leuchttürme errichtet wurden. Doch wie so oft erreichte die Geldgier das, was die Neugier nicht vermocht hatte: Schließlich sorgten die Entdeckung von üppigen Wäldern für die Holzgewinnung in unserem vulkanischen Hügelland und die großen Austernbänke in der Tiefe dafür, dass es mit der Einsamkeit der Bucht bald vorbei war.
Die Bäume wurden so lange abgeholzt, bis die Hügel fast kahl waren. Die Austern wurden abgeerntet, zuerst nur, um den Kalk zu nutzen, später auch für den Verzehr, bis der Raubbau schließlich verboten wurde. Um ehrlich zu sein, benahm sich auch mein Vater, als er damals hier ankam, keinen Deut besser als alle anderen: Das Meer war voll jagbarer Fische – Fächer- und Thunfisch, Haie und Speerfische –, und in allem, was die Natur bot, sah er den möglichen Profit. Ein nie abreißender Strom von Beutegut, direkt vor seiner Haustür. Und so kam es, dass auf diesem letzten felsigen Aufschluss von Silver Bay unser Hotel entstand, erbaut mit seinen und den letzten Ersparnissen von Mr. Newhaven.