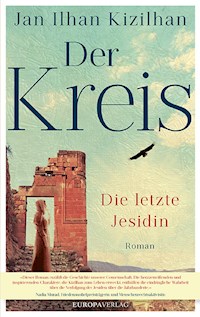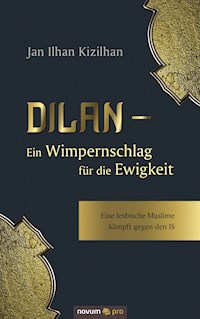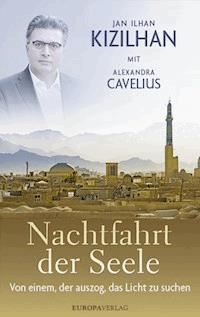
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Am Tage merkte ich oft nicht, wie sehr ich mich im Gestrüpp dunkler Gedanken verloren hatte. Nachts versank ich in so tiefen Schlaf, dass ich mich morgens an nichts mehr erinnern konnte." Jan Ilhan Kizilhan, Psychotherapeut und Trauma-Experte, gerät im Winter 2010 in eine tiefe Sinn- und Lebenskrise. Während er in seiner Klinik eine vergewaltigte Kurdin betreut, fragt er sich voller Zweifel, ob er in solch schweren Fällen tatsächlich auf Dauer etwas Positives bewirken kann. Auf der Suche nach Heilung für die versehrte Seele des Menschen merkt der zweifach promovierte Professor jedoch nicht, wie er sich selbst immer mehr verliert. Nach außen funktioniert der Therapeut und Familienvater, innerlich jedoch ist er ausgebrannt. Als er eine Einladung in den Iran erhält, um die dortige traditionelle Heilkunde kennenzulernen, nimmt er an. Eine alte Heilerin namens Anaram führt ihn zu alten Kult- und Tempelstätten und bringt ihm die Lehre Zarathustras näher. Während sich Kizilhan als rationaler Mensch anfangs distanziert verhält, gerät er zunehmend in den Bann ihrer orientalischen Erzählungen über die alte Heilkunst. Langsam öffnet er sich dieser Fremden und lernt, dass er als Therapeut anderen Menschen nur dann erfolgreich helfen kann, wenn er sich auf eine Reise zu sich selbst und seinen Vorfahren begibt. Auf dem Rückflug ahnt er noch nicht, dass er sich in naher Zeit der größten Herausforderung seines Lebens stellen wird, nämlich der Behandlung Tausender schwer traumatisierter Frauen des IS-Terrors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Ilhan KizilhanmitAlexandra Cavelius
Nachtfahrtder Seele
Von einem, der auszog, das Licht zu suchen
»Die Menschenseele ist eine Fee, sie verwandelt Stroh in Diamanten, und unter ihrem Zauberstab sprießen Wunderpaläste wie die Feldblumen unter der belebenden Wärme der Sonne empor.«
(HONORÉ DE BALZAC)
1. eBook-Ausgabe 2018
© 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München · Zürich · Wien Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von Fotos von © Getty Images/Jean-Philippe Tournut und © picture alliance/Frank May
Das Gedicht von Charlie Chaplin When I Loved Myself Enough wurde 2001 von Kim und Alison McMillen bei St. Martin‘s Press veröffentlicht. Das Gedicht über Isfahan entstammt dem Filmtext Schätze der Welt – Isfahan, IranSatz: Danai Afrati & Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-218-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
VERLETZTE SEELEN:
Die verschiedenen Farben unseres Selbst
AUFGEWACHSEN WIE VOR 500 JAHREN:
Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss
GEPLANTES ATTENTAT AUF DIE LIEBE:
Über die schönste und schrecklichste Zeit zugleich
SELTSAMER BESUCH:
Das orientalische Zauberhaus im deutschen Kaff
REISE MIT VIELEN UNBEKANNTEN GRÖSSEN:
Einen Blick in die Unendlichkeit wagen
AM ORT DER TIEFSTEN TRAUMATA ANGELANGT:
»Jetzt erst recht kämpfen!«
VERLETZTE SEELEN:
Die verschiedenen Farben unseres Selbst
Dohuk 2017: Welcome to hell
Schon wieder klingelt das Telefon. »Herr Professor, könnten Sie uns mit Zeugen der IS-Verbrechen zusammenbringen?« Darum bitten mich in den letzten Jahren immer häufiger die Journalisten in meiner Heimat im Schwarzwald. Sie wissen, dass ich als Traumatherapeut mit den Überlebenden arbeite und den Nordirak fast wie meine eigene Westentasche kenne. Kultur und Sprache sind mir vertraut, denn ich bin in diesem Land zwischen Euphrat und Tigris, das einst Mesopotamien genannt wurde, dem Land von Noah und Abraham, geboren.
Seit dem Einmarsch der IS-Terroristen im August 2014 ist der Nordirak größtenteils mit traumatisierten Menschen bevölkert, die nach der Diktatur Saddam Husseins aus ihrem gewohnten Leben ins tiefe Mittelalter hineinkatapultiert worden sind. Die Gräueltaten haben die Überlebenden zutiefst verstört zurückgelassen. Am härtesten hat es dabei die Minderheit der Jesiden getroffen, aber auch Christen, Mandäer, Kakai und zum Teil Schiiten in Mossul und Umgebung.
Einige Wochen später holpern ein Fernsehteam und ich in einem weißen Range Rover über staubige Straßen im Nordirak, vorbei an den von Handfeuerwaffen zerfressenen Lehmhäusern und ausgebrannten Fahrzeugen. Die Menschen am Straßenrand tragen abgerissene Kleidung, ihre Gesichter wirken leer wie die geplünderten Ruinen ihrer Häuser. Nahezu alles, was sich die Einwohner einst über Jahrzehnte aufgebaut hatten, liegt nach vier Jahren Schreckensherrschaft in Trümmern.
Stück für Stück hat das irakische Militär mit seinen Verbündeten das »Kalifat« zerschlagen, doch das Terrornetzwerk wird trotzdem nicht von unserer Landkarte verschwinden. Vermutlich taucht der IS schon bald mit einem anderen Gesicht an einem anderen Ort wieder auf. Überall, wo Chaos, Vakuum und Paralysierung regieren, findet diese »Herrschaft des Gesandten Gottes« neue Soldaten zum Rekrutieren. Solche, die nichts mehr zu verlieren haben. Für die der Tod erstrebenswerter ist als das Leben. Und deren Aufgabe darin besteht, Angst und Schrecken auch in Europa zu verbreiten.
Im Flüchtlingslager Khaparto angekommen, schiebt ein 9-jähriger jesidischer Junge auf meine Bitte hin sein Hemd hoch. Akrams magerer Bauch ist vernarbt und verbeult. IS-Soldaten hatten ihn beim Einmarsch ins Sindschar-Gebiet angeschossen, als er versucht hatte zu fliehen. Seinen Vater haben sie exekutiert, seine Mutter und seine Geschwister als Leibeigene missbraucht. Akram haben sie als Kindersoldaten einer Gehirnwäsche unterzogen.
Mit den wild zugewucherten Wunden am Bauch besuchte der damals 6-Jährige die Schule der radikalen Islamisten. Gemeinsam mit den anderen entführten Jungen lernte er, an Puppen zu üben, wie man Köpfe mit einem Messer abtrennt. Manche Kinder führten das Einstudierte später an den eigenen Eltern durch. Verschämt und mit fahrigen Gesten berichtet der Junge den Journalisten: »Zur Strafe haben sie mich über Nacht in ein Leichenhaus eingesperrt.« Kurz blickt er der Reporterin mit einer stummen Frage in die Augen: »Verstehen Sie?« Aber wer will solche Gefühle schon wirklich verstehen? Das hält keiner aus. Doch Akram musste es aushalten. Zitternd. Voller Todesangst. Zwischen blutigen Körpern am Boden. Zerfetzt vom Hass. Nur die eigenen Arme, um sich festzuhalten.
Als einer von wenigen hat der Halbwaise es geschafft, aus dem Grauen lebendig davonzukommen. Nur was fängt man als 9-jähriger mit so einem Leben an? Mit Bildern vom Wahnsinn im Kopf. Mit einem Bauch voller Schmerzen. Zwischen Armut und Verzweiflung. Ohne ausreichenden Schutz. Es ist nicht klar, was aus Akram wird, solange die Situation im Irak weiter unklar bleibt.
Nach dem Sieg über den IS bekriegen sich diejenigen, die zuvor noch Seite an Seite gekämpft haben. Erneut sind dabei die Kurden ins Feuer geraten, die gegen die Terroristen an vorderster Front gestanden sind. Sie verstehen sich als westlich orientierte Ordnungsmacht. An das Syrien und den Irak von morgen haben jedoch in all diesen Jahren keine Partei und keine Weltmacht gedacht. Weiterhin beherrschen den Irak eine tiefe Zerrissenheit und allseitiges Misstrauen. Der Staat, in dem die Kurden verdientermaßen ein Recht auf Selbstbestimmung verlangen, existiert de facto seit einigen Jahren nicht mehr.
Manchmal erlebe ich nach solchen Begegnungen mit den Opfern die Journalisten, die sonst so gerne viel fragen und so neugierig sind, als sprachlos. Ich erkläre ihnen dann, was bei einer sekundären Traumatisierung geschieht. Allein schlimme Ereignisse wie diese zu hören kann uns Menschen traumatisieren, obwohl wir sie nicht am eigenen Leibe erlebt haben. Dabei fällt mir die Geschichte des Fotojournalisten Kevin Charters ein, der 1993 für eines seiner Bilder den Pulitzer-Preis erhielt. Darauf sieht man ein hungerndes sudanesisches Mädchen, hinter dem einige Meter weiter ein Geier wartet. Zwei Monate später beging der Reporter Selbstmord. Seiner 7-jährigen Tochter hinterließ er folgenden Brief:
»Es tut mir sehr, sehr leid … Der Schmerz des Lebens übersteigt die Freude in einem Maße, dass keine Freude mehr existiert … [Bin] deprimiert … Mir gehen die lebhaften Erinnerungen nach, an Morde und Leichen und Wut und Schmerz … an verhungernde und verwundete Kinder, an schießwütige Irre – oft Polizisten –, an Exekutierer von Killern …«
Bevor die Sonne untergeht, holpern wir zurück im weißen Jeep. »Welcome to hell« hat irgendjemand an einen Mauerrest geschmiert. Für einen Moment habe ich das Gefühl, all das schon Hunderte Male gesehen und gehört zu haben. War es in Syrien, Bosnien oder irgendwo in Afrika? Am Ende trägt doch jeder Krieg dasselbe Gesicht aus Verzweiflung, Sinn- und Trostlosigkeit. Im nächsten Moment tauchen wir zwischen den Glitzerfassaden verspiegelter Hochhäuser in die Straßenschluchten der Großstadt ein.
2014: Eine fast unmögliche Mission
Es war im August 2014, als in den klimatisierten Wohnzimmern der Welt die ersten Bilder langer Menschenströme auftauchten, die in der glühenden Hitze des kargen Sindschar-Gebirges vor ihren Verfolgern in den Nordirak geflohen sind. Über eine halbe Million Alte, Frauen und Kinder, von denen viele auf der Flucht verdursteten. In der Folge hörte man über Tausende Väter und Söhne, bei Massenexekutionen hingerichtet und von Baggern zugeschüttet. Über Mütter und Mädchen, vergewaltigt und versklavt. Über unsere Flachbildschirme flimmerten Nahaufnahmen von Gesichtern, in denen das blanke Entsetzen stand.
Schreckliche Nachrichten verbunden mit einem meist phlegmatischen Umgang sind wir alle gewöhnt, sediert von dem Ohnmachtsgefühl, daran ohnehin nichts ändern zu können. Normalerweise schaltet man den Fernseher aus, nimmt sich im Sommer ein kühles Bier und setzt sich in den Garten. Bei mir aber ist mit einem Knall die Schutzhaut zwischen der inneren und der äußeren Welt geplatzt. Zwei Welten, die ich kenne, haben sich schlagartig schmerzhaft überschnitten.
»Nein!«, rief ich laut aus, fast als könnte ich wie ein Regisseur von außen die Handlung anhalten, den Film zurückspulen und löschen. Mit einem Satz bin ich aufgesprungen und habe fast den Gartenstuhl umgeworfen. »Ich kann nicht tatenlos dabei zusehen«, sagte ich zu meiner Frau. Wollte ich Einfluss auf die Politik nehmen, reichte Reden allein nicht mehr aus. Ich musste etwas unternehmen.
Mit der Unterstützung einiger hochkarätiger Kräfte habe ich schließlich die medizinisch-therapeutische Leitung für eine fast unmöglich scheinende Mission übernommen. Die baden-württembergische Landesregierung schickte mich mit dem für das Staatsministerium zuständigen Leiter, Michael Blume, in den Nordirak. Unser verkürzt formulierter Auftrag lautete: »Wählen Sie in den Flüchtlingslagern die allerhärtesten Fälle aus.« 1000 schutzbedürftige jesidische Frauen und Kinder sollten im Rahmen dieses einzigartigen deutschen Projekts die Chance auf eine zwei Jahre lang andauernde Therapie in Baden-Württemberg bekommen. Der Koffer war schnell gepackt. Meine Frau und ich umarmten uns lange und ohne viele Worte.
Und schon saß ich im März 2015 im Flugzeug nach Erbil. Diese boomende Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan erinnerte mit ihrem Ölreichtum und ihren schillernden Wolkenkratzern eher an Dubai als an ein Krisengebiet. Mit dem Taxi passierte ich einige Checkpoints, rollte vorbei an eilig ausgehobenen tiefen Gräben für Panzersperren und fuhr durch eine tiefe Ebene ins grüne Hügelland hinein. Hier und da Erdölfördertürme. In der Ferne schneebedeckte Berge. Nachts war die 140 Kilometer lange Strecke gesperrt, da sie an mehreren Stellen dicht an der Frontlinie zum IS-Gebiet verlief.
»Kommen Sie näher, ich erkläre Ihnen die aktuelle Lage.« Ein Mitarbeiter vor Ort deutete von einem Hügel der etwa 400 000 Einwohner großen Stadt Dohuk aus mit dem Finger auf drei riesige Flüchtlingslager zu unseren Füßen. Eines überfüllt mit syrischen Flüchtlingen, eines mit Jesiden und eines gemischt mit allen möglichen Landsleuten, die vor dem IS-Vormarsch im Irak geflohen sind. »Und da hinten siehst du den Stausee von Mossul am Tigris«, wies er mich auf ein breites Gewässer hin. Der Grenzübertritt war lebensgefährlich. Beide Seiten schossen sofort. »Dohuk hat längst mehr Flüchtlinge als Einwohner«, schloss mein Begleiter.
Wo anfangen? Ein Zelt reihte sich ans nächste, man sah kein Ende. Abertausende Menschen unter diesen löchrigen weißen Stoffplanen waren schwer traumatisiert. Und wir sollten unter ihnen diejenigen ausfindig machen, die dem IS entflohen waren und ohne unsere Hilfe nicht mehr lange überlebten. Der Zeitdruck bis Ende des Jahres war groß, und die eigens auferlegten Aufnahmekriterien waren sehr streng, doch anders funktionierte dieses Vorhaben nicht. Trotzdem wünschte ich mir in den nächsten Wochen immer wieder heimlich, die Auflagen neu zu formulieren und bessere finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Nie zuvor hatte ich einen schwierigeren Auftrag als diesen. Wenn ich aber scheitern würde, dann scheiterte das ganze Projekt.
»Kein Problem für mich als Traumaexperten.« Ich hatte meinen Mund zuvor sehr voll genommen. Ich musste mich zusammenreißen, kühl und diszipliniert mithilfe einer Liste der registrierten 1403 Überlebenden meinen Fragen-Katalog abarbeiten. Insgesamt sind am Ende 1100 Frauen und Kinder im Rahmen dieses Sonderkontingents nach Deutschland gekommen, 1000 davon nach Baden-Württemberg, 70 nach Niedersachsen und 30 nach Schleswig-Holstein.
Nachdem eine jesidische Ärztin die Frauen und Kinder untersucht hatte, ging ich mit zwei deutschen Landesbeamten die einzelnen Schicksale durch, um erneut abzuwägen: »Mitnehmen oder nicht?« Ein ständiger Kampf. Wir waren keine Götter, nur Menschen, die helfen, aber nicht über Leben und Tod entscheiden wollten. Anschließend informierten zwei Beamte die ausgewählten Frauen über die Situation in Deutschland und klopften nochmals ab: »Seid ihr sicher, dass ihr dort leben möchtet?« Fern von den Familien und der ihnen vertrauten Kultur.
Ich hätte am liebsten alle mitgenommen. Doch es waren so viele. So schrecklich viele. Und jedes Mal, wenn sich die Tür in meinem Büro hinter einem Menschen schloss, war ich überzeugt: »Schlimmer geht es nicht.«
Doch es ging immer noch schlimmer.
Interviews mit 1403 Überlebenden des IS-Terrors
Im März 2015 saß ich in einem Büro der 4. Etage eines achtstöckigen Hochhauses, 74 Kilometer von Mossul entfernt, wo der Krieg gegen den IS-Terror wütete und Frauen und Mädchen in Käfigen, wie Ziegen, auf dem Markt verkauft wurden. In Dohuk dagegen gingen die Menschen weiter ihrer Arbeit nach wie in jeder anderen Stadt im Mittleren Osten. Der Ventilator summte, Tee dampfte in der Tasse, und der Kugelschreiber lag parat. Ich erwartete eine 16-jährige Jesidin, der die Flucht aus Mossul, der zweitgrößten Stadt Iraks, gelungen war.
Die Sekretärin klopfte und gab mir Bescheid: »Das Mädchen ist da …« Ich ging zur Tür, um sie dort in Empfang zu nehmen, und erblickte dabei im Warteraum noch weitere Frauen mit kleinen Kindern auf dem Schoß. Was hatten sie wohl durchgemacht? Für einen Moment kam mir wieder das Camp Khaparto in den Sinn, das ich am Vortag besucht hatte. Allein in diesem Lager, das kaum 30 Kilometer von Dohuk entfernt ist, versuchten mehr als 28 000 Menschen zu überleben. Teils besaßen sie nicht mal eine Plane, um sich gegen die Regengüsse zu schützen. Ein Genozid war im Gange, und wir saßen auf gut gepolsterten Drehstühlen in einem Wolkenkratzer, hochgezogen von türkischen Bauunternehmern mit dicken goldenen Uhren am Handgelenk.
Das junge Mädchen rückte ihr Kopftuch zurecht; angespannt blickte sie um sich, als könnte jederzeit ein Ungeheuer hinter meinem Schreibtisch hervorspringen. »… Ich bin Dr. Ilhan aus Deutschland«, stellte ich mich vor, gab ihr die Hand und bat sie, Platz zu nehmen. Mit überrascht geweiteten Augen schaute sie mich an, weil ich ihren kurdischen Dialekt beherrschte. Doch es dauerte noch ein bisschen, ehe sie den Mut fasste, mir ihre Geschichte zu umreißen.
Es war dunkel, als mich mein kurdischer Fahrer in einem schusssicheren Geländewagen ins Hotel brachte. Mein Drang zu reden war am Ende dieses Tages so groß, als liefe ich über wie ein zu voller Wasserkrug. »Stellen Sie sich mal vor, nur eine Stunde Autofahrt von uns entfernt werden Frauen, die vor ihren Peinigern fliehen wollten, mit dem Strick an die Stoßstange eines Jeeps gebunden und durch die Stadt geschleift …« Der Fahrer biss sich auf die Lippen und knurrte schließlich in seinen schwarzen Schnauzbart hinein: »Ich bete, dass unsere kurdischen Kämpfer diese Terroristen besiegen werden!«
Das Morden jener Dschihadisten hatte das Leben im Irak auf den Kopf gestellt, auch in Dohuk, das für seine Liberalität und Offenheit bekannt war. Normalerweise drängten nach der Sommerhitze des Tages Frauen, Kinder und Männer auf die Straßen und in die Restaurants. Doch in den Cafés waren nur vereinzelt Menschen zu sehen. Die Angst vor dem Grauen, das in unmittelbarer Nähe schien, hatte sich den Stadtbewohnern bis ins Mark gefressen.
Erschöpft streifte ich im Hotel die Schuhe ab und legte mich mit Jackett und Hose aufs Bett. Die vielen Leidensgeschichten, die ich heute gehört hatte, wie ein monotones Summen im Ohr. »Unter Drogen stehende IS-Kommandanten, die Jesidinnen zwangen, ihre in Honig eingetunkten Zehen abzulutschen … Achtjährige Mädchen, über Monate von mehreren IS-Kämpfern vergewaltigt … Teenager bewusstlos geprügelt und mit gebrochenen Knochen wie Abfall auf der Straße entsorgt …«
Im Auge der Katastrophe: Gepflegtes Diner im Kulturzentrum
»Warum sind Menschen zu anderen Menschen so grausam?« Immer wieder blendete sich diese Frage in mir ein und sollte mich von nun an begleiten. Schon wieder klingelte das Telefon. Ich war um 21.00 Uhr zum Abendessen eingeladen, aber ich hatte keine Lust dazu. Allerdings würden viele Politiker und ehemalige Minister anwesend sein. Ich musste dorthin, um Beziehungen zu pflegen und dafür zu sorgen, dass mein Team weiter ungehindert seiner Arbeit nachgehen konnte.
Das Kulturzentrum mit Restaurant an der Universität bot einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Während uns ein lauer Wind unter dem leuchtenden Sternenhimmel umschmeichelte und der Kellner Whisky reichte, plauderten wir über Wissenschaft und Literatur und andere schöne Dinge. »Wie absurd«, dachte ich. Es handelte sich um eine völlig andere Realität. Dieses Gespräch hätte ich genauso in Berlin, London oder Paris führen können.
Jedem der Anwesenden war bewusst, dass wir uns inmitten einer Katastrophe befanden. Jeder versuchte, damit irgendwie zurechtzukommen. Das war nachvollziehbar, aber trotzdem hätte ich lieber darüber geredet, was mich eigentlich bewegte. Die anderen aber wollten essen, trinken und sich über deutsches Bier, Mercedes oder die Kleinstadt Schnackenburg in Niedersachsen austauschen, von der ich bis dahin nie etwas gehört hatte.
Auf der Rückfahrt ins Hotel dachte ich voller Sehnsucht an meine Familie. Die große Distanz ertrug ich mit dem Gedanken, dass sie zu Hause in Sicherheit waren. Gleichzeitig spürte ich eine Wut, die wie ein eingesperrtes Tier in mir immer stärker wütete. Die Menschen in diesem Land waren nichts als ein Spielball verschiedener Herrschaftsinteressen. Auf der einen Seite standen einige Regierungen im Mittleren Osten, die aus Machthunger den Terror unterstützten. Auf der anderen Seite trieb die Gier die Drahtzieher aus dem Westen an, sich mit Waffenlieferungen an genau diese Länder eine goldene Nase zu verdienen. Doch ich versuchte, mich nicht weiter mit diesen Gedanken zu beschäftigen, weil sie mich sonst lähmen würden.
Pendeln zwischen zwei Welten
Jeden Abend habe ich mit meiner Frau telefoniert. Die Gespräche waren kurz, wegen der großen Distanz und der hohen Telefonkosten. Jeden Abend fragte ich das Gleiche: »Wie geht es dir? Was machen die Kinder? Und was habt ihr heute unternommen? Seid ihr gesund? Gibt es irgendwelche Probleme?« »Natürlich« gab es nie Probleme, da meine Frau mich nicht zusätzlich belasten wollte. Erst später in Deutschland erfuhr ich, dass beispielsweise eines der Kinder krank oder tieftraurig gewesen war. Wir redeten am Telefon über Dohuk, das Wetter und die Leute, die ich besucht hatte. Über die grausamen Schicksale sprachen wir nicht. Ich wollte es auch nicht. Vielleicht wollte ich meine Frau schützen, obwohl sie natürlich wusste, was ich hier machte.
Als ich nach meinem ersten Aufenthalt im Nordirak in Wien landete, umhüllte mich wie ein warmer Mantel ein Gefühl von Sicherheit. Meine Muskeln lockerten sich, und ich merkte jetzt erst, wie verkrampft ich die ganze Zeit über gewesen war. In den Gesichtern um mich herum sah ich eine Leichtigkeit, die mir in Dohuk gefehlt hatte. Da erst spürte ich auch die Müdigkeit, die ich verdrängt hatte. Am liebsten hätte ich mich sofort auf eine der Bänke gelegt und wäre tief und fest eingeschlafen.
Die erste kleine Gruppe von 30 Frauen und Kindern, die wir nach Deutschland brachten, hat sich mir besonders eingeprägt. Einen Tag vor Abflug hatten wir sie in einem Hotel in Dohuk untergebracht. Sie waren alle furchtbar angespannt, kauten Fingernägel und rupften an ihren Haaren. Zum ersten Mal in ihrem Leben reisten sie ins Ausland. Viele ließen ihre Heimat, ihre Verwandten in IS-Gefangenschaft und ihre Toten zurück, ohne sie beerdigt zu haben. Um ihnen den Abschied etwas zu erleichtern, brachten wir Frauen und Kinder in Kleinbussen am Nachmittag zum jesidischen Heiligtum in den Tempel nach Lalish.
Das geistige Oberhaupt, der Baba Sheikh, wartete bereits auf uns. Die Mädchen standen in einer Reihe, gingen zu dem weiß gekleideten Priester mit dem langen weißen Bart und küssten ihm die Hand; er küsste sie auf die Stirn. Der alte Mann mit dem so gütigen Gesicht wirkte wissend und mit allen Sorgen vertraut wie einer, der ihre Verletzungen selbst erfahren hatte. »Ich bin stolz auf euch, dass ihr zurückgekehrt seid aus der Gefangenschaft!«, sprach er zu allen, »ich segne euch im Namen der heiligen Sheikhs und von Taus-i Melek. Ihr habt das Beste getan, was möglich war. Ihr seid zurückgekommen anstatt wegzulaufen. Ihr seid Jesiden und lasst euch nichts anderes einreden! Geht nach Deutschland und macht uns stolz …«
Die vergewaltigten Frauen, die große Angst gehabt hatten, aus ihrer patriarchalisch geprägten Gesellschaft als entehrt ausgestoßen zu werden, begannen erleichtert zu weinen; einige waren so stark ergriffen, dass sie in Ohnmacht fielen und wir sie kurz behandeln mussten. Diese Gruppe hat den Weg freigemacht für die anderen, die ihnen bis Januar 2016 nachfolgten.
Zu Hause angekommen, warteten meine Frau und meine Kinder auf mich. Meine jüngere Tochter wollte meine Hand nicht loslassen und schaute mich immer an. Ich war berührt und empfand zugleich Schuldgefühle. Wenn ich meine Jüngste heute zur Schule fahre, fragt sie immer, bevor sie sich verabschiedet, um wie viel Uhr ich abends zu Hause sein werde. Sie braucht diese Sicherheit, dass ich wieder heimkomme. Es ist ein hoher Preis, den meine Familie für meine Arbeit zahlen muss, und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann wiedergutmachen kann.
Ein Universum von Geschichten
»Wie halten Sie diese Grausamkeit und das Elend der Menschen aus?«, fragen mich die Leute häufig. Wie alle anderen habe auch ich gelernt, erfolgreich zu verdrängen. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, weil ich zu beschäftigt bin, den Menschen zu helfen. Manchmal verwundert mich die Frage nach meinem Befinden, denn diese Arbeit ist für mich mittlerweile fast selbstverständlich geworden. Wie also bin ich der geworden, der ich heute bin? Ein 51 Jahre alter Traumatherapeut, der voller Zuversicht, Tatendrang und Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht? Für einige ein wandelnder Widerspruch in sich.
Doch es ist gar nicht so schwer, das zu verstehen. Es ist sicher nicht so, dass ich ein in mir ruhender Yogi wäre. Manchmal fahre ich schon aus der Haut, wenn mir jemand vor der Nase den Parkplatz wegschnappt. Mich über Dummheiten aufzuregen, habe ich also noch nicht verlernt. Aber ich habe etwas anders verstanden: Wie man zuhört und dabei gewinnt.
Lauschen wir aufmerksam den Geschichten anderer, gelingt es uns, Verbindungen zu uns selbst zu finden; die jeder braucht, um sich selbst besser zu begreifen. Auf diese Weise sind wir in der Lage zu verstehen, warum wir zu dem wurden, was wir heute sind, und wie wir zu den Menschen werden, die wir sein wollen. Und wer wir sein wollen, das dürfen wir in einer demokratischen Welt mit humanistischen Werten selbst bestimmen. Schon deshalb lohnt es sich, gebrochenen Seelen dabei zu helfen, ihre Freiheit zurückzuerobern, ihnen bestenfalls wieder Flügel zu verleihen und autoritären Gewaltherrschern dadurch ihre Fesseln zu nehmen. Denn es sind die freiheitsliebenden Kräfte, die irgendwann ein Land wieder in eine offenere Richtung führen werden.
Ganz gleich, aus welcher Kultur, Religion, Ethnie wir stammen, welchen Geschlechts wir sind oder welche Vorlieben wir haben: Wir alle bringen Geschichten mit in die Welt, schöne und weniger schöne. In einem offenen Gespräch, in dem nur ein wenig Neugier und Verständnis vorherrschen, entstehen zwischen zwei oder drei Personen oder sogar ganzen Gruppen weitere Geschichten, die sich wie ein Ast verzweigen in viele kleine Teilgeschichten. Durch einen einzigen Kontakt und jede einzelne Information, von Mensch zu Mensch weitergegeben, entsteht am Ende ein Universum von Geschichten. Und jeder Stern darin ist ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte und seiner ureigenen Identität. Unverwechselbar und einzigartig.
Heilen ist möglich durch Erzählen und Zuhören. Allein durch unsere Vorstellungskraft sind wir Menschen in der Lage, schlimme Erfahrungen zum Besseren hin umzuwandeln. Unser Geist ist wie ein Blatt auf den Wellen eines Sees, in ständiger Bewegung, und in jedem Bruchteil einer Sekunde fließt in uns eine neue Geschichte über unser Leben zusammen.
Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an
»Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an«, formulierte einst der römische Kaiser Marc Aurel. Das gilt selbstverständlich nicht nur für unser Unglück, sondern genauso für unser Glück und unsere Zufriedenheit. Unsere Erwartungshaltung beeinflusst unsere psychische Verfassung. Wer sich auf Dauer ein krankes Herz einredet, erleidet früher einen Infarkt. Wer sich dagegen für stark hält, bleibt das auch länger.
Doch um Leiden zu mildern, nutzt es natürlich nicht, einem Depressiven anzuraten: »Denk mal positiv!« Damit sich unsere Wahrnehmung verändert, sind konkrete Maßnahmen notwendig. Mir ist es dadurch gelungen, die Welt mit einer positiven Haltung zu betrachten und zu erkennen, dass unmöglich Scheinendes oft möglich ist. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie sich todunglückliche Menschen verändern, weiterentwickeln und zu ihrem Lachen zurückfinden.
Über die Jahre habe ich viele Traumatisierte kennengelernt, die zwar dem Bösen direkt in seine hässlichste Fratze geblickt hatten, aber dennoch ihr Vertrauen in das Gute nicht verloren und es geschafft haben, das Leben wieder lebenswert zu finden. Für jeden Schritt zurück gibt es auch einen Schritt nach vorne. Wer solche Kraft im Menschen entdeckt, wächst selbst daran. So betrachtet zieht jedes Leid auch einen Lohn nach sich.
Doch selbst als Psychologieprofessor mit zwei Doktortiteln in Psychologie und Orientalistik, der seit über 20 Jahren die menschliche Seele erforscht, bundesweit Konzepte für transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie entwickelt und verschiedene Institutionen in Fragen von Migration, Flucht, Deradikalisierung von Terroristen und über den Nahen Osten berät, habe ich erst lernen müssen, nicht nur Leid zu ertragen, sondern auch Kraft aus dem Leid zu ziehen. Jeder kann es schaffen, sich aus dem Dunkeln ans Licht zu arbeiten.
Wenn wir lernen, wieder positive Erfahrungen zu sammeln, die in uns das Vertrauen und die Hoffnung wecken und bestärken, dass der Mensch auch viele gute Eigenschaften besitzt, dann verschwimmen die Bilder der traumatischen Vergangenheit wie unter Wasser. Wir tauchen immer tiefer bis hinab zum Meeresboden und entdecken neue Schönheiten. Aus all diesen Gründen möchte ich meine Geschichte in der Geschichte erzählen.
Ich habe gelernt zu handeln, wenn es unerträglich wird. Das war ein langer, manchmal holpriger und anstrengender Weg. Noch vor acht Jahren wären mir all diese Erfolge unvorstellbar erschienen. Damals habe ich mich auf die Suche begeben …
2010 Ausgebrannt: Im Gestrüpp dunkler Gedanken hängen bleiben
Im Jahr 2010 war ich ausgebrannt, ohne es richtig zu merken. Ich habe mich hinter meinen Büchern, gerichtlichen Gutachten und Fachartikeln vergraben und mit meinen Zweifeln über die menschliche Seele gehadert. Wie sollte ich anderen helfen, wenn ich mir selbst nicht helfen konnte? Wie die Seele ergründen, wenn ich nicht in der Lage war, unzählige Fragen darüber zu beantworten? Wie begreifen, »was die Welt im Innersten zusammenhält«, wie Goethe im Faust schrieb, wenn ich nicht wusste, wie ich zu diesem Ort vordringen sollte, an dem unsere schwärzesten Geheimnisse genauso wie unsere leuchtendsten Schätze lagerten? Am Ende bin ich über die Grenzen meines eigenen Horizontes gestolpert und dort hängen geblieben wie an Stacheldraht.
Dabei hatte ich offenbar alles, was man im Leben braucht. Eine wunderbare Frau und vier Kinder, die ich über alles liebe. Die Arbeit mit meinen Studenten an der Hochschule, die mich fordert und mir Freude bereitet. Dazu Gesundheit, ein gutes Auskommen und Sicherheit … Was will man mehr vom Leben? Und dennoch steckte ich fest.
Am Tage merkte ich oft nicht, wie sehr ich mich im Gestrüpp dunkler Gedanken verloren hatte. Und nachts versank ich so tief im Schlaf, dass ich mich morgens an nichts mehr erinnern konnte. Nicht zu Unrecht beklagte meine Familie immer wieder, dass ich viel zu viel arbeitete, aber die Arbeit war nun mal Teil meines Lebens. »Keine Strafe, sondern sinnerfülltes Tun«, wie der Kirchenreformer Martin Luther es einmal ausgedrückt hatte.
Überall auf der Welt war ich als Experte eingeladen, um Vorträge über »Traumata« zu halten. Ich war an ehemaligen Kriegsschauplätzen im Irak, in Syrien oder im Iran unterwegs, hatte Menschen aus Afghanistan, Ruanda, Bosnien, Tschetschenien oder der Türkei behandelt und über viele Jahre hinweg Wissen über den Umgang mit seelischen Verletzungen gesammelt, aber im Winter 2010 empfand ich immer mehr das Gefühl, immer weniger zu verstehen. Ich spürte, wie sehr ich an mir selber zweifelte und langsam ins Grübeln versank. Meine Augen hatten sich mit der Zeit so sehr an dieses Dämmerlicht gewöhnt, bis ich glaubte, es sei normal, in der Dunkelheit zu wohnen.
Mein Kopf war voller Bilder, doch ich wagte nicht, sie anzusehen. Darin taumelte ich wie ein Überlebender im Krieg durch eine Ruinenstadt. Zwischen den Trümmern streckte eine 16-Jährige ohne Augen, das Fleisch ihrer Gesichtshaut zu einem Klumpen verschmolzen, die Hand wie eine Bettlerin nach mir aus. Ich wollte sie greifen, fasste aber durch sie hindurch. Erst vier Jahre später würde ich diesem jesidischen Mädchen tatsächlich begegnen, halbtot, in einem der zahlreichen Zelte eines Flüchtlingslagers im Nordirak.
Verstört eilte ich weiter, denn am Ende der Straße schrie ein 5-jähriger Junge: »Nicht weggehen! Bitte nicht!« Das war ja ich! Nur war das 1971 und lag Jahrzehnte zurück. Vater schleppte den Koffer, immer wieder drehte sich Mutter mit schmerzvollen Blicken nach mir um. Außer mir vor Entsetzen und Wut weinte und beschimpfte ich meine Eltern: »Warum lasst ihr mich alleine?! Nehmt mich mit nach Deutschland!« Beim weiteren Wandern durch diesen Albtraum entdeckte ich durch eine zerbrochene Fensterscheibe meine Frau, gebeugt sitzend auf einem Untersuchungstisch, das kastanienbraune Haar verdeckte ihr Gesicht. »Was machst du denn da?!«, rief ich ihr zu. Doch sie hörte mich nicht. Sie schlug die Hände vors Gesicht und weinte.
Wie aber ist es möglich, im Geiste Kind und Erwachsener zugleich zu sein? Wie kann ich dort in der Gegenwart, in der Zukunft und gleichzeitig in der Vergangenheit leben? Ich scheine unter Gespenstern zu wandeln und selber eines von ihnen zu sein. Was sind das für Ängste, die uns Menschen da aufwühlen, umhertreiben und wegscheuchen? Was wollen all diese Gefühle und Bilder von uns?
Ich spürte, dass auf meiner eigenen Seele etwas Drückendes lastete, ahnte, dass ich etwas unternehmen musste. Ich wusste nur nicht was. Als mich in dieser Zeit im Schwarzwald überraschend einige Heilkundige aus Persien aufsuchten, habe ich ohne lange nachzudenken deren Einladung in ihre Heimat angenommen.
Ihr Versprechen klang genauso großmäulig wie verlockend: »Ihnen werden die Augen aufgehen, Doktor Kizilhan! Sie werden erstaunliche Neuigkeiten über unsere uralte orientalische Heilkunst und die versehrte menschliche Seele erfahren, von denen sie nicht die geringste Vorstellung haben.« Das Land Zarathustras, wo das Licht als das Gute und das Reinigende verehrt wird. Eine der wenigen Gegenden auf der Welt, deren Kultur alle großen religiösen Traditionen geprägt hat. Diese Religionen, wie Islam, Christentum und Judentum, hatten in den letzten zweitausend Jahren die Menschheit tief beeinflusst, selbst die Ungläubigen unter uns wie mich. Vielleicht würden mir Kultur, Geschichte und Heilkunst dieses Landes dabei helfen, mich selber wiederzufinden.
Mit der Reise wollte ich die lästigen Bilder in meinem Kopf abschütteln, aber sie sind mir etwa 4000 Kilometer bis in eine der ältesten Hochkulturen der Welt gefolgt. Ohnehin würde alles anders laufen als geplant. Ich bin durch und durch ein rationaler Mensch und glaube an die Gesetze der Wissenschaft. Mit Esoterik hatte ich noch nie etwas am Hut. Nach der Ankunft hatte ich allerdings zunächst den Eindruck, in einem schlechten Mystery-Film gelandet zu sein. Mein Streifzug nach Persien stand unter einem denkbar ungünstigen Stern.
Er begann mit einem Gefühl der Todesangst.
Alleingelassen in Teheran
In der stickigen und nach Teer riechenden Luft reckte ich am Teheraner Flughafen den Hals und hielt Ausschau nach den Leuten, die mich abholen sollten. Verärgert schnaubte ich aus. Erst hatte mich mein Begleiter kurzfristig am Check-in in Frankfurt sitzen gelassen, und nun wartete ich erneut auf jemanden, der nicht kam. Das hatte ich nun davon. Allein gelassen in einem fremden Land, in dem man öffentlich Ehebrecherinnen steinigte oder politische Dissidenten an Autokränen aufknüpfte.
Verzweifelt blickte ich mich um. Hier und da huschten tief verschleierte Frauen wie schwarze Vögel vorbei. Rein äußerlich fiel ich unter den Wartenden vor allen durch meine modernere Kleidung auf: Jeans, Jackett und Hemd. Im Kopf hatte ich bereits einige Horrorszenarien durchgespielt. Möglicherweise war ich ins Visier des iranischen Geheimdienstes geraten? Ein deutscher Wissenschaftler mit kurdischen Wurzeln, der sich mit einer im Iran verfolgten religiösen Minderheit, den Bahai, eingelassen hatte und naiv deren Einladung hierher gefolgt war. Leute, von denen ich nicht mal viel wusste. Nur so viel, dass sie offenbar nicht besonders zuverlässig waren. Iranische Heilkundige, die mir von Anfang an suspekt gewesen waren. Statt jedoch den Warnungen meiner inneren Stimme zu vertrauen, war ich meiner Neugierde gefolgt.
Es war schon spät am Abend, und die einzige Telefonnummer meiner persischen Gastgeber aus Deutschland schien mir auf einmal völlig sinnlos. Der nächste Schweißtropfen löste sich von meiner Stirn. »Es kann doch nicht sein, dass man mich erst mit hohem Überredungsaufwand hierher lockt und dann einfach stehen lässt?« Doch unbarmherzig drehte der Zeiger der Uhr in der Ankunftshalle eine Runde nach der anderen. Langsam leerte sich die Wartehalle. Zwei lange Kerle mit schwarzen Bärten, die mir vorher schon aufgefallen waren, blieben in meiner Nähe stehen. Sie waren etwa gleichaltrig, trugen abgetragene blaugrün karierte Hosen und Jacketts wie aus den 1980er-Jahren. Einer von ihnen hielt ein Schild nach oben, darauf stand der Name »Moses«.
Verwundert rieb ich mir das Kinn. Ein »Moses« im Land der Ayatollahs? Zwar wusste ich Bescheid über eine kleine, ständig schrumpfende armenisch-christliche Gemeinde, deren Mitglieder seit Jahrhunderten vor allem in Isfahan lebten. Die Perser hatten sie im 15. Jahrhundert zur Aufbauhilfe als Handwerker und Architekten ins Land geholt. Trotzdem erschien mir dieser biblische Name in so einem streng islamischen Land paradox.
Mit jeder weiteren Stunde, die verstrich, hingen die Mundwinkel jener Männer mit dem »Moses«-Schild tiefer, und meine Stimmung schwankte immer stärker wie eine Rettungsinsel auf hoher See zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Irgendjemand musste mich doch hier herausholen, oder? Schließlich waren nur noch die beiden Lulatsche und ich in der großen Halle übrig. Sie blickten mich fragend an, und ich blickte fragend zurück. Mit meiner bronzefarbenen Haut, den schwarzen Haaren und dunklen Augen sah ich sicher nicht so aus, wie sie sich ihren »Moses« vorstellten. Trotzdem holte ich tief Luft und ging auf sie zu.
»Moses aus Deutschland?«, wollten die Männer mit den langen Schnurrbärten sogleich von mir wissen. Ihre Hände waren rau und kräftig wie die von Landarbeitern. Ich hätte so gerne mit einem »Ja« geantwortet, musste sie aber mit einem »Nein« enttäuschen. Verdrossen wendeten sie sich wieder ab. Doch auf keinen Fall wollte ich noch länger allein hier herumstehen. Mit Mühe gelang es mir, diesen Typen aus der Nase zu ziehen, dass sie nach Schahr-e Kord fahren würden. Dort wollte ich auch hin an die Universität.
»Bitte, könnt ihr mich mitnehmen?«, bedrängte ich die beiden. Doch sie wollten keinen Ärger wegen eines Fremden aus dem Westen. Meine Gehirnzellen stöberten verzweifelt nach einer Lösung. »Wenn uns unterwegs die Polizei aufhält, gebe ich mich einfach als euer Moses aus«, schlug ich ihnen vor. Sie steckten ihre Köpfe zusammen, tuschelten in ihrem schwer verständlichen Dialekt und warfen mir dabei seltsame Blicke zu. Dann winkten sie mich wortlos hinter sich her.
In der Dunkelheit folgte ich ihnen zu einem alten weißen Toyota. Meinen Koffer legten sie hinten in den Kofferraum. Beide überragten mich fast um einen Kopf und waren gebaut wie die kastenförmigen Spintkästen in der Hochschule zu Hause. Mit einem mulmigen Gefühl stieg ich hinten ein. Rasch drückte der Fahrer meine Tür zu, nicht ohne sich dabei nochmals nach allen Seiten umzuschauen. Der Motor sprang an. Und plötzlich stieg die Panik wie Fieber in mir hoch. Vielleicht waren das Kriminelle? Hatten sie mich vorhin nicht so seltsam angeschaut, ja, wie ein Stück Beute? Wahrscheinlich wollten sie an einen stillen Ort fahren und mich unterwegs ausrauben. Ich saß in der Falle.
Wie hatte ausgerechnet mir so etwas passieren können? Einem Menschen, der sonst so rational war, sorgfältig plante und alles abwog. Einem Menschen, der anscheinend neben sich stand, ohne es bemerkt zu haben. In den letzten Jahren hatte ich so viele Traumatisierte behandelt, dass ich ihre Zahl nicht mehr nennen konnte. Nach außen hin hatte ich gut funktioniert. Und jetzt klopfte mir auf der Rückbank das Herz bis zum Halse.
Die Straßen wurden holpriger, die Männer immer schweigsamer. Bei jedem Schlagloch stieß ich mit dem Kopf an die Decke. Mein Handy meldete ein Funkloch, ein ewiges Funkloch. Ich war abgeschnitten von der Welt. Mit zwei Fremden im Auto, die in jedem schlechten Krimi die Mörder hätten spielen können. Wie gerne wäre ich jetzt mit meiner Frau im Schwarzwald auf dem Sofa gesessen und hätte Fernsehen geschaut. Notfalls sogar einen deutschen Tatort, von denen ich bisher keinen bis zu Ende gesehen hatte. Ob ich jemals in Schahr-e Kord ankomme? Außer den Geiern wird mich in dieser Wüste hinter all den Gesteinsbrocken so schnell keiner finden, war ich mir sicher. Ein hastiger Blick auf die Uhr. Wenn alles gut ging, stand mir eine etwa sechsstündige Fahrt durch die Nacht bevor. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich mich unterwegs gefragt habe: »Wieso hast du dich treiben lassen wie ein kleiner Junge, den das Abenteuer lockte?« Angestrengt blickte ich auf die Hinterköpfe der Fremden. Ihre Haare so schwarz wie die Nacht da draußen, die Lippen zusammengepresst wie zwei Lineale. Und plötzlich sah ich wieder die Syrerin vor mir am Boden, ihre schwarzen Haare wie wildes Gestrüpp ums wachsbleiche Gesicht. Ihr Mund weit aufgerissen.
Und dann hörte ich wieder diesen Schrei.
Der Schrei
Einen markerschütternden Schrei. Wie Wassermassen brachen die Schallwellen in mein Büro herein, drangen in die für Gefahren und Angst besetzten Nischen meines Gehirns vor und versetzten mich in einen Alarmzustand. Die Finger über der Computertastatur verharrten in ihrer Bewegung. Angespannt horchte ich auf. Was war das? Ein raues Krächzen, das sich in Jammerlaute zersplitterte, um sich zu sammeln und erneut als Aufschrei aufzubäumen.
Im nächsten Moment klopfte es heftig, und die Tür sprang auf; eine Schwester mit roten Flecken auf den Wangen stürzte ins Zimmer und stammelte: »Kommen Sie schnell!« Ihr hinterhereilend, sah ich am Ende des Ganges eine junge Frau, vermutlich aus dem arabischen Raum stammend, die sich am Boden krümmte. Im ersten Moment erkannte ich nur ihre zierliche Gestalt, eine helle Bluse, den dunklen langen Rock bis zu den Knien hochgeschoben. Ein Arzt und eine Schwester standen bereits neben ihr und wirkten beinahe noch hilfloser als die Kollabierende selbst. Kaum etwas ist unerträglicher, als Zeuge solch irrsinniger Schmerzen zu sein. Zwar war dem medizinischen Personal klar, dass sie diesen Anfall überleben würde, aber die Frau am Boden selber wusste das nicht.
Sie krampfte, zitterte, schlug mit dem Kopf hin und her und rief immer wieder: »Hört auf! Hört auf! Ihr Tiere!« Die unsichtbaren Peiniger, mit denen sie am Boden rang, waren für sie real. Wahrscheinlich roch sie gerade ihren Atem, spürte ihre Tritte oder hörte ihre Stimmen. Denselben Kampf hatte sie in der Wirklichkeit schon einmal ausgefochten. Bloß an einem anderen Ort und zu anderer Zeit, mit Menschen aus Fleisch und Blut. Genau wie damals jagte ihr Herzschlag im selben Tempo, ihre Panik zerriss sie fast, ihr Bewusstsein schwand im Zittern ihres Körpers. Und wieder schrie die junge Frau so laut ihre Verzweiflung heraus, dass ein Echo zwischen den Klinikmauern nachhallte, ehe es verklang und den Flur für Momente still wie einen Friedhof zurückließ.
Entschlossen beugte ich mich über ihren Körper und sprach mit lauter Stimme, in der Hoffnung, zu ihr durchzudringen. »Sie sind in Sicherheit!« Ihre Augen zugekniffen. Der Mund weit geöffnet. »Sie müssen keine Angst mehr haben!« Ich wiederholte es immer wieder. Sie schlug um sich, warf den Kopf hin und her, knallte mehrmals damit auf dem harten Boden auf. Reflexartig zog ich meine Jacke aus, stopfte sie unter ihren blutig-feuchten Schopf und hielt ihre Handgelenke fest, damit sie sich nicht noch mehr Schaden zufügte.
Mit meinen 85 Kilogramm war ich fast doppelt so schwer wie sie, doch beim Niederdrücken dieser dünnen Arme spürte ich eine unglaubliche Kraft. Sie wehrte sich. Nur gegen wen? Mühsam schnaufend, wendete ich mich nach dem Arzt und der Schwester um: »Bitte, holen Sie einen Rollstuhl«. Dabei rutschte meine schweißnasse Hand an ihrer Haut ab, und schon im nächsten Augenblick riss sie sich aus ihren gekräuselten schwarzen Haaren ein Büschel heraus. Ich zerrte ihre Finger zurück. »Hören Sie mich?…«
Erst nach etwa zehn Minuten ließ die Kraft der jungen Frau nach, meine eigene allerdings auch. Ihr Atem wurde ruhiger, nur manchmal noch überfuhr sie ein Schauder. Mit den Augen auf ihr Gesicht gerichtet, grübelte ich: »Welcher Schrecken besitzt solche Gewalt, dass er jederzeit nach einem Menschen greifen und ihn in die Hölle seiner Erinnerungen zurückschleudern kann?« Weiter hielt ich ihre Hände fest, redete beruhigend auf sie ein, ohne meine eigenen Worte zu hören, und beschäftigte mich mit den möglichen Gründen für diese Dissoziation. Dem plötzlichen Abtrennen wichtiger Nervenverbindungen im Gehirn, um schnellstmöglich nach Auswegen zu suchen.
In der völligen Konfusion stehen dem Menschen nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Flucht oder Gegenwehr. Da weder das eine noch das andere möglich war, sicherte die Seele das Überleben durch den völligen Rückzug nach innen. Zum zweiten Mal wiederholte die Schwester: »Professor, der Rollstuhl ist da.« Da dämmerte mir, dass ich die Arme der jungen Frau endlich loslassen musste, damit die Schwester sie zurück auf ihr Zimmer ins Bett bringen konnte. Ermattet ließ sich die junge Frau in den Rollstuhl hieven, öffnete die Augen und begann zu weinen, tief beschämt über ihr unkontrolliertes Verhalten. »Es tut mir so leid, es tut mir so schrecklich leid …« »Es ist doch nichts Schlimmes passiert«, besänftigte ich sie. Sie ließ den Kopf wieder sinken und verschwand mit der Schwester im Fahrstuhl.
Statt sofort in mein Büro zurückzukehren, entschied ich mich, auf dem Klinikgelände noch kurz frische Luft zu schnappen. Nebel stand vor meinem Mund, die Luft schmeckte nach Eis und Frost, aber der Schnee ließ noch auf sich warten. Die psychosomatische Klinik, in der ich seit 13 Jahren als Abteilungsleiter und Psychotherapeut beschäftigt war, wies eine Besonderheit auf.
In einer extra eingerichteten transkulturellen Abteilung kümmerte sich ein multikulturelles Team um schwersttraumatisierte Kriegsflüchtlinge und andere psychisch erkrankte Menschen aus vielen Ländern der Welt. Die Patienten verbrachten hier zwischen sechs und zwölf Wochen. Meine Mitarbeiter beherrschten nicht nur deren Muttersprache, sondern brachten auch den entsprechenden kulturellen Hintergrund mit, der ihnen den Zugang zu den Kranken erleichterte.
Ich selber komme aus einem Dorf in Kurdistan. Es liegt im Osten der Türkei, unweit der syrisch-irakischen Grenze.
AUFGEWACHSEN WIE VOR 500 JAHREN:
Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss
Aus der Vogelperspektive betrachtet ein tonfarbener Klecks auf einem grünen Hügel, eingebettet zwischen bunt-getupften Wildblumenwiesen, Linsen-, Weizen- und Melonenfeldern, zu dessen Füßen sich ein blaugrüner Fluss schlängelte. Mir erschien als Kind das Leben in meinem Heimatort Gelhok wie im Paradies, für die Erwachsenen dagegen war es ein Überlebenskampf wie in einem großen Gefängnis. Es schien so, als hielten sich Weite und Enge an diesem kleinen Fleck eng umschlungen.
Etwa 60 Familien lebten in Gelhok ausschließlich von Ackerbau und Viehzucht, nutzten ihre Körperkraft und die der Ochsen beim Ackern. Nicht anders als vor 500 Jahren in Deutschland. Es gab keine Elektrizität, geschweige denn gepflasterte Straßen oder Autos. Nur vereinzelt tuckerten Traktoren über die Felder.
Tagsüber rackerten sich die Männer auf den Feldern ab, abends saßen sie Raki trinkend im Dorf zusammen. Vater war ein typischer Patriarch wie alle Väter im Ort auch. Einer, der Befehle gab, für Ordnung sorgte und alles andere den Frauen überließ. Leider hatte ich nie so eine enge Beziehung zu ihm, wie ich sie mir gewünscht hätte. Er war etwas kleiner als meine schlanke, hoch-gewachsene Mutter. Mit seinem traurigen Gesichtsausdruck wirkte er immer wie von einer unsichtbaren Last niedergedrückt.
Mutter war das glatte Gegenteil. Ihre großen dunklen Augen sprühten nur so vor Lebensmut. Sie hatte als Einzige in ihrem Heimatdorf eine Schule besucht, konnte lesen und schreiben. Jung und Alt baten sie bei bürokratischen Angelegenheiten um Rat. Sie war eine starke Persönlichkeit und genoss großen Respekt im Dorf. Obwohl Frauen in dieser patriarchalischen Gesellschaft nicht viel zu melden hatten, ließ Mutter sich nichts gefallen. Sie machte keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.
Einmal war sie bei einer Hochzeitsfeier kurzerhand in die für Frauen verbotene Zone der Männer hinübergewechselt, um sich dort ins Gespräch einzumischen. »Dazu fällt mir auch etwas ein …« Anfangs stutzten die Männer und schauten stirnrunzelnd meinen Vater an. Wie konnte eine Frau es wagen, die übliche räumliche Geschlechtertrennung zu ignorieren? Etwas unbeholfen strich sich Vater über sein volles dunkles Haupt. Doch mit der Zeit gewöhnten sich die Kerle im Dorf an Mutters Gesellschaft und riefen sogar von selbst nach ihr. »Komm! Setz dich zu uns!«
Als kleiner Junge mit fünf Jahren war ich mächtig stolz auf sie. Und Vater war es auch. Besaß seine Frau doch obendrein zu ihrer Klugheit eine deutlich weißere Hautfarbe als andere, was gemeinhin als sehr erotisch galt. Nur selten trug sie ein leichtes Tuch über ihrem Haupt, das aber niemals ihre wunderschönen langen dunkelbraunen Haare überdeckte. Erst in Deutschland hat Mutter ihre langen Kleider gegen Hosen ausgetauscht.
In Gelhok kannte jeder jeden, auch die jeweiligen Macken, ob klein oder groß. Da gab es den »verrückten Shükrü«, der von Geburt an geistig behindert war, aber von allen geliebt und behütet wurde. »Eines Ta-Tages werde ich dei-deine Mutter hei-heiraten«, zog er mich gerne stotternd auf, während ich ratlos meine Mutter anblickte, die sich den Bauch vor Lachen hielt. Dann war da noch der Bürgermeister Osman, der lieber der Steintaubenjagd als seiner Amtstätigkeit am Schreibtisch nachging. Und nicht zu vergessen Ahmet der Heiler. Als einmal ein langer Nagel in meinem Knie steckte, zog er mir das rostige Teil heraus, mischte aus Eiern und Pflanzen eine Salbe und verband mir mein Knie. Bis heute erinnert mich eine Narbe so groß wie ein Auge an ihn.
Das Zusammenleben in der Abgeschiedenheit erforderte eine enge Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Es bedeutete aber auch, dass jeder Schritt von allen Augen scharf beobachtet wurde. Da blieb kein Mucks unbemerkt, kein Problem verborgen. Alle Familien zusammen jedoch einte die Sorge ums tägliche Überleben.
Erstochen mit der Heugabel
Im Sommer brannte die Sonne vom blitzblauen Himmel. Es waren Tage ohne Schatten, aber dennoch schien über jedem Haus eine schwarze Wolke das Leben zu verdunkeln wie ein sich zusammenbrauendes Unheil. Als bangten die Bewohner: »Werden wir morgen wieder gemeinsam aufwachen?« Das lag auch an Geschichten wie denen, die mein Großvater erlebt hatte:
Die Luft flirrte über den braunen Wiesen. Mein Großvater und mein Großonkel, beide damals noch junge Männer, wischten sich den Schweiß von der Stirn. »Mein Bruder, wir sollten eine Pause machen«, schnaufte Großvater um die Mittagszeit herum und legte seine Heugabel zur Seite, »ich hole uns etwas zu essen.« Mein Großonkel nickte und warf noch eine weitere Gabel Heu auf den riesigen Haufen, den sie bereits zum Trocknen aufgetürmt hatten. »Ich mache noch weiter, bis du wieder zurück bist.«
Auf dem Weg zum Dorf stapfte Großvater ein Mann vom Stamme der Reshkota entgegen. Dieser muslimische Kurde war in Gelhok gefürchtet, weil er keinen Hehl aus seiner Verachtung für uns Jesiden machte. Für ihn waren wir »Teufelsanbeter«, weil wir an »Taus-i Melek« als unseren Schutzengel glaubten. Im Koran dagegen erinnerte seine Geschichte an den Engel »Iblis«, der den Satan im arabischen Raum verkörperte.
Unserer Überlieferung nach hatte Gott einst Adam eine Seele eingehaucht und dann alle sieben Erzengel aufgefordert, vor seiner Schöpfung, dem Menschen, niederzuknien. Nur der Pfau-Engel Taus-i Melek hatte sich geweigert, den Befehl auszuführen. Daraufhin hatte Gott ihn zur Strafe 30 000 Jahre lang verbannt, bis der sühnende Engel mit seinen Tränen für die Jesiden die Feuerhölle auf immer erlöscht hatte. Ein wunderbarer Gedanke, dass sich ein Engel, als Mittler zwischen den Welten, so voller Liebe für sein Volk einsetzte, ihnen im Voraus alles verzieh und sie direkt in den Himmel einließ. Nach dem Tod sollten die Menschen dann auf der Seelenwanderung »ihr Kleid wechseln«.
Gott hatte Taus-i Melek vergeben und ihn, für die ihm gelobte Treue, zu guter Letzt zum obersten Engel ernannt. Kaum zu glauben, aber bis heute bestimmt diese märchenhafte Paradiesgeschichte von Adam und Eva und ihre unterschiedliche Auslegung in den Schriften von Christen, Juden und Muslimen unser Leben genauso wie unseren Tod.
Mein Verwandter grüßte den Vorbeieilenden mit ehrfürchtig gesenktem Haupt, auf keinen Fall wollte er Ärger mit einem Muslim riskieren. Wortlos stapfte der Mann an ihm vorbei. Knapp eine halbe Stunde später kehrte Großvater mit einem großen Korb voller Essen zurück zum Feld. Die Sonne blendete, daher beschirmte er mit einer Hand die Augen und suchte die Wiese zwischen den großen Heuhaufen ab. Wo war sein Bruder abgeblieben? »Sabri!«, rief er nach ihm. Mit einem Mal aber verloren seine Hände alle Kraft, der Korb fiel zu Boden, das Wasser versickerte im Staub.
Wie im Schwindel lief Großvater ein paar Schritte, taumelte und stürzte wenige Meter später vor seinem Bruder zu Boden. »Nein!«, schrie er, sprang wieder auf und zerrte an der Heugabel, die mit Wucht in dessen Brust gerammt war. Großvaters Atem erst keuchend, dann immer schwächer werdend, die Stimme so leise, dass nur er selber sie noch hören konnte. »Nein.« Doch es war zu spät. Sein Bruder war tot.
Was gibt es Schrecklicheres, als einen Menschen zu verlieren, den man liebt? Meine Großeltern haben sich von dieser seelischen Erschütterung nie wieder erholt. Der Mörder aber brüstete sich vor anderen Muslimen mit seiner Tat. »Ich werde ins Paradies kommen«, tönte er herum, »denn ich habe einen Ungläubigen getötet.« Da seine Familie sehr mächtig und einflussreich war, legte die Polizei den Fall bald zu den Akten. »Der Täter ist unbekannt«, hieß es offiziell. Dabei kannten alle seinen Namen und seine Anschrift. Doch jemand, der auf dem Papier nicht existierte, konnte niemand verklagen.
Protest gegen Ungerechtigkeit war lebensgefährlich. Jederzeit hätten Verwandte des Mörders ihn und seine Familienangehörigen angreifen oder umbringen können. Niemanden hätte das bekümmert. Vetternwirtschaft, Einschüchterung und Korruption gehörten in diesem Regime zum Alltag wie die Fliegen auf dem Mist. Mein Großvater verstummte.
Im Leben aller Menschen bildet Gerechtigkeit die Basis für ein erfolgreiches Zusammenleben. Dieser in uns so ausgeprägte Sinn hat sich im Laufe der Evolution herausgebildet und unterscheidet uns von den Tieren. Gerechtigkeit soll Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen schaffen. Sie gilt für alle, ganz gleich, ob arm oder reich, Frau oder Mann, gläubig oder ungläubig. Einigen aber scheint Gerechtigkeit nur wichtig, solange sie sich selbst nicht ungerecht behandelt fühlen.
Der Mörder hat auf jeden Fall noch ein langes, unversehrtes Leben geführt und ist vor etwa 20 Jahren an Altersschwäche verstorben. Jeder Jeside in Gelhok hatte ein ähnliches Drama in der eigenen Familie erlebt. Als mein Großonkel mit nur 24 Jahren sein Leben verloren hatte, war mein Vater erst ein Jahr alt, aber seine Eltern haben ihm diese Geschichte über den verlorenen Bruder später immer und immer wieder erzählt. Und Vater wiederum hat uns diese Geschichte immer und immer wieder erzählt, als wir erwachsen waren, unterbrochen von vielen tiefen Seufzern.
Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen
Gerechtigkeit gab es für meine Großeltern nicht. Dieser nagende Schmerz ist wie eine ansteckende Krankheit auf meinen Vater übergegangen. Zeitlebens hat er dieses Virus in sich getragen, und seine Wunde öffnete sich jedes Mal, sobald er dem Mörder, dessen Familienangehörigen oder auch nur einzelnen des mehr als zehntausend Mitglieder starken Großstammes auf der Straße begegnete. Dann wurden ihm die Brust eng und die Knie schwach.
Einst war sein eigener Vater selber Oberhaupt eines Großstammes gewesen, ein wohlhabender und einflussreicher Mann. Der alte Herr hatte über mehr als 40 Dörfer und Ländereien verfügt, so groß wie heute eine Kreisstadt. In den 1940er-Jahren jedoch hatte die Regierung seine Besitztümer und Ländereien beschlagnahmt. Obwohl Großvater alles verloren hatte, war er zeitlebens ein sehr stolzer und patriarchalischer Mann geblieben. Viermal hatte er geheiratet, viermal waren seine Frauen jung verstorben. Die fünfte Frau war meine Großmutter. Sie war die Einzige, die ihm ein Kind geschenkt hatte. Großvater hatte sie sehr geliebt.
Besonders verzweifelt war Vater über die Tatsache, dass die Mehrheit jener Mörder wie wir zu den Kurden gehörten. Wir alle hatten dieselben Wurzeln in unserer etwa 4000 Jahre alten jesidischen Naturreligion. Den Islam hatte es damals noch gar nicht gegeben. »Bevor sie im 8. Jahrhundert zu Muslimen wurden, waren sie wie wir Jesiden«, klärte Vater uns Kinder mit bitterer Miene auf, »wir haben danach so sehr unter ihrer neuen Religion gelitten.« Die Osmanen, selber lange Zeit »Ungläubige«, wechselten den Glauben, um ihre Macht über alle anderen Moslems zu sichern; sie ernannten sich selbst zu den Kalifen der islamischen Welt und hatten diese Machtstellung bis zum Ende des Ersten Weltkrieges inne.
Heute noch berichten die Menschen von einem Massaker an den Jesiden durch Mustafa Reshid Pasha und die kurdische Fürstenfamilie Bedirkhan aus Botan auf Befehl des Sultanats in Istanbul. Etwa 40 000 Jesiden sollen ermordet und Tausende von Kindern und Frauen auf den Märkten in Damaskus, Bagdad und Istanbul verkauft worden sein. Darunter auch meine Verwandten, Ur-Ur-Onkels, -Tanten oder -Cousinen. Zu Zeiten der Bedirkhans entstand die Aussage, dass der in den Himmel käme, der sieben Jesiden tötete. »Jener kurdische Fürst Bedirkhan Beg schlachtete zum Opferfest mit seinen eigenen Händen nicht nur Schafe, sondern auch Jesiden, die nicht Moslems werden wollten«, wusste Vater.
Doch erst später habe ich verstanden, dass eine Feindschaft zwischen ehemaligen »Brüdern« meist besonders brutal, emotional aufgeladen und mit unmenschlicher Kälte abläuft. Das belegte die Historie an Kämpfen zwischen Protestanten und Katholiken genauso wie zwischen Arabern und Juden oder Schiiten und Sunniten. »Wir gehören alle zusammen wie die Finger an unserer Hand«, sagte Vater oft verzweifelt und hob die Hand wie ein Beweisstück nach oben.
Auf wen aber war in dieser Welt noch Verlass, wenn einem sogar die Nächsten zum Feind werden? Und wie viel Ungerechtigkeit kann ein einzelner Mensch ertragen? Sicher mehr als er denkt und viel mehr als ihm lieb ist. Während der eine sich aber wieder erhebt und weiterkämpft, geht der andere daran zugrunde. Als Vater ein Jahr alt war, ist mein Großvater verbittert und verarmt verstorben. Seine junge Witwe blieb mit dem Kleinkind krank und so ausgezehrt zurück, als könne der nächste Wind sie fortwehen.
Der blinde Großvater
Großmutter war von kleiner und zierlicher Gestalt; in ihren Augen brach sich das Licht der Sonne wie in einem grasgrünen Kristall. Aber ihr neuer Mann konnte das nicht sehen. Er war blind. Um ihren Sohn und sich zu schützen, ging meine Großmutter die Ehe mit diesem zweiten Mann ein, den sonst keine andere im Dorf haben wollte. Seine blauen Augen waren stechend, nur an den Seiten wirkten sie leicht verschroben, als wären sie verbrannt.
Durch die Hochzeit blieben der Witwe und ihrem Kind nicht nur Hunger und Not erspart. Die anderen Männer hätten die junge Mutter womöglich belästigt. Eine Frau ohne einen Mann an ihrer Seite war leider nichts wert. Der Blinde aber erwies sich als ein fürsorglicher und liebevoller Partner, der seine Frau achtete und respektierte. Beide setzten noch einen Sohn in die Welt, der die grünen Augen meiner Großmutter geerbt hat. Es war mein Stiefonkel, dem damals noch nicht schwante, dass er eines Tages meinen zwei Geschwistern und mir den Vater ersetzen müsste.
Die Geschichte, wie meine Eltern zusammengefunden haben, war keine Romanze. Meinem blinden Großvater, einem schlauen Mann, war die Schönheit meiner Mutter zu Ohren gekommen. So marschierte er in ihr Dorf, sprach mit ihrem Vater, umgarnte ihn mit Geschichten, dass er Krüge von Gold verfolgter Armenier gefunden und versteckt habe. »Willst du nicht für deine Tochter einen wohlhabenden Mann haben?« Er erzählte zeitlebens Geschichten, bei denen wir nie sicher sein konnten, ob sie seiner Fantasie entsprungen waren oder doch einen Funken Wahrheit enthielten.
So heiratete meine damals 20-jährige Mutter einen vier Jahre älteren Fremden, dem sie nie zuvor begegnet war. Am 15. Oktober 1966 habe ich im zweistöckigen Lehmhäuschen meiner Großeltern das Licht der Welt erblickt. Meine Eltern gaben mir zwei Namen. Einen kurdischen, er lautet Jan und bedeutet übersetzt so viel wie »emotionaler Schmerz«, als ob man sich erst verliebt hat, dann trennen muss und etwas Kostbares verliert. Mein zweiter Name ist türkisch, mit »Ilhan« rufen mich die Meinen. Jan werde ich eher von deutschen Freunden genannt, da es einfacher auszusprechen ist. Insofern reagiere ich auf beide Namen. Vielleicht war mein kurdisch-türkischer Name ein Versuch meiner Eltern, beide Gruppen in meiner Person miteinander zu versöhnen.
Gemeinsam teilten wir anfangs zu siebt vier Zimmer mit dem Stiefbruder meines Vaters und meinen Großeltern, die einen Raum für sich alleine hatten. Aus dem angrenzenden Stall hörten wir es muhen, krähen, blöken oder bellen. Da mein eigener Vater zu beschäftigt mit der Feldarbeit und den Alltagssorgen war, kümmerte sich Großvater bald wie ein Ersatzvater um mich. Niemand hat gewagt, ihm zu widersprechen. In seiner Nähe fühlte ich mich sicher.
Mal abgesehen davon, dass dieser blinde Mann die Kräfte eines Bullen besaß und ein so guter Ringer war, dass niemand im Dorf ihn auf den Rücken legen konnte, war er ein hochtalentierter Erzähler. Im Nachhinein betrachtet, waren all seine Geschichten, die er mir im Garten unter dem Maulbeerbaum erzählt hatte, sehr wichtig für mich, weil ich mich in schwierigen Situationen damit trösten könnte.
Trotz seiner Blindheit besuchte Großvater selbstständig alle Dörfer in unserer Gegend und schaffte es, mittels seines hochentwickelten Gehör-und Geruchsinns zu meinem großen Staunen sogar Vögel mit Steinen zu erlegen. Größe und Beschaffenheit eines Raumes echolote er mit dem Schnalzen seiner Zunge aus. Eines Tages legte sich ein Dorfbewohner mitten vor ihm auf den Weg, um herauszufinden, ob er ihn bemerken würde. Zehn Meter davor blieb Großvater stehen und rief seinen Namen: »Ismail, steh auf! Ich weiß, dass du das bist!« Ismail war darüber so verwirrt und verärgert zugleich, dass er laut schrie: »Du bist niemals blind, du legst uns alle nur herein!« Wenn Großvater morgens aus seinen Träumen erwachte, war die Welt dunkel.
Durch ihn aber habe ich gelernt, dass Blindheit einen Menschen nicht blind machte.
Warum Angst vor Gott haben, wenn Gott gut ist?
Von unserer jesidischen Kultur und Geschichte hatte ich, genau wie alle anderen Dorfbewohner, keine Ahnung. Außer dass das Universum aus einer weißen Ur-Perle explodiert war und durch die Wucht des Ausbruchs Elemente wie Wasser, Luft und Feuer freisetzte, aus der auch unsere Erde entstanden war. Wir wussten, dass Respekt und Achtung vor der Natur so wichtig waren, dass wir nicht auf den Boden spucken durften und im April die Erde ruhen musste, weil sie schwanger war. Außerdem glaubten wir an unseren Engel Taus-i Melek, der auf Bildern wie ein Pfau dargestellt wird.
Wir besaßen keine Bücher und hätten diese als Analphabeten ohnehin nicht entziffern können. Die Priester in unserem Dorf waren schlicht zu faul, sich an die jesidischen Gelehrten in den anderen Orten zu wenden, um mehr über ihren Glauben zu erfahren und dieses Wissen an uns weiterzugeben, was eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre. Eine Geschichte jedoch begleitet mich bis heute. Ich betrachte sie als kulturelles Erbe, obwohl die Religion in meinem Dorf etwas anders gelebt wurde als sonst unter Jesiden. Abends saßen wir Dorfbewohner rund ums Feuer zusammen, während die Äste knackten und einer der Alten mit rauer Stimme ansetzte: »Einst wollte der uralte heilige Vater die Leere um sich beleben. Dabei ist unversehens das Licht entstanden.«
Fasziniert blickte ich den Funken hinterher, die wie kleine Glühwürmchen in den Himmel tanzten, bis sie weiter oben in der tintenschwarzen Nacht wieder erloschen. »Als aber das Licht ausstrahlte, sickerte auch die tiefste Dunkelheit in das Leben hinein. Licht und Schatten waren geschaffen. Somit hatte Gott, ohne es selbst vorher geahnt zu haben, eine Abfolge von Ereignissen ausgelöst, von denen jede einzelne zugleich Ursache der Folgenden ist. Glied um Glied verbinden sie unser aller Leben bis in unsere Zeit hinein.« Aufgestützt auf beide Ellbogen, rollte ich mit den Augen hinüber zu Vater, der ins Feuer starrte, wobei seine Gedanken sicher ganz woanders waren. Ob die Ernte diesmal besser ausfiel? Ob wir genug Vorräte für den Winter hatten? Ob statt Fleisch wieder Suppe auf dem Tisch dampfte?
Mahnend senkte der Erzähler seine Stimme, während sein Gesicht im Tanz der Flammen gespenstisch aufleuchtete. »Der Mensch aber ist weder gut noch böse, denn Licht und Schatten teilten sich in seinem Körper. In seinem Inneren treiben auch die lichtlosen Schattengeister ihr Unwesen. Sie sorgen mit ihrer Unzufriedenheit für Streit und plagen andere Mitmenschen.« Unbehaglich bohrte ich mit dem Finger in der Erde herum. Zum Glück aber endete diese Geschichte tröstlich. »Auch solche Geister haben stets die Möglichkeit, sich wieder ihrem Ursprung, dem Anfangsereignis, nämlich dem ›uralten heiligen Vater‹, anzunähern.«
Ich atmete leise auf. Für mich bedeutete das, dass jeder eine Chance auf Besserung hatte. Auch jemand wie ich. Das erleichterte mich, denn ich hatte aus Wut wieder einmal die Nachbarsjungen schlimm beleidigt: »Eure Mutter ist furchtbar dumm, dass sie euch auf die Welt gebracht hat!«
Bis zum heutigen Tag habe ich kein einziges Mal gebetet. Täglich aber beobachteten wir Kinder, wie die Erwachsenen draußen ihre Gebete sprachen. Die Köpfe zur Sonne gedreht, mit Handbewegungen als wuschen sie sich die Gesichter mit Sonnenstrahlen. Da die Jesiden diesen leuchtenden Himmelskörper als sichtbaren Beweis Gottes verehren, nennt man sie auch »Kinder des Lichts«. Ohne das ewige Feuer am Himmel könnte kein Mensch leben. Niemand aber lehrte uns, diese Gebete zu sprechen, oder zwang uns, dabei mitzumachen. Ich hatte nur so viel verstanden, dass Gott uns hinter den Sternen beobachtete und beschützte, aber auch mit strenger Hand kontrollierte.