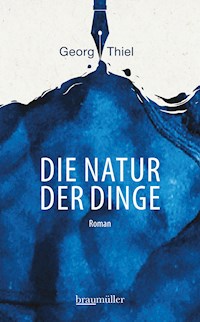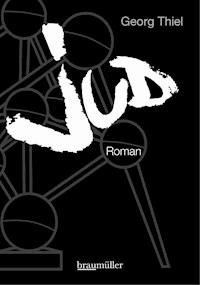21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Johannes, Lukas, Markus und Matthäus kennen einander seit dem ersten Schultag und sind, obwohl sie von Temperament und Wesen unterschiedlicher nicht sein könnten, eng befreundet. Diverse Frauengeschichten, bewusstseinsverändernde Substanzen und eine Leiche später finden sie sich auf einem rasanten Roadtrip wieder, der für die vier gänzlich anders verläuft als geplant. Georg Thiels neuer Roman steht unter dem Motto "Die Katastrophe fängt damit an, dass man aus dem Bett steigt" und ist, ungeachtet der Namensgebung seiner Protagonisten, alles andere als ein Evangelium. Darüber hinaus auch viel kurzweiliger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
GEORG THIEL
NACHTFAHRT
Roman
Die Katastrophe fängt damit an,dass man aus dem Bett steigt.
Thomas Bernhard, Verstörung
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Marie, und das Wort war unfreundlich. Johannes hätte nicht im Traum daran gedacht, dass es so kommen würde. Es hatte sich nicht angekündigt. Johannes konnte sich, so sehr er auch nachdachte, an kein wie auch immer geartetes Anzeichen erinnern. Zumindest war ihm nichts aufgefallen.
Vielleicht, dass Marie heute heftiger in ihrem Kaffee gerührt hatte als sonst. Der Kaffee war über den Rand geschwappt, auf die Untertasse geronnen, die Tasse schwamm regelrecht. Marie führte sie zum Mund, blies hinein, laut, zu laut, wie er fand. Die Tasse tropfte die ganze Zeit. Ekelhaft. Mag sein, dass die Bemerkung, die er daraufhin machte, keine glückliche gewesen war. Aber rechtfertigte sie das, was folgte? Nein! Maries Verhalten ist durch nichts zu entschuldigen. Vielleicht, wenn sich ein über Jahrzehnte aufgestauter Hass entlädt. Aber das ist nicht der Fall. Hier geht es um kein vergeudetes Leben. Es geht um eine lächerliche Spanne Zeit.
Diese vollkommen überzogene Reaktion! Richtig hysterisch! Marie hatte auf seine Bemerkung zunächst nichts erwidert, ihn lediglich auf unangenehme Art angesehen. Sie wird doch nicht, dachte er, aber noch ehe der Satz zu Ende gedacht war, hatte er schon den Kaffee im Gesicht. Während die klebrige Flüssigkeit an ihm herunterrann, wurde ihm bewusst, dass er das letzte gebügelte Hemd trug. Er machte sie darauf aufmerksam. Ganz ruhig, ohne den leisesten Vorwurf. Obwohl er alles Recht der Welt dazu gehabt hätte. Mehr brauchte es nicht. Sie begann zu toben. Dass die letzten 9 ½ Wochen die mühsamsten ihres Lebens gewesen seien! Dass er ein entsetzlicher Mensch sei. Diese ewigen Belehrungen! Kein Gegenstand sei vor seiner Belehrung sicher. Sie halte ihn keinen Augenblick länger aus. Er solle verschwinden – jetzt sofort, auf der Stelle! Marie packte ihn am Arm, zerrte ihn vom Sessel und drängte ihn aus der Küche. Er war zu überrascht, um reagieren zu können. Beim Eingang stieß sie ihn mit solcher Wucht über die Schwelle, dass er strauchelte und fast hingefallen wäre. Schuhe, Tasche, Sakko schleuderte sie hinterher. Johannes möge sich nie wieder blicken lassen! Man hörte es durchs ganze Haus.
Noch bevor das Geräusch der zugeschlagenen Wohnungstür verhallt war, gingen die Türen der Nachbarwohnungen auf. Er war sich bewusst, dass er keinen günstigen Eindruck machte. Ein verkommenes Subjekt, gegen das ein Akt der Notwehr verübt worden war. Hastig versuchte er in die Schuhe zu kommen. Schon fielen erste unfreundliche Bemerkungen. Ein Senkel riss. Johannes vermeinte die Worte „Das arme Fräulein Marie“ zu hören. Die Atmosphäre kippte ins Bedrohliche. Er verzichtete auf die Schnürung des anderen Schuhs. Die Tasche in der einen, das Sakko in der anderen Hand rannte er hinunter. Um ein Haar wäre er über das offene Schuhband gestolpert. Unten angekommen, war er völlig außer Atem. Auch spürte er einen stechenden Schmerz. Die Hand gegen die rechte Flanke gepresst, lehnte er sich gegen die Wand. Es dauerte, bis sich sein Puls wieder beruhigte. Doch dann fiel ihm ein, was alles in Maries Wohnung zurückgeblieben war. Das Gewand war zu verschmerzen. Aber die Bücher aus der Institutsbibliothek! Es würde Probleme geben, wenn er sie nicht zurückbrachte. Probleme gravierender Natur. Gott, das Institut! So wie er aussah, konnte er unmöglich hin. Wenn er ein Taxi nehmen, zu seiner Wohnung fahren und sich umziehen würde, könnte er …
Ein Blick auf die Uhr machte die Idee zunichte. Er musste versuchen, unauffällig ins Institut zu gelangen, dort in einen Arbeitsmantel zu schlüpfen und den Tag bei den Bananenschachteln im Keller zu verbringen. Eine verhasste Tätigkeit, dieses Sortieren von Dingen, denen der Schmutz vieler Jahre anhaftete. Andererseits würde es ein gutes Licht auf ihn werfen. Das brauchte er ohnehin, schlecht angeschrieben, wie er war. Zunächst einmal musste er aber weiter. Johannes eilte vom Hauszum Gartentor, doch noch ehe er es erreichte, war Marie zu hören: „Warte, warte!“ Jetzt tut es dir leid, dachte er grimmig, aber jetzt ist es zu spät. Freilich, so spann er den Gedanken weiter, wäre es unklug, dies zu kommunizieren, solange seine Habe – namentlich die Bücher – noch in ihrer Gewalt waren. Es galt, mit Klugheit vorzugehen. Verständnis für das Ungeheuerliche vorzutäuschen. Verzeihung signalisieren, für eine Trennung auf Zeit plädieren, etwas in der Richtung.
„Johannes!“ Die Stimme klang mit einem Mal ungeduldig, ja schneidend. Er drehte sich um. Marie stand am Balkon. Desgleichen die Nachbarn, die zuvor am Gang gewesen waren. Andere schauten aus den Fenstern. Selbst der Hausmeister hatte den Kopf aus seiner Kellerwohnung gereckt. Das ganze Haus starrte ihn an. Er versuchte den Blicken auszuweichen, fokussierte auf einen Gegenstand auf der Brüstung des Balkons. Ein Wäschekorb. Die blauen Umschläge der Bücher, die zuoberst lagen, kamen ihm bekannt vor.
„Deine Sachen“, tönte es vom Balkon. Der Korb wurde gekippt, sein Inhalt ergoss sich zwei Stockwerke nach unten. Eine Nachbarin johlte, der Hausmeister zog erschreckt den Kopf ein.
„Wenn mir noch etwas unterkommt, schicke ich es dir. Nicht nötig, dass du noch einmal vorbeikommst.“ Das Gesicht des Hausmeisters tauchte wieder auf.
„Žene su loše“, sagte er. Johannes schaute verständnislos. „Frau nix gut“, übersetzte der Hausmeister, drehte den Kopf zur Seite, rief: „Dragica. Dragica! Jesi li glu?! Uzmi torbu!“ Kurz darauf reichte er eine blau-weiß-rote Tasche aus geflochtenen Plastikstreifen durch das Fenster. Johannes wollte sich bedanken, brachte aber nur einen krächzenden Laut hervor. Der Hausmeister winkte ab, ehe er in den Tiefen seiner Wohnung verschwand.
Johannes machte sich daran, seine Sachen aufzulesen. Ein Behältnis, das besser intakt geblieben wäre, war geborsten. Das darin befindliche Heilmoor hatte einen Teil der Wäsche durchtränkt. Peinlich berührt, sammelte er dunkelbraun gesprenkelte, leicht zu Missverständnissen Anlass gebende Kleidungsstücke zusammen und stopfte sie in die Tasche. Darauf schichtete er den Rest. Es war mehr als erwartet. Gottlob war die Tasche groß, und wenigstens schienen die Bände aus der Institutsbibliothek nichts abbekommen zu haben. Aber wo war der Registerband? Er war sich sicher, auch den Registerband mitgenommen zu haben. Doch das würde sich hier und jetzt nicht klären lassen. Johannes nahm die Tasche auf, ging zum Gartentor. Als er die Klinke niederdrückte, ließ sich Marie erneut vernehmen. „Warte!“ Sein erster Impuls war, sie zu ignorieren. Es war genug. Es gab Grenzen. Er würde weitergehen. Schließlich …
„Ich habe noch was gefunden.“ Der Impuls erstarb. Er drehte sich um, sah hoch. Am Rande der Brüstung stand das vermisste Buch. Marie schien zu lächeln, als sie es anstieß. Das Buch trudelte durch die Luft, fächerte sich auf und landete mit einem klatschenden Geräusch, in das sich ein schmatzender Unterton mischte, am Boden. Johannes bewegte sich darauf zu. Trance musste sich so anfühlen. Genau die Stelle, an der die Flasche mit dem Heilmoor aufgeplatzt war. Das Buch lag aufgeschlagen im Schlamm. Während er noch überlegte, was er jetzt tun solle, streckte der Hausmeister die Hand aus dem Fenster. „Šljivovica. Aus Heimat.“ Johannes nahm das Glas, dankte und trank. Unmittelbar darauf schnappte er nach Luft. Tränen schossen ihm in die Augen, es war, als hätte ihn jemand in den Magen geschlagen. „Sedamdeset posto“, erläuterte der Hausmeister, „70 Prozent. Hilft gegen alles. Viel Glück, mladi gospodin.“
Benommen taumelte Johannes die Straße entlang. Ihm war klar, dass seine Erscheinung Aufmerksamkeit erregte. Er hatte eine plastische Vorstellung davon, wie es aussah, wenn man in einem kaffeegetränkten Hemd vom Gewicht einer Gastarbeitertasche nach unten gezogen wurde. Die Tasche. Gab es irgendeinen Ort, wo man sie deponieren konnte? Vielleicht … Oh. Jetzt hatte er einen Herrn gestreift. „Aufpassen, Tschusch!“ Johannes eilte weiter. Diese schreckliche Tasche. Vielleicht konnte er sie in einer Drogerie deponieren? Bei der Gelegenheit könnte er sich gleich wegen der Flecken erkundigen. Moor war wohl kein Problem. Aber Kaffee? Wie schwer diese Tasche war! Johannes wechselte die Trageseite. Zwei Minuten nach neun. Johannes begann zu rennen. Es geriet zur Karikatur. Nach wenigen Schritten war das Stechen wieder da. Lufthunger. Atemnot, der Schmerz der ins Fleisch schneidenden Henkel.
Es gelang ihm, sich unter Kontrolle zu bekommen. Er schaffte es sogar, ungesehen in das Institut zu gelangen. Das Weitere verlief allerdings nicht nach Plan. Es war seltsam. Zunächst das Gefühl, dass sich die Türe hinter ihm schneller schloss als sonst. Als wäre er in eine Falle getappt. Irritiert drehte er sich um. Genau in diesem Moment musste der Institutsvorstand aus seinem Büro gekommen sein. Aus dem Nichts konnte sich Rambauske ja schlecht materialisiert haben.
„12 Minuten zu spät. Sehr schön, der Herr Kollege steigert sich!“.
„Herr Professor, ich …“
„Vielleicht haben Sie die Güte mich anzusehen, wenn ich mit Ihnen rede?“
Johannes hantierte hektisch, ehe er sich umdrehte. Die Tasche verdeckte nun seinen Oberkörper.
„Was soll das? Was schleppen Sie da an? Auszug aus Ägypten? Haben Sie vor, das Institut zu Ihrem festen Wohnsitz zu machen? Das könnte zu optimistisch gedacht sein.“ Rambauske kam näher.
Der Registerband, dachte Johannes, er liegt ganz oben, wenn er den Registerband sieht, bin ich erledigt. „Hören Sie, Herr Professor, ich …“
„Sie riechen nach Schnaps! Wo kommen Sie her? Aus der Branntweinstube?!“ Branntweinstube, dachte Johannes. Branntweinstube. Es war eine Situation, in der ein sauberes Hemd auch nichts mehr genutzt hätte. Er stellte die Tasche ab und präsentierte sich in seiner ganzen Erbärmlichkeit.
„Das wird ja immer besser! Nun, wenn es ihr ureigenster Wunsch ist zu kündigen: Das können Sie haben. Damit erweisen Sie mir sogar einen Gefallen. Kommen Sie mit ins Büro!“
Johannes machte einen energischen Schritt auf Rambauske zu. „Herr Professor, ich habe keinesfalls vor zu kündigen.“
Rambauske wich zurück. „So, das haben Sie nicht? Dann erklären Sie mir doch, wie …“
„Das versuche ich ja die ganze Zeit. Es verhält sich nämlich so …“ Johannes lieferte eine Erklärung, der der Institutsvorstand nicht viel entgegenzusetzen hatte. Dass er seit 9 ½ Wochen mit der Idee für ein Forschungsprojekt schwanger gehe; ein Forschungsprojekt, das sich mit marginalisierten Randgruppen beschäftige. Nachdem dies ein weites Land sei, habe er sich vorgenommen, den Fokus auf obdachlose Männer zu legen. Natürlich kenne er die Einwände, die der Herr Institutsvorstand gleich vorbringen werde: dass es sich hierbei um eine viel zu große, von einem einzelnen Individuum gar nicht erforschbare Gruppe handle. Eine Gruppe, die in dieser Stadt zudem erhebliche Forschungsdefizite aufweise, wenn man von den Publikationen – an dieser Stelle flocht Johannes den Namen eines Mannes ein, mit dem Rambauske seit Jahrzehnten in erbitterter Fehde lag – in den Jahrbüchern für Hermeneutik absehe. Dessen sei er sich bewusst. Ihm schwebe daher vor, sich auf die Habitate besagter Subkultur zu konzentrieren, Habitate in und an öffentlichen Verkehrsknotenpunkten, um genau zu sein. Örtlichkeiten, die sich nicht oder nur schlecht mittels qualitativer Umfragen erkunden ließen. Hier sei Feldforschung gefragt, teilnehmende Beobachtung. Heute – der Herr Institutsvorstand habe ganz richtig gelegen – habe er bereits einen Branntweiner in Bahnhofsnähe aufgesucht. In erforschender Absicht natürlich. Deshalb die Camouflage, die Tasche sei eigens für diese Unternehmung angeschafft worden. Es gebe Orte, an denen man sich in Verkleidung sicherer fühle, wie schon Ernst Jünger 1954 an Martin Heidegger geschrieben habe.
Doch garantiere sie keine Sicherheit, wie der Herr Institutsvorstand am Zustand seines Hemdes sehen könne. Dieser sei auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei der Forschungsgruppe zuzurechnenden Individuen zurückzuführen. Sie habe keine zwei Minuten gedauert, aber er habe dabei mehr gelernt als im gesamten Seminar Soziolekte der Misera plebs von Professor Beitelmann. Er sei dabei mit einem Fiaker angeschüttet worden.
„Von einem Fiaker?“, fragte Rambauske. „Sagten Sie nicht eine Auseinandersetzung zwischen Obdachlosen?“
Johannes beharrte: „Nein, mit einem Fiaker. Kaffee mit einem Schuss Sliwowitz.“ So die normale Rezeptur, beim Branntweiner mische man ihn anders. Nun, das seien Risiken, derer man sich bewusst sein müsse, wenn man Feldforschung betreibe. Er habe nicht vor, sich davon abhalten zu lassen. Dafür verspreche er sich von diesem Projekt zu viel. An dieser Stelle würde ihn interessieren, was der Herr Institutsvortand davon halte.
Rambauske hielt nichts davon. Von allen qualitativen Methoden, die der Kultur- und Sozialanthropologie zur Verfügung stünden, halte er die teilnehmende Beobachtung für die problematischste. Sie verlange eine stabile Persönlichkeit und spezielle Begabungen. Die wenigsten hätten sie. Am Institut habe sie keiner. Er denke, der Herr Kollege mache besser mit der ihm zugewiesenen Arbeit weiter. Diese werde ihn beschäftigt halten. Zuerst einmal möge er aber ausstempeln, nach Hause gehen und sich umziehen. Ihm liege daran, in diesen Räumlichkeiten eine, wenn auch primitive Kleiderordnung aufrechtzuerhalten. Ein Institut sei ein Institut, sei ein Institut, kein Habitat für Obdachlose. Er persönlich bedaure, dass der Krawattenerlass gekippt worden sei. Damit habe es begonnen, und am Ende stehe dann die Freizeitbekleidung: Jeans, Trainingshosen und dergleichen mehr. Der Endsieg der Bequemlichkeit. Aber nicht hier. Nicht, solange er diesem Institut vorstehe! Das Wort Ausstempeln schrie er regelrecht, als Johannes das Institut verließ.
Die Straßen waren jetzt belebter. Unter den Passanten, die ihm begegneten, mehrheitlich Maulaffen. Johannes kam der Gedanke, dass ihm vermutlich nie mehr so viel Aufmerksamkeit widerfahren würde. Seine 15 Minuten Ruhm. Die Aussicht stimmte melancholisch. Wie kam er eigentlich dazu? Alles wegen Marie! Dabei hätte er es wissen müssen. Was für ein Idiot er gewesen war! Er hätte ihren Auftritt ignorieren sollen, damals, bei diesem Fest vor 9 ½ Wochen.
Sie musste mitten in einer Nummer die Tanzfläche verlassen haben. Sie war in seine Richtung gekommen, stand plötzlich vor ihm und fragte etwas. Die Musik war zu laut, als dass er sie hätte verstehen können. Sie wiederholte das Gesagte, wobei sie auf etwas deutete. Er hatte keine Ahnung, worauf sie hinauswollte. Sie lächelte und zuckte mit den Schultern, ehe sie ging. Er blickte ihr nach. Wallendes Haar, lasziver Gang. Eine Handbewegung, die man als Einladung interpretieren konnte. Er wie ein läufiger Hund hinterher. Auf der Tanzfläche der Versuch, sich die Schrittfolge des Discofox in Erinnerung zu rufen. Es gab Erinnerungslücken. Sie nahm ihn trotzdem mit. Es muss mit dem Zyklus zu tun gehabt haben. Auch wenn dies Gebiete berührte, bei denen er sich nicht allzu sehr auskannte.
Wenig später stolperte er durch eine unbekannte, dunkle Wohnung. Nackt, auf der Suche nach einem Ort, an dem er das Kondom entsorgen konnte. Als er zurückkam, zündete sich Marie gerade eine Zigarette an. Er legte sich zu ihr, fragte:
„Was rauchst du?“
„Gitanes.“
Er begann über die Gefährlichkeit von im Bett gerauchten Zigaretten zu dozieren. Ingeborg Bachmann, Rom, September 1973. Mit einer glühenden Zigarette eingeschlafen – und zu ihrem Unglück nicht gleich verbrannt. Wenn er sich richtig erinnere, sogar mit einer Gitanes. Die Bachmann wäre mit einer Marlboro auch nur schwer vorstellbar. Oder mit einer Camel. Ganz zu schweigen mit einer HB. Eine HB und die Bachmann – das gehe nicht zusammen. Wenn er so nachdenke, dann falle ihm auf, dass es immer französische Marken seien, denen neben dem Krebs noch eine weitere Ebene des Unglücks anhafte. Zum Beispiel bei Camus. Ein letaler Autounfall mit einer Gitanes im Gesicht. Oder Sartre, der gegen Ende seines Lebens nichts mehr halten konnte. Dem die Zigaretten aus dem Mund fielen und Löcher in Hosen, Möbel und Teppiche brannten. Sogar in den Urinbeutel. Eine fürchterliche Vorstellung. Simone de Beauvoir habe es bis ins kleinste Detail beschrieben. Eine Geschmacklosigkeit, wie er finde. Schließlich gebe es Grenzen. Oder Belmondo, der noch im Sterben Rauch aus seinen wulstigen Lippen blies. Dieses Bild werde er sein Leben lang nicht aus dem Kopf bekommen.
Marie hatte daraufhin ausgedämpft und gesagt, Belmondo habe keine wulstigen Lippen. Darüber hinaus lebe er. Johannes meinte, er habe sich auf die Schlussszene von Außer Atem bezogen. Ein Film, ein Werk der Fiktion, wie er einräume. Doch müsse sie zugeben, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen der Marke Gitanes und all dem Unglück geben müsse. Am schwarzen Tabak allein könne es nicht liegen. Vielleicht am Namen: Gitanes, was übersetzt ja nichts anders als Zigeunerinnen heiße. Ein problematisches, weil politisch inkorrektes Wort. Dabei passend, weil unheilschwanger konnotiert. Er denke an Carmen. Der Fluch der Zigeunerin. Ein großes Thema, vielleicht werde er einmal etwas darüber schreiben.
„Mach das“, sagte Marie. Sonst nichts. Er fragte, was sie dazu bewogen habe, sich aus dem Pulk der Tanzenden zu lösen und zu ihm zu kommen? Sie nestelte eine neue Zigarette aus der Packung. Es sei das Licht gewesen. Dieses seltsame aus- und angehende Licht, das wie ein Signal auf sie gewirkt habe. Sie sei dem nachgegangen, und da habe er auf der umgedrehten Bierkiste gehockt und etwas im Schein einer Taschenlampe notiert. Die er immer abdrehte, wenn er mit ein paar Zeilen fertig war. Sie habe das rührend gefunden, irgendwie. Wobei sie, obwohl sie ihn zweimal gefragt habe, noch immer nicht wisse, was er in diesem dunklen Winkel eigentlich aufgeschrieben habe. Er sagte, wenn er sie akustisch verstanden hätte, hätte er natürlich geantwortet. Und mit dem dunklen Winkel habe es eine einfache Bewandtnis gehabt; er sei der Feldarbeit günstig gewesen.
„Der Feldarbeit?“, hatte Marie gefragt, und er hatte ihr dargelegt, dass das ein anderer Begriff für Feldforschung sei. Treffender, weil es harte, mit großen Mühen verbundene Arbeit sei, an empirische Daten zu kommen. Er für seine Person würde so einen Ort freiwillig ja niemals aufsuchen. Da müsse man ihn schon hinschleifen. Auf dieser Art von Festen sei doch alles grässlich. Die Pappbecher, der Lärm, die verrauchte Luft. Ganz zu schweigen von den Toiletten, wo man das Gefühl habe, in die Kloake der Hölle zu blicken. Gerade dort müsse man freilich hin. Toiletten seien, rein soziologisch betrachtet, von eminenter Bedeutung. Trinkverhalten, sexuelle Orientierung, Drogenhandel und -konsum, all das lasse sich hier wie nirgends sonst studieren. Wenn man über das Freizeitverhalten in studentischen Milieus forsche, verbringe man viel Zeit auf Toiletten. Leider.
Sie wollte wissen, warum er es dann überhaupt mache, wenn er so leiden müsse? Weil er derzeit alle Richtungen für ein Dissertationsthema auslote. Weil ihm eine Milieustudie vorschwebe, er sich aber noch unschlüssig sei, welches Milieu genau. Er schließe nichts aus. Wobei das nicht ganz stimme. Denn so froh er sei, dass er hingegangen sei und nun bei ihr liege – das studentische Milieu brauche er nur bedingt. Es sei ihm im Grunde fremd, auch wenn er ein Studium abgeschlossen habe. Ganz zu schweigen von der Größe des Feldes. Selbst wenn man den Schwerpunkt auf eine Fakultät lege. Nein, es wäre klüger, sich auf eine kleine, in sich geschlossene Gruppe zu beschränken. In Vereinen organisierter Heimatvertriebenen etwa. Beskiden-, Karpaten-, Böhmerwalddeutsche, so etwas in der Richtung. Die hätten Archive, ritualisierte Umgangsformen, oft auch auffällige Trachten. Ausgeprägte, gut gepflegte Mundarten. Ideale Voraussetzungen. Nicht zu vergessen – das werde gefördert. Dafür sei doch immer Geld da. Mit etwas Glück für mehrere Jahre. Er habe schon konkrete Stipendien vor Augen. Außerdem hoffe er, die Dissertation in der Arbeitszeit schreiben zu können.
Sie erkundigte sich daraufhin nach seiner Arbeit und dem Institut. Er schilderte es wahrheitsgemäß. Dass das, was am Institut getrieben werde, unfassbar sei. Der Institutsvorstand sei ein Trottel. Da seien Bestände nicht aufgearbeitet – das glaube ihm keiner. Erst gestern habe er in einer alten Feigenkaffeebüchse ein Bündel Briefe gefunden. Alois an Adolf Hitler. Ein gestochenes Kurrent, auch wenn er sich mit Kurrent schwertue. Aktuell arbeite er die Wallfahrtsmedaillen der Sammlung Sabarac auf. Eine der umfangreichsten ihrer Art. Klinge uninteressanter als es sei. Besonders unter den Pestmedaillen fänden sich schöne Exemplare. Obwohl er sagen müsse: Wenn man 50-mal am Tag die Worte Crux sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux in den Computer tippe, habe man schon seine Durchhänger. Maria murmelte etwas von copy and paste. Es klang schläfrig. Johannes meinte, es sei nicht so schlimm. Außerdem überwiege das meditative Element. Der Benediktussegen sei ja wunderschön. Auch auf Deutsch: Das heilige Kreuz sei mein Licht, der Drache sei mein Führer nicht! Starke Worte. Theologisch betrachtet, wäre seine derzeitige Tätigkeit ja eine, die die Existenz der Menschheit vor Gottes Angesicht rechtfertige. Bekanntlich sei dem Herrn der Zorn nicht fremd; eine Systemimmanenz, wenn man so wolle. Ständig müsse er geheiligt, verehrt, bebetet, nein, angebetet werden, damit er einen verschone. Natürlich meine er das nicht ernst und hoffe, dass er jetzt keine religiösen Gefühle verletzt habe. Wenngleich er die Gefahr als gering erachte. Johannes lachte. Seine Frage laute ganz anders. Ihn würde interessieren, was sie von der Dissertationsidee mit den Karpatendeutschen halte. Denn ein Projekt wie dieses berge auch seine Risiken und Tücken. Bekanntlich seien diese Vereine hoffnungslos überaltert und würden von Greisen geführt, die nicht immer das beste Erinnerungsvermögen hätten, dafür geschwätzig seien. Starrköpfig noch dazu.
Marie sagte nur, sie sei sehr müde. Er hatte es als Zeichen genommen, dass das Thema für eine Dissertation geeignet war, und sich versichert, dass im Aschenbecher nichts mehr gloste, ehe er seinen Arm um sie legte und einschlief.
Johannes war nur noch wenige Schritte von seinem Haus entfernt. Endlich konnte er die Tasche abstellen, aufsperren, sich waschen und umziehen. Wo aber war der Schlüssel? Er sollte in der rechten Außentasche des Sakkos sein. Dort war er allerdings nicht. Folglich befand er sich noch bei Marie. Marie war keine Option. Gab es noch eine andere Möglichkeit? Es gab nur eine einzige. Die Wohnungsbesitzerin.
Gern hätte er es vermieden, sie anzurufen. Vielleicht doch lieber ein Aufsperrdienst? Damit wäre das Schlüsselproblem nicht aus der Welt. Es half nichts; das Telefonat musste geführt werden. Er schleppte sich mitsamt der Tasche zur Telefonzelle, wählte ihre Nummer. Hoffentlich war sie zu Hause, hoffentlich hob sie ab. Sie tat es, gleich nach dem ersten Klingeln. Bellte herrisch den Familiennamen in die Muschel, sagte, dass der Anruf ungünstig komme, sie sei in Eile. Kurz darauf: Das sei wieder typisch für ihn, dass er den Schlüssel verlegt habe und jetzt sofort, auf der Stelle, Ersatz wolle. Aber so einfach verhalte sich die Sache nicht. Sie müsse jetzt weg. Er solle ordentlich suchen und sich am späten Nachmittag noch einmal melden.
Johannes war kurz davor, vor Zorn gegen die Tasche zu treten. Doch fürchtete er, durch eine solche Aktion noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Darüber hinaus hätte es wenig genutzt. Es gab keine Therapie gegen Mütter. Zunächst brauchte er ein Hemd. Er trottete Richtung Institut. Am Weg gab es einen trostlos herabgewirtschafteten Laden, dessen Inhaberin meist rauchend im Eingang stand. So auch heute. Ein kurzer Blick in die Auslage: Kittelschürzen, Hauskleider, Schontextilien. So etwas hätte er in der Früh gebraucht, als ihm Marie den Kaffee ins Gesicht geschüttet hatte.
„Haben Sie Hemden?“, fragte er.
Oberhemden? Natürlich führe sie Oberhemden. Erste Qualität! Sie schnippte den Zigarettenstummel unter ein parkendes Auto.
Wenig später war Johannes wieder auf der Straße und überlegte, wo er sich umziehen könne. Er kam zu dem Schluss, dass es nur eine einzige Möglichkeit gäbe; sie behagte ihm nicht. Er würde versuchen, den Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten. Als er den Park erreicht hatte, setzte er sich auf eine Bank, um das Hemd auszupacken. Im Tageslicht besehen, zeigte es sich in seiner ganzen vergilbten Hässlichkeit. Dem beiliegenden Zettel war zu entnehmen, dass es im August 1977 durch die Qualitätskontrolle gegangen war. Johannes hatte gar nicht gewusst, das Essen damals eine Textilindustrie gehabt hatte. Der Anzahl der Nadeln nach, mit denen es in Form gehalten worden war, musste ein Naheverhältnis zu Krupp bestanden haben.
Vor dem Hineingehen beobachtete er die Bedürfnisanstalt eine Weile. Sie schien wenig frequentiert. Johannes öffnete die Türe. Urinale, ein Waschbecken mit Spiegel, zwei Toiletten. Es stank. Die Wände mit nicht wiederzugebenden Angeboten, Nachfragen und Schmähungen beschmiert. Johannes suchte nach einem Haken, um die Tasche aufzuhängen. Es gab keinen. Er drehte das Wasser auf, schlüpfte aus dem Hemd, seifte sich ein. Dabei kam er nicht umhin, sein Spiegelbild zu betrachten. Hänflingsgrößen führe sie nicht, hatte die Ladenbesitzerin gemeint. Er war über das Waschbecken gebeugt, als er eine Stimme vernahm. Einen Augenblick hoffte er, dass eben Gehörte auf seine überreizten Nerven zurückführen zu können. Doch die Stimme fragte noch einmal:
„Na, du?“
Er richtete sich auf. Im Spiegel sah Johannes einen Mann, den er auch außerhalb einer öffentlichen Bedürfnisanstalt als unangenehm empfunden hätte. Der Mann kam ohne Umschweife zur Sache: „Magst du dich nicht lieber bei mir waschen? Ist doch viel angenehmer. Ich wohne ganz in der Nähe. Eine schöne Wohnung, wird dir gefallen.“ Er deutete auf die Tasche: „Wäsche kannst du auch waschen. Und bis alles fertig ist, machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Na, wie klingt das?“ Der Mann lächelte süßlich. Johannes schüttelte den Kopf.
Der Mann gab nicht auf. „Ein schönes Bad. Wanne, Brause, rustikal verfliest.“ Johannes winkte ab, wischte fahrig mit dem Morgenhemd am Oberkörper herum. „Mit Bidet“, lockte der Mann. Johannes sah zu, dass er in sein neues Hemd kam, er schlüpfte in die Ärmel, zog es über die Schultern, schrie auf.
„Ja, was ist denn?“, fragte der Mann, „bist du verspannt? Rückenschmerzen? Da kann ich helfen. Ich habe magische Finger, weißt du?“ Er streckte ihm seine Hände entgegen. Johannes blickte auf Finger, die in brüchig-gelben, spitz gefeilten Nägeln ausliefen. Der Mann schloss die Augen, leckte sich über die Lippen, machte Massagebewegungen. Johannes wurde es zu viel, er gebrauchte für seine Verhältnisse scharfe Worte; dass er nicht homosexuell sei und mit ihm nirgends hingehe, höchstens zur Polizei, wenn er ihn noch länger belästige.
Der Mann war aufrichtig erstaunt. Wieso er sich dann an einem Ort wie diesem entblöße und derart produziere? Wenn er angeblich keine Absichten habe? Johannes, damit beschäftigt, die vergessene Nadel, die sich in seinen Rücken gebohrt hatte, aus dem Hemd zu ziehen, hielt inne. Was das heißen solle? Es wisse doch jeder, dass das eine Loge sei, sagte der Mann.
„Wie bitte?“, fragte Johannes.
„Eine Loge!“, wiederholte der Mann, „du weißt schon, ein Ort für sexuelle Begegnungen.“ Er seufzte, sah bekümmert drein, erklärte, dass diese Loge in den vergangenen Jahren sehr abgewirtschaftet habe. Die Gegend sei überaltert. Viele Pensionisten, steinalte darunter. Brillen in faltigen Gesichtern, loses Fleisch. All das ekle ihn an. Mit den Jungen mache es einfach mehr Spaß. Aber hier tauche kaum noch Material auf, wie er es möge, sehnig, schlank, bereit, Schmerz zu empfangen. Man suche eben immer den Gegensatz. In den seltenen Fällen, in denen ein Junger auftauche, handle es sich meist um einen Ausländer. Nicht dass er per se etwas gegen Ausländer habe. Aber ihm gehe es ja nicht nur um die körperliche Befriedigung, sondern immer auch um das Gespräch. Nicht zuletzt, um gewisse Dinge abzuklären. Verwendung eines Gummis beispielsweise. Was erwünscht sei. Was weniger. Was nicht. So ein Gespräch sei mit Ausländern eben nur eingeschränkt möglich. Leicht ergäben sich Missverständnisse. Zumindest bei jenen, die er in dieser Loge angesprochen habe. Und dann sei es natürlich eine nicht ganz ungefährliche Sache, er denke etwa an den armen Moshammer Rudi. In der eigenen Wohnung mit einem Telefonkabel erdrosselt. Nein, so etwas brauche er nicht. Deshalb spreche er keine leichtfertigen Einladungen zu sich nach Hause aus. Das meiste spiele sich ohnehin in einer der beiden WC-Kabinen ab. Dort gebe es ein Loch zwischen den Trennwänden. In Hüfthöhe. Er gab obszöne Laute von sich, leckte sich erneut über die Lippen. Auf der Zunge ein schwerer Belag von eigentümlich dunkler Färbung.