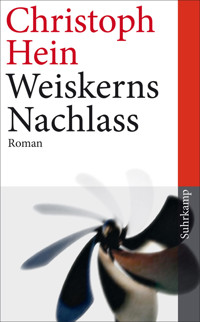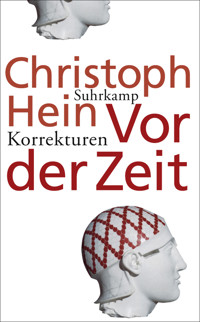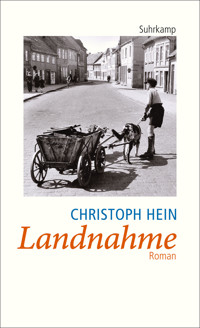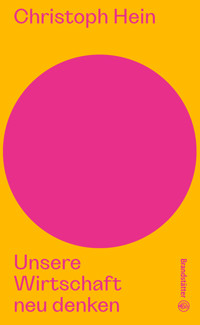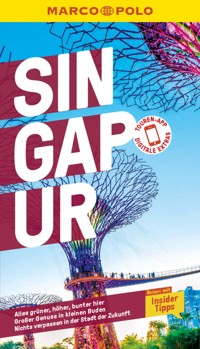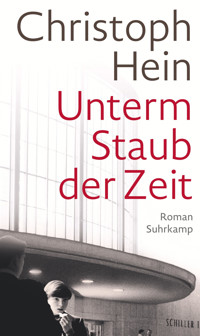11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Details könnten genau so stimmen, und doch ist alles frei erfunden in diesen Erzählungen, die von den Großen der Geschichte ebenso wie den Namenlosen handeln: vom ewig von Leibschmerzen geplagten Racine auf dem Weg zum König; von der großen Sibirien-Expedition des Alexander von Humboldt; von Max, der einem Lehrerehepaar bei der Flucht in den Westen helfen soll und sich dabei in die Frau des Lehrers verliebt; von einem modernen Michael Kohlhaas, dem im Streit mit seinem Arbeitgeber, der örtlichen volkseigenen Stuhlfabrik, die Ehefrau mitsamt dem vierjährigen Sohn abhanden kommt. Ein phantasievolles Spiel mit Wirklichkeiten, mit historischen Daten und Fakten treibt der Erzähler in diesen Prosastücken, die durch Witz und Scharfsinn bestechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christoph Hein
Nachtfahrt und früher Morgen
Erzählungen
Suhrkamp
Inhalt
Einladung zum Lever Bourgeois
Aus: Ein Album Berliner Stadtansichten
Friederike, Martha, Hilde
Die Witwe eines Maurers
Die Familiengruft
Charlottenburger Chaussee, II. August
Nachtfahrt und früher Morgen
Frank, eine Kindheit mit Vätern
Der Sohn
Leb wohl, mein Freund, es ist schwer zu sterben
Der neuere (glücklichere) Kohlhaas. Bericht über einen Rechtshandel aus den Jahren 1972/73
Die russischen Briefe des Jägers Johann Seifert
Einladung zum Lever Bourgeois
Zum Lever, der Zeremonie des königlichen Aufstehens, geladen zu sein, galt als besondere Gunst am französischen Hofe.
Ein Geräusch im Haus weckt ihn. Er lag nur im Halbschlaf und erinnert sich augenblicklich daran, daß ihn Catherine bereits geweckt hat, daß seitdem vielleicht schon Stunden vergangen sind, daß er weit über seine übliche Zeit hinaus im Bett zugebracht hat. Trotzdem, er fühlt sich unausgeschlafen. Nicht fähig, rasch aufzustehen. Er schlägt die Bettdecke zurück, bleibt liegen. Die plötzliche Kälte soll in seinem Körper die wenige Energie beleben, die ihm der Nachtschlaf brachte und die ihm so notwendig ist, um bis zum Abend aufzubleiben.
Ihn fröstelt.
Bis zum Abend. Mißmutig erinnert er sich des vergangenen. Madame de Maintenon hatte ihn gebeten, wieder einmal an einem Tag des Appartements teilzunehmen, und er hat der Einladung dankend folgen müssen. Die Empfänge beanspruchen ihn außerordentlich: Er fühlt sich nach den wenigen Stunden körperlich erschöpft, beginnt heftig zu schwitzen (mitten im Gespräch, die Achselhöhlen laufen einem davon), seine Aufmerksamkeit läßt schnell nach. Es fällt ihm schwer, seine Gedanken auf ein Thema zu konzentrieren. Noch unangenehmer sind ihm belanglose Plaudereien. Die geschwätzige Nichtigkeit. Er murmelt eine Antwort. Dazu ein hilfloses Lächeln. Es soll verbindlich wirken. Als Zugabe seiner Aneinanderreihung von Worten, ihm selbst unbegreiflich, unverständlich. Immerhin, Antwort ist Antwort. Und leise genug: Seine Gesprächspartner dürfen nach eigenen Vorstellungen seiner kaum hörbaren Erwiderung einen Sinn unterlegen. Die ihn Umstehenden verabschieden sich bald, was ihn amüsiert. Nein, diese abendlichen Empfänge sind seinen Jahren nicht zuzumuten. Die unverbindlich redseligen Gespräche lassen ihn schmerzhaft das Verstreichen von Zeit spüren, sein Altern. Aber er hat die wiederholte Aufforderung nicht abschlagen können. In seiner mißlichen Situation, jeder weiß ja, daß Ludwig auch ihm die Hetzschrift zutraut, stellt die Einladung eine herzliche und sogar mutige Geste der Witwe dar. Also, ergriffen bedankt man sich.
Langsam schwenkt er seine Füße, stellt sie auf den kühlen Fußboden, richtet sich auf und lauscht für Sekunden den Regungen in seinem Körper. Das längere Verweilen im Bett scheint ihm gutgetan zu haben. Er steht auf, legt sich eine Decke über die Schultern, trägt den Kerzenleuchter zum Schreibpult. Dort liegen zwei unbeendete Briefe, die er gestern nach dem Empfang begonnen hat. Er nimmt eins der Blätter, überfliegt es und greift nach der Feder, um den Brief an seinen Pächter weiterzuschreiben. Die übergelegte Decke erweist sich als hinderlich, er schiebt sie zurück, sie fällt auf den Boden, der Luftzug reißt den anderen Brief vom Pult, er segelt mit den weit ausholenden Schwingungen eines großen Pendels auf den Teppich. Racine sieht dem Papier nach. Er legt die Feder weg, geht zur Tür, bittet Therese, ihm die Wasserschüssel zu bringen. Dann, auf dem Bettrand, hüllt er sich wieder in die Decke ein und wartet auf das Mädchen.
Die Witwe war an dem vergangenen Abend um ihn besorgt. Sie schickte Lecomte zu ihm, als sie sah, wie verloren er bei den jungen Damen stand. Er nahm es gerührt zur Kenntnis, wenngleich ihn ihre Bemühungen anstrengen. Später flüchtete er in den Dianasaal, wo er, ein Buch in der Hand, scheinbar aufmerksam dem Billardspiel zusah. Und er registrierte: Blicke, Kopfnicken, Erkennen. Man erinnert sich seiner. Noch mit Ehrfurcht, auch schon mit Nachsicht. Die uninteressierte Höflichkeit. Er kann sich nicht über mangelnde Achtung beklagen.
Racine ist nicht unzufrieden. Er hat die Gesellschaft nicht gesucht, er verlangt nichts von ihr, er braucht sie nicht. Er ist sich selbst genug geworden. Und er weiß, vor allem sein Altern beschränkt ihn so einsiedlerisch auf sich selbst. Aber seine Unlust an der abendlichen Hofrunde entspringt auch anderen Ursachen. Der Hof ist eine Gesellschaft junger Leute, die er nicht kennt, fremd und laut. Zu seiner Zeit – also hat jeder nur zwanzig Jahre als seine Zeit. Doch noch hat er auch hier Freunde, die er ungern, selbst jetzt nicht, vermissen möchte. Beispielsweise Madame de Maintenon, die Mätresse Ludwigs, eine wunderbare Frau. Und –. Er langweilt sich. Er ist ungeduldig im Umgang mit Bekannten. Gespräche bricht er unvermittelt ab und verläßt, deutlich seine Verärgerung bekundend, das Zimmer, sobald ein Wort ihm dumm und abgeschmackt erscheint. Er ist launisch und nicht mehr bemüht, es zu unterdrücken. Unschlüssig ist er nur bei dem Gedanken, wieweit er seinen Mißmut allein den Jahren und den Gebrechen zuzuschreiben hat, wie sehr er sich nach dem Zustand seiner eigenen Natur veränderte. Der Darm als Weltsicht. Er ist unzufrieden geworden mit seinen alten Erfolgen. Die früheren Anerkennungen scheinen ihm jetzt oberflächlich. Ein taubes Echo, in dem alles versank.
Therese klopft an die Tür, bringt die Waschschüssel herein, stellt sie auf das Schränkchen hinter dem Paravent und verschwindet aus dem Zimmer, nicht ohne nach seinen weiteren Wünschen zu fragen. Er erwidert ihr nichts. Wickelt sich aus der Decke, geht hinter den Paravent und wäscht bedächtig und gründlich sein Gesicht mit dem angewärmten Wasser. Unter der Haut seiner Wangen fühlt er Knoten, diese gelblichen, geldstückgroßen Flecke, die ihm noch nie Schmerzen bereitet haben. Das stimmt ihn zufrieden. Man hat nicht auch ihretwegen Falcon zu rufen, den Arzt.
Die wenigen Haare sind verschwitzt. Er reibt seinen Kopf mit einem Wolltuch ab. Die Jahre machen vorsichtig, und er fürchtet die Erkältung. Mit einer Bürste säubert er die Hände, die Fingernägel, um sie anschließend mit einer Eisenfeile, verzierter Holzgriff, einem Geschenk Catherines, zu kürzen. Das ist langwierig und verlangt doch die ganze Aufmerksamkeit: Er will sich nicht an dem Eisen verletzen. Und er hat an dieser gleichförmig wiederkehrenden Tätigkeit Gefallen gefunden. Mit Hingabe führt er sie jeden Tag aus. Der uneingestandene Grund für diese Akribie, für seine Lust an der Pflege der Hände ist die Angst vor dem unausbleiblich folgenden Teil der Morgentoilette: der Entleerung seines Körpers. Sie ist ihm seit dem letzten Jahr zur Qual geworden. Seine Leibschmerzen wurden unerträglich, und Falcon kennt nur seine üblichen Salzlösungen zum Trinken und Gurgeln. Wenn er nicht überhaupt mit witzig gemeinten Sprüchen verbleibt. (Letzte Gewißheit über Ihren Zustand, Verehrter, hatte der hilflos grinsende Arzt ihm gesagt, werden außer Gott wir alle erst nach der letzten Eröffnung unseres geschätzten Hofhistoriographen haben.)
Die Fingernägel sind untadelig. Racine sucht vergeblich nach einer Unebenheit, mit der er sich weiter beschäftigen kann. Er muß das Eisen fortlegen. Seine tägliche Passion beginnt. Das Nachtgeschirr hat er seit seinem Darmleiden im Schlafzimmer stets zur Verfügung. Eine nachlässige Bequemlichkeit, die, wie er meint, keinen was kostet, aber ihm vielleicht eine schlimme Entwicklung seiner Krankheit erspart. Manchen Morgen muß er bis zu einer halben Stunde auf dem Stuhl seiner Qualen zubringen. Das Ärgerliche ist, daß keiner genau sagen kann, woran er leidet, ob es sich bessern wird, was dagegen zu tun ist. Die Schmerzen sind selten eindeutig zu lokalisieren. Es kann die Leber sein, vielleicht sind es die Nieren, ganz bestimmt aber die Därme. Die machen ihm besonders seit Beginn des Januars zu schaffen (Falcon: Trinken Sie die Salze, mein Bester. Bei diesem Wetter bitte regelmäßiger. Es gibt nichts Besseres. Mein Kollege, der königliche Leibarzt würde Ihnen vermutlich Senfpflaster auflegen. Er heilt nach Methoden, Verehrter, man möchte meinen, er sei ein Republikaner, ein Cromwell.)
Racine ist jetzt neunundfünfzig Jahre, seit wenigen Wochen, und er fürchtet sich, bis an sein Lebensende unter diesen Schmerzen zu leiden. Lebensende, wie eine bekannte Größe auf einer arithmetischen Geraden. Er setzt sich vorsichtig auf den Stuhl, seine Hände halten das hochgeraffte Hemd, und wartet darauf, daß die Marter beginnt. Er lauert ängstlich und angespannt, wann das wilde Tier des Alterns wieder die Krallen in seinen Leib schlagen wird. Er verkrampft sich in der Erwartung seiner alltäglichen Schmerzen. Als er es merkt, bemüht er sich, die Verkrampfung zu lösen. Die Krankheit würde sonst heftiger und bösartiger einsetzen. Er weiß es, die Erfahrung ist der bessere Arzt. Und wie immer hegt er die Hoffnung, daß ihm an diesem Tag die Qual erspart bleibt. Trotz der Erfahrung.
Er versucht sich abzulenken. Boileau kommt ihm in den Sinn. Todkrank ist er. Armer Freund, und dazu seine schlechten Augen. Nein, nein, er will nicht daran denken. Possier, der Advokat, ein lieber Mensch und kann nicht mehr seine Füße heben. Herrgott, ist er denn nur noch mit Krankheiten, Gebrechen, Alter umgeben! Gesund, völlig gesund war er in Neerwinden. Danach? Es war ein allmähliches Wachsen der Krankheit. Die Leber, später die Därme, der ständige Kopfschmerz. Letzteres wohl nur eine Folge. Ja, in Neerwinden noch war er ein vollkommen gesunder Mensch. Da hatte er noch keinen Falcon nötig. Aber was war das schon für eine gute Zeit! Nur in der Pfalz soll das glorreiche Heer schlimmer gewütet haben. Was er in den Niederlanden zu sehen bekam – bestialische Soldaten, übermäßige und sinnlose Verwüstungen, ungerechtfertigte Requisitionen. Und die Offiziere! Was wußte er schon vorher. Jungfer, es ist Krieg. Man hat über ihn gelächelt.
Das Verfahren gegen die drei Offiziere. Eine holländische Bäuerin war vergewaltigt worden, man fand sie dann zusammen mit ihrem Kind in der Stallung tot auf. Die Untersuchung wurde eingestellt, um höhere Interessen nicht zu inkommodieren. Alltag der Armee. Der Bauer, der die drei Offiziere angezeigt hatte, ein Nachbar jener Frau, verübte später – wie der französische Kommandant im Dorf bekanntgeben ließ – Selbstmord. Schuldig des Diebstahls von Militäreigentum. Bemerkenswert daran, daß er sich in seiner Scheune mehr als zwanzigmal eine Forke in den Körper gestoßen haben mußte, so daß sein Leib in zwei Teile zerriß. Schon der zweite Stoß mit der Forke hätte nach Ansicht des Feldschers den Mann innerhalb von Sekunden verbluten lassen müssen.
Racine hatte damals die Suite des Königs für wenige Tage verlassen, um die ländlichen Gegenden kennenzulernen. Ein Bildungsreisender in den Niederlanden. Der Kommandant des Dorfes war durch das Erscheinen des königlichen Historiographen beunruhigt. Daran hatte auch seine Versicherung nichts geändert, daß er derzeit nur privat und völlig eigennützig reise. Zudem habe er sich als Historiograph für belangreichere Ereignisse zu interessieren. Herr Dorfkommandant!
Damals erschien ihm die Annahme des Offiziers vermessen, daß er, der königliche Beamte, dergleichen Auswurf zu Notiz nehmen würde. Über diese Einzelheiten des niederländischen Feldzuges hatte er zwar auch berichtet, jedoch nicht in der Historie und nur an wenige Freunde, Boileau, auch an Nicolas in Port-Royal. Und nur andeutungsweise. Hier eloquent zu detaillieren wäre unangebracht. Vielleicht gar Schlachtengemälde liefern!
Und schließlich, was hätte er ausrichten können. Er, ein kleiner Geschichtsschreiber, gegen die allmächtige, allgegenwärtige Armee. Nein, da sind keine Schuldgefühle, weder damals noch heute. Der Feldscher hatte ihn vor der Scheune in den Bericht einsehen lassen und ihn dabei höhnisch angestarrt. Was sind das für Menschen, kann es Schlimmeres geben! Vor dem Scheunentor war Posten bezogen worden, um jedem Unbefugten den Eintritt zu verwehren. Möglicherweise wäre er befugt gewesen, sich das Tor öffnen zu lassen. Seine Stellung gegenüber den militärischen Rängen war nicht eindeutig bestimmt. Einige Privilegien, seine Nähe zur königlichen Suite – sicher, man hätte ihm letztlich den Blick auf den zerfleischten Kadaver nicht verwehren können. Aber wozu. Was dann. Sollte er in die Scheune gehen, um dann Mord, Mord zu schreien? Die reinen Helden in der Literatur. Auf der Bühne ist es angebracht. Helden. Tat und Tod. Er ist kein Schauspieler.
Das Scheunentor zu öffnen, fehlte es ihm nicht an Mut, ihn hinderte Lebenserfahrung. Und bedenke die Folgen, prudenter agas. Schließlich hat ein jeder die Möglichkeit, ein solches Scheunentor aufzureißen, um sich von irgendeiner Widerlichkeit, sagen wir: Unglaublichkeit, zu überzeugen. Daß in den Verliesen des Sonnenstaates nicht nur Verbrecher liegen, daß gefoltert wird, daß Militär und Polizei sich bei ihren Verhören gewisser Praktiken der verfemten spanischen Inquisition bedienen – welcher Narr möchte ein Tor aufreißen. Jeder weiß ja einiges, kennt den oder jenen Unglücklichen. Weiß aber auch, hier nachzuforschen wäre Staatsverleumdung.
Und wozu auch. Nur Idioten und Kinder verwundern sich über die Welt. Die Bestialität der Polizei, der Armee ist abscheulich, ekelhaft, aber untauglich für Meditation. Allenfalls für ein Gespräch mit gleichermaßen Enttäuschten: eine Andeutung, eine ironische Bemerkung, ein verzweifeltes Lachen, Charakter en passant, man weiß. Vielleicht ist die Fähigkeit, ein Verbrechen verschweigen zu können, die Bedingung der menschlichen Rasse, in Gesellschaft zu leben. Das »höhere Interesse« eines Staates anzuerkennen, ist bestialisch möglicherweise, aber die Voraussetzung seiner weiteren Existenz. Der des Staates, des Individuums ohnehin. Und der verdiente Staatsbürger ist zu ehren um seiner schweigenden Mitwisserschaft willen. Da ist es süß, für das Vaterland zu sterben, um ihm nicht anderweitig dienen zu müssen.
Die Scheunentore zu öffnen, um nie wieder schlafen zu können, um sich vor sich selbst zu ekeln, auszuspeien? Nein, es widerspricht der Vernunft, Kenntnisse zu erlangen, zu erzwingen, die uns unerträglich sind. Mächtigere als er hatten sich Augen und Ohren verstopft, um die Welt für gut befinden zu können. Er hatte dem höhnisch lächelnden Militärarzt den Bericht schweigend zurückgegeben und war zu seinem Quartier gegangen. Die Übelkeit kam erst, als sein Blick auf eine Mistforke fiel, die an die Stallung seiner Gastgeber gelehnt war. Drei schmutzbedeckte eiserne Zinken, fußlang, vierkantig, spitz auslaufend. Wieviel ist zwanzig mal drei. Er erbrach grünlichen Magensaft.
Zwei Tage später gehörte er wieder zur königlichen Suite. Um einen weiteren Urlaub bat er nicht.
Er starrt auf den Paravent, die gemusterte Seidentapete. Die unentwegt sich wiederholenden Bäume beginnen vor seinen Augen zu hüpfen. Er atmet schwer. Sitzt auf dem Zimmerklo zusammengesunken und ergeben. Ein Kloß von Erinnerungen und Schmerzen. Vielleicht hier drauf zu sterben. Nein, zuvor noch ins Bett krauchen. Ach was. Die Briefe aus den Niederlanden. Man hatte vorsichtig zu sein. Falls es der König, was nie auszuschließen war, erfahren würde – mit Ludwig hatte er auch schon zu jener Zeit genügend Ärger. Sein damals erneut beginnendes Arrangement mit dem Kloster Port-Royal ist vom Hofe ungnädig bemerkt worden. (Eiferer und Heilspriester alles. Ich hoffe, daß man in Port-Royal über dem Geschreibsel nicht vergißt, allein auf die himmlischen Gefilde und die irdischen Weinfelder das Augenmerk zu richten.) Ludwig verwies auf die Hugenotten, die man auf Anraten der Jesuiten wieder stärker kontrolliert. Dragoner werden in ihre Häuser gesetzt. Die Kinder werden ihnen weggenommen und vom Staat erzogen, selbst von den käuflich erworbenen Ämtern müssen sie zurücktreten, ihre Ehen gelten für Kirche und Gesellschaft als nicht vollzogen. Racine weiß auch, daß die Jesuiten das stille Port-Royal als die gefährlichere Bastion ansehen, so verderblich für sie wie unangreifbar. Denn die meisten der Großen Familien sind nicht gewillt, der Kirche nochmals allzu willfährig zu folgen, und die Jansenisten des Klosters Port-Royal stellen ihnen für die ständige Konfrontation mit Rom ein ergiebiges, kleines Spielbrett dar: schlägst du meine Bauern, schlag ich … Man soll sich da nicht täuschen. Trotzdem, die Andeutungen Ludwigs bezüglich der Hugenotten waren und sind eine leere Drohung. Das rechtgläubige Kloster mit den dissidierenden Protestanten zu vergleichen! Das kann auch ein XIV. sich nicht erlauben. Nicht vor dem Hof. Überdies, sagt er sich, haben die Dunkelmänner keine Schriftsteller, jedenfalls keinen Pascal und Boileau. Auch keinen Racine. Um mit ironischen Schriften, bissigen Kommentaren die Öffentlichkeit für sich einzunehmen, fehlt ihnen nichts weniger als alles.
Allerdings hat er auch nicht erwartet, daß man seine Aussöhnung mit Nicolas, mit dem Kloster so mißmutig aufnehmen würde. Vom, immerhin, Erfolg verwöhnt, glaubte er, man werde stillschweigend seine so sehr persönliche Entscheidung akzeptieren. Empfand er es doch als kaum mehr denn eine entschuldigende Geste für ein paar Jugendtorheiten, für etwas erhitztes Blut in der Polemik gegen das verfemte Kloster, für seinen Vorwurf gesellschaftlicher Impassibilität (mit achtzehn, zwanzig, da ist es nicht bösartig, sondern rührend), mit dem er sich dazumal von Port-Royal lossagte. Der Hof spricht von einem Kniefall vor der strengen, unduldsamen Lehre seiner Kindheit, vor der weltentsagenden Disziplin der Jansenisten. Auch, daß er damit seine Enttäuschung über den Hof, die Libertins, vielleicht seine Abkehr von der Bühne bekunden wolle. Das ist alles in allem großer Unsinn. Natürlich. Es war nur eine Geste, eine übliche, konventionelle Theatergeste.
Man klopft an die Tür, Therese fragt, ob er das Frühstück wünsche. Racine schrickt zusammen. Später, bittet er, später. Er beeilt sich, ihr zu antworten. Er ist unsicher, ob er die Zimmertür zugeschlossen hat. Ich melde mich, Therese, ruft er. Er legt beide Hände auf seinen Leib, streicht behutsam über die weichliche Haut, die dicken Wülste, die Schamhaare, als wolle er die befürchtete Rebellion der darunterliegenden Organe beschwören, einschläfern. Während der kreisenden Bewegung seiner Hände betrachtet er seinen Bauch. Überhängend, ein schlaffes, weichliches Fettgewebe. Der Schauplatz der Schlacht. Schlachtplatz. Letztes Heldentum im Rückzug auf den Wanst. Verinnerlichter Lebenskampf. Wie die wilden Tiere, denkt er. (Er hatte sie vor vielleicht zwanzig Jahren in der Stadt gesehen. Ein großer hölzerner Bau inmitten des Jahrmarktsplatzes. Vergleichbar einer halbierten Tonne aus dem Keller Gargantuas. Über steile, enge Treppen gelangte man an der Außenwand nach oben zur Plattform, die sich rund um den unbedachten, ansonsten aber tür- und fensterlosen Bau zog, und von der aus man in das Innere blicken konnte. Dort lagen – für den Betrachter wie in einer tiefen Höhle – verschiedene wilde Tiere friedlich nebeneinander, Raubkatzen. In die Stadt geholt von einem Konsortium Pariser Geschäftsleute. Sein Freund Possier, der ihn begleitete, war einer der Initiatoren. [Der Aufwand ist nicht unbeträchtlich, mein Lieber. Immerhin, ein Transport aus Nordafrika. Aber unsere Geschäftsbücher halten einen Vergleich mit der Tabakgesellschaft aus.] Von Zeit zu Zeit verkauften oder vielmehr versteigerten die Eigentümer der Menagerie, Araber, rohe Fleischstücke. Diejenigen des Publikums, die Fleisch erwerben konnten, warfen es selbst oder durch die Hilfe eines Araberjungen den Tieren vor. Die schläfrig nebeneinander ruhenden Raubkatzen, die die Schaulust der Pariser mit der routinierten Würde eines alten, aristokratischen Geschlechtes hinnahmen, richteten sich, sobald ein Herr aus dem Publikum oder jener Araberjunge ein blutiges Fleischstück über die Öffnung der Höhle hielt, auf, sprangen die Wände hoch, rissen an den Holzplanken, fielen übereinander her, um schließlich, wenn das rote und sie erregende Fleisch zu ihnen hinunterfiel, in einen tollwütigen, orgiastisch zuckenden Kampf zu fallen, dessen Keuchen, Jaulen und Schreien die Holzwände verstärkt wiedergaben und das noch Sekunden nach dem schnell verrauschenden Taumel über dem Rand der Höhle nachzuklingen schien. Was aber den Besucher auf der oberen Plattform mehr als alles erschreckte, was diese Marktplatzsensation ihm zu einem aufreizenden Schauspiel machte, das war das – auch bei wiederholtem Besuch nicht zu verleugnende – Gefühl, selber an diesem Kampf beteiligt, in den Strudel der zuckenden, geschmeidigen Katzenleiber hineingerissen zu sein. Der Holzbau schwankte und erzitterte unter den wütenden Schlägen seiner Bewohner, vibrierte nervös wie in Erregung nach dem blutenden Fleisch, bäumte sich auf mit den weit emporschnellenden Körpern der Raubtiere. Man spürte, wie das Holz splitterte. Die Balken begannen nachzugeben. Die Plattform schwankte unregelmäßig unter dem Ansturm und den rasenden Schlägen der exotischen Tiere. Dazu die lauten, befehlenden Rufe der Araber, ihre fremden, ungewohnten Schreie, die Ohnmachten und das hysterische Kreischen der Besucherinnen – all dies bewog den Betrachter unwillkürlich, seine Hände um das Geländer zu klammern, brachte ihn bis an die Grenze, die immer verschwimmendere, unwirklich werdende und in der Erinnerung fast verschwindende Grenze, die ihn von dem leidenschaftlichen Kampf der Tiere trennte. Die Attraktion, die sich dem Besucher bot, war die des Voyeurs. Es waren der Schrecken und der Reiz, während der gesamten Vorführung im Ungewissen zu sein, ob er nicht schließlich von dem sich immer mehr verstärkenden Sog des Geschehens, von der Ekstase der Bestien in die Höhle des Schauspiels hineingerissen, von dem Ausbruch des Blutdurstes fortgeschwemmt würde.
Der Einfall, das Tierfutter an die Besucher zu versteigern, kam von Possiers Gesellschaft und wurde gegen den Widerstand der um ihre Tiere besorgten Araber durchgesetzt.)
Racine versucht, durch behutsames Tasten zu ergründen, wo sich jetzt die Schmerzen in seinem Körper verborgen halten. Seine Finger drücken in das Fleisch. Er friert. Er steht auf, holt sich die Decke, die auf dem Boden vor seinem Bett liegt, und legt sie sich um die Schultern. Dann nimmt er seinen Platz wieder ein. Er hat nur wenig Hoffnung, an diesem Morgen seinen Darm zu entleeren, doch er setzt sich nochmals auf den Stuhl mit dem Nachtgeschirr. Seinen Golgathathron. Er will nicht die Liturgie seines Tages verletzen. Den vorgeschriebenen Kampfregeln entsprechen. Flucht ist hier nicht einmal eine Denkmöglichkeit. Die Feindlichen sind miteinander verwachsen. Gemeinsames Zeitenende, wer immer die tödliche Wunde erhält. In jedem Fall Selbstmord. Aber aus Gewohnheit schlägt man nach dem Gegner.
Wenn seine Bemühungen erfolglos bleiben, wird der Schmerz wütender beginnen. Unersättlich nach anderen Organen greifen. Und er ist bereit, sich nicht dagegen aufzulehnen, zu gehorchen.
Die Verbeugung vor Port-Royal war keine Heimkehr gewesen, kein Kniefall eines gealterten, reuigen Mannes. Das erbärmliche Schauspiel des verlorenen und wiedergewonnenen Sünders wird er Versailles und Paris nicht geben. Er ist kein La Fontaine, meine Herren. Das Kloster gehört zu seinem Leben, und er wollte die wenigen Striche, die diesem Bild seines Anfanges noch fehlten, mit der versöhnenden Geste hinzufügen. Auch dann, wenn dieser Schritt sowohl vom Hof wie von seinen alten Freunden und Erziehern mißdeutet wird, selbst dann, wenn sich unsinnige Mutmaßungen daran schließen. Die Enttäuschung, die Versailles für ihn, einen kranken Mann, geworden ist, hat vielleicht sein Entgegenkommen befördert. Doch er kehrt nicht zurück.
Er zieht seinen Bauch zusammen. Die Augen hält er geschlossen. Für Sekunden vermeidet er es zu atmen und lauscht. Die Därme sind regungslos und still. Er spürt, wie sich auf seiner Stirn Schweißtropfen bilden.
Trotz der Krankheit fühlt er sich kräftig. So kräftig und unbeugsam wie in jenem Jahr, als er Catherine heiratete, die er nicht liebte, und Marie verließ, deren Atem er noch heute zu verspüren meint. Er verließ sie an dem Tag, an dem er beschlossen hatte, eine Arbeit zu beenden, weil er nicht weiter imstande war, länger zu warten. Zu hoffen. Er schloß sie ab wie einen Brief, an dem man lange geschrieben und so viele neue Blätter hinzugefügt und so oft die einzelnen Worte und Buchstaben verbessert, ausgewechselt und nachgezogen hatte, bis man unversehens, aber nicht unerwartet erfuhr, daß es keinen Adressaten mehr gibt, keinen. Nicht für seinen Brief. Damals meinte er, mit Masken zu sprechen, mit freundlichen Masken, hinter deren Augenhöhlen der Wind des Vergessens längst seine gründliche Säuberung vollzogen hatte. Die Tränen, die er über die Masken laufen sah und die überdeutlich Spuren in der Schminke hinterließen, gaben ihm keine Antwort. Sie waren die Hinterlassenschaft eines versickerten Lebens, nur für wenige Momente noch sichtbar.
Er flieht blindlings. Was hat er schon einzutauschen! Am gleichen Tag, an dem er die für ihn lange unerklärliche Herkunft der Tränen begriff und er seine Zwiesprache mit den ausgestorbenen Augenhöhlen abbrach, verabschiedet er sich von Marie de Champmeslé und heiratet wenige Monate später Catherine, die er kaum kennt und nie geliebt hat. Sie war ihm von seinem Beichtvater empfohlen worden, und er hatte sogleich um sie angehalten. Er wollte von einem Tag auf den anderen den Zögling des Paters, das aufrichtige, haushälterische Mädchen, heiraten. Schnell, nur schnell. Eine Flucht, deren Ziel ihm barbarisch erscheint. Er heiratet eine Unbekannte.
Über zwanzig Jahre lebt er mit ihr zusammen. Er schätzt Catherines Ruhe und Ausgeglichenheit, ist erfreut, wenn er sie mit den Kindern spielen sieht, und dankbar, wenn sie nachts, von seinem unruhigen Schlaf geweckt, in sein Zimmer kommt, ihn fragt, ob er Schmerzen habe, um dann, nach seinem unwilligen Brummen, wortlos aus dem Raum zu gehen. Sie ist ihm ein Freund geworden, den er nicht entbehren will. Er achtet sie, die Mutter seiner sieben Kinder. Aber er liebt sie nicht.
Marie hat er verlassen, um sich loszureißen von dem, was er, er wußte es damals bereits, bald schmerzlich vermissen würde. So war er rücksichtslos gegen sich und andere geworden, nur, um nicht zu zögern. Um nicht an seiner für ihn ungeheuren und entsetzlichen Entscheidung zu zweifeln.