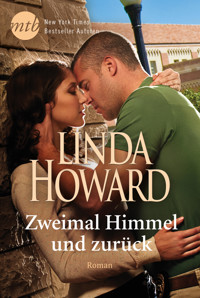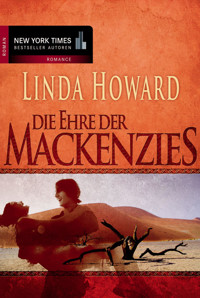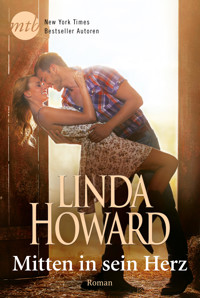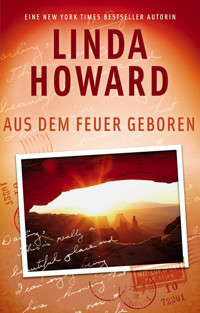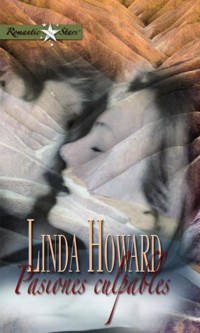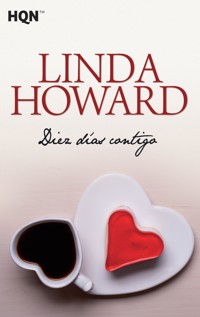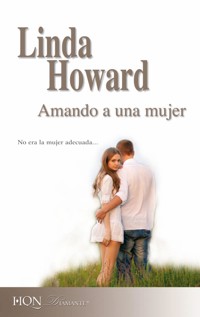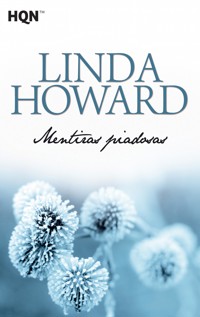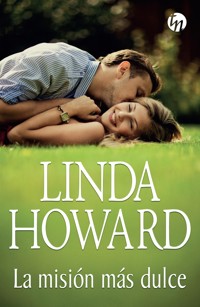5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Aus Gefahr wird Verlangen ...
Jenner Redwine hat endlich einmal Glück. Der Gewinn eines beachtlichen Lotterie-Jackpots wird ihr ein sorgenfreies Leben bescheren - denkt sie. Doch an dem Geld zerbrechen alte Freundschaften und die junge Frau weiß schon bald nicht mehr, wem sie eigentlich trauen kann.
Jahre später beschließt Jenner, mit ihrer Freundin Sydney eine Kreuzfahrt zu machen. Doch was als Urlaub beginnt, entpuppt sich schnell als Horrortrip: Die Freundinnen werden Opfer einer Geiselnahme. Der Entführer droht, Jenner zu töten, wenn sie nicht kooperiert. Ein gefährliches Spiel nimmt seinen Lauf - das schon bald zu einem leidenschaftlichen wird. Denn plötzlich wird aus der anfänglichen Furcht Faszination und aus Verachtung wird Verlangen ...
Jetzt erstmals als eBook. Weitere Titel von Linda Howard bei beHEARTBEAT u. a. "Mordgeflüster", "Heißkalte Glut", "Danger - Gefahr".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Erster Teil Losglück
1
2
3
4
5
Zweiter Teil Glücklos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dritter Teil Schweres Los
31
32
33
34
Leseprobe
Weitere Titel der Autorin
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Heiße Spur
Mitternachtsmorde
Ein gefährlicher Liebhaber
Ein tödlicher Verehrer
Auch Engel mögen’s heiß
Mister Perfekt
Heißkalte Glut
Danger – Gefahr
Über dieses Buch
Jenner Redwine hat endlich einmal Glück. Der Gewinn eines beachtlichen Lotterie-Jackpots wird ihr ein sorgenfreies Leben bescheren – denkt sie. Doch an dem Geld zerbrechen alte Freundschaften und die junge Frau weiß schon bald nicht mehr, wem sie eigentlich trauen kann.
Jahre später beschließt Jenner, mit ihrer Freundin Sydney eine Kreuzfahrt zu machen. Doch was als Urlaub beginnt, entpuppt sich schnell als Horrortrip: Die Freundinnen werden Opfer einer Geiselnahme. Der Entführer droht, Jenner zu töten, wenn sie nicht kooperiert. Ein gefährliches Spiel nimmt seinen Lauf – das schon bald zu einem leidenschaftlichen wird. Denn plötzlich wird aus der anfänglichen Furcht Faszination und aus Verachtung wird Verlangen …
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Nachtkuss
Aus dem Amerikanischen von Christoph Göhler
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „Burn“
Originalverlag: Ballantine Books, New York
This translation published by arrangement with Ballantine Books, an Imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2010 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Blanvalet Verlag, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © GettyImages-971774658; GettyImages-470697314
E-Book-Produktion: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8530-4
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes »Er wird dich jagen« von Alexandra Ivy.
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Gewidmet den reizenden Menschen, die im Weihnachtsladen von Pigeon Forge, Tennessee, arbeiten, einem wahrhaft magischen Ort – danke, dass ich für einige Figuren in diesem Buch eure Vornamen verwenden durfte.
Und unseren geliebten Golden Retrievern Honey und Sugar, die jetzt gemeinsam im Himmel herumtollen. Ganz bestimmt kommen alle Hunde in den Himmel, denn wo sollten Wesen, die zu so reiner Liebe fähig sind, sonst hin?
Prolog
Gegenwart, an Bord der Silver Mist
Das war keine Kreuzfahrt, sondern ein Höllentrip.
Jenner Redwine saß wie gelähmt auf dem Barhocker, versuchte sich in Erinnerung zu rufen, was Bridget ihr eingeschärft hatte, und bemühte sich, es mit dem Albtraum in Einklang zu bringen, der sich gerade abspielte. Bridget hatte ihr erklärt, dass irgendwann im Lauf des Abends ein Mann und eine Frau in Streit geraten würden. Die Frau, Tiffany, würde verschwinden, und dann würde der Mann, Cael, Jenner ansprechen. Sie hatte die Anweisung bekommen, sich interessiert und aufgeschlossen zu zeigen. Sie sollte alles tun, was er verlangte, sonst würde Syd, ihre einzige wahre Freundin auf dieser Welt, umgebracht werden.
Die Szene entwickelte sich ganz und gar nicht wie erwartet. Tiffany machte keine Anstalten, die Bar zu verlassen. Sie zeterte, stampfte mit dem Fuß auf und steigerte sich, scheinbar alkoholisiert, in einen Wutanfall, obgleich sie keineswegs betrunken war. Sie beschuldigte Cael, mit Jenner geschlafen zu haben, obwohl sie erst vor wenigen Stunden an Bord gegangen waren und – wahrscheinlich – noch niemand mit irgendwem geschlafen hatte. Weil Cael Jenner angesprochen hatte, bevor er mit Tiffany zu streiten begann, hatte sie natürlich nicht geahnt, wer er war. Er hatte neben ihr im Gedränge an der Bar gestanden, um eine Bestellung aufzugeben, und nichts zu ihr gesagt, was irgendwie zweideutig geklungen hätte. Nein, abgesehen von diesem vor allen Leuten ausgetragenen Streit entwickelte sich der Abend ganz und gar nicht so, wie Bridget es angekündigt hatte.
Cael würde noch an den Details feilen, hatte Bridget gesagt. Das hatte er getan, so viel stand fest. Wahrscheinlich war es ganz gut, dass Jenner keine Ahnung hatte, was als Nächstes passieren würde. Sie war keine Schauspielerin und konnte nicht aus dem Stand eine filmreife Szene improvisieren. Die anderen konnten das offenbar sehr wohl.
Der Mann, der Cael vorhin angeschubst hatte, mischte sich jetzt genauso laut und genauso heftig lallend ein und fuhr Tiffany an, sie würde Unsinn reden und solle in ihre Kabine verschwinden, um sich auszuschlafen. Er war offenbar entschlossen, die Schuld für den lautstarken Streit auf sich zu nehmen, was, selbst wenn er betrunken war, eine nette Geste war. Vielleicht gehört er ja auch zu ihnen, dachte Jenner. Da sie ihn nicht kannte, hätte er weiß Gott wer sein können.
Wirklich unverdächtig waren nur die Menschen, die ihr schon länger bekannt waren, begriff sie. Sie hatte zwar keine Ahnung, wem sie hier nicht trauen konnte, aber sie wusste definitiv, wem doch, auch wenn ihr das herzlich wenig nutzte. Was auch gespielt wurde, sie musste auf Gedeih und Verderb mitspielen, wenn sie Syd nicht im Stich lassen wollte, denn ihre Freundin schwebte in Lebensgefahr. Am liebsten hätte Jenner sich betrunken; im Zustand der Trunkenheit hätte sie nicht so viel Angst ausgestanden.
Wenn sie nur eine Idee gehabt hätte, wie sie diese Menschen wieder aus ihrem Leben vertreiben konnte – aus ihrem und Syds. Stattdessen stand sie Todesängste aus, dass die ganze Sache für sie und Syd übel ausgehen würde, ganz gleich, was sie unternahm. Wenn sie wenigstens gewusst hätte, was man von ihr erwartete, hätte sie sich vielleicht nicht so sehr davor gefürchtet und wäre sich nicht ganz so hilflos vorgekommen. Das Gefühl von Hilflosigkeit konnte sie einfach nicht leiden, am allerwenigsten bei sich selbst.
Vielleicht war es an der Zeit, wieder die Initiative zu ergreifen, so wie vorhin, als sie auf den Balkon getreten war, während Faith Wache gestanden hatte. Sie glitt von ihrem Hocker und versuchte sich an Cael vorbeizuschieben, als wollte sie sich unbemerkt aus dem Staub machen, aber Tiffany kreischte sofort auf: »Versuch nicht, dich zu verdrücken, als wärst du völlig unschuldig! Ich habe genau gesehen, wie du ihn angeflirtet hast ...«
»Ich kenne Sie überhaupt nicht«, fiel ihr Jenner ins Wort, während Cael sich umdrehte und ihr unauffällig den Fluchtweg abschnitt, indem er einen Schritt zur Seite trat. »Und ihn kenne ich auch nicht, also lassen Sie mich gefälligst in Frieden.« Sie fing den Blick einer Frau namens Leanne Ivey auf, die sie aus Palm Beach kannte, und zuckte ratlos mit den Achseln, als hätte sie keine Ahnung, was das alles sollte. Leanne reagierte mit einem mitfühlenden Lächeln.
Plötzlich erschien Faith in der Menge, stellte sich zu Tiffany, legte den Arm um die Schultern der schwarzhaarigen Frau und begann leise auf sie einzureden. Tiffany brach sofort in Tränen aus und ließ sich von Faith wegführen, womit das Drama beendet war. Fast im selben Moment humpelte Faiths Ehemann Ryan auf Cael zu. »Es war ausgesprochen galant von Ihnen, dass Sie ihr die Suite überlassen haben«, verkündete er mit voller Stimme und gerade so laut, dass die Umstehenden ihn verstehen konnten.
Cael zuckte mit den Achseln. »Ich konnte sie ja schlecht rauswerfen, oder?« Er stand immer noch so, dass Jenner zwischen ihm und Ryan eingekeilt war. Die beiden hatten sie damit so in die Zange genommen, als hätte jeder einen Arm gepackt und festgehalten. Nicht dass es wirklich zählte. Auch wenn ihrem Gesicht deutlich anzusehen war, dass sie gern verschwunden wäre – sie konnte nirgendwo hin.
Die Silver Mist war ein großes Schiff voller Menschen mitten auf dem Meer. Selbst wenn diese Leute nicht ihre Freundin in der Gewalt gehabt hätten und Jenner ihnen tatsächlich entkommen wäre, hätte sie nirgendwohin fliehen können. Cael würde sie finden, wo sie sich auch versteckte. Sosehr es ihr auch widerstrebte, bei diesem Spiel mitzumachen, sie wollte lieber nicht wissen, wozu er fähig war, wenn er nicht seinen Willen bekam.
»Bei unserer Reservierung gab es eine Verwechslung«, fuhr Ryan fort. »Jetzt haben wir eine Suite mit zwei Schlafräumen statt mit einem bekommen. Wenn Sie möchten, können Sie den freien Raum haben.«
»Das ist überaus großzügig. Aber ich will erst nachfragen, ob es noch eine freie Kabine gibt. Wissen Sie zufällig, ob das Schiff ausgebucht ist?«
Jenner hätte am liebsten laut aufgeschrien. Die beiden Männer unterhielten sich so unbefangen, als wären sie sich bei einer Party über den Weg gelaufen. Niemand außer ihr ahnte, was sich hier wirklich abspielte. Vermutlich hatten die beiden es genauso geplant, aber dieses Geplauder wetzte wie Sandpapier an ihren Nerven.
Ryan zog eine Schulter hoch. »Nein, tut mir leid. Aber wenn sonst nichts mehr frei sein sollte, können Sie auf jeden Fall zu uns ziehen. Ich habe das schon mit Faith besprochen. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, ob ihr das recht ist.« Erst jetzt sah er Jenner an und schenkte ihr ein freundliches, fast mitfühlendes Lächeln. »Ein ganz schön aufregender Start für eine Kreuzfahrt, nicht wahr?«
»Ziemlich explosiv«, bestätigte sie und versuchte noch einmal, sich seitlich an den beiden vorbeizuschieben. Sie fühlte sich zwischen den riesigen Männern so beengt, dass sie Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Sie nahmen ihr im wahrsten Sinn des Wortes die Luft, und sie musste dringend durchschnaufen. Sie hatte das Gefühl, zwischen ihnen zermalmt zu werden, dabei berührten die beiden sie nicht einmal. Und dann ...
... umfasste Ryan ihren Ellbogen in einer scheinbar fürsorglichen Geste, mit der er sie gleichzeitig festhielt. »Wurden Sie einander schon vorgestellt, oder sind Sie aus heiterem Himmel ins Kreuzfeuer geraten?«
»Nein, wir kennen uns noch nicht«, antwortete Cael, obwohl Ryan Jenner angesprochen hatte.
»Das macht die ganze Szene noch lächerlicher, nicht wahr?« Ryan schickte ein kurzes, bedauerndes Lachen von Mann zu Mann hinterher. »Jenner Redwine, das ist Cael Traylor.«
»Sehr erfreut.« Cael streckte die Hand aus, und Jenner blieb nichts anderes übrig, als sie zu schütteln. Seine festen warmen Finger legten sich um ihre, und sie spürte die leichten Schwielen in seiner Handfläche. Als sie aufsah, blickte sie in kalte blaue Augen, die jede Bewegung registrierten und jedes noch so kleine Zucken in ihrem Gesicht bemerkten.
Sie hatten die Streitszene völlig umgeschrieben, begriff sie, weil sie und Cael auf diese Weise sympathischer wirkten, als wenn er Tiffany den Laufpass gegeben und sich gleich danach an sie herangemacht hätte. Offenbar hatte Bridget Jenners Kommentar weitergegeben, dass es nicht ihre Art sei, sich mit Schleimern einzulassen. Schließlich sollte niemand bei ihrer »unerwarteten Romanze« Verdacht schöpfen. Also hatten sie Tiffany als aufdringliche Betrunkene auftreten lassen und damit den Zuschauern das neue Pärchen sympathisch gemacht. Nun waren sie einander sogar offiziell vorgestellt worden, und das von einem Mann, der allem Anschein nach absolut harmlos und wohlerzogen war.
Aalglatt, dachte sie grimmig. Diese Leute waren aalglatt. Sie durfte sie auf keinen Fall unterschätzen und würde bei allem, was ihnen noch einfiel, mitspielen müssen. Das hieß allerdings nicht, dass sie bedingungslos kapitulieren und sich tot stellen würde; auch das war nicht ihre Art.
Sie musste nur abwarten, bis Syd außer Gefahr war. Sie klammerte sich an den Gedanken, dass Syd unverletzt freigelassen und sie selbst irgendwann eine Gelegenheit bekommen würde, diesen Menschen heimzuzahlen, was sie ihr und ihrer Freundin angetan hatten. Schon die Vorstellung, es könnte anders enden, hätte sie gelähmt – und das durfte sie keinesfalls zulassen. Bis sich ihr eine solche Gelegenheit bieten würde, blieb ihr nichts anderes übrig, als alles zu tun, was Cael ihr befahl.
Nur ihr Überlebensdrang – und ihre Rachegelüste – hinderten sie daran, laut aufzuschreien. Stattdessen plauderte sie weiter mit Ryan und Cael, wobei sie das Gespräch für das immer noch neugierig lauschende Publikum möglichst flach und unzusammenhängend hielten. Cael dankte Ryan nochmals für dessen Angebot, die freie Kabine in ihrer Suite zu nutzen, und wandte sich dann ab, um Jenners Drink und den von ihm bestellten Ghostwater von der Bar zu nehmen.
Er warf einen Blick auf den Ghostwater, verzog das Gesicht und stellte ihn zurück. »Der war für Tiffany«, sagte er zu Jenner. »Sie hatte vorhin einen und wollte unbedingt noch einen zweiten trinken. Ich habe jetzt also aus nächster Nähe erlebt, wie stark und schnell sie wirken.«
Sie nickte, antwortete aber nicht. Er sollte sich für seine Instant-Romanze ruhig ein bisschen ins Zeug legen.
Er sah sich in der überfüllten Bar um. Größtenteils hatten die Anwesenden ihre Gespräche wieder aufgenommen. Die Musik hatte ebenfalls wieder eingesetzt. Er nickte einigen Gesichtern zu – waren es bloße Bekannte oder gehörten sie zu seiner Truppe? – und meinte dann: »Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Ich könnte etwas Bewegung gebrauchen.«
»Gehen Sie nur«, antwortete Ryan, bevor Jenner ablehnen oder zustimmen konnte. »Ich sehe lieber mal nach, wie Faith mit Tiffany zurechtkommt.«
Nachdem sich auf dem Lidodeck zu viele Menschen und Liegestühle drängten, fand sich Jenner wenig später auf dem Sportdeck wieder, wo sie neben Cael auf und ab ging. Obwohl das Sportdeck direkt über dem Lidodeck lag, war der Geräuschpegel hier deutlich niedriger, und sie hatten kaum Gesellschaft. Sie wechselten kein Wort; stur geradeaus blickend stapfte sie dahin, bis er sie schließlich am Arm zurückhielt und sie zwang, langsamer zu gehen. »Das sieht fast so aus, als wollten Sie vor mir davonlaufen.«
»Was Sie nicht sagen«, erwiderte sie sarkastisch. Es ärgerte sie ungemein, dass seine Stimme so weich und tief und er selbst so groß und gutaussehend und elegant war. Sie hatte einen ganz gewöhnlichen Gauner erwartet, der ihr auf den ersten Blick unsympathisch gewesen wäre. Schließlich war er ein Kidnapper und damit krimineller Abschaum. Ihr Herz hämmerte wie wild vor Angst – und vor Anspannung, weil sie wenigstens aus der Ferne den Eindruck erwecken musste, sie würde sich gerade auf eine Kreuzfahrt-Romanze einlassen.
»Denken Sie an Ihre Freundin«, erwiderte er scheinbar beiläufig, aber noch leiser als vorhin. Die Brise trug alle Worte weiter, und hier oben wehte der Fahrtwind des Schiffes, der ihr die Haare aus dem Gesicht blies, noch stärker. Fröstelnd rieb sie sich mit den Händen über die nackten Arme.
»Ich denke ständig an sie. Sonst hätte ich Sie längst ins Meer gestoßen.«
»Dann sollten Sie noch inniger an sie denken! Bisher jedenfalls verkaufen Sie unserem Publikum erbärmlich schlecht, dass es zwischen uns gefunkt hat.«
»Wem soll ich hier denn irgendwas verkaufen? Hier oben ist doch niemand«, schoss sie zurück, und damit hatte sie mehr oder weniger recht. Ein paar vereinzelte Pärchen schlenderten genau wie sie an der Reling entlang, außerdem hatte sich ein Raucher hierher zurückgezogen, der allein abseitsstand. Sie war eben keine so gute Schauspielerin, wie er sich gewünscht hätte, da half keine noch so finstere Drohung. Anders als diese Leute war sie nicht in der Lage, auf Kommando jemand anderen zu verkörpern.
»Wann Sie wem was verkaufen müssen, entscheide ich, nicht Sie. Und ich will, dass Sie jetzt damit anfangen.« Völlig mühelos zog er sie herum, bis sie ihn ansehen musste und so nah vor ihm stand, dass seine Körperwärme sich um sie legte wie eine Decke. Das Schiff war hell erleuchtet, aber die tiefe Nacht, die sie umgab, zog scharfe Schatten über sein Gesicht und ließ seine Züge noch härter und strenger wirken. Er sah sie lange an. Plötzlich atmete er tief ein, legte die Hände an ihre Taille und zog sie an seinen Körper. »Sie nehmen die Gesundheit Ihrer Freundin nicht so ernst, wie Sie sollten.«
»Ich habe alles getan, was Sie verlangt haben!« Auch wenn es ihr missfiel – sie hatte mitgespielt. Ihre Stimme zitterte leise. Sollte das heißen, dass sie Syd schon etwas angetan hatten?
»Küssen Sie mich, als würden Sie es wirklich wollen«, befahl er und senkte langsam den Kopf.
Diesmal kam sie seinem Befehl nicht nach. Sie konnte es einfach nicht. Auch wenn sein Atem angenehm sauber und sein Mund warm und seine Lippen fest waren, konnte sie nicht vergessen, wer und was er war und was seine Komplizen mit Syd angestellt hatten. Steif und mit angehaltenem Atem stand sie vor ihm, die Arme an die Seiten gepresst, und ließ sich küssen. Falls er auch nur einen Funken Mitgefühl besaß, musste er merken, dass sie Todesängste ausstand, aber vermutlich war für Cael jeder Funke Mitgefühl ein Funke zu viel.
»Ihre Freundin«, knurrte er über ihrem Mund und vertiefte den Kuss noch, indem er den Kopf zur Seite neigte und mit seiner Zunge ihren Mund zu erforschen begann. Jenner stand wie gelähmt da, weil ihr das Herz vor Angst aus der Brust zu springen drohte, aber dann dachte sie an Syd und hob gehorsam die Arme, um sie um seinen Hals zu schlingen.
Gleichzeitig versuchte sie immer noch, etwas Abstand zwischen ihren Körpern zu halten und ihn weder mit den Brüsten noch mit ihren Hüften zu berühren. Sie wollte ihm nicht näher kommen als unbedingt nötig. Aus einiger Entfernung musste jeder glauben, dass sie den Kuss genoss, und das hätte ihm eigentlich genügen müssen. Trotzdem brach er ihren Widerstand, indem er sie noch fester an sich zog, ihren Leib wie den einer Geliebten an seinen schmiegte und sie so festhielt. Unter seinem Seidenhemd spürte sie die festen Muskeln an seinen Schultern, und sie merkte, wie etwas Dickes, Festes gegen ihren Unterleib drückte.
O Gott. Jetzt geriet sie wirklich in Panik. Er bekam eine Erektion. Das hier war kein normales Date; sie konnte sich nicht darauf verlassen, dass er ihren Willen respektierte, dass er sich von einem »Nein« aufhalten lassen würde. Sie versuchte zurückzuweichen und wieder etwas Abstand zwischen ihren Körpern herzustellen, aber er hielt sie eisern umklammert. Sie war ganz und gar seiner Gnade ausgeliefert, wenn es denn für ihn überhaupt so etwas gab ... Und musste sie nicht das Schlechteste von ihm denken? Was hatte er mit ihr vor? Ihr schwante Übles, aber sie hatte keine Ahnung, wie sie ihn hätte aufhalten sollen.
Machte Syd in diesem Moment vielleicht das Gleiche durch? Bis jetzt hatte sie sich ausschließlich darauf konzentriert, dass Syd überlebte, doch jetzt wurde ihr klar, dass ihr auch etwas anderes zustoßen konnte, dass sie womöglich beide nicht unbeschadet aus dieser Affäre hervorgehen würden. Inzwischen erschienen ihr die Rachefantasien, die sie vorhin gesponnen hatte, trivial. Sie wollte überleben; sie wollte nicht leiden. Und für Syd wollte sie das Gleiche. Was später passieren würde, interessierte nicht mehr, geblieben war nur die nackte Angst vor dem Tod oder dem Leid.
»Nicht«, hörte sie sich wimmern. Wie konnte sie ihn anbetteln, wo sie ihm doch eigentlich nur ins Gesicht spucken wollte? Wie konnte sie ihm verraten, wie verängstigt sie war?
»Dann tun Sie so, als würden Sie es wirklich wollen«, ermahnte er sie zum zweiten Mal und küsste sie gleich wieder.
Zornig und hilflos erwiderte sie seinen Kuss.
Erster TeilLosglück
1
Sieben Jahre vorher ...
Gerade als Jenner Redwine über den Parkplatz zu ihrem Wagen ging, begann ihr Handy zu läuten. Bestimmt war es Dylan. Sie merkte, wie Ärger in ihr aufflackerte, während sie den Apparat aus den Tiefen ihrer Jeans-Handtasche fischte; sie hatte das Ding erst seit fünf Wochen, und schon hatte Dylan ein festes Ritual entwickelt. Ohne aufs Display zu blicken, drückte sie auf den Annahmeknopf, sagte »Hallo« und wartete ab, ob sie ihre Wette gegen sich selbst gewann.
»Hey, Babe«, sagte er wie üblich.
»Hey.« Falls er auch nur etwas Einfühlungsvermögen besaß, würde er merken, dass sie ganz und gar nicht erfreut klang, aber »Einfühlungsvermögen« und »Dylan« waren direkte Gegensätze.
»Schon fertig mit der Arbeit?«
Als hättest du nicht genau diesen Zeitpunkt abgepasst, dachte sie, sprach es aber nicht aus. »Ja.«
»Kannst du vielleicht beim Supermarkt haltmachen und mir ein Sixpack mitbringen? Das Geld gebe ich dir dann.«
Bis jetzt hast du’s noch jedes Mal vergessen, dachte sie verdrossen, und allmählich hatte sie das satt. Er verdiente mehr als sie in seinem Loser-Job, trotzdem schnorrte er sie ständig um Bier an. Nur noch dieses eine Mal, nahm sich Jenner fest vor, nachdem sie »Okay« gesagt und aufgelegt hatte. Wenn er diesmal wieder nicht zahlte, hatte sie ihm das letzte Mal Bier besorgt.
Gerade hatte sie die Spätschicht in der Harvest Meat Packing Company hinter sich gebracht. Sie war völlig erledigt, und ihre Fußsohlen pochten, nachdem sie acht Stunden auf Beton gestanden und Fleisch verpackt hatte. Dylan arbeitete in seiner Werkstatt in der Frühschicht, und das bedeutete, dass er seit etwa acht Stunden frei und es trotzdem nicht für nötig gehalten hatte, sich sein Bier selbst zu besorgen. Stattdessen hatte er vor ihrem Fernseher gelegen und ihr Essen verdrückt.
Anfangs hatte sie geglaubt, ein fester Freund sei ein Gewinn, aber Jenner konnte es nicht ausstehen, wenn sich jemand allzu dämlich anstellte, selbst wenn sie selbst dieser Jemand war. Falls Dylan sich nicht auf wundersame Weise besserte, würde sie ihn in Kürze unter »Fehlgriff« abhaken. Sie würde ihm noch diese eine Chance einräumen – nicht weil sie glaubte, dass er sie nutzen würde, sondern weil sie irgendwie diesen letzten kleinen Beweis brauchte, um den entscheidenden Schritt zu tun. Dass sie an Menschen festhielt, die sie eigentlich in die Wüste schicken sollte, war ein Charakterfehler, aber sie kannte sich gut genug, um zu akzeptieren, dass sie ihm diese letzte Chance lassen musste, weil sie andernfalls von Unsicherheit zerfressen würde.
Endlich war sie bei ihrem verbeulten blauen Dodge angekommen, schloss ihn auf und zerrte am Türgriff – die Fahrertür klemmte wie üblich. Nachdem die Tür ihren Bemühungen erst störrisch widerstanden hatte, flog sie urplötzlich mit einem rostigen Quietschen auf und ließ Jenner zurücktaumeln. Mit mühsam unterdrücktem Zorn stieg sie ein, knallte die Tür wieder zu und schob den Schlüssel ins Zündschloss. Der Motor sprang sofort an. Ihr Dodge, der in der Modellpalette die Typenbezeichnung »Blaue Gans« erhalten hatte, sah vielleicht nicht besonders gut aus, aber er war zuverlässig, und das allein zählte. Damit hatte sie wenigstens etwas, worauf sie sich verlassen konnte, selbst wenn es nur ein verbeulter, rostiger Wagen war.
Der nächste Supermarkt lag ein paar Blocks abseits von ihrem Heimweg, aber immerhin so nah bei ihrer Wohnung, dass Dylan problemlos selbst hätte hinfahren können. Der 7-Eleven war hell erleuchtet und der Parkplatz auch zu dieser späten Stunde gerammelt voll. Jenner zwängte den Dodge in eine Parklücke, die enger war als eine zu klein gekaufte Strumpfhose, aber egal – wen störte schon eine weitere Beule, wenn das Auto praktisch nur aus Beulen bestand?
Sie warf sich mit der Schulter gegen die Tür, die, selbstverständlich, sofort aufging und gegen den Wagen nebenan knallte. Sie verzog das Gesicht, quetschte sich durch den Spalt und rieb mit dem Finger über die Macke in dem anderen Wagen, als könnte sie das Blech damit ausbeulen. Nicht dass der Besitzer die Delle bemerken würde – schließlich sah sein Wagen fast so übel aus wie ihre Blaue Gans.
Ein Gemisch aus Abgasen, Benzin und Asphaltdämpfen schlug ihr ins Gesicht. Der typische Sommergeruch, und eigentlich mochte sie den Geruch von Benzin. Genau wie den von Kerosin. Merkwürdig, aber nichts, worüber sie sich ernsthaft Gedanken gemacht hätte.
Die Sohlen ihrer Turnschuhe blieben beinahe auf dem weichen Asphalt haften, während sie zum Eingang trottete. Sobald sie durch die Tür trat, wurde sie von der thermostatgesteuerten Kälte im Laden überspült. Am liebsten wäre sie eine Weile stehen geblieben und hätte in der kühlen Luft gebadet. Die Region um Chicago brodelte unter einer Hitzewelle, die Jenners Widerstandsfähigkeit auszukochen schien. Verflucht, sie war so müde. Sie sehnte sich nach ihrer Wohnung, wo sie endlich die Schuhe von den schmerzenden Füßen streifen, sich aus den verschwitzten Jeans und dem Hemd schälen und sich aufs Bett fallen lassen konnte, um ihren fast nackten Körper vom Deckenventilator kühlen zu lassen. Stattdessen stand sie hier und kaufte Bier für Dylan. Wer also war der größere Loser? Dylan oder sie?
Sie warf einen Blick auf die unerwartet lange Schlange vor der Kasse, dann fiel in einem Aha-Erlebnis der Groschen: die Lotterie. Offenbar war sie wirklich übermüdet, sonst hätte sie gleich begriffen, was los war. In den letzten Wochen hatte sich ein immenser Jackpot angesammelt, und am nächsten Abend würden die neuen Zahlen gezogen werden. Darum war der Parkplatz so voll und die Schlange so lang. Ab und an spielte sie auch, sie hatte sogar mehrmals ein paar Dollar gewonnen, aber meist scheute sie den Aufwand. Heute Abend dagegen ... verdammt, warum eigentlich nicht? Dylan konnte ruhig noch länger auf sein Bier warten.
Sie griff nach einem Sixpack und stellte sich in die Schlange, die durch einen Gang bis ans Ende des Ladens und durch den nächsten Gang wieder halb zurückreichte. Die Wartezeit vertrieb sie sich, indem sie die Preise verglich, die Süßigkeiten betrachtete und überlegte, welche Zahlen sie ankreuzen sollte. Sie stand zwischen zwei Männern, die beide nach abgestandenem Bier und ebenso abgestandenem Schweiß müffelten und sie abwechselnd immer wieder anquatschten, was sie jedoch größtenteils ignorierte. Trug sie etwa einen unsichtbaren Stempel auf der Stirn: »Alle Loser hier melden«?
Möglicherweise hatten es die Typen aber auch nur auf ihr Bier abgesehen. An einem so heißen Sommerabend war ein Sixpack bestimmt ziemlich verlockend – vielleicht verlockender als eine abgespannte Blondine mit gefärbten Haaren in einem hässlichen blauen Hemd mit einem aufgestickten »Harvest Meat Packing« auf der Brusttasche. Obwohl sie bei der Arbeit einen Kittel und eine Plastikhaube überziehen mussten, verlangte die Firma von allen Angestellten, auf dem Arbeitsweg die Firmenkleidung zu tragen, weil man sich dadurch kostenlose Werbung versprach. Die Angestellten mussten die verfluchten Hemden sogar selbst kaufen – dafür würde Jenner die Dinger aber auch behalten dürfen, falls sie irgendwann kündigte ... um sie bei der erstbesten Gelegenheit in die Mülltonne zu stopfen.
Aber vielleicht sahen die beiden Alkis auch nur ihr Shirt und dachten: Hey, die Kleine hat einen Job! Und Bier! Ihr graute bei dem Gedanken, dass jemand auf dieses Hemd anspringen konnte.
Schließlich schob die langsam vorrückende Schlange sie bis an die Kasse. Sie ließ das Geld auf die Theke fallen und kaufte drei Lotteriescheine, hauptsächlich, weil die Drei als Glückszahl galt. Sie wählte die Zahlen rein zufällig aus einem Gemisch von Telefonnummern, Geburtstagen, Hausnummern und allem Möglichen, was ihr gerade in den Sinn kam. Dann ließ sie die Durchschläge der Scheine in ihre Tasche fallen und trottete zu ihrem Wagen zurück. Das Auto, das neben ihr geparkt hatte, war weg, dafür stand jetzt ein Pick-up dort. Er parkte so dicht an ihrer Blauen Gans, dass sie unmöglich die Fahrertür öffnen konnte. Unter einem leisen Fluch schloss sie die Beifahrertür auf und kletterte mit dem Kopf voraus in den Wagen, um sich über den Schalthebel hinweg in den Fahrersitz zu winden. Wenigstens war sie dünn und gelenkig, sonst hätte sie das nie im Leben geschafft.
Gerade als sie die Beine unter das Lenkrad bugsieren wollte, läutete ihr Handy. Sie schreckte hoch, schlug sich den Kopf an und fluchte erneut. Diesmal nicht leise. Dann wühlte sie das Handy aus ihrer Tasche, drückte den Knopf und fauchte: »Was ist?«
»Wo steckst du denn?«, wollte Dylan wissen.
»Im Scheißsupermarkt, da stecke ich. Ich musste so lange anstehen.«
»Mach hin, okay?«
»Bin schon unterwegs.« Falls in ihrer Antwort eine gewisse Schärfe lag, so war Dylan dieses winzige Detail entgangen, aber ihm entgingen ohnehin eine Menge Signale.
Beide Hälften des Doppelhauses, in dem sie wohnte, hatten jeweils eine eigene kleine Zufahrt, sodass sie nicht auf der Straße parken musste. Theoretisch jedenfalls nicht. An diesem Abend aber stand Dylans Mustang in ihrer Einfahrt, und sie musste auf die Jagd nach einer Parklücke gehen. Bis sie eine entdeckt und sich zu ihrer Wohnung zurückgeschleppt hatte – in der alle Lichter brannten –, stand sie kurz vor der Explosion.
Wie nicht anders zu erwarten erblickte sie, als sie die Wohnung betrat, Dylan, der auf ihrer Couch lümmelte und die Füße in den Arbeitsschuhen auf ihrem Couchtisch abgelegt hatte, während aus dem Fernseher eine Wrestling-Show blökte. »Hey, Babe«, sagte Dylan lächelnd und stand auf, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden. Er nahm ihr das Sixpack ab und befreite eine Flasche aus dem Karton. »Scheiße, das ist ja warm.«
Sie sah zu, wie er nach dem Öffner griff, den er aus der Küche geholt hatte – schließlich wollte er keine Sekunde länger als nötig auf den ersten Schluck warten müssen –, den Kronkorken abhebelte und die Flasche an den Mund setzte. Er ließ den Kronkorken auf den Tisch fallen und sich selbst wieder auf die Couch.
»Pack doch die anderen in den Kühlschrank, wenn du dich umziehen gehst«, schlug er hilfsbereit vor. Sie zog sich immer um, sobald sie nach Hause kam, weil sie das grässliche Polyesterhemd keine Sekunde länger als nötig auf ihrer Haut spüren wollte.
»Klar doch.« Sie nahm den Karton vom Tisch. Dann teilte sie ihm mit, wie viel das Bier gekostet hatte.
Er starrte sie mit offenem Mund an. »Hä?«
»Das Bier.« Sie klang ganz gelassen. »Du hast gesagt, du gibst mir das Geld.«
»Na klar. Ich hab’s nur nicht dabei. Ich gebe es dir morgen.«
Ding. Sie hörte das Glöckchen, das die letzte Runde einläutete. Sie wartete auf ein Gefühl von Erlösung, doch stattdessen fühlte sie sich nur noch müde. »Spar dir die Mühe«, sagte sie. »Verschwinde einfach, und lass dich hier nie wieder blicken.«
»Hä?«, fragte er schon wieder. Offenbar war er nicht nur begriffsstutzig, sondern auch schwerhörig. Dylan sah gut aus – verflucht gut –, aber nicht so gut, dass es all seine Fehler wettgemacht hätte. Okay, sie hatte also vier Monate ihres Lebens mit ihm vergeudet; das würde ihr kein zweites Mal passieren. Sobald der nächste Typ anfing zu schnorren, war er Geschichte.
»Raus. Das war’s. Du hast mich das letzte Mal angeschnorrt.« Sie öffnete die Tür und wartete darauf, dass er ging.
Er wuchtete sich hoch und ordnete seine Miene zu jenem betörenden Lächeln, von dem sie sich so lange hatte blenden lassen. »Babe, du bist fix und fertig ...«
»Ganz recht. Und zwar mit dir. Und jetzt Tempo.« Sie schaufelte mit den Händen Luft ins Freie. »Raus hier.«
»Komm schon, Jenn ...«
»Nein. Das war’s. Du hattest nicht vor, das Bier zu bezahlen, und ich habe nicht vor, dir noch eine Chance zu geben.«
»Du hättest einen Ton sagen können, wenn es dir wirklich so viel bedeutet. Kein Grund, mich gleich ins kalte Wasser zu werfen«, beschwerte er sich. Das charmante Lächeln war wie weggefegt und einer finsteren Miene gewichen.
»O doch. Kaltes Wasser tut jedem gut. Es erfrischt und weckt auf. Und jetzt raus.«
»Wir können doch daran arbeiten ...«
»Nein, Dylan. Das war deine letzte Chance.« Sie sah ihn zornig an. »Entweder du ziehst jetzt Leine, oder ich rufe die Polizei.«
»Schon gut, schon gut.« Er trat auf den Vorplatz und drehte sich dann zu ihr um. »Ich hab sowieso die Nase voll von dir, du blöde Schlampe.«
Sie knallte die Tür zu und schreckte zusammen, als er mit der Faust gegen das Holz schlug. Offenbar sollte das sein Abschiedsgruß sein, denn etwa zehn Sekunden später hörte sie seinen Wagen anspringen, und dann beobachtete sie durch einen Spalt im Vorhang, wie er rückwärts aus der Einfahrt setzte und abrauschte.
Gut. Endlich. Sie war wieder ohne festen Freund, und das war ein gutes Gefühl. Besser als gut. Endlich machten sich Erleichterung und Befreiung breit und ließen sie tief durchatmen, so als hätte sie eine schwere Last von den Schultern geschüttelt. Sie hätte schon viel früher aufbegehren sollen, dann hätte sie sich eine Menge Ärger erspart. Eine weitere Lektion fürs Leben.
Jetzt eins nach dem anderen. Erst ging sie zu ihrem Auto und stellte es in die Einfahrt, wo es hingehörte. Dann kehrte sie in die Wohnung zurück, verriegelte die Türen und zog die Vorhänge dicht zu, bevor sie auf dem Weg ins Schlafzimmer, wo sie sich auszuziehen begann, Michelle anrief. Dass sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hatte, gehörte zu den Dingen, die eine beste Freundin augenblicklich erfahren musste.
»Dylan ist Geschichte«, sagte sie, sobald Michelle abgehoben hatte. »Ich habe ihn eben an die Luft gesetzt.«
»Was ist passiert?« Michelle klang entsetzt. »Hat er dich betrogen?«
»Nicht dass ich wüsste, aber das heißt nicht, dass er es nicht getan hat. Ich hatte es satt, dass er mich ständig angeschnorrt hat.«
»Mist. Dabei ist er so ein hübscher Junge.« Das Entsetzen flaute zu einem Bedauern ab, und aus dem Hörer stieg ein leises Seufzen.
Den Hörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt, setzte sich Jenner aufs Bett, um sich die verschwitzten Jeans von den Beinen zu zerren. »Das ist er, aber er ist auch blöd. Definitiv zu blöd.«
Michelle schwieg eine – knappe – Sekunde, dann hellte sich ihre Stimme schlagartig auf. »So! Die Nacht ist noch jung, und du bist wieder frei. Gehen wir aus?«
Genau darum habe ich dich angerufen, dachte Jenner. Michelle war immer bereit, einen draufzumachen, und Jenner musste sich aus dem Dylan-Trott befreien, in den sie in letzter Zeit versunken gewesen war. Sofort waren die schmerzenden Füße vergessen. Sie war dreiundzwanzig, hatte eben einen Loser in die Wüste geschickt und würde sich nicht von ihrer Müdigkeit unterkriegen lassen. Sie wollte feiern. »Klar. Ich muss nur schnell duschen. Wir treffen uns im Bird’s«, schlug sie ihre Stammkneipe aus prä-dylanschen Zeiten vor.
»Wowiie!«, jubilierte Michelle. »Nehmt euch in Acht, ihr Vögel! Wir sind wieder da!«
Sie und Michelle bildeten ein wirklich heißes Team, wenn sie das ohne Eigenlob behaupten durfte. Michelle war knapp einen Meter sechzig groß, hatte dicke schwarze Locken, große braune Augen und an allen entscheidenden Stellen die richtigen Kurven. Jenner selbst war mittelgroß und eher dünn, aber wenn sie sich Mühe beim Frisieren und Schminken gab und in etwas Enges, Kurzes schlüpfte, konnte sie sich durchaus sehen lassen. Eine Stunde später liefen sie im Bird’s ein, lachend und »Hit the Road, Jack« singend, und forderten alle anwesenden Frauen auf, beim Refrain mitzusingen. Jenner sang »Dylan« statt »Jack«, was nicht ganz so gut klang, aber wen interessierte das schon? Sie amüsierte sich, und es herrschte kein Mangel an Männern, die mit ihr tanzen wollten.
Als sie schließlich in der Morgendämmerung heimwärts taumelte, freute sie sich darauf, das erste Mal ausschlafen zu können, seit sie in der Spätschicht arbeitete. Sie hatte nicht übermäßig viel getrunken, nur ein paar Bier im Verlauf der letzten fünf Stunden, aber die Erschöpfung hatte ihr den Rest gegeben. Vielleicht war sie mit dreiundzwanzig doch nicht mehr so jung, wie sie geglaubt hatte: Zeitweilig war die Energie zwar durchaus zurückgekehrt, aber nicht ganz so schnell wie früher, und jetzt konnte sie kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen.
Sie stellte noch gewissenhaft den Wecker, dann kippte sie vornüber auf die Matratze und rührte sich nicht mehr, bis der Wecker acht Stunden später klingelte. Blinzelnd lag sie im Bett, schaute an die Decke und versuchte sich ins Gedächtnis zu rufen, welcher Tag es war. Schließlich begannen die Räder ineinanderzugreifen – richtig, es war Freitag –, und im selben Moment fiel ihr wieder ein, dass Dylan weg war, weg, weg, weg. Gleich danach begriff sie, dass sie zur Arbeit musste. Sie sprang auf, stürzte unter die Dusche, wo sie zu Ehren ihrer neu gewonnenen Freiheit ein Liedchen summte, und zog dann bemerkenswert frohgemut ein frisches hässliches blaues Hemd an. Nicht mal das Hemd konnte ihr heute die Laune verderben.
Warum hatte sie erst jetzt erkannt, wie komplett es mit ihr und Dylan vorbei war? Warum hatte sie sich seine Schnorrerei so lange gefallen lassen? Gut, eigentlich war es nicht besonders lang gewesen, aber sie hatte die Situation gute vier Wochen länger hingenommen, als eigentlich erträglich gewesen wäre, so als hätte sie gehofft, dass sich alles einrenkte, obwohl sie genau gewusst hatte, dass das nicht geschehen würde. Das passierte nie. Sie musste lernen, um den blinden Fleck herumzublicken, der ihre Menschenkenntnis zu trüben schien. Obwohl es nicht direkt ein blinder Fleck war. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass Dylan nicht der Mann war, den sie sich erträumte, genauso wenig wie ihr Vater der Vater war, den sie sich erträumte. Ihren Dad hatte sie längst abgeschrieben; dagegen hatte Dylan zu Anfang, vor ein paar Wochen, einen durchaus vielversprechenden Eindruck gemacht. Erst später war unter der schönen Fassade die hässliche Wirklichkeit zum Vorschein gekommen.
Sie überstand ihre Schicht und ging fröhlich ins Wochenende. Endlich konnte sie wieder tun und lassen, was sie wollte und wann und mit wem sie es wollte. Vor allem wollte sie wieder mit Michelle ausgehen, und so zogen sie erneut los und machten das Bird’s unsicher.
Erst in der Pause am Montagnachmittag hörte sie wieder von der Lotterie. Während sie mit ihren Kolleginnen in dem schmierigen Pausenraum saß und lustlos auf einem Schinkensandwich herumkaute, das sie mit einer Pepsi hinunterspülte, bekam sie mit, wie die anderen sich darüber unterhielten, dass der Jackpot geknackt worden sei, sich der Gewinner aber noch nicht gemeldet habe. »Der Schein wurde in dem Supermarkt drüben an der Siebenundzwanzigsten ausgefüllt«, erzählte Margo Russell. »Und wenn er verloren gegangen ist? Ich würde mir die Kugel geben, wenn ich einen Tippschein verlieren würde, der dreihundert Millionen wert ist!«
»Zweihundertfünfundneunzig Millionen«, korrigierte jemand.
»Auch egal. Wen interessieren schon fünf Millionen hin oder her?«, prustete Margo los.
Jenner wäre um ein Haar erstickt. Unfähig, den Sandwichbissen in ihrem Mund hinunterzuschlucken, saß sie wie gelähmt da. Ihr Kehlkopf war wie betäubt, genau wie der restliche Körper. Der Supermarkt an der Siebenundzwanzigsten? Genau dort hatte sie das Bier gekauft.
Schon der Gedanke, die bloße Möglichkeit, schien unvorstellbar. Hatte sie vielleicht ...? Blanke Panik und das Gefühl, am Rand einer Klippe zu stehen, trieben ihr den Schweiß auf die Stirn.
Dann meldete sich die Vernunft zurück, und die Welt um sie herum hellte sich wieder auf. Sie kaute und schluckte. Quatsch, Leuten wie ihr passierte so was nicht. Wahrscheinlich hatte sie nicht mal fünf Mäuse gewonnen. Da drin hatten die Leute Schlange gestanden, um ihre Scheine abzugeben. Die Chance, dass sie gewonnen hatte, stand eins zu tausend oder vielleicht zwei- bis dreitausend. Sie hatte die Ziehung am Freitagabend nicht verfolgt, hatte die Zahlen weder in der Zeitung nachgeschlagen noch in den Nachrichten gesehen, weil sie damit beschäftigt gewesen war, mit Michelle durch die Bars zu ziehen. Die Tippscheine waren immer noch dort, wo Jenner sie hingesteckt hatte, tief unten in ihrer Jeans-Handtasche.
Im Pausenraum lagen mehrere Ausgaben der aktuellen Tageszeitungen herum. Sie griff nach einer und begann sie auf der Suche nach den Lottozahlen durchzublättern. Schließlich hatte sie die Meldung gefunden und riss sie heraus. Ein Blick auf die Wanduhr verriet ihr, dass ihr noch fünf Minuten blieben, bevor sie wieder an die Arbeit musste.
Mit pochendem Herzen eilte sie in den Umkleideraum und öffnete dort mit zittrigen Fingern das Zahlenschloss an ihrem Spind. Mach dich nicht verrückt, schimpfte sie sich. Je mehr Hoffnungen sie sich machte, desto tiefer würde die Enttäuschung ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit sprach gegen sie. Sie musste sich nur kurz vergewissern, damit sie sich nicht bis zum Schichtende den Kopf darüber zerbrach – so wie sie sich letzte Woche vergewissern musste, dass Dylan ein Loser und Idiot war, weil sie sich sonst bis an ihr Lebensende gefragt hätte, ob es nicht vielleicht ein Fehler gewesen war, ihn in die Wüste zu schicken. Nachdem sie die Scheine überprüft und sich überzeugt hatte, dass sie nicht gewonnen hatte, würde sie mit Margo und den anderen darüber Witze reißen, so wie sie mit Michelle über Dylan Witze gerissen hatte.
Sie griff nach ihrer Tasche, stülpte sie um und kippte den Inhalt auf den Boden des Spindes. Zwei Tippscheine trudelten heraus, und sie griff danach. Wo steckte der dritte? Was war, wenn sie den dritten nicht mehr fand? Wenn sie ihn nie wieder fand und niemand den Gewinn abholte? Dann würde sie bis an ihr Lebensende wissen, dass sie ihre einzige Chance verschenkt hatte, jemals zweihundertfünfundneunzig Millionen Dollar zu besitzen.
Krieg dich wieder ein. Du hast nicht gewonnen. Sie rechnete nie damit zu gewinnen, wenn sie einen Tippschein abgab, sie spielte nur mit, weil sie allein bei der Vorstellung, allein bei dem Gedanken »Was wäre, wenn?« ein angenehmes Kribbeln spürte.
Sie holte tief Luft, durchwühlte den Haufen und atmete tief und erleichtert aus, als der vermisste Schein endlich in ihrer Hand lag. Sie verglich die Zahlen mit denen auf dem Fetzen, den sie aus der Zeitung gerissen hatte, und hätte beinahe laut aufgelacht, als sie unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Keine einzige Übereinstimmung. So viel zu ihrer Panik, weil sie den Schein nicht gleich gefunden hatte.
Sie überprüfte den nächsten Schein und überprüfte ihn gleich noch mal. 7, 11, 23, 47 ... Ihr Blickfeld verschwamm; die übrigen Zahlen konnte sie nicht mehr erkennen. Sie hörte, wie sie nach Luft schnappte. Ihre Knie knickten ein, sodass sie sich gegen die offene Spindtür lehnen musste. Der Tippschein fiel aus ihren plötzlich tauben Fingern, und schlagartig geriet sie regelrecht in Panik, obwohl der Schein nur auf den Boden geflattert war. Sie sank in die Knie, grabschte nach dem Schein und verglich die Zahlen erneut, und diesmal konzentrierte sie sich auf jede einzelne Ziffer: 7, 11, 23, 47, 53, 67.
Sie prüfte den Ausriss erneut und verglich ihn dann wieder mit ihrem Schein. Die Zahlen blieben gleich.
»Ach du Scheiße«, flüsterte sie. »Das gibt’s doch gar nicht.«
Behutsam schob sie den Zeitungsausriss und den Schein in die Vordertasche ihrer Jeans, richtete sich auf, schloss ihren Spind, hängte das Schloss wieder ein und kehrte wie betäubt an ihren Arbeitsplatz zurück, wo sie den hässlichen Overall anzog und die weiße Haube aufsetzte. Und wenn sie sich irrte? Wenn das alles nur ein schlechter Scherz war? Sie würde wie der letzte Idiot dastehen, wenn sie jetzt den Mund aufmachte.
Morgen würde sie das überprüfen. Vielleicht würde sie morgen früh in den Nachrichten hören, dass der Gewinner des Jackpots sich gemeldet habe, und dann bei einem erneuten Blick auf ihren Schein feststellen, dass sie sich einfach verlesen hatte.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Margo, als Jenner wieder an ihrem Platz stand. »Du bist ja ganz grün.«
»Mir ist es einfach zu heiß.« Der Instinkt, nicht darüber zu sprechen, war so stark, dass sie selbst gegenüber einer gutherzigen Seele wie Margo schwieg.
»Stimmt, die Hitze ist unerträglich. Du musst mehr Wasser trinken.«
Irgendwie überstand sie ihre Schicht, und irgendwie überstand sie auch die Heimfahrt, obwohl sie das Lenkrad der Blauen Gans so fest umklammert hielt, dass ihre Hände schmerzten. Sie atmete zu schnell, nein, sie schnappte nur noch nach Luft, ihre Lippen waren taub und in ihrem Kopf drehte sich alles. Mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung lenkte sie den Wagen schließlich in ihre Einfahrt, schaltete die Scheinwerfer aus und stellte den Motor ab. So als würde ihr Herz nicht wie irre dahingaloppieren, stieg sie aus, schloss pflichtbewusst die Gans ab, erklomm die Stufen zu ihrer quietschenden Miniveranda, öffnete die Haustür und trat in ihr sicheres Heim. Erst dort und erst nachdem sie die Tür verriegelt hatte und sich unbeobachtet fühlte, zog sie den Schein mitsamt dem Zeitungsausriss aus der Jeanstasche, legte beides nebeneinander auf den Couchtisch und zwang sich, die Zahlen ein weiteres Mal zu vergleichen.
7, 11, 23, 47, 53, 67.
Es waren auf beiden Papieren die gleichen.
Sie überprüfte die Zahlen noch einmal und dann gleich noch einmal. Sie nahm einen Stift, schrieb die Zahlen von ihrem Schein auf einen Zettel und verglich diesen Zettel dann mit der Zeitungsmeldung. Nichts hatte sich geändert. Ihr Herz begann wieder zu rasen.
»Ach du Scheiße.« Sie konnte kaum noch schlucken. »Ich habe einen Sechser im Lotto.«
2
An Schlaf war nicht zu denken. Während die Uhr die stillen Nachtstunden abzählte, lief Jenner im Haus auf und ab und blieb nur gelegentlich stehen, um einen Blick auf die sechs Zahlen zu werfen: 7, 11, 23, 47, 53, 67. So oft sie auch hinsah, sie blieben immer gleich, auf dem Tippschein wie auf dem Zeitungsausriss. Vielleicht hatte sich die Zeitung bei einer der Zahlen verdruckt; vielleicht würde es in der nächsten Ausgabe eine Berichtigung geben. Und vielleicht war es völlig verrückt von ihr, sich halb zu wünschen, dass die Zahlen nicht stimmten, aber ... zum Teufel, zweihundertfünfundneunzig Millionen Dollar!
Was sollte sie mit so viel Geld anfangen? Fünftausend, okay. Mit fünftausend konnte sie umgehen. Sie wusste genau, was sie damit anfangen würde: die Gans abbezahlen, sich was Neues zum Anziehen kaufen, vielleicht nach Disney World fahren oder so. Sie hätte sich schon immer gern einmal Disney World angesehen, ganz egal, wie spießig sich das anhörte. Fünftausend Eier wären okay.
Mit zwanzigtausend hätte sie auch noch kein Problem. Fünfzigtausend ... damit würde sie sich ein Auto kaufen, sicher, und mit dem Rest eine Anzahlung auf ein kleines, noch nicht allzu heruntergekommenes Häuschen leisten, das aber gleichzeitig so reparaturbedürftig war, dass sie sich die Raten leisten konnte. Sie hatte nichts dagegen, zur Miete zu wohnen – sie brauchte die Reparaturen nicht selbst zu bezahlen, auch wenn es jedes Mal Nerven kostete, den Vermieter zu bequatschen –, trotzdem hätte sie es irgendwie nett gefunden, etwas Eigenes zu besitzen.
Jenseits der Fünfzigtausend jedoch wurde es beängstigend. Sie kannte sich nicht mit Geldanlagen oder ähnlichem Mist aus, und obwohl sie keine Erfahrungen mit überschüssigem Kapital hatte – soweit es einen Zwanziger hier und da überstieg –, war sie ziemlich sicher, dass man so viel Geld nicht einfach zur Bank brachte und aufs Sparkonto einzahlte. Bestimmt wurde von ihr erwartet, das Geld zu investieren, es auf mysteriöse Weise wieder in Umlauf zu bringen, es arbeiten zu lassen.
Das war Neuland für sie. Sie wusste, wenigstens ungefähr, wozu es Aktien gab, hätte aber nicht sagen können, was eine Anleihe war oder wozu sie gut sein sollte. Die Betrüger und Bauernfänger würden ihr die Tür einrennen, um ihr das Geld aus der Tasche zu ziehen – der gute alte Jerry, ihr Vater, wäre der Erste –, und sie hatte keine Ahnung, wie sie sich vor ihnen schützen konnte.
Nach einem weiteren Blick auf ihren Tippschein wurde ihr auf einmal übel, und sie rannte ins Bad, wo sie lange über der gesprungenen alten Toilettenschüssel hing, obwohl nichts als warmes Wasser aus ihrem Mund kam. Schließlich holte sie ein paar Mal tief Luft, beugte sich über das Waschbecken und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Dann stemmte sie die Hände auf das kühle Porzellan und betrachtete sich im Spiegel. Das Gesicht, das ihr entgegenblickte, war eine Lüge. Dem Spiegel zufolge war alles wie sonst, dabei war nichts wie sonst, denn das Leben, in dem sie sich eingerichtet hatte, gab es nicht mehr.
Sie sah sich im Bad um, betrachtete die abgeplatzten Bodenfliesen, die billige Fiberglas-Duschkabine, den fleckigen Spiegel ... und wäre um ein Haar unter dem überwältigenden Gefühl zusammengebrochen, dass bald nichts von alldem mehr real sein würde. Das hier war für sie völlig in Ordnung. Hier gehörte sie her. In dieser heruntergekommenen, bejahrten Doppelhaushälfte in diesem langsam absackenden Stadtviertel fühlte sie sich zu Hause. In zehn Jahren würde diese Gegend zum Slum verkommen sein, sie selbst wäre bis dahin in eine andere Wohnung gezogen, die sich auf demselben Niveau wie ihr jetziges Zuhause befand, und damit wäre sie vollauf zufrieden. Das war ihr Leben. Sie wurstelte sich durch, sie konnte ihre Rechnungen bezahlen, und ab und zu machte sie mit Michelle im Bird’s einen drauf. Sie wusste, wo ihr Platz in dieser Welt war.
Nur dass das nicht mehr ihre Welt war ... Diese Erkenntnis setzte ihr so zu, dass sie sich gleich wieder über die Toilette beugte und zu würgen begann. Sie konnte nur so weiterleben wie bisher, wenn sie ihren Gewinn verfallen ließ, aber nein, dazu würde es nicht kommen. Sie war schließlich nicht blöd. Vielleicht so nervös, dass sie kotzen musste, aber bestimmt nicht blöd.
Sie würde sich praktisch aus ihrem ganzen bisherigen Leben verabschieden. Sie ging ihre Freundschaften durch, enge und lose, und kam zu dem Schluss, dass wahrscheinlich nur die mit Michelle überleben würde. Sie und Michelle waren praktisch seit ihrer ersten Begegnung in der Highschool befreundet. Sie hatte damals mindestens so viel, wenn nicht sogar mehr Zeit bei Michelle verbracht wie bei sich zu Hause – wo das auch gerade gewesen war, denn Jerry hatte sie von einem Loch ins nächste geschleift und dabei regelmäßig ein paar Monatsmieten an Schulden hinterlassen. So wie er es sah, brauchte er auf diese Weise nur zwei, drei Monate im Jahr Miete zu zahlen und konnte die restliche Zeit mietfrei wohnen, da der Vermieter normalerweise mehrere Monate brauchte, um sie an die Luft zu setzen. In Jerrys Welt zahlten nur Vollidioten jeden Monat Miete.
Jerry würde zum Problem werden. Die Frage war nicht, ob er Schwierigkeiten machen würde, sondern, wie groß sie sein würden.
Jenner machte sich keine Illusionen über ihren Dad. Sie hatte ihn seit Monaten nicht mehr gesehen und wusste nicht einmal, ob er immer noch im Umkreis von Chicago lebte, aber so sicher, wie die Sonne im Osten aufging, so sicher würde er auftauchen, sobald er von ihrem Lotteriegewinn hörte, und dann würde er alles unternehmen, um möglichst viel von ihrem Reichtum in die Finger zu bekommen. Darum musste sie überlegen, wie sie ihr Geld schützen konnte, bevor sie den Gewinn einlöste.
Sie hatte von Menschen gelesen, die alles genau durchdacht und sich nach allen Seiten abgesichert hatten, bevor sie, manchmal erst nach Wochen, den Gewinn einlösten und damit ins Licht der Öffentlichkeit traten. Genauso würde sie es auch machen. Sie würde weiter bei Harvest arbeiten, bis sie das Geld tatsächlich in Händen hielt, aber sie musste so bald wie möglich – am besten noch heute – jemanden finden, der von Berufs wegen wusste, was man mit so viel Kohle anstellte.
Um drei Uhr morgens war sie völlig ausgepumpt, körperlich und geistig. Sie zog sich aus, legte sich ins Bett und stellte für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie einschlafen konnte, den Wecker auf acht Uhr. Es gab zu viel zu erledigen, als dass sie hätte ausschlafen können. Erst als es zu dämmern begann, sank sie in einen rastlosen Schlaf, aus dem sie immer wieder erwachte, um einen Blick auf die Uhr zu werfen, bis sie irgendwann, noch vor dem Läuten des Weckers, aufstand. Nach einer kurzen Dusche machte sie sich in der Mikrowelle einen Instantkaffee heiß, den sie mit ins Bad nahm, um sich dort die Haare zu fönen und sich zu schminken.
Um halb neun blätterte sie bereits, ein Auge auf die Uhr geheftet, im Branchenbuch. Unter »Geldmanager« gab es keinen Eintrag, was sie ziemlich frustrierend fand; worunter sollten solche Menschen sonst aufgeführt sein? Vielleicht wurde sie ja unter »Banken« fündig. Dort erfuhr sie immerhin, dass es im Großraum Chicago haufenweise Banken gab, die gern ihren »Rundum-Service« anpriesen. Was sollte das heißen? Dass sie in ihrer Schalterhalle Kaffee servierten oder beim Auto den Ölstand kontrollierten, während man Geld abhob? Banken waren dazu da, um Schecks einzulösen und Sparkonten zu verwalten. Das war alles. Leider war den Anzeigen nicht zu entnehmen, worin der angepriesene Rundum-Service bestand, sodass sie weiter im Dunkeln tappte.
Sie klappte das Branchenbuch zu und marschierte grollend in der Küche auf und ab. Es gefiel ihr gar nicht, dass sie sich so hilflos vorkam, und es gefiel ihr noch weniger, dass sie im Branchenbuch nicht fündig wurde, nur weil sie nicht wusste, was wo aufgeführt wurde. Aber sie hatte noch nie ein Bankkonto geführt, weil sie nie viel Geld besessen und daher ein Konto für überflüssig gehalten hatte. Ihre Rechnungen beglich sie entweder bar, oder sie zahlte den fälligen Betrag am Schalter ein. Das war doch nicht verkehrt, oder? Viele Menschen machten das so – eigentlich die meisten in ihrem Bekanntenkreis.
Schon jetzt prallte sie gegen die Wand, die sie von Anfang an gespürt hatte – die Wand zwischen dem Leben, das sie bis jetzt geführt hatte, und jenem Leben, das Menschen mit viel Geld führten. Andere hatten diese Wand schon vor ihr überwunden, und sie würde das auch schaffen. Sie musste sich nur schlaumachen.
Also schlug sie das Branchenbuch wieder auf, suchte eine der Banken mit »Rundum-Service« heraus, überzeugte sich, dass es inzwischen nach neun Uhr war, und rief dort an. Als eine Frau mit wohlklingender, professionell freundlicher Stimme antwortete, fragte Jenner: »Ich habe Ihre Anzeige im Branchenbuch gesehen. Was bedeutet ›Rundum-Service‹ genau?«
»Das bedeutet, dass wir Hilfestellung bei der Finanzplanung und bei Investitionen leisten. Außerdem bieten wir Finanzierungen für Immobilien, Autos oder Boote an, und Sie bekommen bei uns Ratenkredite und eine Vielzahl von Auszahlungs- und Sparplänen, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind«, erwiderte die Frau wie aus der Pistole geschossen.
»Danke.« Jenner legte auf, denn damit hatte sie erfahren, was sie wissen wollte. Finanzplanung. Das hätte ihr auch einfallen können. Schließlich redeten sie im Fernsehen ständig davon. Dauernd taten die Finanzmärkte irgendwas, kamen in Bewegung oder brachen zusammen, drehten sich im Kreis und konnten offensichtlich alles Mögliche anstellen, außer sich selbst am Allerwertesten zu lecken.
Lektion Nummer eins: Was für sie »Geld« hieß, hieß für Menschen mit Geld »Finanzen«.
Sie beugte sich wieder über das Branchenbuch und schlug unter »Finanzplanung« nach. Hier fand sie eine ganze Liste von Einträgen, deren Namen ihr teilweise aus der Werbung bekannt waren. Außerdem gab es dort mehrere Unterkategorien für Fondsanlagen, Aktien und Anleihen, und es gab Finanz- und Investmentberater sowie Börsenmakler.
Sie ging die Einträge unter »Finanzberatung« dreimal durch und entschied sich dann für eine Firma namens Payne Echols Financial Services. Sie hatten statt eines einfachen Eintrags eine Werbeanzeige drucken lassen, aber keine ganze Seite gekauft, woraus sie schloss, dass die Firma zwar etabliert, aber nicht die größte in der Stadt war. In einem Mammutbetrieb würde man sich vielleicht heimlich über sie lustig machen oder sie, schlimmer noch, über den Tisch ziehen. Eine mittelgroße Firma wäre hoffentlich überglücklich, sie als Kundin zu bekommen, und würde sie daher besser behandeln.
Sich für ein Unternehmen zu entscheiden war nur der erste Punkt auf ihrer Liste, aber schon nach diesem grundlegenden Schritt ging es ihr spürbar besser. Sie hatte alles unter Kontrolle. Niemand konnte sie zwingen, etwas zu tun, das sie nicht wollte. Wenn ihr die Leute bei Payne Echols nicht sympathisch waren, würde sie sich für eine andere Finanzberatung entscheiden.
Sie atmete kurz durch und rief an. Beim zweiten Läuten meldete sich auch hier wieder eine professionell wohlklingende Stimme: »Payne Echols Financial Services. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich weiß nicht genau. Ich hätte gern einen Termin, und zwar so bald wie möglich.«
Die Frau zögerte kurz. »Darf ich fragen, worum es geht? Dann weiß ich, welcher Berater sich bei Ihrem Anliegen am besten auskennt.«
»Ähm ...« Jenner überlegte kurz, denn sie wollte nur ungern mit der Wahrheit herausplatzen. »Ich habe etwas geerbt, um die fünfzigtausend, und würde gern wissen, wie ich das Geld anlegen soll.« Sie hatte die Summe aus der Luft gegriffen, aber sie kam ihr passend vor, weil sie einerseits groß genug war, um sich beraten zu lassen, andererseits aber nicht so groß, dass sie besondere Aufmerksamkeit erregen würde.
»Einen Moment bitte.« Die Frau hatte wieder ihre Honigstimme eingesetzt. »Ich verbinde Sie weiter.«
»Moment! Mit wem denn?«
»Mit der Assistentin von Miss Smith. Sie wird einen Termin mit Ihnen vereinbaren.«
Eine halbe Sekunde blieb die Leitung tot, dann wurde ihr Trommelfell mit blecherner Warteschleifenmusik malträtiert. Was sollte das, wollte man sie vielleicht so sehr langweilen, dass sie irgendwann auflegte? Warum wurde in den Warteschleifen nie was Lebhaftes oder Interessantes gespielt?
Sie wartete eine Weile und versuchte dabei die grässliche Musik zu ignorieren. Wie lange konnte es schon dauern, ein Gespräch weiterzuvermitteln? Leicht verärgert klopfte sie mit dem großen Zeh auf den Boden. Gerade als sie sich entschieden hatte aufzulegen, hörte sie ein leises Klicken, und die nächste samtene Frauenstimme fragte: »Büro Ms Smith, was kann ich für Sie tun?«
Allmählich hatte sie diese unpersönlichen perfekten Stimmen satt. Ob diese Leute wohl gefeuert wurden, wenn sie etwas so Banales wie echtes Interesse erkennen ließen? »Ich heiße Jenner Redwine. Ich möchte einen Termin mit Ms Smith vereinbaren.«
»Gern, Ms Redwine. Wann würde es Ihnen denn passen?«
»So bald wie möglich. Am besten jetzt gleich.«
»Jetzt? Mal sehen ... Ms Smith hätte tatsächlich in fünfundvierzig Minuten einen Termin frei. Wäre es Ihnen möglich, bis dahin bei uns zu sein?«
»Ja, ich komme zu Ihnen.«
Jenner legte auf, schob den Tippschein mit dem Zeitungsausriss in ihr Portemonnaie, steckte das Portemonnaie in ihre Jeans-Handtasche und ging dann nach draußen, um die Blaue Gans aufzuschließen. Wie üblich klemmte die Fahrertür, was Jenner einen halblauten Fluch entlockte. Fünfundvierzig Minuten waren im Stadtverkehr von Chicago nicht allzu viel, und sie hatte keine Zeit für ein Kräftemessen mit einer Autotür. Sie packte den Griff fester und riss energisch daran, woraufhin die Tür so unversehens aufflog, dass Jenner mit dem Hintern auf dem Boden landete.
»Als Erstes«, grummelte sie, »lege ich mir ein neues Auto zu.« Es brauchte kein besonders schickes Auto zu sein, Hauptsache, es war neu, beulenfrei und mit leicht zu öffnenden Türen. Und danach – wer weiß ... Über das »Danach« machte sie sich lieber keine Gedanken. Ein Schritt nach dem anderen, und der erste Schritt bestand darin, das mit dem Geld zu organisieren.
Auf der Fahrt spielte sie mit dem Gedanken, Michelle anzurufen und ihr zu erzählen, was ihr gerade widerfuhr. Sie wühlte sogar das Handy aus ihrer Tasche und tippte die ersten Ziffern ein, doch dann drückte sie die »Abbruch-Taste« und versenkte das Telefon wieder in der Tasche. Michelle würde glauben, dass sie Witze machte, aber ... wenn nicht? Wieder erwachte dieses Misstrauen. Bevor jemand von ihrem Gewinn erfuhr, wollte Jenner alles geklärt und geregelt haben.
Die Büros von Payne Echols befanden sich im Stadtzentrum, wo es weit und breit keine Parkmöglichkeit gab, aber beim Vorbeifahren fiel ihr auf, dass die Firma über einen Privatparkplatz verfügte, der von einem Wachmann beaufsichtigt wurde, damit keine Normalsterblichen ihr Auto dort abstellten. Sie fuhr an die orangefarbene Schranke und kurbelte das Fenster nach unten. Der Wachmann warf einen Blick auf die Blaue Gans, und sie konnte erkennen, wie der Zweifel in ihm zu keimen begann. »Ich habe einen Termin bei Ms Smith.«
»Ihr Name?«
»Jenner Redwine.«
Er tippte auf einem kleinen Computer herum, bekam offenkundig bestätigt, dass ihr Name auf der Liste stand, und öffnete daraufhin die Schranke. Jenner fuhr durch, parkte auf dem ersten freien Platz, an dem sie vorbeikam, und eilte zum Eingang.
Sobald sie die Tür geöffnet hatte, überlief sie ein nervöser Schauer. Die Empfangshalle von Payne Echols war kühl und karg eingerichtet und so still, dass sie sich atmen hören konnte. Alles war in Grau und Braun gehalten, fast als hätte der Innenarchitekt eine Todesangst vor jeder lebhaften Farbe gehabt. Die abstrakten Gemälde an den Wänden tendierten ins Blaue, aber selbst das nur ganz dezent. Es gab haufenweise eindrucksvolle Pflanzen, die so perfekt gewachsen waren, dass sie unmöglich echt sein konnten; trotzdem spürte sie echte Erde, als sie verstohlen einen Finger in einen der Töpfe bohrte. Hastig versteckte sie die Hand hinter dem Rücken und versuchte den Dreck von ihrem Finger zu wischen, während sie auf die Empfangstheke zuging, die halb verdeckt hinter weiteren Pflanzen stand.
Hinter der Theke saß eine schlanke Brünette im Business-Kostüm, die sofort aufsah und fragte: »Kann ich Ihnen helfen?« Ihre Stimme war so neutral wie die Einrichtung, aber Jenner hatte ein weiteres Mal das Gefühl, nicht für voll genommen zu werden.
Ebenso unverbindlich und ruhig antwortete sie: »Jenner Redwine. Ich habe einen Termin bei Ms Smith.«
»Bitte nehmen Sie Platz. Ich sage Ms Smiths Asisstentin Bescheid.«
Jenner ließ sich auf der Kante eines ungemütlichen grauen Sofas nieder. Ihr gegenüber hing ein abstraktes Gemälde, das aussah, als hätte es ein blinder Affe hingepinselt. So was zu malen, war bestimmt keine Kunst. Dazu brauchte man nur ein paar Pinsel, eine Leinwand und irgendwelche Farben. Die Farben wahllos auf die Leinwand klatschen und – presto, schon war das große grässliche Gemälde vollendet.
Ein paar Männer in Anzügen kamen vorbei, außerdem konnte Jenner in ihrem begrenzten Blickfeld ein paar Menschen in mehreren Büros sitzen sehen. Alle wirkten schwer beschäftigt und konzentriert, sprachen in ihre Telefone, studierten Papiere oder tippten auf ihren Computertastaturen herum. Es waren ausschließlich Männer.