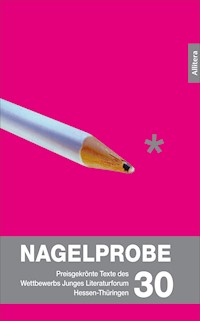
Nagelprobe 30 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die "Nagelprobe" dokumentiert mit den preisgekrönten Texten den jährlichen Wettbewerb "Junges Literaturforum Hessen-Thüringen". Der Wettbewerb wird gemeinsam vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur veranstaltet. Eine Jury, bestehend aus Matthias Biskupek, Daniela Danz, Martina Dreisbach, Antonia Günther, Martin Lüdke, Christoph Schröder, Martin Straub und Renate Wiggershaus, hat die 31 Preisträger ausgewählt. Aus diesem Kreis wurden zehn Autor / Innen mit einem Geldpreis ausgezeichnet. Diese und fünf weitere Autor / Innen wurden zu einem Literaturworkshop mit erfahrenen Schriftstellern eingeladen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit finanzieller Unterstützung der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen in Frankfurt am Main
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:
www.allitera.de
Mai 2013
Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH, München
© 2013 für die Anthologie: Buch&media GmbH, München
© 2013 für die Einzelbeiträge
beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink,
unter Verwendung eines Motivs von Bettina Hermann
Printed in Germany · ISBN 978-3-86906-511-3
Preisrede
Die Bäume wachsen natürlich in den Himmel
Die Lage, das wollte unser unvergessener Altkanzler Konrad Adenauer immer wieder gern bestätigen, die Lage sei ernst. Aber auch hoffnungslos? Wenn man dem Pechvogel glauben darf, der vom Dach eines Wolkenkratzers in Milwaukee fiel, nicht unbedingt. Als er am vierten Stock vorbeiflog, die längste Strecke hatte er längst hinter sich, meinte er noch hoffnungsvoll – und solche Optimisten braucht das Land –, bis jetzt sei ja alles gut gegangen. Mit dieser Einstellung sollten wir uns unserer Sache nähern. Also:
Poesie öffnet Räume. Punkt.
Oder, von der anderen Seite her betrachtet:
Poesie verschließt sich! Ausrufezeichen.
Das könnten wir, zumindest vorläufig, so stehen lassen. Und weitersehen.
Als ich, das ist ein paar Tage her, in einem Alter war, das mich selbst noch zur Teilnahme an dem Wettbewerb des Jungen Literaturforums berechtigt hätte, wähnte sich, auf gute altdeutsche Art, ein ehemaliger Seemann namens Freddy Quinn »Unter fremden Sternen«, und das Kingston-Trio beklagte, weltweit erfolgreich, das Schicksal des armen Hundes »Tom Dooley«, der am nächsten Morgen, nur weil er eine Frau mit dem Messer erstochen hatte, am Ast eines Baumes gehängt werden sollte, weit, weit weg von hier und überall, im fernen Tennessee.
So etwas hörte ich, damals. Die Welt, die erlas ich mir, damals. Diese unendlichen Räume der Poesie. Ich begeisterte mich maßlos an den Partyleichen von T. S. Eliot:
Frauen kommen und gehen und schwätzen so /
daher von Michelangelo.
Da konnte ich eine Versprechung herauslesen. Poesie und Zorn vertragen sich durchaus.
Angefangen hat das Ganze aber mit Mark Twain, für mich die Prairie am Wasser. Filme darüber gab es noch nicht. Aber die Gestalten waren sichtbar, Tom Sawyer, Huck Finn, der Indianer Joe. Alles spielte sich in dem kleinen Kaff Hannibal, Missouri, direkt am Mississippi ab, und war für mich eine ganze Welt.
Andere Zeiten, gewiss doch.
Als ich, mehr als ein paar Tage später, mit meinem eigenen Sohn, damals auch um die sechzehn, in der Nähe von New Orleans am Ufer des Mississippis stand, meinte er völlig ungerührt, na breiter als der Main ist der auch nicht. Mein Sohn hatte recht. Nur konnte der arme Junge den mythischen »Ol‘ Man River« gar nicht mehr sehen. Auch, natürlich, weil er bis dahin, und zwar problemlos, ohne eine »Wünschelrute« durch sein junges Leben gegangen war, schon gar nicht mit einer Eichendorff’schen.
Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
Wozu ein Zauberwort, wenn es doch jederzeit Flugreisen zu Spottpreisen gibt. Die Welt hatte sich geöffnet. Wozu noch Poesie?
Wozu? Natürlich um Räume zu öffnen. Aber eben auch, um solche geöffneten Räume wieder vor anderen zu verschließen:
Möglicherweise tue ich unserem Preisträger Juan S. Guse, dem ich diese Absichten unterstellen will, Unrecht. Das muss Guse aber akzeptieren. Denn er will sich in drei, ja, wie soll ich sagen: Gedichten – nein!, Prosastücken – auch nicht!, also, kleinster gemeinsamer Nenner: in drei »Texten« vermeintlich über die aufhebung der impetustheorie auslassen.
das geschichtete kantholz | vor der mühle ein pflock | auf einem strunk erzählt vom ackerbau zum zahnrad von hinterwäldlern | archiviert der segen der erde als konzept eines löschteiches | die entfluteten felder der ruhr | trocknen
Hermetisch nennt man diese Attitüde der Abgrenzung. Fragen nach dem Sinn, oder nach der Bedeutung eines solchen Textes, prallen an solchen Texten ab wie der mental malade Psychiatriepatient an den Wänden seiner Gummizelle. Das macht gar nichts. Denn für schlichte Gemüter mit handfesten Erwartungen sind solche Texte nicht geschrieben. Lesen kann, zur Not, auch anstrengen. Deshalb bedarf Guses Versuch keiner Rechtfertigung. Ganz abgesehen davon, wie Juan S. Guse sich in die neueren Strömungen gegenwärtiger Lyrik einschreibt. Allein solche Versuche rechtfertigen im Gegenteil den ganzen Wettbewerb!
Man sollte es hier also mit dem guten alten Gottfried Benn halten, der ganz nüchtern proklamierte: »Entweder es giebt die Kunst, dann ist sie autonom, oder es giebt sie nicht, dann wollen wir nach Hause gehen.«
Autonom – das heißt natürlich nicht, dass auch jeder Mist Kunst ist. Im Gegenteil.
Von den insgesamt 625 eingesandten Beiträgen segelt tatsächlich ein großer Teil unter der ästhetisch markierten Wahrnehmungsgrenze problemlos hindurch und zeigt auf diese Weise, wie weit sich Ausdrucksbedürfnisse und Ausdrucksfähigkeiten voneinander entfernen können. Diese Differenz hat sich in den letzten Jahren keineswegs verringert. Trotzdem bleiben, Jahr für Jahr wieder, einige Texte durch eine, ich möchte sagen, besondere Duftmarke, wie bei dem »Scheißerchen« von Anne Völker, in Erinnerung.
In den ersten Jahren dieses Wettbewerbes, anfangs nur für das Land Hessen ausgeschrieben, aber auch noch in den ersten Jahren nach der Wende, als Thüringen hinzugekommen war, ließen sich die Beiträge in ihrer Gesamtheit stets als eine Art Bewusstseinsspiegel einer ganzen Generation betrachten. Was in den Köpfen der sechzehn- bis fünfundzwanzigjährigen Beiträger drin war, das kam in ihren Beiträgen raus. Alles das, was diese Generation beschäftigte, von den persönlichen, oft auch nur pubertären Problemen bis hin zu sozialen, politischen Fragen, die steigende Arbeitslosigkeit und ihre Folgen, das Schicksal von abgewickelten und damit ausgegrenzten Menschen, die gesellschaftliche Stimmungslage und die entsprechenden Erwartungen, positiven meist weniger als negativen, all das artikulierte sich in den Beiträgen des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen. Und es fand, oft genug, auch noch eine – ästhetische – Form. Allerdings von Jahr zu Jahr weniger. In der Zwischenzeit läppert sich vieles einfach nur so dahin, vieles in einer sprachlichen Verfassung, die sich nicht allein auf die unzweifelhaft verheerenden Folgen der großen Rechtschreibereform zurückführen lässt. Die unorthodoxe Sprachbehandlung in vielen, vielen Beiträgen geht eben leider nicht mehr auf einen Originalitätsanspruch zurück, orientiert zum Beispiel noch an Uwe Johnson oder Ernst Jandl, sondern auf Unvermögen und Unkenntnis.
Hier wird nun, damit kein Missverständnis aufkommt, nicht der große kulturkritische Klagegesang angestimmt, nach dem Motto: Früher war alles besser. Das ist nämlich Quatsch. Denn früher war vieles eher schlimmer. Solche Klagen sind also witzlos. Und uralt. Schon der gute alte Plinius (allerdings der Jüngere, ein alter Römer aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung) hatte darüber gezetert, dass der Wunsch, die Anerkennung der Nachwelt zu erringen, zurückgegangen sei und sich stattdessen das Motiv durchgesetzt habe, Gewinn statt Kultur, statt durch Kultur zu erzielen. Die Zeiten haben sich halt verändert. Das kann man zwar beklagen, aber nicht ändern. Hinzu kommt: Auch die tatsächliche Bedeutung von Kunst und Literatur ist in den letzten drei Jahrzehnten nachweisbar zurückgegangen. Der Distinktionsgewinn, den der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1930–2002) dem Erwerb kulturellen Kapitals damals noch zuschrieb, geht immer weiter zurück. Wer liest, gilt eher als Sonderling denn als Junggenie. Das ist den Beiträgen des Literaturforums natürlich auch abzulesen.
Nur: Wie steht es mit denen, die schreiben? Es gibt ja nach wie vor einzelne Beiträge, in denen öffentliche Belange beziehungsweise allgemein wichtige Fragen aufgegriffen werden, deutsche Soldaten in Afghanistan etwa. Oft sogar in einer Form, die der Sache angemessen ist. Aber, bitte, glauben Sie nicht, dass wir, die Jury, also Matthias Biskupek, Daniela Danz, Martina Dreisbach, Antonia Günther, Christoph Schröder, Martin Straub, Renate Wiggershaus und ich, dass wir uns immer einig wären. Das Gegenteil ist der Fall. Wir streiten oft und manchmal ziemlich laut und lange, allerdings mit Argumenten. Am Ende entscheidet dann zur Not die Mehrheit. Auch das ist in Ordnung. Denn ein Moment der Subjektivität fließt in jedes ästhetisches Urteil ein.
Die Poesie ist der genuine Ausdruck von Subjektivität. Deshalb ist der Raum weit, den sie eröffnet. Und die Grenzen sind durchlässig. Wie hier, bei Silva Bieler, zum Beispiel:
Mühsam ohne Wind
Jetzt geht es darum
Wer als erster alle
Blätter verspielt hat
Denn Nacktheit ist Trumpf
Im Dezember
Mühsam ohne Wind. Von dieser Silva Bieler werden wir wohl noch hören. Obwohl das Literaturforum nicht als Vorschule für angehende Schriftsteller missverstanden werden sollte. Klar, es sind einige unterdessen renommierte Autoren daraus hervorgegangen. Ich nenne, für die Träumer unter den diesjährigen Preisträgern, in alphabetischer Folge nur Daniela Danz, Nadja Einzmann, Thomas Hettche, Ricarda Junge, Leif Rand, Annika Scheffel, Anke Velmeke, Maike Wetzel. Und ich warne davor, die Schriftstellerei als möglichen Beruf zu betrachten. Der Preis ist sehr hoch. Wer fähig ist, an der Freude satt zu werden, die ihm eine gelungene Formulierung einbringt – bitte. Aber sonst?
Das Junge Literaturforum betreibt keine Nachwuchsförderung. Sondern? Wichtig scheint mir vor allem, dass tatsächlich ein Raum für Poesie erschlossen wird. Wie bei Marie-Luise Gürtler:
Ein Mondvogel noch singt vom Tag nachts und eine Geige aus den Feldern streicht gen Gott.
Das heißt, ich sagte es eingangs, die Poesie öffnet Räume. In solchen, oft fragilen, manchmal etwas wackeligen, Gebilden findet unsere Fantasie den Platz, sich auszubreiten. Ann-Christin Helmkes »Pinselstriche« sind, wie auch der »Plastikstuhl« auf einem Balkon von Philipp Kampa, dafür weitere und gute Beispiele.
In solchen Gebilden öffnet sich tatsächlich ein Raum – für die Fantasie, der Platz genug bietet, um die zarten Gestalten unserer Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche unterzubringen, unsere Vorstellungen von der Welt, in der wir leben möchten. Platz genug auch, um gegen die realen und die möglichen Widerstände anzukämpfen. Also Platz für Utopien und Platz für Kritik.
Jede heranwachsende Generation beansprucht die Welt, die ohnehin die ihre werden wird, für sich. Und das zu recht. Die Investmentbanker versuchen, fantasielos, aber erfolgreich, auf Kosten anderer sich durchzusetzen. Die Politiker versuchen es mit – meist hilflosem – Aktionismus.
Eroberer, Abenteurer, Entdecker, die Helden der vergangenen Zeiten, gibt es nicht mehr. »Die Vermessung der Welt«, wie Daniel Kehlmann diesen Prozess nannte, ist abgeschlossen. Deshalb könnte es umso wichtiger werden, uns schreibend, zum Beispiel, neue Räume zu erschließen. Und sei es auch nur in der Lebensphase, die zur Teilnahme an diesem Wettbewerb berechtigt.
Denn:
Jetzt geht es darum
wer als erster alle
Blätter verspielt hat
Richtig. Weil das so ist, kann uns nichts und niemand ausreden, dass die Bäume natürlich in den Himmel wachsen.
Dreißig Jahre Junges Literaturforum Hessen-Thüringen. Was bedeutet das? Ich sehe es an der »Nagelprobe«, die jetzt bereits ein kleines Regal füllt. Ich sehe es aber besser noch an unserer Pappel, die längst, am Fenster meines Arbeitszimmers vorbei und auch schon über das Dach des Hauses hinaus tatsächlich weiter und weiter in den Himmel wächst.
im April 2013Martin Lüdke
30 Jahre Nagelprobe – Zwei ehemalige Preisträger erinnern sich
Ricarda Junge
»Abgelehnt« (Nagelprobe)
Am Anfang steht immer die Ablehnung. Wie eine Mauer. Hier geht es nicht weiter, dieser Weg ist versperrt. Ist das eigentlich immer so? Auf das Junge Literaturforum trifft es in jedem Fall zu. Zumindest in meinem Fall. Wie oft habe ich mich beworben? Wie oft bin ich abgelehnt worden? Und viel wichtiger: Warum schreibe ich, dass ich abgelehnt worden bin? In Wirklichkeit waren es doch wohl meine Texte: Gedichte und kurze Geschichten. In jedem Wort, jeder Zeile steckten viel Gefühl, weltbewegende Gedanken, klapprige Reime und eine große Portion pubertierendes Ich. Zuerst war ich zu jung, um das Mindestalter des Wettbewerbs zu erreichen. Ich schickte trotzdem jedes Jahr einen Text ein, mit zwölf Jahren das erste Mal. Wenn ich abgelehnt wurde, dachte ich, dass es an meinem Alter liegen musste. Ich war empfindlich und fürchtete mich davor, immer weiter abgelehnt zu werden. Ich war weder musikalisch noch sportlich noch übermäßig beliebt, und das Einzige, was ich wirklich gern tat, war schreiben. Vielleicht, weil man es auch allein tun konnte. Aber ich hätte gerne ein Gegenüber gehabt. Im Stillen wünschte ich mir jemanden, der mein Schreiben ernst nahm und es nicht lächelnd als Tagebuchschreiberei oder Kleinmädchenspleen abtat. Ich erinnere mich, wie es war, die Texte zu schreiben, weiß noch, wo ich saß, was ich dachte, was mich umgab. Niemals gab ich jemand anderem etwas zu lesen, immer war die mir unbekannte Jury des Jungen Literaturforums meine erste Leserschaft. Ich erinnere mich an das wattige Gefühl im Magen und das Kribbeln unter der Haut, wenn ich mir vorstellte, dass vielleicht in diesem Moment jemand meinen Text – nein: mich – las. So als träte ich in Kontakt, als würde ich mit jemandem sprechen, als hörte mir jemand zu – und ich wartete gespannt auf Antwort. Ich erinnere mich an den Schmerz, den ich empfand, wenn die Antwort kam: eine freundliche, aber unmissverständliche Ablehnung. Und dann war da diese Stille in meinem Kopf, diese Leere. Bis das nächste Jahr kam. Der nächste Wettbewerb. Der nächste Versuch. Ein neuer Text.
Natürlich wäre alles ganz anders gewesen, wenn ich anders gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel hätte singen können und eine Band gehabt hätte, mit der ich am Wochenende im Kulturzentrum aufgetreten wäre. Als Nachwuchsschauspielerin wäre ich Mitglied der Jungen Theaterwerkstatt geworden, als Sportlerin hätte ich einen Trainer und einen Verein gehabt. Selbst wenn ich eine Leidenschaft fürs Blockflötenspielen gehabt hätte – was ich mir allerdings nur schwer vorstellen konnte –, hätte es für mich eine Musiklehrerin und Flötenunterricht gegeben. Nur wenn man schrieb, gab es das alles nicht. Das Einzige, das man dann tun konnte, war, sich Jahr für Jahr wieder beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen zu bewerben. Ich wusste nicht, was genau sich dahinter verbarg. Aber ich wünschte mir auch eine Werkstatt, einen Lehrer, einen Verein, verdammt, ich wünschte mir einfach irgendeinen Ort, irgendeinen Menschen, zu dem ich gehen, an den ich mich wenden konnte.
Mit sechzehn reichte ich drei Liebesgedichte ein, die meinem Klassenkameraden Janosch Schimansky gewidmet waren. Endlich war ich alt genug für den Wettbewerb. Ich wurde trotzdem abgelehnt. Janosch Schimansky interessierte sich weder für meine Lyrik noch für mich. Und das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen erkannte nicht, was für eine gefühlvolle junge Autorin ich war, obwohl mein ganzes Herzblut in die Gedichte geflossen war.
Wie in jedem Jahr verteilte unsere Lehrerin die neue »Nagelprobe« im Deutschunterricht. Wie in jedem Jahr las ich den Band von der ersten bis zur letzten Seite. Die darin versammelten jungen Autorinnen und Autoren stellte ich mir als glückliche Menschen vor. Warum gehörte ich nicht dazu? Was hatten sie anders gemacht? Ich las, ich kam nicht dahinter, ich beneidete sie. Vor allem darum, dass sie jemand gelesen, dass ihnen jemand zugehört hatte. Ich war allein, unverstanden und unglücklich. Es war grauenhaft. Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. Und auch nicht, woher ich die Verbissenheit, die Zähigkeit und vielleicht auch den Mut nahm, mich wieder und wieder beim Jungen Literaturforum zu bewerben.
Mit fast neunzehn Jahren und nach einem halben Dutzend Bewerbungen bekam ich zum ersten Mal keine Ablehnung. Ich weiß noch, dass ich den Brief in der Hand hielt und sicher war, mich verlesen zu haben. Oder bekam ich einen Anruf und glaubte nicht, was ich hörte? Wie konnte das sein? Was hatte ich anders gemacht? Sollte mein Text diesmal wirklich in der »Nagelprobe« erscheinen? Schickte man mich auf das Autorenseminar? Da musste ein Irrtum vorlie gen. Ich konnte gar nicht gemeint sein. Ist das eigentlich immer so? Man wartet und wartet und wartet auf etwas, und wenn es dann eintritt, braucht man die gleiche Zeit noch einmal, bis man begreift, dass es wirklich eingetreten ist? Ich weiß noch, dass die Preisverleihung in Erfurt stattfand. Ein junger Schauspieler, der fast so gut wie Janosch Schimansky aussah, trug dem Publikum meine Geschichte vor. Ich hörte es, so wie ich auch sah, dass meine Geschichte schwarz auf weiß in der Nagelprobe abgedruckt war. Aber wirklich glauben konnte ich es erst, als Janosch Schimansky wutschnaubend vor meiner Tür stand und mir den Band mit meiner Geschichte vor die Füße warf. Wie ich einfach über ihn schreiben könnte! Und noch dazu so einen Scheiß! Was mir einfalle! Dabei war er gar nicht gemeint. Ich hatte ihm hundert Gedichte geschrieben, aber in dieser Geschichte ging es einmal nicht um ihn. Ich hatte sie mir einfach ausgedacht. Aber das behielt ich für mich. Ich sagte: Ist es nicht eine Ehre in einem Buch zu erscheinen? Diese Ehre lehne er entschieden ab, wütete er, musste plötzlich grinsen und senkte verlegen den Kopf, um mich dann wieder anzusehen. Ganz anders als vorher. Ich hatte mir die Autorinnen und Autoren der »Nagelprobe« immer als glückliche Menschen vorgestellt, jetzt wusste ich, dass es wirklich so war. Ich blieb lange mit Janosch Schimansky zusammen, und ich hörte nie wieder auf zu schreiben.
Jan Volker Röhnert
Der Anfang von etwas
Hinter den sieben Bergen beginnt die Literatur. Zumindest war dort, wo ich ausstieg, die Bahn zu Ende, als wäre das ein Halt ohne Wiederkehr, zwar nicht im Mittleren Westen, aber im innersten verwunschenen Oberhessen, als wären die Würfel gefallen und die dort sprudelnde Ohm der Rubikon, den es zu überschreiten galt. Friedberg oder Dreysa, so hieß die Bahnstation, die dann hinter einem Rammbock ins Leere lief, aber ich musste noch weiter, über den Berg und den Hügel hinab, wo die Welt, oder wenigstens die Landstraße, dann nun wirklich zu Ende war und das Elementare begann, das farblose lebenspendende Mineral, »which makes the atoms dance«, wie einmal ein amerikanischer Dichter schrieb und wovon die Ansiedlung im Tal ihren Namen hatte: Salzhausen, das, ohne dass jemand dort davon gewusst hätte, zweimal im Jahr sich zur Keimzelle künftiger Literatur verwandelte.
Aus irgendeinem Grund besaß ich bis auf die Anschrift des Hotels, das sich tatsächlich als das letzte Anwesen vor Flur und Feld erwies, so gar keine Mitteilung darüber, wer oder was mich dort erwarten sollte, so dass ich mit dem Gefühl anreiste, zu einer konspirativen Sitzung einbestellt worden zu sein. Der erste Eindruck in der Runde kam diesem Gefühl ziemlich nahe: Wir saßen völlig auf uns gestellt, ohne weitere Gäste oder Personal, in einem ebenerdigen, dunklen Gastraum, in dem ein kaltes Büffet und Mineralwässer für uns aufgetafelt waren. An der Rezeption stapelten sich unsere Reisetaschen. In der Benommenheit des endlich Angekommenseins schienen alle am Tisch in sich gekehrt oder mit sich selbst beschäftigt zu sein. Ich wartete auf ein klärendes Wort von jemandem, das Aufschluss gegeben hätte über den Zweck unseres Hierseins, ein Signal, das unser Herumsitzen in eine Richtung gewiesen hätte.





























