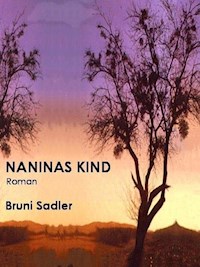
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
NANINAS KIND Roman (166 Seiten) 1.Teil Abschied und Aufbruch Luba, die Protagonistin, verlässt mit 15 Jahren nach dem Tod ihrer Ziehmutter Nanina zum ersten Mal ihr Zuhause. In einem Sanatorium, ehemaligem Kloster, überleben nach einem GAU auf Dauer Nanina und das Kind Luba. Nach 15 Jahren stirbt Nanina im Alter von 32 Jahren in ihrer Herz-Lungenmaschine. Nanina eine SF-Liebhaberin wusste zu Überleben und gibt Luba ihr Wissen mit auf den Weg, ihrer Reise auf der Suche nach Menschen. Ausgerüstet mit allen "Überlebensdingen" und in einem umgebauten Rollstuhl mit Anhänger durchfährt sie einen Kontinent bis zum Meer. Begleiter sind die Elemente der Natur und die dreiste Schwester Einsamkeit. Die Historie der Menschheit im Kopf, gelesen und erzählt von Nanina, findet sie einen Bauernhof, eine Bäckerei, eine Druckerei, ein Schloss mit seiner und ihrer Geschichte, ganz ohne Menschen. Krankenhäuser sind Lieferanten der "Isotonen Kochsalzlösung" und der Lebensmittel. Kaum noch Hoffnung, sieht sie am Himmel ein Flugzeug mit langem Kondensstreifen. 2.Teil Ankunft Ihr Segelboot kentert im Sturm und Luba wird gerettet von Überlebenden eines anderen Kontinentes: Menschen, die durch eine Genmanipulation völlig aggressionslos leben. Sie wird vor die Entscheidung gestellt, diesem operativen kleinen Einschnitt zuzustimmen oder auf eine Insel verbannt zu werden, zu den ewig Gestrigen. Der Schluss endet mit einer überraschenden Wende. Das Manuskript hat einen Grundakkord, den der Titel präludiert ohne breitgewalzte Unterhaltungseffekte, aufgebaut zu einer Fabel von etwas eigentlich Unfasslichem. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das Geröll der Gleichniselemente zu einer bündigen Handlung zu schichten. Brunhilde [email protected]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruni Sadler
NANINAS KIND
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Abschied und Aufbruch
Ankunft
Impressum neobooks
Abschied und Aufbruch
Beeil` dich Luba, mach` dich auf den Weg. Noch steht die Sonne hoch, niemand sonst, der dir den Weg zeigen könnte.
Allein wirst du sein auf deiner Reise. Der Tag wird dich führen, ins Neue, Unbekannte. Komm nütze die Gunst der Stunde, bevor dich die Nacht überschwemmt mit ihrer Dunkelheit. Geh`, sei ohne Angst. Hier ist die Sonne, die dich erwärmen wird. Der Tag, der dich sehen lässt. Der Wind wird dich kühlen. Zeig` dich. Wir erwarten dich. Komm, sei ohne Angst.
Leise schloss Luba die morsche, hölzerne Seitentür des Traktes zum letzten Mal. Drei Tage zuvor erst hatte sie, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen, diese Tür zum ersten Mal geöffnet. Vorsichtig, mit einer Atemmaske vor dem Gesicht, schnupperte sie, Millimeter nur, die Nase direkt am Türrahmen, hinaus. Erst flach, dann tiefer die Luft in ihre Lungen gesogen. Weiter öffnet sie die Tür einen Spalt, trat ganz hinaus ins Freie. Nimmt die Maske ab, fühlt, wie sich langsam ihre Brust hob und senkte, durchatmen, mit leichtem Druck im Kopf ging sie einige zaghafte Schritte, bückte sich und berührte mit der flachen Hand die Erde. So nahm sie nach fünfzehn Jahren den ersten Kontakt mit der Welt draußen, außen auf. Hochblickend an dem Gebäude suchen ihre Augen die Fenster des Zimmers, die ihr und Nanina bisher Heimat, Schutz und Überleben waren.
Mit einer ihr völlig fremden Stimme, hier draußen im Freien, ruft sie gegen das Gemäuer; "Nanina, ich werde deinen Rat befolgen, es ist Zeit, ich werde gehen." Leicht trug der Wind den Klang ihrer Stimme fort, ungehört. Die Atemmaske in der Hand geht sie zurück ins Haus, hinauf in ihr gemeinsames Zimmer. Nanina lag wie immer in ihrer "Eisernen Lunge", die langen, schwarzen Haare nach oben ausgebreitet auf das kleine, weiße Kissen. Luba setzt sich auf ihren Stuhl, der seit Jahren daneben steht, betrachtet das blasse, schmale Gesicht. Zum letzten Mal.
Der Blasebalg steht still, kein atmen von Nanina im Gleichklang des auf`s und ab`s der ledernen Fächer. Sie geht zum Fenster, öffnet es weit, zum ersten Mal und stellt sich stumm die Frage, wie lange schon hätten wir es öffnen können; sieht, dass ein Windhauch mit Naninas Haar spielt. Geht zu ihr, beugt sich weit über die Maschine, hebt die Plexiglashaube über Naninas Kopf und verschließt sie. Zum letzten Mal.
Drei Tage benötigt sie für die Vorbereitungen und zum Verlassen ihrer Heimat in eine ungewisse Zukunft. Trägt einen neuen Rollstuhl hinaus ins Freie, baut mit Gardinenstangen und Plastikvorhängen ein Dach darüber zum Schutz gegen Hitze und Regen. Unter den Sitz legt sie ein Brett als Ablage für die Ersatzreifen. Doch wohin mit den Nahrungsmitteln, ohne sie gab es kein Überleben? Ratlos steht sie, steigt über Einsturzgeröll, sucht das ganze Krankenhausgebäude ab, war erstaunt über seine Größe und entdeckt in der ehemaligen Gartenanlage einen zweirädrigen Karren mit langer Deichsel, zieht ihn zu ihrem Rollstuhl, bindet und verknotet ihn an der Rücklehne. Erschöpft setzt sie sich hinein. So lange im Freien zu arbeiten war sie nicht gewohnt. Sie bewegt den Hebel, er ging leicht vor und zurück und zog den Anhänger. "Alles in Ordnung", nickt sie.
Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang backt sie Fladenbrote aus Reis, stieg xmal in das düstere Kellergewölbe, ihre Speisekammer, ihren Überlebensraum, schleppt die "Isotone Kochsalzlösung" in den Karren, zur Vorsicht eine Sauerstoffflasche, einige Dosen Obst, Decken und Kissen, nützt jeden freien Raum, deckt alles mit Plastikfolie ab, zurrt sie auf dem kleinen Karren fest. Nimmt Abschied in der Dämmerung von Nanina, ängstlich, als wäre der Mut zu groß gewesen oder die Arbeit der letzten Tage zu schwer. Ihre Hände zittern, fühlt, Nanina ist gegangen, hat den Raum verlassen, vor ihr. Fühlt die Leere, bezwingt sich, muss es tun, sauber wird sie ihr Zuhause zurücklassen. Sie ordnet Kleinigkeiten auf dem Tisch, sieht Naninas Tagebuch, nimmt es, drückt es an sich, hört Naninas Stimme: "Luba, wenn ich nicht mehr bei dir bin, nimm es mit, ich habe versucht, ein bisschen unser Leben aufzuschreiben." Fest hält sie den Band umschlossen, bis die Knöchel weiß werden. Nimmt die lederne Handtasche, die Nanina vor Jahren in dieses Haus mitbrachte, legt das Buch zu den Kleinigkeiten, die ihr liebgeworden sind in all den Jahren.
Unruhig war diese letzte Nacht für sie. Bleich und fahl kroch die Sonne über das weit geöffnete Fenster. Sie erwacht, will hinaus aus der Leere. Die Tasche unter dem Arm floh sie die Flure entlang, die Treppen hinunter. Sie verstaut sie an der Rückwand des Rollstuhls. Mahnend hört sie Nanina sagen; verlasse diesen Ort, diese Gegend ohne Halt. Das Zentrum des Unglücks kann nicht weit entfernt sein, bringe es hinter dich. Sie blickt auf ihr Gefährt. Abenteuerlich sieht es aus, der überdachte Rollstuhl, der den kleinen Karren zieht.
Auch das war Naninas Idee; "nimm einen Rollstuhl mit für deine Reise, das geht schneller und ist bequemer", riet sie. Luba nahm diesen Rat gerne an, zumal sie noch nie lange Wege gegangen war, ganz zu Schweigen von einer solchen Reise ins Ungewisse.
Sie setzt sich, bewegt den Hebel, langsam zieht der Karren an, sie hat Mühe die Balance zu halten, noch ungeschickt holpert das Gefährt. Vorsichtig umfährt sie die Risse der aufgeworfenen Auffahrt. Ausgebrochene Mauersteine, Glassplitter und Geröll. Schnell schlägt ihr Herz, aufgeregt ist sie. Zu schnell noch bewegt sie ihren Arm, zu fest hält sie den Hebel. Schmerzhaft spürt sie die Sehnen, sie nimmt die andere Hand zur Hilfe. Sie will hinaus, das Gelände hinter sich lassen. Sie erreicht das Tor, eingelassen in der Mauer, die standhielt, allem trotzte, erbaut von Händen, die an seine Unsterblichkeit glaubten. Nun bröckelt der Putz, legt blanke rote Steine frei.
Den Kopf tief zwischen den Schultern, angespannt, verkrampft, die Augen auf den Boden geheftet, schiebt sie sich Meter um Meter vor. Kurz lüftet die Sonne den diesigen morgendlichen Schleier und kann nicht glauben, was sie da sieht. Den Schatten, den das Gefährt wirft, neu ist er. In dieser Gegend gibt es andere Schatten, die kennt sie, seit Jahren unverändert, aber hier, der bewegt sich. "Halt an Wind, sag mir, was ich da sehe"? Oh nein, er wird nicht antworten. Zu groß ist seine Freude, mit den Haaren des Mädchens zu spielen, um das Gefährt zu tanzen, die Plastikplane, die über den Karren gezurrt, anzuheben; mit einem schmatzenden Laut wieder hinaus zufahren, er fühlt den Atem, den das Mädchen keuchend vor Anstrengung ausstößt, prüft ihn, wirbelt ihn hin und her, schlüpft neugierig in die Kehle des Mädchens, das sich verschluckt, hustet, ihn ausspuckt, doch er lässt nicht locker, fährt durch den offenen Kragen über den Rücken. "So antworte doch, Wind", ein heißer Sonnenstrahl bannt ihn für Sekunden. "Du bist zu langsam", wirbelt er hinauf zur Sonne, "mir gehört sie, ich will mit ihr spielen. Du wirst sie sehen, wenn sie bei uns bleibt, länger, vielleicht den ganzen Tag". Fast hätte er sich verplaudert. "Da sind Schweißtropfen auf der Stirn des Mädchens, ich muss sie trocknen, also stör mich nicht, Sonne".
Luba keucht eine Anhöhe hinauf, steigt aus, geht nach hinten, schiebt den Karren, kommt in eine Schräglage, muss ihn über aufgeworfene Rillen hinweg anheben. Sie erreicht die Anhöhe, stützt sich einen Augenblick auf, hebt ihr Gesicht in den Wind, atmet aus, reckt den gebeugten Rücken und sieht sich um. Blickt auf Zurückliegendes, Vergangenes, leicht Überschaubares.
Braun und schmutziggrau liegt eingebettet zwischen sanften Hügeln, das ehemalige massive Gebäude des Klosters. Kleine Türme, abgebrochen, erheben sich bizarr aus den umliegenden Trümmern. Friedlich, ohne Laut, liegt das Tal ausgebreitet in dunkler Schönheit. Bäume recken Restäste von sich. Schwarz ist die Erde, wie hingeworfen, Steine und Geröll. Ringsherum zerstreut, zusammengedrückte, verfallene Häuser. Ihr Auge tränt vor Anstrengung. Es ist das erste Mal, dass sie ohne Begrenzung sieht. Sie wischt die Augen, sieht mit dem inneren Auge, das von Nanina Erzählte, sieht das Gewesene. Die Kinderbuchidylle.
Das alte Kloster, von Benediktinern erbaut, ist wehrhaft mit einer hohen Mauer umgeben. Obstbäume stehen inmitten saftiger, grüner Wiesen. Kleine Hütten, Stallungen für Schweine und Rinder, die hier weideten. Sie halfen dem Kloster sich selbst mit Fleisch zu versorgen. Draußen arbeiten die Mönche für diejenigen, die drinnen sich ihren Studien widmen. Die Brüder draußen krümmen den Rücken beim Anlegen der Gärten, beim Pflanzen und Ernten. Weit ab von der nächsten Stadt, um Einflüsse abzuhalten. Weit spannt sich ihr Himmel von einem Ende zum anderen, noch lauschen sie dem Wind, der ihre Wälder bewegt, in denen sie jagen, Pilze und Beeren sammeln. Wie viele Jahre mögen sie den Segen des Himmels für sich erbittet haben? Ungehört, umsonst. Alt wurden sie und immer weniger. Kein Nachwuchs mehr, niemand, dem sie ihre Lehren weiter vermitteln konnten. Die Stadt breitet sich aus, schon rückt sie näher, laut und schmeichelnd, mit Abgeordneten, die an die Pforte klopfen. Von Krankheiten erzählen, die man besser hinter dicken Mauern versteckt. Verschreckt zogen sich die Mönche zurück. Doch nicht lange, bald darauf baute man um, setzte leichte Gebäude neben die alten Festen, errichtete Labors, Gebäude mit hohen Schloten, Unterkünfte für Betreuer und Ärzte, schmückte sie mit Girlanden, hielt Reden mit schönen Worten, wie Sanatorium und Kurort, schickte Lungenkranke und Ansteckende, nicht Heilbare, später die neue Krankheit, Immunschwache, auf die Anhöhe der ehemaligen Benediktinerabtei.
Das Alte hielt stand, nur das Neue ist zusammengefallen, eingebrochen. In Geröllhalden liegt es in der untergehenden Sonne. Manch Glasscherbe wirft einen diamantenen Strahl. Verrostende Autos liegen vor der Einfahrt. Noch steht ein Krankenwagen mit aufgemaltem Kreuz aufrecht, als warte er auf Patienten, die Türen geöffnet, bereit zur Weiterfahrt. Als hätte Luba in ihrer Unachtsamkeit ein Glas Wasser über Kinderbuchbuntes gekippt, hat sich die Farbe der Landschaft verwischt. Und doch war es ihr Heimat gewesen, dort, bei Nanina die zurückblieb, bleiben musste, auch ohne das große Unglück dort geblieben wäre. Für immer in der "Eisernen Lunge".
"Lös` dich Luba, du musst weiter, bevor es vollends dunkel wird". Die Stimme Naninas nimmt sie mit, sie wird bei ihr bleiben. Schon sitzt sie in ihrem Stuhl, bewegt rasch den Hebel. Nur auf die Straße achten, fahren zur ersten Nacht unter freiem Himmel. Sie muss nicht warten, bis die Hügel die Sicht versperren, es ist die Nacht, die ihre dunkle Hülle darüber zieht, weitere Blicke nicht erlauben. Sie hält an, holt aus ihrem Vorrat eine Kerze, entzündet sie, sucht eine Stelle, einen Ort. Ein wenig seitlich von der Straße findet sie eine freie Fläche ohne Geröll, zwischen zwei Baumstümpfen. Sie zurrt die Plastikplane von ihrem Karren, legt eine Decke auf die Erde, isst im Schein der Kerze ein Fladenbrot, das sie gestern mit so viel Hoffnung gebacken, spült den Brei in ihrem Mund mit einer Flasche "Isotone Kochsalzlösung" hinunter. Die Müdigkeit kriecht durch ihren Körper, erreicht den Kopf, sie bläst die Kerze aus. Als flöge der letzte Funke in die Nacht, entzünden sich tausend kleine Flämmchen, die ihr zublinken. Umsonst. Sie ist eingeschlafen.
Angespült, gestrandet. So nahm sie die ausgetrocknete, rissige Erde an. In ruhigen Wellen verläuft ihr Atem, still und genügsam, nicht wie damals dieser lang gezogene aus rotem Körper hervorquellende erste Schrei, der im Entsetzen unterging. Nur gehört von ihrer Mutter...............
Lubas Mutter lag hermetisch abgeschlossen unter einer Plastikplane im Kreißsaal. Die Wehen hatten eingesetzt. An Leukämie erkrankt, hatte man sie auf die Anhöhe gebracht, hoffend auf Heilung und hoffend, einem gesunden Kind das Leben zu schenken. Alle Vorkehrungen waren getroffen, beruhigend der junge Arzt. Schritte auf dem Flur. Telefone klingelten, die Sirene des Krankenwagens drang schwach durch die geschlossenen Fenster. Die werdende Mutter presste im stummen Grollen, drängender die Stimme des Arztes, aufmunternd die der Schwester. Schon hielt der Arzt den Kopf des Neulings in der Hand, zog ihn ins Leben, hielt ihn hoch, als mit donnerndem Krachen der Kreißsaal in purpurnes Licht getaucht wurde. Die Fenster zersprangen und die Menschen taumelten gegen die Wand. Der junge Arzt warf geistesgegenwärtig das durchscheinende neue Bündel Leben in den Brutkasten und verschloss ihn.
Die Erde barst, bäumte sich auf gegen das Ungeheuerliche, das man ihr antat.
Ruhig gab er seine Anweisungen an die Entsetzten, verhängte die Fenster mit weißen Tüchern, versorgte die Mutter mit Umsicht, setzte allen eine Atemmaske auf. "Ihr wisst, was zu tun ist, wir haben es oft genug geprobt, nun ist es geschehen, ein Kernkraftwerk, ob rechts oder links von uns, hat einen Unfall, also steht nicht herum, beeilt euch, nehmt euch zusammen, wir wussten, es würde einmal geschehen."
Früh zog sich der Tag zurück, verschwand im Tosen und Beben, hier gab es nichts mehr zu Sehen. Die Sonne zog sich einen Schleier vor das Gesicht. Diese Schande.
Die Nacht hielt die Sterne zurück, auch sie verschwand hinter einer Wolke aus grauem Staub. Grau blieb es, bis der Regen zur Rettung des Himmels ihn herabsenkte. Verschont den Himmel, vernichtet euch, wenn ihr es wollt. Wolkenbruchartig spie er sich über die Erde aus. In lähmendem Zeitgefühl, ohne Datum liegt das geborstene Land. Wen kümmerten Gezeiten des Jahres? Tag und Nacht lösten einander ab, ohne gesehen zu werden.
Warm streuten die Sonnenstrahlen ihr Licht unter Lubas Augen, noch träumt sie, von weißen Tüchern, die aus dem Fenster des Gemäuers wehen und Kinderbuchäpfel regnen, horcht halbschlafend auf das Geräusch der "Eisernen Lunge", die zeigt, wenn Nanina erwacht. Sie lauscht nach der Alltäglichkeit des Raumes, wirft die Decke zurück und spürt den Schmerz in den Armen, lässt sie sinken, schwer liegen sie an ihrer Seite. Sie wird wach. Ein kühler Wind bewegt den Staub, er scheint sich auf sie nieder gesenkt zu haben. Ihr Gesicht ist schmierig. Sie steht auf, holt eine Flasche Wasser, nässt ein Tuch, wäscht sich den Staub aus Gesicht und Augen, trinkt den Rest der Flasche, reckt sich, breitet die Arme aus, lässt sie schmerzhaft fallen. Nicht gehen lassen, du musst weiter. Sie stülpt sich Gummistiefel und Ledermantel über, schiebt das Gefährt zur Straße, setzt sich hinein, bewegt den Hebel unter Schmerzen. Doch blank und ausgeruht die Augen, sieht sie die Erde unter der Sonne, nicht zerstört, nur ruhend bis zum nächsten Grün. Sie wird unbekanntes Land durchfahren. Es ist ihr Land, ihr Heimatboden und doch haben ihre Füße ihn bisher nie berührt. Für sie gab es nur die Flure im Krankenhaus, die vom Zimmer zum Keller führten. Hier ist ihr alles fremd.
Wenn sie nicht acht gibt, wird sie sich an den spitzen Steinen die Reifen aufstoßen oder in einer aufgeworfenen Rille hängen bleiben. Sie muss vorsichtig sein, wenn sie am Ziel ihrer Reise ankommen will. Sie darf Nanina nicht enttäuschen, ihre Lehrmeisterin, die sie hinausschickte um Menschen zu suchen.
Die Sonne steht hellrot am Himmel, wärmt die schmerzenden Schultern, verringert den Schmerz in den Armen, dehnt die Sehnen. Stunde um Stunde gräbt sie sich in die Landschaft, die eintönig rechts und links der Straße nur Unrat, wie Blech, leere Fensterrahmen, alte zerborstene Türen, kleinere Anhäufungen säumten. Die Einsamkeit macht sich breit, setzt sich zu ihr. "Ich werde bei dir bleiben, dich begleiten. Lang hielt ich Ausschau nach einer wie dir", flüstert sie. Luba schüttelt den Kopf, sagt laut: Nein.
Umsonst. Sie wird unachtsam, der Karren hat sich festgefahren, sie musste aussteigen, ihn gerade stellen, schieben. Der gekrümmte Rücken schmerzt. Es war Zeit für eine Pause. Sie sucht den Schatten, muss essen und trinken.
Gesättigt von zu vielen Reisfladen, die nicht mehr frisch waren, aber ihren Hunger stillen, lehnt sie sich zurück. Wie gerne hätte sie mit jemandem gesprochen und gelacht. Bleiern liegt die Stille über ihr, kaum auszuhalten. Sie horcht in die Nacht hinaus, nichts rührt sich. Ihr ist, als wolle sich zu der Einsamkeit die Angst setzen. Sie wehrt ab, will sie abschütteln. Verschwindet, schreit sie ungehört in die Nacht, greift nach dem Tagebuch von Nanina, blättert in den Seiten, sieht die runde noch kindliche Handschrift, ähnlich ihrer heute. Wort um Wort füllen die Seiten. Luba liest, ruhiger geworden, nun nicht mehr allein und die Einsamkeit flüchtet.
Seit fast zwei Jahren lebt Nanina hier, in liebevoller Fürsorge von ihren Eltern auf die Anhöhe gebracht. Ein Zimmer mit Aussicht. Zwei hohe breite Fenster überfluten den Raum mit Helligkeit, der voll gestellt mit Privatem, ein Zimmer von der "Eisernen Lunge" beherrscht. Mehrere Stunden täglich bringt sie darin zu. "Natürlich nur vorübergehend", versicherten die Ärzte. Man hoffe und sie mit ihnen. So nahm sie es gelassen und widmete sich ganz ihrem Hobby, dem Lesen von Science- Fiktion Romanen. Hier ließ sie ihrer Phantasie freien Lauf, flog mit zu anderen Galaxien, entwickelte Überlebensstrategien. Musste sie in ihre Maschine, wurde diese zum Raumschiff und die Krankheit verlor ihre Bedrohung.
Mehrmals täglich lag sie darin, je nach Anstrengung, Witterung oder sonstigen Einflüssen, die ihr das Atmen schwer machten. Es war früher Nachmittag und sie mühte sich in ihre Maschine einzusteigen, als ein ohrenbetäubender Knall das Zimmer erschüttert, ein greller Blitz es in gelbes Licht taucht. In den Haltegriffen hängend übersteht sie den ersten Stoß, löst sich von der schwankenden Maschine, lässt sich auf den Boden fallen, robbt zum Fenster, um hinauszusehen, zu sehen, wie es geschieht, wenn sich die Erde öffnet. Sieht wie Bäume zu Boden geschleudert werden und Gebäude wie Kartenhäuser zusammenfallen. Eine Windböe fegt Glassplitter und Möbelteile über den Hof, Menschen rennen zu ihren Autos, versuchen zu entkommen. Es war passiert. Sie hat es hundertmal gelesen. Schnell fasst sie sich, eilt zum Flur, zu einem Wäscheschrank, zieht eiligst alle weißen Laken hervor und behängt ihre Fenster, kaum achtend auf die Menschen, die schreiend über die Gänge hetzen. Dann verstopft sie die Türritzen mit Decken, legt sich in ihre Maschine und verschließt sorgfältig die Haube über ihrem Kopf.
Weitere Explosionen erschüttern das Krankenhaus. Der Generator fliegt in die Luft. Mehr als dankbar war sie dem Arzt, dass sie die einzige alte "Eiserne Lungenmaschine" damals bekam, mit dem Blasebalg, den sie mit ihren Füßen betätigen konnte und so unabhängig wurde von jeglicher Elektrizität. So lag sie geschützt und abwartend, ruhig im Wirbel des Ausbruchs. Sie wollte überleben.
Tage verbrachte sie ausschließlich, mit nötigen kurzen Unterbrechungen, in ihrer Maschine. Ohne Nachricht über das Ausmaß des Geschehens, verunsichert und isoliert, drängten die Kranken und das Personal in die nahe gelegene Kreisstadt. Einige, im Leben allein Gebliebene richteten sich ein. Sahen nach ihr, brachten schnell gekochtes, rückten zusammen, schickten sich ins Unvermeidliche.
Wochen später. Es war stiller geworden im Haus, seltener Besuche anderer. Vorsichtig war sie aus ihrer Maschine gestiegen und mit einer Atemmaske vor dem Gesicht, durchstreifte sie Gänge und Zimmer, sah Reste von Menschen, haarlos und mit Geschwüren übersät, die schnell hinter Türen verschwanden, sich versteckten. Der Tod hatte alle Hände voll zu tun, gönnte sich keine Pause. Sie umging ihn, fand das Kellergewölbe, hier bis zur Decke gestapelt lagerten Lebensmittel. Ihr Bade- und Duschraum wurde zur Küche, die Duschwanne zum Herd, mit einem Gitter als Rost, unter dem manch Stuhlbein verbrannte und Wärme verströmte. Sie begann ihr Tagebuch, hielt Zwiesprache mit ihm in langen Stunden und hoffte weiter, dass die Retter bald kämen. Bis dahin diente die Wand als Kalender, der mit der Stunde Null begann.
Luba war eingeschlafen, lag als kleines Bündel eingemummt inmitten ihrer leeren Dosen und Flaschen. Nicht sanft eingeschlafen, sondern vom Schlaf überrumpelt, das Buch noch geöffnet neben sich. Traumlos. Erst als die Morgendämmerung aufzieht, öffnet sie die Augen, die tränen und schmerzen. Nimmt ein Tuch, netzt es mit wenig Wasser, streicht kühlend darüber, wird vollends wach. Rührt in einem Glas einige Vitamintabletten, unerschöpflich schien davon die Krankenhausapotheke zu sein, trinkt, denkt, ich muss weiter, packt ihren Karren, zurrt den Gurt fest. Schon sitzt sie in ihrem Rollstuhl und bewegt den Hebel. Vor ihr noch zaghaft die ersten Sonnenstrahlen, selbst noch ein wenig lahm, kaum wärmend und windlos. Sie fuhr, ihren schmerzenden Arm ignorierend, schneller. Da vorn -eine Kreuzung, ein schief hängendes Schild, gelb, mit schwarzer Schrift, eine Nachricht von Menschen an Menschen, mit Kilometerangabe, "Vierzig" stand da. Doch in welche Richtung? Die Spitze zeigt auf den Boden.
Luba wird zornig; "Konntest du nicht warten, stehen bleiben, deine Pflicht erfüllen hier an der Kreuzung, hast die Hoffnung aufgegeben, dass hier noch jemand vorbeikommt?" Sie nimmt ihre Karte aus der Tasche, sucht und findet den Ort, der auf dem Schild steht. Fest hält sie den Finger darauf. Von Menschen eingezeichnet, eine Botschaft. Sie verlässt sich auf ihr Glück, biegt ab, hofft das Richtige zu tun, fährt rasch weiter. Nun kann sie selbst ausrechnen, wie schnell sie ist, wie viel sie an einem Tag schafft. Nun hat sie eine Angabe, eine Zahl. Die Straße wird enger, schmaler, fast nur noch ein Weg. Sie müht sich, doch umsonst, hier kommt sie nicht mehr durch, der Weg endet im Nichts. Trostlosigkeit macht sich breit, sie möchte aufgeben. Keine Stadt, kein Dorf, nichts, sie hat sich geirrt, automatisch schon bewegt sie ihren Hebel, fährt zurück, nimmt einen anderen Weg. Vier Tage später. Diese Müdigkeit.
Wie kommt es, dass der Körper nicht mehr den Befehlen des Gehirns gehorcht? Woher dieses übermächtige Bedürfnis, sich irgendwo zu Boden sinken lassen, ohne sich um Schutt oder Trümmer oder einen schattigen Platz zu kümmern. Sie weiß, dass die Müdigkeit nicht aus ihrem Innern kommt. Da ist sie sicher. Sie strebt mit allen Fasern vorwärts. Aus ihrem Kopf kommt sie nicht. Es sind ganz einfach die Arme und Beine. Sie wollen nicht mehr. Doch sie muss weiter, sie darf ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren.
"Luba, wach auf, öffne die Augen. Sieh` der Tag ist da. Die Morgendämmerung ist grußlos gegangen, bewege deinen Arm". Schwer ist ihr Körper. Sie steht auf, ganz dünn und mager ist sie, grau vom Staub des Weges. Sie darf sich nicht mehr waschen, muss haushalten mit dem Wasser. Sie bürstet sich den Schmutz aus den Haaren, isst eine Dose Obst, packt zusammen, langsam und bedächtig. Ich bin so müde, ich werde zurückgehen, ich muss mich ausruhen, denkt sie und blickt mit rotgeränderten Augen in die Sonne, folgt ihren Strahlen auf dem Weg und sieht in der Ferne ein metallisches Aufblitzen.
Als wären diese hellen Punkte Impulsgeber, strömt neue Kraft durch ihre schmerzenden Arme, hastig und neugierig hält sie darauf zu, schneller wird sie, nähert sich dem Blinken, kann es nicht erwarten, steigt aus, rennt eine Geröllhalde hoch, über schwarze Steine, greift in Dorniges und erkennt dunkel und rostrot zwei Schienenstränge. Gleise überwuchert der blanke Stahl, nur hier und da kleine silberne Flecken, die, von der Sonne beschienen, Lichtreflexe aussenden. Vielleicht hatte etwas darauf gelegen, ein Kiesel oder so, dass sie so jungfräulich sauber die Jahre überstanden. Wohin führen die Stränge, woher kommen sie? Sie beugt sich, legt ihr Ohr auf die Schienen, lauscht, spürt die leichte Vibration, leise geben ihn die verbindenden Bohlen von Strang zu Strang.





























