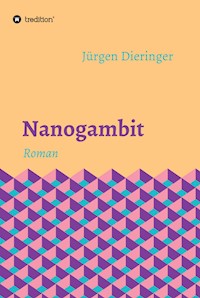
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tübinger Naturwissenschaftler Andries Niemetz macht eine bahnbrechende Entdeckung im Bereich der Nanotechnologie, die den Lauf der Weltgeschichte verändern könnte. Skeptisch gegenüber universitären Ethikräten und staatlicher Regulierung forscht er im Geheimen. Doch nach einem Diebstahl wird dem Professor bewusst, dass seine Erfindung die Büchse der Pandora geöffnet hat. Der von Niemetz beauftragte Privatdetektiv Mennet jagt dem Material in Istanbul und Budapest hinterher, während der Professor in Tübingen die Grenzen der Wissenschaft aufgezeigt bekommt. Ein Roman über Ethik in den Wissenschaften und die Gefahren der Forschung. Hintergrund dieses Romans ist eine naturwissenschaftliche Debatte aus den 1980er Jahren, die damals noch utopisch war. Mit dem rasanten wissenschaftlich-technischen Fortschritt - auch und gerade in der Nanotechnologie - steht die einstige Utopie nah an der Schwelle zur Realität. 2016 gewannen Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart und Bernard Feringa den Nobelpreis für Chemie. Sie entwickelten Nanomaschinen aus Molekülen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jürgen Dieringer
Nanogambit
Roman
© 2018 Jürgen Dieringer
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-8881-8
Hardcover:
978-3-7469-8882-5
e-Book:
978-3-7469-8883-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1
Unumkehrbar
Es war nicht wie sonst, als er wegwollte, aber nicht vom Fleck kam. Eher das Gegenteil: Jemand wollte im REM-Schlaf die Initiierung verhindern, doch die Erfindung machte sich selbständig, sie zischte hinaus in die Weltgeschichte wie ein losgelassener Luftballon, furzend, unkontrolliert und unaufhaltsam. Andries Niemetz wachte auf, feucht wie ein mit schwacher Hand ausgewrungener Waschlappen. Es macht keinen Sinn mehr, es immer wieder hinauszuschieben, den Zweifeln und der Angst vor der eigenen Courage nachzugeben. Der Professor hatte den Tag im Kalender mit einem grauen Filzstift umrandet. War das Zufall? Grey goo, die graue Schmiere! Die Vernichtung allen biologischen Lebens auf der Erde, eine Ökophagie, verursacht durch Nanoroboter, die exponentiell wachsen und dabei alle Materie für ihre eigene Reproduktion verbrauchen. Maschinen, die aus den Fugen geraten, die sich selbständig machen wie ein Pubertierender, sich der Kontrolle von Eltern und Lehrern entziehend. Grey goo war nur einer seiner vielen Albträume und nur eine der Gefahren, die wie Damoklesschwerter über der Erfindung baumelten.
Schwachsinn! Hatte nicht auch Eric Drexler höchstselbst bereut, den Begriff ‚Grey goo‘ überhaupt in die Welt gesetzt zu haben? Untergangsszenarien von Kultur- und Wissenschaftspessimisten, konservativen ‚Bewahrern‘, die nicht kapiert hatten, dass Bewahrung zum Stillstand führt und Stillstand erst zum Rückschritt, dann zur Implosion. Was die Menschheit forschen kann, wird sie forschen, wenn nicht er, dann irgendjemand im Reich der Mitte, im Silicon Valley oder in einem hermetisch abgesperrten Labor in der Negev-Wüste. Deutschland, das Land der Bedenkenträger, vielleicht hätte er sich doch für Berkeley entscheiden sollen und nicht für Tübingen und die Bundesrepublik, mit dem ganzen Knäuel an erstickenden Regularien und Ethikräten. Es hatte schon viel Kraft gekostet, sie zu umgehen, wieviel mehr Energie hätte es gekostet, den offiziellen Weg zu gehen?
Der Professor verzichtete auf das Frühstück und fuhr durch den Schneematsch des nur noch zuckenden Winters ans Institut. Es war noch keine sechs Uhr am Morgen, als er seiner Versuchsanordnung mit einem banalen Druck auf einen Schalter Leben einhauchte.
2
Verspielt
Es ging um die Wurst – und er war das Würstchen, dessen Restlebenszeit auf einer scharf geschliffenen Klinge über dem Abgrund der Verstrickung jonglierte. Er hatte den anderen unterschätzt, mea culpa, mea culpa! Das Herz trommelte wie Keith Moon zu seinen besten Zeiten einen über den Durst. Als er Schritte hörte, laut wie das durchziehende Spätsommergewitter, vollzogen seine Nackenhaare einen Hochsprung in die Vertikale. Er hatte geglaubt, nur vor der Polizei fliehen zu müssen. Fataler Irrtum! Mit dem Hades und seinen Kreaturen aus der Büchse der Pandora hatte er nicht gerechnet. Aber ja doch, er hatte den Teufelspakt nicht eingehalten, nicht einhalten können. Zu dumm! Der Feind meines Feindes ist mein Freund, warum war er nicht früher draufgekommen. Man hätte einen Deal machen können, ein Positivsummenspiel, nur Gewinner. Aber die hier hatten kein Mandat zum Verhandeln.
Er spürte ihre Schatten auf der Haut seines Gewissens. Kein Zweifel: Sie waren hinter ihm her, die Aasverwerter der Gesellschaft. Im trippelnden Schritt des Blitzgealterten ging es durch den alten botanischen Garten. Seitenstechen, ein hämischer Gruß der Leber, die zuckte wie eine frische Jakobsmuschel aus der Bretagne, sich vergeblich dem Sauerstoff der Luft und der Säure der Zitrone erwehrend. Im Reservemodus ging es durch die graffitiverschmierte Unterführung mit der Kinowerbung, hechelnd am Bach entlang, vorbei am weißen Buch aus Stein. Jetzt, in der Zeit größter Not, fiel ihm auf, dass er nicht einmal den Namen des Baches kannte. Weiter, nur nicht stolpern, mit dem lädierten Knie. Auf dem Zahnfleisch unter dem Fachwerkhaus hindurch, nur noch zwei Ecken, durch das Tor in die bewehrte Zuflucht des Priesterseminars, wo ihm ein alter Bekannter der Familie mit einem unappetitlichen Laster Unterschlupf gewähren würde, einen Cordon sanitaire für den Augenblick. Er würde weg müssen aus dieser Stadt, diesem Land, von diesem verfluchten Kontinent, der mittlerweile sogar kriminaltechnisch zusammenwuchs. Ein neues Leben, fernab von diesem Wahnsinn. In Südostasien sollen sie einen angeblich in Ruhe lassen, solange man zahlt. Er würde noch einmal raus müssen, den Zugriff auf die Finanzen sichern. Er würde es bekommen, das Fluchtgeld, und dann vorbei an den Dummköpfen von Polizei und LKA und wie sich die ganze Mischpoke an Steuerzahlergelder verschwendenden Diensten nannte. Vor den schattenspendenden Palmen standen leider kirchturmhohe Hürden. Willkommen in der traurig-profanen Realität. Schweiß schmierte eine Lage Salz auf seine Haut. Hieß der Bach nicht Ammer?
Das Projektil nahm Obhut im Metabolismus des Flüchtenden, schlug ein faustgroßes Loch in den Oberkörper und warf den Mann in den Staub. Die Erkenntnis ließ eine ungehörig lange Weile auf sich warten, um dann ungebremst einzuschlagen wie ein Meteorit auf einen Planeten ohne Atmosphäre. Nur die herannahende Ohnmacht kümmerte sich um das Opfer – und das Kino des Lebens begann mit dem Vorspann abzulaufen.
3
Von Fall zu Fall
Theo Mennet gehörte zu den Menschen, die die Bude nachts verrammeln, die Rollläden auf blickdicht und den Schlüssel im Schloss. Das war gut gegen Einbrecher und gegen unerwünschte Sonnenstrahlen in der Herrgottsfrühe. Er tappte im Dunkeln zum Lichtschalter, Oberkörper frei und die Pyjamahose als Solitär auf Halbmast. Immer im schönsten Traum, verdammter Dünnschiss noch mal, das war eine ausgemachte Verschwörung. Ein Druck mit dem Daumen, aber die moderne Glühbirne schien es sich erst einmal zu überlegen, bevor sie verzögert den Tag simulierte. Er schloss geblendet die Augen und fummelte nach dem Hörer. Sein in die Muschel gegähntes ‚Ja’ klang mehr wie ein Stoßseufzer als wie ein Willkommensgruß.
Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine angenehme Stimme, sonor, man hörte ihr den Schliff des gehobenen Bildungsbürgertums an, eine geschulte Stimme, voll im Safte, die zu erschallen pflegte, den Raum füllend, ausgreifend. Unter anderen Umständen war sie bestimmt von Selbstbewusstsein erfüllt. Heute klang ein gewisser Bodensatz an pikiertem Zögern mit.
„Herr Mennet, Theo Mennet?“
„Ja, am Apparat.“ Mennet klang genervt. Wenn man auf neue Kunden wartet, sollte man besser nicht genervt klingen, das war ihm in den Tiefen seiner erst im Vorglühen begriffenen Synapsen schon klar. Er biss sich leicht auf die Zunge, bis ein sachter Schmerz sich kitzelnd meldete. Das Problem war, neben der doch recht frühen Stunde, dass ihn seit Wochen ein Vertreter von Maison Vins de Bordeaux am Telefon terrorisierte, zu fast jeder Tageszeit, sieben Tage die Woche, so ein Marktschreier mit fehlender Mundbremse und Keramiklächeln. Nur einmal hatte er den Fehler gemacht und etwas bestellt. Warum auch nicht? Er brauchte ein Geschenk für einen guten Kunden. Davon gab es nur wenige in Theos altmodischer Karteikartenbox, also musste man die wenigen wenigstens pflegen. Bordeaux macht sich immer gut.
Privat war Theo eher der Biertyp, abzulesen an der leichten Schwellung über dem Hosenbund. Kein Grund für die penetrant nachgefragten Folgebestellungen, weil weder Eigenkonsum noch Kundenbetreuung in die entsprechenden Quantitäten neigten. Theo hatte gedroht, gefleht, geschrien, bis sich sein Arsenal an Flüchen in der Begrenztheit der deutschen Sprache erschöpfte. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kapitalverbrechen für Menschen, die keine Zeit zu verschenken haben.
Nicht, dass Mennet überbeschäftigt gewesen wäre. Keineswegs.
Am Ende war der Detektiv die Plage dann doch noch losgeworden, als er dem Drückerrabauken in morgenländischem Tonfall zu verstehen gab, Mennet sei ausgezogen, er wiederum sei Herr Hussein. Auf die Nachfrage, ob er denn an Rotwein von der Rive gauche interessiert sei, antwortete Theo mit ‚nix Rotwein, ich Muselman’. Der Papagei legte ohne Abschiedsgruß auf. Allah akbar!
„Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so früh anrufe“, wurde vom anderen Ende der Leitung etwas zögerlich verlautbart. Definitiv kein Vertreter, die entschuldigen sich nie. „Mein Name ist Andries Niemetz, Professor Andries Niemetz.“
Theo ließ seine Blicke schweifen und zog am Rollladen, die Kuckucksuhr aus den Beständen der reichlich blanken Erbtante zeigte acht Uhr am helllichten Morgen. Die ersten brutalen Sommersonnenstrahlen hatten es über die maroden Häuser Kreuzbergs geschafft und tauchten das Einzimmerappartement in ein diffuses Licht. So, ein Wissenschaftler also, schon wieder. Theo gähnte heimlich in seine Hand und rieb sich Augenbutter aus den Augenecken, um sie anschließend genüsslich zwischen Daumen und Zeigefinger zu verschmieren.
„Herr Mennet? Sind Sie noch am Apparat?“
„Klar, schießen Sie nur los, Professor.“
Mennet klemmte das altertümliche Gerät gähnend zwischen Schulter und Ohr, er war jetzt aufnahmebereit.
„Ich brauche einen Privatdetektiv und Sie sind mir empfohlen worden, von Doktor Schippke.“
Schippke? Scheiße! Das war ein Fall, an den Theo auf gar keinen Fall erinnert werden wollte. Heiliger Strohsack! Er hatte ihn schließlich eigenhändig vermasselt. Ein typischer Nachbarschaftsstreit über den Gartenzaun hinweg, Typ Frucht der Erkenntnis wuchert über die Grenzlinie, mit der Folge beidseitiger rektalbasierter Beleidigungen. Mennet hatte sich angeschlichen und die Ausführungen des Nachbarn heimlich mitgeschnitten. Leider vergaß er, die kaum hörbaren Erwiderungen Schippkes vom Beweisband zu löschen. Der Anwalt des wegen Beleidigung Angeklagten wurde auf das Grummeln im Hintergrund aufmerksam. Er ließ die Aufnahmen in die Technik bringen und förderte eine im Ausdruck zwar gehobene, aber strafrechtlich immer noch relevante Gegenattacke ans Tageslicht. Der jugendlich wirkende Richter mit dem pseudo-modischen Stufenhaarschnitt à la Junge Union schlug vor, die beiden Streithähne mögen ihn mit solchen Dingen verschonen, sich verdammt noch mal auf gutnachbarschaftliche Beziehungen einigen oder ansonsten zur Fernsehrichterin Barbara Salesch gehen. Wer hätte dem braven Seitenscheitel derart Humorvoll-Treffendes zugetraut? Der Richter stellte das Verfahren ein, die Kosten hatten die beiden Kontrahenten ‚brüderlich’ – das waren bei der Urteilsverkündung tatsächlich seine Worte – zu teilen. Seitdem war Frieden eingekehrt im Hause seines Auftraggebers. Es war ein kalter Frieden, aber der Fall war mithin gelöst, allerdings nicht zur Zufriedenheit des Wissenschaftlers, seines Zeichens beschäftigt an einer Berliner Universität. Dass Schippke ihn trotzdem weiterempfohlen hatte, war, gelinde gesagt, überraschend, auch etwas befremdend. Na gut, er hatte kein Honorar verlangt. Trotzdem, Dr. Bernard Schippke rotierte damals vor Wut und tunkte den bemitleidenswerten Detektiv in eine zornige Suada. Erst die Aussicht auf Rückzahlung der Vorkasse und der Spesen, also Appeasement in reinster Form der unseligen Neunzehndreißigerjahre, hatte ihn in einen Zustand der Tranquilität zurückversetzen können. Zen, man, Zen!
Theo stand kurz vor Vollendung seines vierzigsten Lebensjahres und damit mitten in einer ausgewachsenen Midlife-Krise. Leonida – Theo und Leo, das Traumpaar von einst, was eher an der Begeisterung der Jungs für Leo lag als der Mädels für Theo – hatte ihn vor Jahrestag verlassen. Seit sie ihrer Promiskuität mit einem anderen frönte, war er erfolglos auf der Suche nach achtzehnjährigen, langbeinigen Neunzigsechzigneunziger-Blondinen. Als Theo die Verflossene nach fast einem Jahr im Supermarkt zufällig wieder traf und ihr in einer peinlich anrührenden Szene seine Einsamkeit klagte, empfahl Leonida eine Prise Schizophrenie, dann fühle es sich wenigstens nicht so nach Onanie an, wenn er wieder notgeil würde. Sie äußerte es viel zu laut. Seither hatte er den Supermarkt gemieden wie der Geharnischte das Weihwasser.
Mennet fiel gewöhnlich nicht weiter auf. Von der Statur her eher Mister Normalo, knapp ein Meter achtzig, Betonung auf knapp, dunkelblond mit fortschreitenden Geheimratsecken. Er sah passabel aus, war aber gewiss kein Blickfang. Von der Statur her war Theo eigentlich schlank, aber mit kleinem Bauchansatz, den er sich unter stillen Flüchen im Fitnessstudio abzutrainieren trachtete. Den Fortschritt opferte er leider immer wieder auf dem Altar der schnellen Currywurst und im Hochamt an Schniposa. Berufskrankheit. Das linke Ohr segelte mehr nach Backbord als das rechte nach Steuerbord, etwa so wie die Lauschorgane eines humorigen Literaturkritikers aus Schwaben. Auf der knolligen Nase reüssierte eine Brille à la John Lennon, rund wie die Null auf Theos Konto. Die Augen hinter den Brillengläsern leuchteten grün und machten einen wachen Eindruck.
Theo war damals aus einem Kaff unweit von Frankfurt nach Berlin gezogen, um der Bundeswehr zu entkommen. Dann kam dieser verdammte Gorbatschow und machte für ein paar profane Kröten alles kaputt, den Sonderstatus Berlins, die kuschelige Gemütlichkeit im westdeutschen Teil des Kalten Krieges, die Sowjetunion und damit das schöne Feindbild des Westens. Theo, angekommen in der gesamtdeutschen Wirklichkeit, musste sich vom Musterungsarzt in den Allerwertesten fassen lassen und dazu im Takt husten. Er hustete viel und stark. Das Urteil war trotzdem T2, tauglich mit Einschränkungen. Theo verweigerte den Wehrdienst sofort. Nach dem Zivildienst studierte er Sozial- und Kulturwissenschaften, weil ihm nichts Besseres einfiel. Dies in einer Zeit, in der einem zu dieser Kombination als drittes Studienfach der Taxischein empfohlen wurde.
Seither hatte Theo, der Meister der Prokrastination, seinen Hintern nicht wirklich hochgebracht. Nach zwanzig Semestern und mehr schlecht als recht bestandenen Prüfungen fuhr er Leichenwagen, dann Sondertransporte für die Forensik. Über diese Schiene wurde sein Interesse für Kriminalistik geweckt. Der Versuch, bei der Polizei anzuheuern, scheiterte an der Existenz steiler Hierarchien. Nicht, dass Theo generell Probleme mit Hierarchien hätte, wenn er denn an der Spitze stünde. Am unteren Ende der Skala allerdings … puh. Das Missverständnis wurde nach zwei Monaten in beiderseitigem Einverständnis geschieden. Danach schwirrte Theo in der Welt herum, Gelegenheitsjobs, Archivarbeit für ein Forschungsprojekt, drei verlorene Jahre in der Einsamkeit eines schlecht durchlüfteten, muffigen Kellers, schließlich der Einfall: Privatdetektiv, eine Art Polizeiarbeit ohne Hierarchie.
Theo als erfolgreich in seinem Beruf zu bezeichnen, wäre eine geflissentliche Übertreibung. Er hatte das Nötigste getan, Lizenz, Handbuch für Privatdetektive gelesen, Anzeige in den Gelben Seiten und im Internet. Dann hatte er sich zurückgelehnt. Er sei schließlich Anfänger, pflegte er seinem Ebenbild im Spiegel zu erklären ohne dabei zu definieren, wann dieser Status eigentlich zu enden habe. Und so zogen sich die Tage hin und jede kleine Erledigung wurde zum 24-Stunden Megaprojekt: der Gang zur Krankenkasse, der TÜV fürs Auto, der Kauf einer Jeans.
Langsam trudelten doch die ersten Aufträge ein, meist Ehe- bzw. Ehebruchobservationen, mit Bildern in flagranti ertappter Paare, viele Currywürste, schließlich Dr. Schippke.
„W-w-womit kann ich Ihnen dienen, Herr … Professor N-Niemetz?“ Theo hatte sich vorgenommen, gelassen zu wirken, souverän. Er stotterte eigentlich kaum. Besser gesagt: er stotterte nur, wenn ihm etwas peinlich war, oder wenn sich die Unsicherheit, seit der Pubertät sein Alter Ego, in unübersichtlichen Situationen ratternd Bahn brach. Schippke war definitiv ein guter Grund zu stottern. Aber er musste sich jetzt zusammennehmen. Tatsächlich benötigte niemand diesen Job mehr als er.
„Ich weiß nicht, ob überhaupt etwas vorgefallen ist, wenn man Vorfall als etwas Physisches definiert“, erklärte der Professor seinen ‚Fall’. „Lassen Sie uns lieber von Wahrnehmungen sprechen, wie die Konstruktivisten. Dinge, die subjektiv-materiell betrachtet der Logik völlig abhold sind, gewinnen durch das Brennglas der Empathie manchmal etwas an Kausalität.“
Seine zwanzig Semester Sozialwissenschaften waren bei weitem nicht genug, fuhr es Theo durch den Kopf. „Können Sie noch etwas elelaborieren?“ Geht doch, kaum gestottert.
„Wie soll ich es sagen? Es sind bei mir, respektive bei uns an der Universität, einige Dinge passiert, die für sich alleine genommen nicht der Rede wert sind, da das sich Zutragen selbiger im Normalfall eher dem verwirrten Geiste des Wissenschaftlers zuzuschreiben wäre, der Untauglichkeit des Gelehrten für das tägliche Leben, klischeegebunden, sozusagen. Sie wissen schon, der berühmte Elfenbeinturm. Zusammen allerdings, ich weiß nicht, es ist nur ein Verdacht, nein, weniger als das, eine temporale Störung der Kohärenz, Widersprüchlichkeiten. Können Sie nach Tübingen kommen? Es ist schwer zu erklären am Telefon. Ich zahle Vorkasse.“
Das Wort Vorkasse öffnete Mennets Sympathieschloss sperrangelweit.
„Hm.“ Theos Stimme sollte zögerlich klingen, wie wenn er an der Last der Arbeit schwer trüge. Aber seine leicht vibrierende Stimme war der Judas der Gemütslage. „Hat Ihnen Dr. Schippke meine Tarife genannt?“
„Ja, ich bin einverstanden.“
Das Einverständnis kam so schnell, dass Theo einen Moment versucht war, eine Schippe draufzulegen. Doch dann verschluckte er den Gedanken. Scheiß drauf, lieber den Spatzen in der Hand.
„Ich nehme morgen die Frühmaschine nach Stuttgart, dann den nächsten Zug nach Tübingen. Wollen wir uns zum Mittagessen treffen, so gegen zwölf dreißig?“
„Einverstanden.“ Niemetz schien erleichtert. „Treffen wir uns beim Neckarmüller, direkt an der Neckarbrücke.“
„Ich werde dort sein“, versprach der Detektiv, legte auf, biss in das angeknabberte Sandwich vom Vorabend und spülte er mit einem unnötig teuren Designerwässerchen nach. Dann nahm den Laptop zur Hand und buchte für den Folgetag einen Flug in die Schwabenmetropole. Ja, verdammte Maske, nur Hinflug, keinen Koffer aufzugeben, keine Versicherung, keine Platzreservierung, einfach nur einen fucking Flug nach Stuttgart, mitten hinein ins Filderkraut. Danach googelte er Professor Niemetz.
4
Filderkraut und Maultaschen
Der Detektiv landete gegen zehn Uhr dreißig in Stuttgart. Er nahm die S-Bahn zum Hauptbahnhof, anschließend nach einer Wartepause einen Zug nach Süden. Theo ließ sich entspannt in eine Ecke des Regio-Shuttle trudeln und stöpselte den Hörer seines Mobile Players ins Ohr. Etwa eine Stunde hätte er für seine Mucke. Eine Stunde? Mist, das würde ja gar nicht reichen! Tübingen war doch quasi eine Vorstadt von Stuttgart. Und dann: Metzingen, Reutlingen, Ingendingen, Dungendangen, der Zug tingelte durch die Provinz. Zu spät dran und keine Handynummer. Wie oft hatte er sich selbst im Spiegel mehr Professionalität versprochen. Amateur, scheiß Amateur!
Schließlich trudelte der Zug in den Hauptbahnhof der Universitätsstadt ein. Die Eingangshalle, durch die Theo spurtete, versprühte den Charme der Gründerzeit und den schwäbischen Pietismus gleichermaßen. Wenigstens hatte er sich den Weg zum Restaurant virtuell eingeprägt. Es war nicht besonders weit. Mehr als eine halbe Stunde verspätet zog er, schon etwas transpirierend, recht abrupt an der breitflügeligen Eingangstür des Neckarmüllers.
Ihm entgegen stolperte ein schlanker Sechzigjähriger im grünbraun-karierten Sakko, dazu trug der Mann eine braune Bundfaltenhose, ein blaues Hemd, feine aber doch sportliche Schuhe, deren Leder aber nicht zum Gürtel passte. Auf dem Haupt weißes, volles Haar, leicht gelockt und schulterlang. Er trug einen Dreitagebart, unter der Nase etwas nikotinbraun gefärbt, im Mund eine Pfeife. Im Gesicht bildeten tiefe Falten einen schimmernden Kontrast zum jugendlichen Feuer seiner intensiv strahlenden blauen Augen.
„Nicht so ungestüm, Sie Berserker, haben Sie Ihren Einstein und Ihren Newton nicht gelesen?“
Theo erkannte den Pfeifenraucher dank seiner Internetrecherche vom Vortag sofort.
„E-e-entschuldigen Sie, Professor N-Niemetz, ich denke wir sind verabredet. Verzeihen Sie meine Verspätung, die Bahn, Sie w-wissen schon.“
„Ah, wen haben wir denn da, doch nicht etwa Mr. Godot?“ Der Professor lächelte. „Auch cum tempore ist bereits verflossen, wie Quecksilber sich in der Luft verflüchtigt. Sie erinnern mich frappant an meine Studenten, junger Mann. Schön, Sie doch noch zu treffen. Was wir nun unserem leiblichen Wohle zugutetun werden, will zur Kompensation meiner Zeit aus Ihrer Brieftasche beglichen werden.“
„Abgemacht!“ Theo atmete auf. So würde er noch relativ billig davonkommen. Nicht auszudenken, würde er auf seinen Reisekosten sitzenbleiben.
Die beiden Männer schüttelten sich die Hände. Der Händedruck des Professors war fest und ausdauernd, wie von einem Mann, der wusste, was er wollte. Sie machten kehrt und betraten das Lokal, das der Professor gerade eben verlassen hatte. Der Neckarmüller war gut gefüllt. Sie ließen sich auf der Terrasse direkt am Neckar nieder und bestellten das rustikale Tagesmenü. Niemetz empfahl das hauseigene Bier. Theo stimmte zu und vernahm dann etwas pikiert, dass der Professor nur ein Mineralwasser orderte.
Sein Auftraggeber machte auf Theo einen ausgesprochen sympathischen Eindruck. Nicht selbstverständlich bei Koryphäen, die sich oft die Aura der Unnahbarkeit und der Arroganz geben. Professor Dr. nat. mult. Dr. h.c. Andries Niemetz war Biologe, besser besagt Biochemiker, mit je einer Dissertation in beiden Fächern, aber einer Habilitation mit thematischem Schwerpunkt in der Biologie. Die Internetrecherche hatte ein umfangreiches Publikationsverzeichnis ergeben, zahlreiche Preise, Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinigungen, einen Ehrendoktor einer japanischen Universität, einen abgelehnten Ruf nach Berlin. Geboren wurde der Professor 1952 in Münster, Westfalen. Nach dem Studium promovierte und habilitierte er in Göttingen, anschließend folgte er einem Ruf nach Tübingen. Die Liste der Gastprofessuren war lange: Er war in Paris an der Sorbonne, am MIT in Boston und an University of Toronto in Kanada, um nur einige zu nennen.
„Woher kennen Sie Schippke?“, fragte Niemetz. Theos einstiger Klient schien ein gutes Eingangsthema abzugeben.
„Ein abgeschlossener Fall, nichts G-Großartiges, habe D-Diskretion zugesagt.“
„Verstehe.“
„Und Sie?“
„Bernard hat mir sehr unter die Arme gegriffen. Der Kollege ist gut vernetzt. Als sich in einem Antrag zu einem Forschungsprojekt eine größere Lücke auftat, sprang er uneigennützig, mit hohem Zeitaufwand und ohne Bezahlung ein. Wahrlich altruistisch.“
„Er ist also in einem Ihrer Forschungsprojekte involviert?“
„Nein, nur im Antrag.“
„Ihr Forschungsprojekt ist demnach interdisziplinär, oder?“
„Ja. Man spricht bei uns auch von Converging Technologies, man kann das nicht mehr auseinanderhalten. Man braucht für das was ich mache sowohl einen Bottom-up- als auch einen Top-down-Ansatz. In der Nanotechnologie sind die Biologen und die Chemiker eher für den Bottom-up-Ansatz zuständig, die Physiker für den Top-down-Ansatz. Aber in meinem jetzigen Forschungsprojekt mache ich die Biologie und die Chemie, die physikalische Seite ist im Moment, im jetzigen Stadium, noch nicht so wichtig. Wir haben im Hause nur den Kollegen Wrange als Physiker – und der ist im Moment nicht greifbar.
„Und Schippke ist Physiker.“
„Genau. Und er ist sowohl hilfsbereit als auch getrieben von der wissenschaftlichen Neugier nach Erkenntnis, unserem Antriebsnukleus. Mancher von uns kennt da keine Grenzen, er muss es einfach wissen, no matter what.“
„Und egal welche Konsequenzen es hat“, schob Theo provokativ ein Verkehrshindernis in die Debatte. Er dachte an die Gentechnologie und genmanipulierte B-Waffen, die chemischen Großforschungen, deren Produkte ganze Landstriche verseuchten. Er assoziierte Genlebensmittel, totkranke Klonschafe, Agent Orange, ballistische Raketen und Deepwater Horizon, er rief sich die Verbindung aus Wissenschaft und Industrie sowie Forschung und Kapital ins Gedächtnis, die das alles möglich gemacht hatten, dann aber mit den Folgen nicht assoziiert werden wollten. Theos politische Einstellungen bewegten sich zuweilen deutlich links von der Mitte. Er war gegen die monopolistische und verbraucherfeindliche Großindustrie und ihre politische Lobby und natürlich gegen die Kriegsindustrie.
Niemetz dachte kurz nach, dann kam eine gut überlegte Riposte: „Die Sinnhaftigkeit einer Grenze erschließt sich erst bei der Überschreitung derselben. Die Grenzüberschreitung ist der unschöne Maßstab des Innovators. Aber ja, Sie haben natürlich des Pudels Kern getroffen, das ist manchmal schwierig, weil die Frage, ob alles was erforscht werden kann, auch erforscht werden muss, nicht nur die Philosophen umtreibt, sondern auch die Naturwissenschaftler. Gefährlich für die Menschheit sind wir Wissenschaftler ja alle. Meine Standesgenossen haben Hiroshima und Nagasaki ermöglicht, wenngleich nicht verursacht. Marx ermöglichte den Kommunismus, aber Stalins Lager jetzt Marx in die Schuhe zu schieben, ist doch eher unzulässig, er konnte unmöglich wissen, wie andere seine Idee pervertierten. Hätte er das Kapital nicht schreiben sollen, weil die Zukunft nicht vorhersehbar ist? Es ist das Schicksal großer Ideen, dass man die Kontrolle verlieren kann, Folgenabschätzung ist schwierig. Letztendlich kann das bewusste Nichtweiterverfolgen eine gefährliche Erfindung ohnehin nur verzögern, fast nie gänzlich verhindern. Die Zeit schafft sich ihre Produkte.“
„Soll das ein Freifahrtschein sein?“
„Nein. Jeder muss individuell und mit seinem Gewissen abmachen, was er verantworten kann und was nicht.“
„Die Atombombe ist das naheliegende Beispiel, aber gewissermaßen auch das Totschlagargument, oder?“
„Schön, dass Sie selber darauf kommen, Mennet. Es ist natürlich ein Exempel aus der Frühzeit der Massenvernichtung. Die heutigen Gefahren sind filigraner. Nehmen Sie zum Beispiel meine Kollegen aus der Biologie. Die haben einen Vogelgrippevirus durch Mutationen multiresistent gemacht. Einige der Kollegen wollten die Ergebnisse dann nicht veröffentlichen, auch weil eine Behörde warnte. Vergeblich. Einer machte es dann doch. Das Wissen schafft sich Bahn, immer. Die Frage ist nur, wann. Passt es gerade, oder passt es nicht?“
„Und wer soll das bestimmen, wann der richtige Zeitpunkt ist?“
„Genau das ist das Problem, wer soll das bestimmen? Letztlich kann das nur der Wissenschaftler – und meiner Meinung nach ist das ‚Jetzt‘ meist der beste Zeitpunkt.“
„Wohl auch, damit einem keiner zuvorkommt, oder?“
„Das ist ein Aspekt, der keinesfalls unterschätzt werden darf. Aber ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel, das das Entscheidungsproblem noch besser veranschaulicht, wieder von den Biologen. Die haben ja bekanntlich das menschliche Genom entschlüsselt und dabei festgestellt, dass wir genetisch zu 99,9 Prozent identisch sind. Das heißt aber auch, dass wir uns in etwa drei Millionen Erbinformationen unterscheiden.“
„OK, davon habe ich gehört.“
„Nun wurde die HapMap hervorgeholt … “
„Entschuldigung, Professor Niemetz, ich brauche etwas Hilfe“, unterbrach Mennet mit hochgezogenen Augenbrauen.
„Die sogenannte Haplotyp-Karte, … „
Ein fragender Blick.
„Haplotypen sind unterschiedliche Abfolgen der insgesamt vier DNA-Grundbausteine. Damit können Sie die HapMap unter anderem ethnisch differenzieren.“
„Auweia!“
„Nicht so vorschnell, Mennet. Es ist so möglich, Medikamente zu entwickeln, die einer bestimmten Ethnie gute Dienste leisten, bei anderen vielleicht wirkungslos sind. Man hat etwa festgestellt, vereinfachend dargestellt, dass Asiaten anfälliger für den Vogelgrippevirus sind als Europäer. Mit diesem Wissen lässt sich in der pharmazeutischen Forschung zielgerichteter arbeiten, aber …“
„Aber?“
„Aber es gibt auch die theoretische Möglichkeit, dass so etwas wie Ethnowaffen entwickelt werden, Dual use nennt man das, je nachdem wie man etwas verwendet, ist es Segen oder Fluch. Man könnte auch von ambivalenten Entwicklungen sprechen, damit man nicht in diese hässliche Gut-Böse-Dichotomie gleitet. Aber nun zu unserer Frage. Sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden, also hier die Haplotypen, oder hat man Angst vor der eigenen Courage?“
„Schwer zu entscheiden, Professor. Ich habe einmal gelesen, um bei der Genetik zu bleiben, dass manche Menschen ein Abenteurergen haben, andere nicht. Es ging wohl konkret um die Bereitschaft von Menschen, Risiken einzugehen um Neues zu erfahren.“
„Wenn das so ist, dann sind Wissenschaftler garantiert Abenteurer. Sie werden immer alles wissen wollen.“
„Die Frage ist, ob mich das beruhigen soll?“
„Eher nicht, um ehrlich zu sein.“
Eine nachdenkliche Stille nahm Besitz von den beiden. Der Detektiv entledigte sich ihr zuerst, indem er abrupt den Bogen zurück zum Ausgangspunkt spann: „Hat das jetzt direkt was mit Dr. Schippke zu tun?“
„Nein, um Gottes Willen. Ich bin Bernard – wie gesagt – zu großem Dank verpflichtet. Er ist meine erste Anlaufstelle in Berlin. Ihn habe ich zu Rate gezogen, als ich gewisse Eigentümlichkeiten feststellte und mir überlegte, die Polizei einzuschalten. Schippke war es, der mir riet, einen Privatdetektiv zu konsultieren. Das sei effektiver, bei der Polizei reiche ein Anfangsverdacht, so vage wie meiner, eigentlich nie aus, das sei vergebliche Liebesmüh. Er meinte mit Ihnen gute Erfahrungen gemacht zu haben.“
Wie Schippke wohl zu dieser Aussage kam? Und was er wohl von Polizeiarbeit verstünde? Theo schaute dem Stocherkahn hinterher, der wie eine Schildkröte auf Land über das ruhige Wasser des gestauten Flusses glitt. Besetzt war das Boot mit Personen in seltsamen Verkleidungen, fast wie zu Karnevalszeiten.
„Worum geht es also? Schießen Sie los!“, eröffnete Theo die Stunde der Wahrheit nach einem inneren Ruck und mit fragendem Blick in die blauen Augen seines Gegenübers.
Niemetz wich dem Blick aus, lehnte sich zurück. Für einige lange Sekunden drehten sich seine Augen nach oben. Er schien nach der richtigen Eröffnung zu suchen.
„Also, in medias res.“ Der Professor atmete tief ein und nahm Augenkontakt mit Theo auf. „Ich glaube, ich werde observiert.“
„Gibt es etwas, was es zu observieren lohnte? Etwa privat?“
„Nicht, dass ich wüsste.“ Die Antwort des Professors klang überzeugend. „Ich bin glücklich verheiratet, seit langen Jahren. Und bevor Sie es selber fragen: Keine Affären mit Studentinnen oder Ähnliches. Kein Erpressungspotential, ich habe eine weiße Weste. Privates ist ausgeschlossen, es kann nur um meine Arbeit gehen.“
„OK. Haben Sie den Beobachter gesehen?“
„Ich habe ihn gespürt. Ich weiß, von einem Wissenschaftler erwartet man keine esoterischen Aussagen, sondern harte Fakten. Aber Ihnen als Kriminalist muss ich nicht sagen, dass es mehr Verbrechen gibt als diejenigen, die man letztendlich beweisen kann. Ergo: Gefühle zu ignorieren, ohne zu wissen, ob sie täuschen, oder ob sie vielleicht doch steuernde Funktionen haben, wäre ebenso falsch, wie ihnen aufzusitzen.“
Theo musste ob der Beförderung zum Kriminalisten schmunzeln. „Wenn man weder verifizieren noch falsifizieren kann, wird man zwangsläufig zum Agnostiker, oder?“
„Gut getroffen, Mennet. Ja, zunächst zumindest. Aber man kann wiederum kaum erklären, warum sich so viele Wissenschaftler mit zunehmendem Alter als gläubig bezeichnen. Glaube ist schließlich nicht mehr als eine Hypothese; und der verzweifelte Versuch, sie zu verifizieren, ohne wissenschaftliche Methoden nutzen zu können. Eine Contradictio in adjecto.“
„Und Gott löste sich in einer Logikwolke auf.“ Theos Lektüre war mehr die Art ‚Per Anhalter durch die Galaxis’ als die Herren Newton und Einstein, Platon und Kant, zumindest, seit er im dritten Semester an Habermas gescheitert war.
Niemetz schaute fragend.
„Egal.“ Mennet würde im Moment bei der Suche nach dem Motiv nicht weiterkommen. Er würde sich also auf den Verfolger konzentrieren müssen. „Beschreiben Sie Ihr Gefühl. Was oder wen fühlen oder sehen Sie?“
„Es sind eher Déja vu’s. Es handelt sich um Personen, die ich meine schon gesehen zu haben, aber irgendwie immer anders.“
„Was meinen Sie mit anders?“
„Die Gesichtszüge sind mir bekannt, aber nicht das Gesicht. Also, die Person meine ich gesehen zu haben, gestern, neulich, en passant. Heute sehe ich ihn wieder, aber er sieht anders aus. Und das geht hin und her. Es ist und bleibt seltsam, Tübingen ist klein, man kennt sich oder man kennt sich nicht. Aber dafür, dass man sich ständig zufällig über den Weg läuft, ist die Stadt dann doch wieder zu groß.“
Theo dachte laut nach. „Gehen wir zunächst davon aus, dass es sich um nur eine Person handelt. Vielleicht eine Art von Camouflage, unterschiedliche Kleidung, heute jugendlich, morgen elegant. Vielleicht Utensilien, ein künstlicher Bart, Kontaktlinsen mit anderen Farben für die Iris, ein Hut oder eine Mütze, unterschiedliche Haarfarben, Perücke?“
„Hm, kaum, fällt eigentlich immer auf, zumindest in schlechten Filmen. Habe in den letzten Jahrzehnten keinen guten mehr gesehen.“
„Den großen Lebowski vielleicht?“
„Nein, wieso, ist das ein guter?“
„Definitiv, mit einem nicht ganz alltäglichen Helden.“
„Und das wäre?“
„Ein Sozialversager, der sich Dude nennt und mit einem Katholiken polnischer Abstammung befreundet ist, der sich für einen Juden hält.“
„Und was machen die zwei so?“
„Sie bowlen.“
„Klingt spannend.“
„Schauen Sie ihn an, wenn Ihnen Ihre Forschung mal zum Hals raushängt und Sie etwas Aufmunterung brauchen.“
„Versprochen.“
„Zurück zu unserem Fremden, Professor: Gibt es etwas, was besonders auffällt, etwa: immer die gleiche Nase, die Augen, der Mund. Ein bestimmter Ausdruck im Gesicht, das Lächeln?“
Niemetz kratzte sich unterm Ohr, ein klassisches Zeichen der Verlegenheit.
„Ja und Nein. Es sind Gesichtszüge, die sich ähneln, die aber definitiv verschieden sind. Männlich, kaukasisch, mittleres Alter. Keine anderen Auffälligkeiten. Ich weiß, es klingt vage, fast wie eine Fata Morgana. Wenn da nicht die andere Sache wäre, wäre ich gar geneigt, mich selbst paranoid zu schimpfen.“
„Welche andere Sache?“ Theos Beine begannen unter dem Tisch schneller zu wippen.
„Ich verwahre in meinem Safe im Büro Unterlagen und einige Flaschen mit Samples aus einem Forschungsprojekt, dem ich einige Bedeutung zumesse. Als ich den Safe neulich öffnete und die Unterlagen hernahm, kam es mir vor, als ob die Papiere anders geordnet wären. Ich könnte mich natürlich täuschen. Es gibt viel zu tun und ich habe einige Projekte, vielleicht habe ich die Unordnung selbst verursacht und erinnere mich nur nicht.“
„Um was handelte es sich bei den Proben und wer hatte Zugang? Ich brauche alle Details über die Dokumente und die Flaschen mit der Flüssigkeit.“
„Wer sagt Ihnen, dass es eine Flüssigkeit ist?“
Theo schaute fragend, ohne etwas zu entgegnen. Flaschen und Flüssigkeit, das liegt doch eigentlich nahe.
„Die Flaschen sind die üblichen Behältnisse für biologische oder chemische Produkte, die luftdicht verschlossen werden können, bräunlich, aber noch transparent. Sie beinhalten ein Granulat. Die Unterlagen dokumentierten das Forschungsprojekt, einfache Folder mit Din-A4-Papier, erklärte der Professor.“
„Und um was geht es im Projekt?“, wollte der Detektiv wissen.
„Was das Projekt angeht“, fuhr der Biochemiker fort, „will ich Sie nicht mit Details nerven, es geht um neue Werkstoffe, an der Grenzstelle von Biologie, Chemie und Physik. Ich glaube Sie verstehen, wenn ich wegen des Financiers, der aus der Wirtschaft kommt, Details nicht verlautbaren kann.“
Industriespionage, schoss es Mennet durch den Kopf. Das Motiv lag doch wohl klar ausgebreitet auf dem Tisch.
Der Professor ergänzte seine Angaben und kam damit den nächsten Fragen auf der Liste zuvor: „Zugang zu den Daten habe nur ich und meine Assistentin. Nur wir und die Sekretärin haben die Schlüssel zum Büro. Sorry, und natürlich der Pedell, der Hausmeister. Es existieren meines Wissens nur diese vier Schlüssel. Die Safe-Kombination kennt nur meine Assistentin – und ich natürlich. Eingebrochen wurde nicht, zumindest sehe ich keine Spuren.“
„Und wer macht sauber?“, brachte Theo eine unumgängliche Notwendigkeit ins Spiel, die Niemetz offenbar übersehen hatte.
„Den Papierkorb leere ich selber, Staubsaugen, na ja, selten, nur auf Nachfrage, nicht, seit ich die Flaschen im Safe verwahre. Unsere Wissenschaft wird nicht von Ungefähr als staubtrocken angesehen.“
Der Kerl hatte sogar Humor.
„Und die Safekombination war 1234, oder?“, beliebte Theo zurückzuscherzen, nur um ins verlegene Gesicht des Professors zu schauen. Nein, das konnte jetzt nicht sein. Niemetz brach in Lachen aus.
„Natürlich nicht, I’m kidding!“
Mennet atmete tief durch. „Und Ihre Assistentin, könnte sie etwas damit zu tun haben?“
„Ausgeschlossen.“ Das kam etwas zu schnell.
„Kann ich mit ihr sprechen?“
„Knapp verpasst. Sie fährt auf einen Kongress nach Budapest, abseitiges Thema, nichts für mich. Sie muss schon unterwegs sein.“
Theos Blick schweifte über den Fluss, heftete sich an den Stocherkahn, der gegen die Strömung kaum vorangekommen war. Dafür hatten sich drei weitere Schwabendschunken zu ihm gesellt. Die bunten Kleidungsstücke der Besatzung wichen immer mehr der nackten Haut.
Der Detektiv nahm einen langen Schluck aus dem Humpen. „Wer weiß von Ihrem Projekt und wer könnte mit den Dokumenten etwas anfangen, oder gar mit den Proben?“
„Vom Projekt weiß die gesamte Scientific community. Ich habe einen Explorative article in der Zeitschrift ‚Science’ veröffentlicht, die eben aktuelle Ausgabe. Niemand wusste, dass ich schon so weit bin; und ich habe es im Artikel auch nicht wirklich verraten. Wer könnte damit etwas anfangen. So isoliert? Eigentlich niemand. Mit den Proben jeder, der die Idee dahinter kennt und etwas von den zugrundeliegenden physikalischen- und biochemischen Prozessen versteht.“
„Und wer wäre das?“
„Kringe, meine Assistentin, wenn sie entschlüsselt hat, was ich vorhabe, was zumindest nicht ausgeschlossen ist. Ich habe sie zwar nur in Teilbereiche eingeweiht, aber sie ist nicht dumm und kann eins zu eins addieren.“
„Sonst noch wer?“
„Kaum. Alle anderen dürften nicht in der Lage sein, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Es ist wie bei dieser alten Show aus den siebziger Jahren, wie hieß die noch, wo ein Bild entschlüsselt wurde. Gewonnen hat, wer zunächst erkennt, um wen es sich handelt.“
„Sie meinen Dalli-Klick, aus Dalli-Dalli, mit Hans Rosenthal.“
„Genau.“
Theo rekapitulierte: Sie hatten also – eventuell – umgeordnete Dokumente, von denen eigentlich niemand wusste, wie wertvoll sie waren, dazu einen Verfolger ohne Gesicht, einen Professor, der sich das Ganze – vielleicht – nur einbildete und hochgradig paranoid war. Entweder sollte man den Fall schnell vergessen und nach Hause fahren, oder es würde ein Wust an Arbeit, der einen für einige Wochen über Wasser halten würde. Und solange dieser Einstein zahlte!
Da der Professor alle Fragen beantwortet hatte, bevor Theo sie stellen konnte, galt es in die Ermittlungen einzusteigen. Theo verlangte nach der Rechnung. „Ich sollte mir ihr Büro anschauen. Ich bräuchte auch ein Foto Ihrer Assistentin, wenn sie wegen dem Ruf der Wissenschaft nach Bukarest nicht persönlich greifbar ist.“
„Budapest“, korrigierte Niemetz.
„N-Natürlich, sorry.“
Mit einem kurzen Räuspern deutete der Professor eine unangenehme Bemerkung an: „Sie verstehen, dass ich gegenwärtig auf gar keinen Fall möchte, dass am Institut falsche Gerüchte aufkommen. Ich würde Sie deshalb als Wissenschaftler ausgeben, nur falls jemand fragt. Sie wären also quasi inkognito bei uns.“
„Inkognito heißt mein Zwillingsbruder“, versuchte Mennet in einem neuen Anlauf witzig zu sein. Er beglich die Rechnung als Strafe für seine Verspätung aus eigener Tasche auf Punkt und Komma, übersah das säuerliche Gesicht der um das Trinkgeld betrogenen Bedienung, nahm den Dank des grinsenden Professors für die Einladung entgegen und bestieg im Schlepptau von Niemetz die Treppe hinauf zur Straße. Bisher hatte Theo draufgezahlt.
Auf der anderen Seite der Brücke hatte sich während des Gesprächs eine Menschenmenge angesammelt, die sich bis zum Ende der Neckarinsel und auf der anderen Flussseite bis zum Hölderlinturm zog. Den gelben Turm direkt über dem Wasser hatte das geisteskranke Lyrikgenie über Jahre nicht verlassen. Auf dem Wasser tummelte sich mittlerweile eine Unzahl an Stocherkähnen, länglichen Holzbooten, die mit einem langen Holzstab angetrieben wurden, der in den Flussboden gerammt wird. Die Stocherkähne waren mit jungen Menschen besetzt. Im Bug der Boote saßen Personen Schrittmacher wie bei einem Wettkampf des Deutschland-Achters. Theo schaute den Professor fragend an.
„Eine Tübinger Tradition der Studentenverbindungen“, erläuterte dieser. „Das Stocherkahnrennen um die Neckarinsel findet normalerweise jedes Jahr zu Fronleichnam statt. Dieses Jahr wurde es wegen des Sturms an Fronleichnam und der folgenden Schlechtwetterperiode verlegt. Es geht nicht nur um den Sieger, sondern auch um den Verlierer. Die Besatzung des Bootes, das Letzter wird, muss eine Flasche Lebertran trinken und das nächste Rennen ausrichten, weswegen das eigene Boot nicht antreten darf. Angeblich sind schon Besatzungen absichtlich Letzter geworden, um das Rennen ausrichten zu dürfen.“
„Oder sie mögen Lebertran.“
„Guter Gedanke. Was haben Sie studiert, Mennet?“
Der Mann setzte also grundsätzlich ein Studium voraus. Schön. Aber was sollte man von einem Professor schon erwarten. Theo blieb unbestimmt: „Nicht der Rede wert, vor allem empirische Sozialwissenschaften und Soziologie.“
„Aha.“
Mennet ließ dies unkommentiert. Er schaute sich das Spektakel an.
„Sind Sie eigentlich bewaffnet?“, fragte der Professor eher schelmisch-schnippisch, als dass er tatsächlich von der Notwendigkeit einer Bewaffnung überzeugt zu sein schien.
„Selbstverständlich“, log Theo nach einem kurzen, verräterischen Zögern, das sein Auftraggeber aber nicht wahrzunehmen schien.
„Gut.“ Niemetz kratzte sich am Kinn und zündete sich die Pfeife an, die er während des Spektakels rituell gestopft hatte. „Werden Sie bei dem Fall wohl nicht benötigen, aber man weiß ja nie, welches Ungeziefer sich in den Poren der Akte herumlümmelt. Dr. Mennet, bis später.“
„Herr Kollege, stehe zu Diensten.“
Theo führte seine flache linke Hand zur imaginären Uniformmütze. Seine Rechte hielt in der Jackentasche etwas verkrampft das Pfefferspray umklammert, das den fehlenden Waffenschein zu substituieren hatte. Professor Niemetz kraxelte ins Taxi und Theo begann langsam Richtung Hotel zu gehen. Vor seinen Augen begannen die neuen Informationen einen Reigen der Verknüpfung zu tanzen. Theo kollidierte fast mit dem Obdachlosen, der nach einem Geldstück einer Währung fragte, die es nicht mehr gab. Er bemerkte auch nicht, wie ihm ein Mann mit asiatischen Gesichtszügen folgte.
5
Am Institut
Vom Hotel nahm Mennet den Bus zur Morgenstelle, den Stadtteil Tübingens, in dem die naturwissenschaftlichen Fakultäten und die Universitätskliniken konzentriert sind. Die Morgenstelle wirkte so nüchternwissenschaftlich wie die Methodik, die die Protagonisten der Scientia naturalis gewöhnlich an ihre Forschungsfelder anlegen. Ein Ghetto der Zahlen und Gesetze, der Abhängigkeiten und Relationen und der objektivierbaren Wahrheit. Auf dieser Morgenstelle lag auch das Interdisziplinäre Institut für Nanotechnologie. Das gleichschenklige Rechteck atmete den Odem der Sechzigerjahre, alles quadratisch, praktisch, gut. Theo betrat das Gebäude, entdeckte keine Zugangskontrolle, passierte das Hausmeisterbüro und wollte mit dem Lift in den zwölften, den obersten Stock fahren. Einzig, dieser versagte den Dienst. Der Zettel, der das Problem ankündigte, hing passenderweise im Aufzug, statt davor. Nach zwölf Stockwerken Treppensteigen gelangte der Detektiv recht kurzatmig ans Ziel. Er stand am Eingang zu einem Labyrinth. Der Wegweiser wies spezialisierte Fachgebiete aus, aber keine Namen. Mennet hielt den nächstbesten Passanten an, einen Mittvierziger in recht gutem Zustand, mehr aus dem Modejournal als aus dem Labor geschnitten. Genau so stellte man sich einen Naturwissenschaftler nicht vor. Der Anzug war figurbetont und auch das weit aufgeknöpfte graue Hemd war garantiert Slim-fit.
„Entschuldigen Sie, wissen Sie zufällig, wo ich das Zimmer von Professor Niemetz finde?“
„Zufällig nicht“, er betonte ‚zufällig’ und zeigte ein Lächeln, das eine perfekt geformte und unwahrscheinlich weiße untere Zahnreihe entblößte. Der Mann hatte etwas Unterbiss. „Mein Wissen ist der Tatsache geschuldet, dass der Kollege mein Zimmernachbar vis-à-vis ist. Kommen Sie, wir haben den gleichen Weg. Sie sind etwas außer Atem, geht uns allen so im Moment. Wir können zwar den Urknall berechnen, Rover auf den Mars schicken und Nanoroboter bauen, aber bei einem profanen Aufzug versagen wir kläglichst.“
„Na ja, der ist ja auch nicht aus der Marsroverzeit“, entgegnete Theo.
„Nein, das nicht, aber etwa aus der Zeit, in der die Amerikaner Menschen zum Mond schickten, immerhin.“
Beide lachten.
Beim Marsch durch den langen Gang erging sich der Fremdenführer in Smalltalk über den heißen Sommer. Daran schloss er die Frage an, was den Besucher in den Semesterferien in diesen unansehnlichen Klotz treibe. Er sei sich nicht sicher, dass der Kollege überhaupt noch hier sei. „Sie haben bestimmt mit dem aktuellen Forschungsprojekt des Kollegen zu tun, nicht wahr?“ Der Detektiv verhielt sich ausweichend, kündigte einen eher privaten Besuch an und dass die beiden verabredet wären. Die Frage nach etwaigem Verwandtschaftsgrad beschied Theo abschlägig.
Vor dem Zimmer von Professor Niemetz bedankte sich der Detektiv artig für die Hilfe. Sein Wohltäter verschwand mit einem Gruß und einem tänzerischen Schwung durch die dem Büro Niemetz gegenüberliegende Tür. Das hatte etwas von Salsa. Das Schild am Eingang wies den hilfreichen Wissenschaftler als Professor Dr. Hinsen aus. Theo begann zu philosophieren, was Professor Hinsen selbst in den Semesterferien wohl noch in diesem, wie hatte er es ausgedrückt, ‚unansehnlichen Klotz’ zu suchen hatte.
Mennet stand vor der Tür und überprüfte, ob das Deo bereits versagte, fand es allenfalls im gelben Bereich und sparte sich einen Gang auf die Toilette. Er beschloss, sich offiziell anzumelden und betrat das Sekretariat.
Auf den ersten Blick war die naturwissenschaftliche Fakultät so naturfern wie ein beliebiges Stück Plastik, sah man einmal von der Armada stachliger Kakteen in Bonsaigröße auf der Fensterbank ab. Der mit Raufasertapete bekleidete Raum war weiß gestrichen, die Decke bestand aus grauen Quadern mit Halteleisten dazwischen. Licht spendete eine surrende Gitterneonlampe. Der Fußboden war mit grauem Industrieteppich belegt, immerhin: kein Linoleum.
Hinter dem Pult thronte eine Mittvierzigerin mit blondierten Kunstlocken, etwas zu dick aufgetragenem Lippenstift, Perlohrringen, gekleidet in Massenmodeschick. Das Namensschild am Eingang identifizierte die Sekretärin als Frau Schmidtbiel. Stoisch tippte sie etwas in den Computer und das Klappern der Tastatur produzierte einen Dreivierteltakt. Das Tippen glich der Geiersturzflugmethode, wobei die Herausforderung darin bestand, die manikürten Fingernägel nicht allzu großen physischen Gefahren auszusetzen. Die Handhaltung erinnerte an ‚Sie baden gerade Ihre Hände darin!‘
Das Wandregal war mit großen anthrazitfarbenen Ordnern gefüllt und mit Semesterzahlen beschriftet, auf dem Schreibtisch der Sekretärin stapelten sich Folder aller möglichen Couleur. Und wenn keine Wunder eintreten würden, würden sie wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag auf die Bearbeitung warten müssen. Bei dem Tempo, mit dem Fräulein Dauerwelle tippte.
„Hallo, guten Tag, Mennet mein Name, Theo Mennet“, wandte sich Theo an die Sekretärin. Die drehte ihren Körper etwas theatralisch in Richtung Detektiv, ihr Blick wanderte von den Geheimratsecken über die Segelohren zur Nase, stach kurz in die grünen Augen und begab sich mit einem Schwung über den Bauchhügel direkt in die Region unterhalb der Gürtellinie. Dort verweilte er länger als ethisch korrekt, was Theo nervös zu machen begann.
„Pro-Professor Niemetz erwartet mich“, brachte er schließlich über die Lippen.
„Doktr Mennet, joh, nehmed’se bitte Blatz“, verwies die schwäbelnde Amazone den Detektiv auf einen Platz in der Ecke des Raumes. Theo ließ sich in den Sessel aus den Siebzigerjahren mit den großen Armlehnen und dem Blumenmuster fallen. Die Sekretärin tippte zunächst ungerührt weiter, bevor sie dann doch die Nummer des Professors wählte und Theo schlampig und etwas gelangweilt mit einem „Dr Doggdr Mennet ischd eingedroffa“ ankündigte. Während sie telefonierte, drehte die Frau das Telefonkabel um den rechten Zeigefinger, bis die geringelte Schnur geradegezogen war. Sie lauschte den Worten ihres Gesprächspartners, dann legte sie ohne weiteren Gruß auf und hielt es anschließend auch nicht für nötig, Theo um einen weiteren Moment der Geduld zu bitten oder dem Gast die Worte des Gastgebers vom anderen Ende der Leitung weiterzuleiten. Theo nutzte die Zeit, um hinter dem Rücken der Sekretärin den Boden unter den Kakteen näher zu inspizieren.
Aber es dauerte nicht lange und Professor Niemetz trat auf: „Kommen Sie nur rein, lieber Kollege, wie geht es Ihnen, willkommen in Tübingen.“
Theo erwiderte höflich einige Floskeln, wie wenn sie sich nicht vor einigen Stunden erst gesehen hätten. Dann wandte er sich an die Sekretärin: „Entschuldigen Sie, Frau Schmidtbiel, haben Sie hier im Raum vielleicht einen Staubsauger?“
Vier fragende Augen starrten ihn an.
„Nun?“
„Noi, mir hend koin Schtaubsaugr, des mached doch d’Butzfraue. Wieso? Isches oametz dreggig?“
„Nein, keineswegs, entschuldigen Sie, ich dachte nur, … egal.“ Er winkte mit einer schnellen Geste ab und der Professor schloss die Tür hinter ihnen. Theo sah aus dem Augenwinkel den neugierigen Blick der Sekretärin, bevor die schwere Tür ins Schloss schwang. Im Büro angekommen, biss sich Mennets Blick an den Parametern des Raumes fest. Ein Schreibtisch aus antikem Holz, Blickfang und unumstrittener Star des Raumes, versprühte seinen Empire-Charme. Darauf ein Notebook einer angesagten Marke, kein Desktop. In der Ecke des Schreibtisches stand ein Kleiderständer, an dem ein anthrazitfarbener Anzug hing, um den Bügel eine dunkelblaue Krawatte gewickelt. Gegen Ende des Raumes eine Sitzgruppe aus Rattan mit einem Wohnzimmertisch vor einem breitflächigen Fenster, das neben dem Fenstergriff über einen zusätzlichen Verriegelungsmechanismus mit Schlüssel und Schloss verfügte. Klar, zwölfter Stock, wahrscheinlich konnte man das Fenster gar nicht ganz öffnen, damit sich die unfähigen Studenten nach der Prüfung nicht in suizidalen Anfällen hinaushievten. Theo mochte sarkastische Kommentare, wenn sie von ihm selbst kamen. Rund herum Bücher, Bücher und nochmals Bücher, nur unterbrochen von einem abstrakten Gemälde an der gegenüberliegenden Wand. Wie hineingepflanzt in die papierene Plantage des Wissens leuchteten rot neben blau, grün neben gelb, zogen Striche Furchen durch Farblachen und über schwarzlackierte Nägel, Schrauben, Ösen und Haken, deren urwaldgleicher Wildwuchs dem Bild eine gewisse Dreidimensionalität gab.
Niemetz räusperte sich und Theo riss sich los. „Entschuldigung, wenn jemand durch das Vorzimmerfenster eingestiegen wäre, hätte er unweigerlich die Kakteen auf den Boden befördert.“
„Ah, deshalb die Frage nach dem Staubsauger?“
„Genau. Hier wäre es einfacher.“
„Durchaus nicht, Mennet. Das Fenster hier im Büro kann nicht geöffnet werden, nur schräg gestellt.“
„Dachte ich mir. Der Safe liegt hinter dem Bild, oder?“
„Naheliegend, nicht wahr? Aber nichtsdestotrotz falsch. Das Bild lenkt den Blick auf sich, aber ab vom Safe.“
„Manchmal versteckt man Dinge im Offensichtlichen und tarnt sie so am besten“, entgegnete Theo, dem klar wurde, dass er seinem Auftraggeber ein gerüttelt Maß an Naivität unterstellte.
„Der Begriff des Offensichtlichen ist in der Wissenschaft ein häufiger Begleiter. Auch das scheinbar Offensichtliche ist aber oft subjektiv, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Ihrem Metier, Mennet. Man projiziert seine Empfindungen und Erfahrungen auf andere und kommt zu ungerechtfertigten Schlüssen. Man läuft zudem Gefahr, dem ‚Offensichtlichen’ monokausale Erklärungskraft beizumessen. Insgesamt ein gefährlicher Pfad. Ähnlich dem Wort ‚alternativlos’, von Politikern heutzutage oft unreflektiert benutzt, weil es fast immer eine Alternative gibt, wenn auch oft eine schmerzliche, aber nicht unbedingt schlechtere als der propagierte Handlungsstrang.“
„Etwa wie: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?“
„Genau, gutes Beispiel. Machiavelli wird zu Unrecht immer als rücksichtsloser Geselle dargestellt. Innerhalb der ihm gesetzten Parameter waren seine Ausführungen immer eine Alternative zum ebenso unbefriedigenden Bestehenden. Das Aufzeigen von Alternativen hat noch selten einen Menschen getötet. Letztlich drückt nicht derjenige den Abzug durch, der Alternativen aufzeigt, sondern der, der aufgrund der vermittelten Informationen eine Güterabwägung vornimmt und, zum Beispiel, seinen persönlichen Nutzen, sei es Macht oder Geld, über das Leben des Anderen stellt. Wir verurteilen Mörder und verehren Attentäter, wenn sie die richtigen umzubringen versuchen, etwa Hitler. Bei Bin Laden ist es schon umstritten, je nachdem wo wir stehen.“
„Ich mag Machiavelli nicht, sein Werk versprüht den Atem von Leichen.“ Theo war Idealist, kein Realist der Schule, die den alten Machiavelli in Ehren hielt.
„Chapeau, welch Metapher! Aber wie ist es mit Argumenten?“, kitzelte der Professor.
„Ich habe keine Argumente, aber ich habe Recht“, beharrte Mennet.
Der Professor setzte gerade zur Replik an, als Theo noch die Kurve kriegte: „Wo ist er dann?“
„Wer?“
„Der Safe.“
„Natürlich, der Safe, ja. Hinter Büchern. Nur hinter welchen?“
Ein Test? Wie wäre es mit einer einfachen Antwort gewesen? Nun gut. „Am besten hinter denjenigen, die man am seltensten braucht, oder?“
„Und das wären?“ Der Professor nahm die Haltung eines Lehrers an. Berufskrankheit, wie die Currywurst beim Detektiv.
„Helfen Sie mir weiter, ich bin f-fachfremd.“
„Zwei Möglichkeiten: Erstens, die eigenen Schriften. Nach Abschluss des Projektes ist man meist so durch mit dem Thema, dass man das Buch nach Erscheinen nur einmal in den Händen wendet, nach dem Zufallsprinzip hineinblättert, den einzigen Druckfehler des Bandes deutlicher sieht als die fett gesetzte Überschrift, deshalb das Konvolut schnell ins Bücherregal verfrachtet. Allerdings gibt es Besucher, die die Zeit des Wartens mit der Ansicht der Bücher überbrücken. Was sucht der Gast? Nach den Publikationen seines Gastgebers, vor allem wenn er im Büro auf diesen warten muss und er ein gutes Einstiegsthema für das anstehende Gespräch sucht. ‚Ach, lieber Kollege, Sie haben da ja einen schönen Sammelband herausgegeben …’ und so weiter.“
Damit war der Test wohl beendet. Zum Glück reagierte der Professor wie viele Lehrer. Sie schütten auf Nachfragen ein Füllhorn inhaltlicher Informationen aus, statt die Prüfung einfach fortzusetzen. Theo fiel sein immer etwas angeheiterter Kunstlehrer ein, der bei Nachfragen komplette Antworten herunterbetete, welche die Eleven stenographisch zu Papier brachten, ohne dass sich die anschließenden Noten auch nur geringfügig ähnelten.
„Also, Variante zwei. Nichts ist verstaubter, als ein Lexikon auf Papier, wenn gleichzeitig ein Computer auf dem Tisch steht“, zog Niemetz seinen Lehrplan weiter durch.
„Das große blaue Lexikon, das dicht gedrängt über mehrere Regalbretter hier rechts hinten steht?“, fragte Theo.
„Getroffen und versenkt. Sie sehen, auch dem Detektiv hilft ein wenig Theorie als Instrument zur Komplexitätsreduzierung. Nehmen Sie den Band XXIV mit dem Index heraus und Sie finden einen Mechanismus zum Öffnen der Abdeckung.“
Theo zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und tat mit diesem als Berührungsschutz wie geheißen, während ihm der Professor über die Schulter schaute. Er tastete im Regal nach dem Mechanismus. Rechts oben in der Ecke spürte er einen kleinen Hebel, wie bei einer Automobilmotorhaube. Er hob ihn leicht an. Mit einem sachten Klicken bewegte sich ein Teil des Regals ein paar zentimeterbreit nach vorne. Ein Griff am Regalbrett ermöglichte das Öffnen des etwa einen Quadratmeter großen Abschnitts. Dieser ließ sich zunächst dreißig Zentimeter in den Raum ziehen und dann nach links schwenkend öffnen. Das Regal gab den Blick auf einen dunkelgrauen Safe moderner Bauart frei. In einem Bedienfeld blinkten mehrere Dioden rot. Theo bat den Professor zu öffnen. Der Safe war nur wenig mehr als fünfzehn Zentimeter tief und war zweigeteilt. Der obere Bereich beherbergte Dokumente in zwei Papierfoldern, die aufgrund der geringen Tiefe des Safes quer aufgestellt waren. Theo nahm einen Dokumentenordner heraus und konnte mit einer schnellen Bewegung gerade noch verhindern, dass sich die Loseblattsammlung gen Boden verstreute. Unten standen drei Flaschen, mit einem mausgrauen Granulat gefüllt.
„Darf ich die Flaschen genauer anschauen?“, beendete Theo die optische Prüfung des vermeintlichen Tatorts.
„Wenn Sie sie fallen lassen, hänge ich Sie an Ihren Ohren auf.“
„F-Fair enough!“ Theo nahm sein Taschentuch und griff nach der rechtsaußenstehenden Flasche. Er machte einige Schritte zurück durch den Raum und stellte das Produkt der Forschung vorsichtig auf den Empire-Schreibtisch. Die eher schmale Flasche war mit einem im Verhältnis dazu sehr großen Flaschenhals versehen. Der Schließmechanismus erinnerte an Omas Einmachgläser oder an eine Flasche Flens. Die Flasche war mit der Aufschrift HK-2.8 beschriftet. Theo öffnete seine Umhängetasche und entnahm ihr einen Pinsel und eine Dose, gefüllt mit Pulver. Er verteilte das Pulver mit dem Pinsel über die untere Hälfte der Flasche. Als der Detektiv das Pulver mit einem leichten Pusten von der Flasche entfernte, wurden auf der Flasche Fingerabdrücke sichtbar, genau wie Theo es vermutet hatte, nicht weiter verwunderlich. Verwunderlich wäre nur, wenn es keine Fingerabdrücke gäbe. Mit seinem Smart-Phone machte der Detektiv Aufnahmen von den Fingerabdrücken und bat den Professor, zum Abgleich seine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Dieser schien nicht erfreut und murmelte etwas von ohnehin schon zu viele Informationen im Netz, ließ sich vom Argument, man müsse schließlich die Fingerabdrücke des Diebes isolieren, dann aber doch überzeugen. Theo legte das hierfür erforderliche Set auf den Tisch, nahm Niemetz’ linken Daumenabdruck und bat den Professor, mit den anderen Fingern alleine fortzufahren. Währenddessen entnahm Theo vorsichtig die mittlere Flasche aus dem Safe und wiederholte die Prozedur an HK-2.7. Mit dem gleichen Ergebnis. Schließlich war Flasche Nummer drei an der Reihe, HK-2.6, die Flasche, die ganz links stand. Theo verstrich das Pulver, dann pustete er sachte.
„Voilà!“ Theo hatte den richtigen Riecher gehabt, die Flasche zeigte keine Fingerabdrücke. Stattdessen zeigten sich deutliche Spuren eines Wischens. „Jemand hat versucht, seine Fingerabdrücke zu beseitigen, an HK 2.6“, murmelte er. Der Professor schaute auf und runzelte die Stirn, ohne etwas zu entgegnen. Es gab keinen Zweifel mehr und keine Paranoia, Theo hatte definitiv einen Fall. Er schaute mit einem leicht triumphierenden Lächeln zu Niemetz auf. Dieser hielt jetzt die Hand vor den Mund.
Theo wiederholte die Prozedur am Safe selbst und an den Dokumenten und fand wiederum Fingerabdrücke und Zeichen des Verwischens. Er fotografierte die Abdrücke mit seinem Smartphone und fing dann an, die Abdrücke des Professors abzulichten und mit den Abdrücken an den Flaschen abzugleichen.
Niemetz war ganz hibbelig. „Was sagt uns das alles, Herr Mennet?“
„Wenn Sie keine Fingerabdrücke hinterlassen wollen, können Sie entweder Handschuhe benutzen, oder die Abdrücke nachher verwischen. Professionell ist eher die erste Variante. Variante zwei, eher unprofessionell, kommt vor, wenn jemand die Gelegenheit hat und diese nutzen will. Wir müssen also nach jemandem suchen, der die Tat eher spontan ausgeführt hat, der unerwartet in den Raum gelangte.
„Aber wie kommt er dann an die Safe-Kombination?“
„Vielleicht kannte er sie schon, nur ergab sich die Gelegenheit früher als erwartet und die Gäule gingen mit ihm durch.“
„Hm. Wir suchen also nach einem Insider?“
Theo freute sich einerseits, weil dies die Zahl der Verdächtigen wesentlich reduzierte, aber es setzte auch das angenommene Motiv, Industriespionage, einem Belastungstest aus. Die Industrie hätte doch eher Profis geschickt.
„Wir müssen drei Fragen beantworten. Wer, wie, warum? Wer ist hier eingebrochen und für wen, und warum hat er nichts mitgenommen. Wie ist er hier hereingekommen und an die Safe-Kombination gelangt? Warum hat er das getan, was ist das Motiv? Wenn wir diese Fragen kohärent beantworten können, haben wir den Täter.“
„Schön. Und mit welchem ‚W’ fangen wir an?“
„Mit keinem der genannten. Besser beginnen wir mit einem ‚W’ wie ‚was’. Professor Niemetz, Sie sollten mir sagen, um was es in Ihrem Projekt geht. Offensichtlich macht es einige Menschen sehr neugierig. Und sehr wahrscheinlich haben Sie mir nicht einmal die halbe Wahrheit gesagt über Ihre Erfindung. Sonst hätten Sie nicht einen der modernsten Safes im Büro, dazu eine schalldichte Tür und Sicherungen im Fenster, obwohl Sie im zwölften Stock residieren.“
Der Professor seufzte. Während Theo Platz nahm, räumte der Professor die Flaschen in den Schrank zurück, nachdem Theo ihm versichert hatte, er könne das nun ungeschützt tun. Der Safe hatte gerade mit einem Piepston den Schließmechanismus aktiviert, das Bücherregal schwenkte nach einem leichten Stoß des Professors mit einem satten Schmatzen zurück in die Camouflage-Stellung, als das Telefon klingelte.
„Entschuldigung, wenn es hier klingelt, ist der Anruf wichtig, sonst würde Frau Schmidtbiel nicht durchstellen, ich hatte um Ungestörtheit gebeten.“ Theo setzte sich in die Rattanecke, winkte mit einer kurzen Handbewegung sein Einverständnis und malte sich die gelangweilte Sekretärin aus, wie sie Anrufer nur zu gerne abwimmelte, um sich Mehrarbeit zu ersparen. Nein, da ließ sich jemand nicht abwimmeln. Niemetz nahm ab.
„Ja?“ Pause.
„Ach ja?“ Pause.
„Jetzt?“ Pause.
„Wenn es sein muss.“ Der Professor legte auf. Mit Blick zu Mennet flüsterte er: „Der Institutsdirektor, ungelegen, sorry“, stand auf und ging zur Tür. Kaum hatte er die Tür einen spaltbreit geöffnet, drängte mit einer gewissen Vehemenz ein gedrungener, runder, weitgehend glatzköpfiger Endfünfziger ins Büro und passierte einen verdutzten Niemetz. Der Eindringling war tadellos in dunkelgrauen Zweireiher und weißes Hemd gewandet. Bei Bedarf konnte man sich den Mann gerne auch im Cord-Jackett vorstellen, für die Aktivitäten im Freien, hierzu trüge man natürlich karierte Mützen – oder in einem blauen, überlappenden Anzug mit großen goldenen Knöpfen. Über dem zugeknöpften Hemdkragen quoll das Doppelkinn, das prächtig mit den herabhängenden Backen harmonierte. Theo fühlte sich an einen Hund erinnert, der in seiner Berliner Nachbarschaft über die Gehsteige hechelte, seinen Besitzer, in ähnlichem Aussehen gefangen, im Schlepptau. Isomorph, Hund und Herrchen. Statt Krawatte trug der Direktor einfarbige Fliege zu Hosenträgern mit extravaganten Mustern. An der Hand prangte eine Patek Philippe. Theo dachte sich ein Monokel hinzu.
„Guten Tag, Herr Kollege.“ Begrüßungsformel schmettern und Niemetz’ Hand schnappen war eins. „Ich muss dringend mit Ihnen über die Angelegenheit von letzter Woche reden. Ich bin überhaupt nicht einverstanden. Sie bringen mich in eine unangenehme Situation. So geht das nicht. Ich werde vor den Kollegen zum Affen gemacht. Nehmen Sie den Antrag bitte zurück.“ Der ohnehin schon hochrote Kopf, wahrscheinlich Zeichen von Bluthochdruck, tendierte zunehmend ins Rubinrote.
Niemetz unterbrach den Redefluss seines Besuchers. „Entschuldigung, Herr Kollege, können wir das ein andermal besprechen, ich habe einen Gast.“
Erst jetzt entdeckte der Direktor Mennet in der Ecke.
„Ähm, ähm …“, stammelte der Ausgebremste, „Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst, darf ich mich vorstellen, Professor Laurenz Graf von Klingstein, Institutsdirektor.“
„Mennet, Dr. Mennet, Berlin“, erwiderte Theo im Aufstehen begriffen, sich pflichtgemäß als Wissenschaftler ausgebend, wie es ihm aufgetragen worden war. Er machte einige Schritte in Richtung Tür und streckte die Hand zur Begrüßung aus. Niemetz sah das Unheil heraufziehen. „Herr Kollege!“ Eine formvollendete Anrede, wie Theo meinte. Gleichzeitig ergriff er die ebenfalls ausgestreckte Hand des Mannes. Der Direktor drückte fest und lang, den Deut zu fest, der im Gedrückten sofort ein Unterlegenheitsgefühl weckt, der unterordnet und die Hierarchie festzurrt. Von Klingstein kniff unter herzigen Handrüttelbewegungen seine Augen zusammen – ja, jetzt rüttelte er auch noch und versandte Blitze.
„Mit was beschäftigt sich der Herr ‚Kollege’ in Berlin, und bei wem?“ Den ‚Kollegen’ hatte der Graf ironisch unterlegt. Die Henkersmahlzeit war gekocht, das Schafott hergerichtet. Wieder entstand eine fürchterlich lange Sekunde. Dann schaltete Theo. Als Nichthabilitierter hätte er den Professor nicht Kollegen nennen dürfen. Dies stand im akademischen Verhaltenskodex nur dem Professor gegenüber Nichthabilitierten zu, keinesfalls vice versa. Und von Klingstein sah durchaus so aus, als legte er gesteigerten Wert auf Etikette. Dieser vermutete in ihm nun einen Assistenten oder Forschungsmitarbeiter eines Kollegen in Berlin, zudem einen ohne Manieren. Theo sah Niemetz verlegen zur entgegnenden Intervention ansetzen. Er musste die Notbremse ziehen.
„K-Kollegen sind wir natürlich nur im übertragenden Sinne, weil uns beide die Neugier nach bisher Unerforschtem und Verborgenen interessiert. Ich bin … freischaffender Journalist und interessiere mich für die Forschungen von Professor Niemetz.“
„Ah, und wo haben Sie promoviert?“ Der Graf ließ nicht locker.
„Ich bin in der Naturwissenschaft eigentlich f-fachfremd. Ich habe Ökonomie studiert, an der London School of Economics in London“, versuchte Theo den fiktiven Ort möglichst aus der Reichweite seines Opponenten zu hieven.
„LSE, quite a noble address“, das Englisch des Direktors ließ seine hessische Herkunft weit deutlicher hervortreten als sein Deutsch. „Kennen Sie dort meinen Kollegen Brampton?“
„W-wie gesagt, ich habe Ökonomie studiert, mein Interesse an den Naturwissenschaften ist eher jüngeren Datums.“ Theos Brust zog sich zusammen und er verspürte eine leichte Übelkeit aufkommen. „Z-z-zudem interessiere ich mich mehr für ökonomische Anwendungen von Erfindungen als f-für die Erfindungen selbst. Insofern bin ich Praktiker.“
„Gut, dann will ich nicht weiter stören. Lieber Kollege, wir müssen die Diskussion leider führen, zeitnah. Klopfen Sie doch bei mir an, wenn Sie eine Minute für mich entbehren können. Ich wünsche allseits einen guten Tag.“
Mit einem etwas zu gönnerhaften Kopfnicken verließ er den Raum. Niemetz schloss erleichtert die Tür hinter ihm und Theo atmete tief durch.
„Keine gute Idee von mir, das mit dem Kollegen“, bedeutete Niemetz die Übernahme der Schuld für den Vorfall.
Auf der anderen Seite der Tür blieb ein nachdenklicher Graf von Klingstein einen Augenblick stehen. Brampton aus London war Ökonom, kein Naturwissenschaftler, und er war seit Jahrzehnten an der LSE. Jeder, der dort promovierte, musste ihn kennen. Warum wollten ihm die beiden einen Bären aufbinden? Was waren das für komische Gegenstände auf Niemetz Schreibtisch und weshalb waren die Fingerkuppen des Kollegen schwarz? Polizei? Von Klingstein warf der jetzt hibbeligen Sekretärin einen kurzen Blick zu und verschwand schnaufend.
Im Zimmer zogen sich Andries und Theo wieder in die Sitzecke zurück.
„Die Flaschen scheinen voll zu sein“, nahm Mennet den Gesprächsfaden wieder auf, „oder haben Sie den Eindruck, dass etwas fehlt?“
Niemetz nahm durchaus erfreut zur Kenntnis, dass der Detektiv wohl vergessen hatte, an seine ursprüngliche Frage nach dem wahren Gehalt des Forschungsprojektes anzuknüpfen.
„Nein, alles scheint unversehrt. Aber künftig werde ich die Behältnisse besser versiegeln.“
„Wie viel Material braucht man, um etwas damit anfangen zu können?“
„Auf jeden Fall mehr als nur einen Teelöffel. Selbst zur Analyse braucht man eine gewisse Menge. Und mehr als die drei Flaschen gibt es nicht von dem Material.“





























