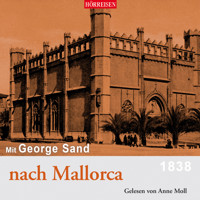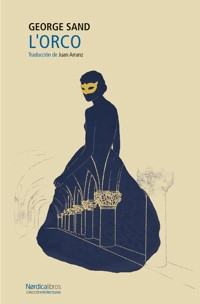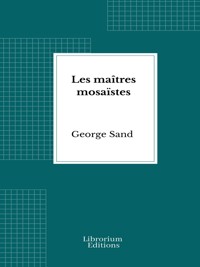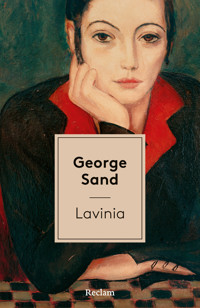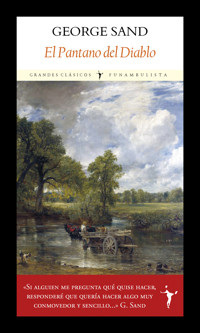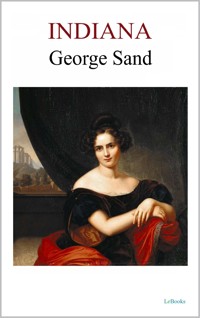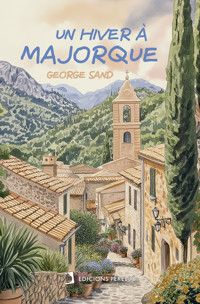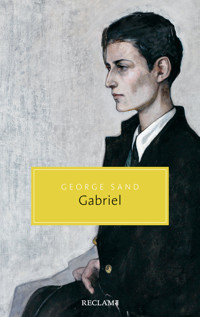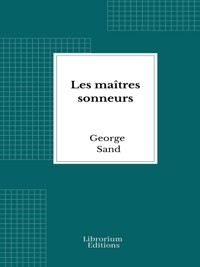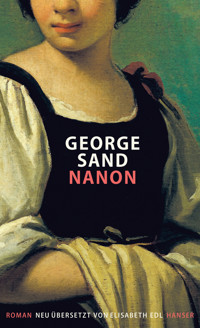
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
George Sand über die Französische Revolution aus der Perspektive eines Bauernmädchens – eine der ersten engagierten Autorinnen der Weltliteratur in neuer Übersetzung Revolution ist Männersache? Nein! Denn George Sand, die unkonventionelle, provozierende Frau unter den französischen Klassikern, erzählt es anders: Nanon ist vierzehn, als 1789 die Revolution losbricht und alle Stände niederreißt. Das Bauernmädchen, eine Leibeigene, wird Zeugin und Akteurin in einem der größten Umbrüche der Geschichte. Als Mädchen noch Analphabetin, schreibt Nanon im Alter ihr Leben auf: die packende Emanzipations- und Bildungsgeschichte einer Frau in einem männlich geprägten Jahrhundert. Neben ihren vielfach ausgezeichneten Neuübersetzungen von Stendhal und Flaubert präsentiert Elisabeth Edl jetzt diese reich kommentierte Ausgabe einer der großen Schriftstellerinnen der Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
George Sand über die Französische Revolution aus der Perspektive eines Bauernmädchens — eine der ersten feministischen Autorinnen der Weltliteratur in neuer ÜbersetzungRevolution ist Männersache? Nein! Denn George Sand, die unkonventionelle, provozierende Frau unter den französischen Klassikern, erzählt es anders: Nanon ist vierzehn, als 1789 die Revolution losbricht und alle Stände niederreißt. Das Bauernmädchen, eine Leibeigene, wird Zeugin und Akteurin in einem der größten Umbrüche der Geschichte. Als Mädchen noch Analphabetin, schreibt Nanon im Alter ihr Leben auf: die packende Emanzipations- und Bildungsgeschichte einer Frau in einem männlich geprägten Jahrhundert. Neben ihren vielfach ausgezeichneten Neuübersetzungen von Stendhal und Flaubert präsentiert Elisabeth Edl jetzt diese reich kommentierte Ausgabe einer der großen Schriftstellerinnen der Weltliteratur.
George Sand
NANON
Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über George Sand
Impressum
Inhalt
NANON
ANHANG
Nachwort
Zur Ausgabe
Kurze Chronologie zur französischen Politik 1789 bis 1870/71
Zeittafel zur Biographie
Anmerkungen
NANON
I.
In vorgerücktem Alter mache ich mich jetzt, 1850, ans Werk und schreibe die Geschichte meiner Jugend.
Damit will ich nicht meine Person in den Vordergrund stellen, bewahren will ich vielmehr für meine Kinder und Enkelkinder die teure und heilige Erinnerung an meinen einstigen Mann.
Ich weiß nicht, ob ich im Schreiben erzählen kann, denn mit zwölf war ich noch außerstande zu lesen. Ich versuch’s, so gut ich kann.
Ich will die Dinge mit innerer Heiterkeit angehen und mich bemühen, meine frühesten Kindheitserinnerungen wiederzufinden. Sie sind sehr verworren, wie bei Kindern, deren Verstand nicht durch Erziehung gefördert wird. Ich weiß, ich bin 1775 geboren, schon mit fünf hatte ich weder Vater noch Mutter, und ich entsinne mich nicht, sie gekannt zu haben. Beide starben an den Pocken, und auch ich wäre fast gestorben, das Impfen war damals noch nicht vorgedrungen bis zu uns. Erzogen wurde ich von einem alten Großonkel, er war Witwer und hatte zwei Enkelsöhne, Waisen wie ich und ein wenig älter als ich.
Wir gehörten zu den ärmsten Bauern im Kirchsprengel. Trotzdem bettelten wir nicht um Almosen; mein Großonkel arbeitete noch als Tagelöhner; und seine zwei Enkel fingen an, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen; aber wir hatten kein Fleckchen eigenes Land, und nur mit größter Mühe konnten wir die Miete für ein schäbiges strohgedecktes Haus mit einem kleinen Garten bezahlen, wo fast nichts wuchs unter den Kastanienbäumen des Nachbarn, die ihren Schatten herüberwarfen. Zum Glück fielen die Kastanien zu uns, und wir halfen ihnen ein bisschen beim Fallen; das konnte uns niemand verübeln, denn die Hauptäste hingen ja zu uns und schadeten unseren Rüben.
Trotz seiner Armut war mein Großonkel, der Jean Lepic hieß, ein sehr anständiger Mensch, und wenn seine Enkel auf fremden Feldern klauten, las er ihnen die Leviten und versohlte sie tüchtig. Mich möge er lieber, sagte er, denn ich sei keine geborene Diebin und Plünderin. Er verpflichtete mich zu Anständigkeit gegenüber jedermann und lehrte mich, meine Gebete sprechen. Er war sehr streng, aber sehr gut, und tätschelte mich manchmal am Sonntag, wenn er zu Hause blieb.
Das ist alles, woran ich mich erinnere, bis zu dem Augenblick, da mein kleiner Verstand sich von allein öffnete, dank eines Vorfalls, den man gewiss sehr kindisch finden wird, für mich aber war er ein großes Ereignis und so etwas wie der Ausgangspunkt meines Lebens.
Eines Tages klemmte Vater Jean mich zwischen die Beine, gab mir eine saftige Ohrfeige und sagte:
»Nanettchen, hört gut zu und merkt Euch genau, was ich jetzt sage. Weint nicht. Wenn ich Euch geschlagen hab, dann nicht, weil ich böse bin auf Euch: Im Gegenteil, es ist nur zu Eurem Besten.«
Ich wischte mir die Augen, schluckte meine Tränen hinunter und lauschte.
»Nun also«, fuhr mein Onkel fort, »Ihr seid elf und habt noch nie außer Haus gearbeitet. Das ist nicht Eure Schuld; wir besitzen nichts, und Ihr wart nicht kräftig genug für Tagelöhnerarbeit. Die anderen Kinder haben Tiere zum Hüten und führen sie auf den Dorfanger; wir freilich konnten uns Tiere nie leisten; jetzt aber hab ich endlich ein wenig Geld beiseitegelegt, und heute will ich auf den Viehmarkt gehen und kaufe ein Schaf. Ihr müsst mir beim lieben Gott schwören, dass Ihr Euch gut darum kümmert. Wenn Ihr für sein Fressen sorgt, wenn Ihr es nicht verliert, wenn Ihr seinen Stall in Ordnung haltet, wird es schön wachsen, und mit dem Geld, das es mir im nächsten Jahr einbringt, kaufe ich Euch zwei, und im Jahr darauf vier; dann könnt Ihr stolz sein und gleichauf gehen mit den andern jungen Dingern, die Grips haben und ihren Familien Gewinn eintragen. Habt Ihr verstanden, und werdet Ihr alles so machen, wie ich’s Euch sage?«
Ich war furchtbar aufgeregt und brachte kaum etwas heraus; doch mein Großonkel begriff, dass ich guten Willens war, und er machte sich auf zum Markt mit dem Versprechen, er sei gewiss vor Sonnenuntergang zurück.
Zum ersten Mal wurde mir die Dauer eines Tages bewusst, und auch, dass meine Beschäftigungen einen Sinn hatten für mich. Offenbar taugte ich schon für irgendwas, denn ich konnte fegen, im Haus aufräumen und Kastanien rösten; aber ich machte diese Dinge gedankenlos, ohne zu wissen, wer sie mir beigebracht hatte. An jenem Tag sah ich die Mariotte daherkommen, eine Nachbarin, etwas wohlhabender als wir, die mich wahrscheinlich großgezogen hatte und die ich jeden Tag auftauchen sah, ohne dass ich mich je gefragt hatte, warum sie sich um unser armseliges Haus kümmerte und um mich. Ich stellte ihr Fragen und erzählte zugleich, was Vater Jean mir gesagt hatte, und ich begriff, dass sie uns den Haushalt führte, als Gegenleistung für die Arbeit, die mein Großonkel verrichtete, denn er bestellte ihren Garten und mähte ihre Wiese. Sie war eine sehr gute und anständige Frau, die mir wahrscheinlich schon lange Unterricht und Ratschläge erteilte und der ich blind gehorchte, deren Worte mich nun aber verblüfften.
»Dein Großonkel«, sagte sie, »entschließt sich also endlich zum Viehkauf! Wie lange liege ich ihm damit in den Ohren. Habt ihr erstmal Schafe, dann habt ihr auch Wolle; ich zeige dir, wie man sie entfettet, wie man sie spinnt und wie man sie blau oder schwarz färbt; und wenn du mit den andern kleinen Hirtinnen aufs Feld gehst, lernst du stricken, und ich wette, du wirst stolz sein, wenn du Strümpfe machen kannst für Vater Jean, der mit halbnackten Beinen herumläuft, guter armer Mann, bis mitten in den Winter, so schlecht geflickt sind seine Hosen; ich hab keine Zeit, kann nicht alles machen. Würdet ihr eine Ziege halten, dann hättet ihr Milch. Du hast gesehen, wie ich Käse mache, und das kannst du auch. Kopf hoch, man darf den Mut nicht sinken lassen. Du bist ein sauberes, vernünftiges Mädchen und achtest auf die armseligen Kleider, die du am Leib trägst. Du wirst Vater Jean helfen, dem Elend zu entkommen. Das bist du ihm schuldig, denn er hat seine Armut verschlimmert, als er dich in Obhut nahm.«
Die Komplimente und Ermutigungen der Mariotte gingen mir sehr zu Herzen. In meinem Innern regte sich Eigenliebe, und ich fühlte mich um einen ganzen Kopf größer als tags zuvor.
Das war an einem Samstag; an diesem Tag aßen wir Brot zu Abend und auch zum nächsten Mittag. Den Rest der Woche lebten wir, wie alle armen Leute in der Provinz Marche, nur von Kastanien und Buchweizenbrei. Ich berichte von lang zurückliegenden Zeiten; wir waren, glaube ich, im Jahr 1787. Damals lebten viele Familien nicht besser als wir. Heutzutage essen arme Leute etwas besser. Es gibt Wege, über die können Nahrungsmittel getauscht werden, und gegen Kastanien bekommt man ein wenig Getreide.
Am Samstagabend brachte mein Großonkel ein Roggenbrot und ein kleines Stück Butter vom Markt mit nach Hause. Ich beschloss, ihm seine Suppe ganz allein zu kochen, und ließ mir von der Mariotte genau erklären, wie sie’s machte. Ich ging in den Garten ein bisschen Gemüse ausrupfen und putzte es säuberlich mit meinem schäbigen kleinen Messer. Als die Mariotte sah, dass ich mich allmählich geschickt anstellte, lieh sie mir zum ersten Mal ihres, das sie mir nie hatte geben wollen, aus Angst, ich könnte mir damit wehtun.
Mein Großcousin Jacques kam früher als mein Onkel vom Markt zurück; er brachte das Brot, die Butter und das Salz. Die Mariotte ging, und ich machte mich an die Arbeit. Jacques verlachte meinen Ehrgeiz, die Suppe ganz allein zu kochen, und behauptete, sie werde übel schmecken. Ich setzte meinen ganzen Stolz darein, die Suppe wurde für gut befunden, und ich bekam Lob.
»Jetzt, wo du eine Frau bist«, sagte mein Onkel zufrieden schlürfend, »verdienst du die Freude, die ich dir machen will. Komm, wir gehen deinem kleinen Cousin Pierre entgegen, er hat’s übernommen, das Schäflein heimzuführen, und sicher ist er gleich hier.«
Dieses heißersehnte Schaf war eine Schäfin, und bestimmt war sie furchtbar hässlich, denn sie hatte drei Livre gekostet. Die Summe schien mir gewaltig, drum fand ich das Tier schön. Gewiss, ich hatte Vergleichsobjekte vor Augen gehabt, seit ich auf der Welt war; aber nie hatte ich daran gedacht, mir das Vieh der andern genauer anzuschauen, und mein Schaf gefiel mir so gut, dass ich mir einbildete, ich hätte das schönste Tier auf Erden. Das Gesicht mochte ich sofort. Mir schien, es beäugte mich voller Freundschaft, und wenn es aus meiner kleinen Hand die Blätter und Gemüseabfälle fressen kam, die ich ihm zuliebe aufgehoben hatte, musste ich mich sehr beherrschen, dass ich nicht schrie vor lauter Freude.
»Ach! lieber Onkel«, sagte ich, weil mir plötzlich etwas einfiel, woran ich noch nicht gedacht hatte, »so ein schönes Schaf, aber wir haben keinen Stall, wo es schlafen kann!«
»Den bauen wir morgen«, erwiderte er; »bis dahin soll es hier in einer Zimmerecke liegen. Es hat keinen großen Hunger heute Abend, es ist viel gelaufen und erschöpft. Morgen bringst du es in aller Früh zum unteren Weg, dort wächst Gras, und es kann sich sattfressen.«
Auf den nächsten Tag warten, dass Rosette (ich hatte sie schon getauft) fressen konnte, das fand ich zu lang. Ich bekam die Erlaubnis, vor Einbruch der Nacht an den Hecken entlang Blätter zu machen. Ich fuhr mit den Händen durch die Zweige der kleinen Ulmen und wilden Haselsträucher, und ich füllte meine Schürze mit grünen Blättern. Die Nacht kam, und ich kratzte mir die Hände an Dornen blutig; aber ich spürte nichts und hatte vor nichts Angst, obwohl ich noch nie allein gewesen war, so spät nach Sonnenuntergang.
Als ich heimkehrte, schlief bei uns alles, trotz Rosettes Geblöke, wahrscheinlich war sie ungern allein und vermisste ihre einstigen Gefährtinnen. Sie fühlte sich wunderlich, wie man bei uns sagte, also fremd. Sie wollte weder fressen noch saufen. Das machte mir große Sorgen und Kummer. Am nächsten Morgen schien sie zufrieden, als sie hinaus und frisches Gras fressen konnte. Ich wollte, dass mein Großonkel ihr schnell einen Unterschlupf baute, wo sie auf Streu schlafen konnte, und ich beeilte mich, gleich nach der Messe, und lief zum Dorfanger Farnkraut schneiden. Das machten alle, und so war kaum etwas da; zum Glück brauchte man nicht viel für ein einziges Schaf.
Doch mein Großonkel war nicht mehr allzu flink und hatte kaum angefangen mit seinem Bau, und ich musste ihm Erde stampfen und anrühren helfen. Endlich, gegen Abend, nachdem Jacques große flache Steine, Geäst, Grassoden und eine ordentliche Ladung Ginster angeschleppt hatte, stand der Stall mehr oder weniger aufrecht und mitsamt einem Dach. Die Tür war so niedrig und klein, dass nur ich ganz gebückt hindurchpasste.
»Siehst du«, sagte Vater Jean, »das Tier ist wirklich deins, nur du kannst in sein Haus schlüpfen. Vergisst du, ihm sein Lager zu bereiten und ihm tagsüber Gras zu geben und zu saufen für die Nacht, dann wird es krank werden und eingehen, und du grämst dich.«
»Ausgeschlossen, das wird nicht geschehen!«, antwortete ich stolz, und von diesem Augenblick an wusste ich, ich bin wer. Ich konnte meine Person unterscheiden von anderen. Ich hatte eine Beschäftigung, eine Aufgabe, eine Verantwortung, einen Besitz, ein Ziel, kann ich sagen eine Mutterpflicht, bei einem Schaf?
Sicher ist, ich war dafür geschaffen, jemand zu umhegen, also zu bedienen und zu schützen, jemand oder etwas, und sei’s nur ein armes Tier, und mein eignes Leben begann durch die Sorge um ein anderes Wesen als ich selbst. Zunächst war ich überfroh, Rosette so gut untergebracht zu wissen; doch bald hörte ich, dass die Wölfe, die unsere Wälder bevölkerten, bis um unsere Häuser schlichen, und konnte nicht mehr schlafen, weil ich mir ständig einbildete, ich hörte sie an Rosettes armseligem Unterschlupf scharren und nagen. Mein Großonkel verlachte mich, sagte, das würden sie nicht wagen. Ich ließ nicht locker, bis er den kleinen Bau durch größere Steine befestigt und das Dach gesichert hatte, mit dickeren, eng aneinandergelegten Ästen.
Dieses Schaf hielt mich den ganzen Herbst beschäftigt. Der Winter kam, und bei tiefen Frostnächten musste ich es zuweilen hereinholen ins Haus. Vater Jean legte Wert auf Sauberkeit, und im Gegensatz zu den Bauern jener Zeit, die gern mit ihren Tieren und sogar den Schweinen zusammenwohnten, widerstrebte ihm der Gestank, und er wollte sie nicht vor seiner Nase dulden. Aber ich schaffte es, Rosette sauber zu halten und ihre Streu immer frisch, sodass er mir meinen kleinen Willen ließ. Ich muss sagen, während ich Rosette so fest ins Herz schloss, nahm ich auch meine anderen Aufgaben ernster. Ich wollte meinem Onkel und meinen Cousins gefällig sein, damit sie mir für mein Schaf nichts mehr abschlagen würden. Ich sorgte ganz allein für Ordnung im Haus und machte alle Mahlzeiten. Die Mariotte half mir nur noch bei schwierigen Arbeiten. Ich lernte schnell waschen und flicken. Ich nahm Handarbeit mit aufs Feld und gewöhnte mich daran, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, denn während ich nähte, hatte ich stets ein Auge auf Rosette. Ich war eine gute Hirtin, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich ließ sie nicht lange am selben Fleck, damit sie bei Appetit blieb, ich erlaubte ihr nicht, an ein und derselben Stelle alles aufzufressen, ich führte sie gemächlich umher und wählte ihr Weideplätzchen am Wegrand; denn Schafe haben keine große Urteilskraft, das muss man schon sagen; sie grasen, wo immer sie stehen, und trotten nur weiter, wenn sie bloß noch in Erde beißen. Von ihnen kann man wirklich sagen, sie sehen nicht weiter, als ihre Nase reicht, wegen ihrer Trägheit beim Schauen. Ebenso gab ich acht, sie nicht anzutreiben, wenn ich sie heimführte in den Stall, über die Wege voller Staub, aufgewirbelt von den Herden. Ich hatte gesehen, wie sie beim Staubschlucken hustete, und wusste, Schafe sind empfindlich auf der Brust. Auch gab ich acht, in ihre Streu keine schädlichen Gräser zu tun, wie Flughafer, dessen Samen in die Nasenlöcher dringt, wenn er reif ist, oder in die Augen sticht und Schwellungen verursacht oder Wunden. Aus demselben Grund wusch ich ihr jeden Tag das Gesicht, und dadurch lernte ich mich selber zu waschen und sauber zu halten, was mir niemand beigebracht hatte, mir aber zu Recht für die Gesundheit der Menschen ganz genauso wichtig schien wie für die der Tiere. Während ich fleißig wurde und mich gebraucht fühlte, begann ich mich vor Krankheit zu fürchten, und obwohl vom Aussehen her mager und schmächtig, wurde ich rasch sehr stark und ausdauernd.
Glaubt nicht, ich sei schon fertig mit meinem Schaf. Es stand geschrieben, dass meine Freundschaft zu ihm über mein weiteres Leben entscheiden sollte. Zum besseren Verständnis von allem, was folgt, muss ich nun aber von unserm Kirchsprengel erzählen und von seinen Bewohnern.
Wir waren kaum mehr als zweihundert Seelen, das heißt, ungefähr fünfzig Häuser, verstreut über eine halbe Meile der Länge nach, denn wir wohnten am Berg, am Rand einer sehr schmalen Schlucht, die sich in der Mitte verbreiterte und ein hübsches kleines Tal bildete, ausgefüllt vom Kloster Valcreux und seinen Nebengebäuden. Dieses Kloster war sehr groß und stattlich, umgeben von hohen Mauern, die Rundbogentore bewehrt mit Türmen. Die Kirche war alt, klein, aber sehr hoch und im Innern ziemlich reich geschmückt. Man betrat sie durch den großen Hof, an dessen Seiten und rückwärtigem Teil sich schöne Gebäude befanden, Refektorium, Kapitelsaal und Wohnraum für zwölf Geistliche, nicht mitgerechnet die Pferdestallungen, Viehställe, Scheunen und Geräteschuppen; denn die Mönche waren Eigentümer fast des gesamten Kirchsprengels, und sie ließen durch Frondienst ihr Land bestellen und die Ernten einbringen; wofür sie zu niedrigen Preisen die von ihren Bauern bewohnten Häuser vermieteten. Alle diese Häuser gehörten ihnen.
Trotz dieses großen Reichtums waren die Geistlichen in Valcreux nicht frei von Geldsorgen. Es ist schon merkwürdig, dass Leute, die keine Familie haben, es nicht verstehen, Gewinn zu ziehen aus ihrem Besitz. Ich habe alte Junggesellen gesehen, die ihre Écus anhäuften, dabei entbehrungsreich lebten und starben, ohne den kleinsten Gedanken an ein Testament, so, als hätten sie weder sich selbst noch die andern jemals geliebt. Ich habe auch welche gesehen, die sich ausplündern ließen, um ihren Frieden zu haben und nicht, um Gutes zu tun; aber vor allem habe ich diese letzten Mönche gesehen, und ich versichere Euch, sie hatten keinerlei Sinn für Wirtschaftlichkeit. Sie dachten weder an die Familie, die sie nicht haben durften, noch an die Zukunft ihrer Gemeinschaft, darüber machten sie sich offenbar keine Gedanken. Ebenso wenig scherten sie sich um den guten Ertrag des Bodens und die pflegliche Behandlung, die er verdient. Sie lebten in den Tag hinein wie Fahrende in einem Zeltlager, pflanzten an einem Ort zu viel, am andern nicht genug, ein Stück Erde, das leicht zugänglich war, laugte aus, ein andres wurde vernachlässigt, weil sie es nicht beaufsichtigen konnten oder wollten. Sie besaßen im Flachland große Teiche, diese hätte man trockenlegen können und besäen; aber dann hätten sie Fisch kaufen müssen für die Fastenzeit, und sie fanden es bequemer, ihn auf eigenem Grund fangen zu lassen. Sie waren sehr faul und fällten Holz nur in ihrer Umgebung, ließen alles Übrige verkommen. Sie wurden viel beklaut und wären nützlicher gewesen für die armen Leute, hätten sie ihnen Redlichkeit beigebracht und keine Faulheit geduldet, die zum Stehlen verleitet. Sie waren zu nachlässig oder zu ängstlich und sagten nichts.
Man muss auch zugeben, die Zeit war nicht eben günstig, um sich Respekt zu verschaffen. Die Leute bei uns konnten nicht klagen über diese Mönche, denn die meisten von ihnen waren weder gut noch böse, und nichts wäre ihnen lieber gewesen, als Gutes zu tun, doch sie wussten nicht wie. Nun gut, so sanftmütig sie auch waren, man klagte über sie, man wollte sie nicht länger ertragen, man respektierte sie nicht mehr, man fing sogar an sie zu verachten. Es ist recht eigentlich eine Angewohnheit der Bauern, Leute geringzuschätzen, die ihre Angelegenheiten schlecht verwalten. Ich kann sagen, wie der Bauer die Dinge sieht, denn ich stamme auch von diesem Menschenschlag. Er achtet vor allem die Erde, die ihn ernährt, und das bisschen, das er davon besitzt, ist für ihn wie die Hälfte seiner Seele; was er nicht besitzt, das begehrt er, und ob sie ihm gehört oder nicht, er respektiert sie, denn sie ist immer Erde, und in ihr meint er die Segnungen des Himmels zu sehen und zu berühren. In meinen jungen Jahren scherte er sich nicht groß um Geld. Er konnte nicht umgehen damit. Écus in Umlauf bringen, arbeiten lassen und vermehren, das war eine Wissenschaft für Bürgersleute. Bei uns dagegen, wo alles über Tauschhandel lief, Arbeit einerseits, Bezahlung in Nahrungsmitteln andrerseits, war Geld kein großer Traum. Man bekam so wenig davon zu sehen, hielt so selten welches in Händen, dass keiner darüber nachsann; man dachte nur daran, eine eigene Wiese zu besitzen, einen Wald, einen Garten, und man sagte:
»Darauf hat ein jeder Anrecht, der arbeitet und Kinder in die Welt setzt.«
Allein die Frömmigkeit hielt den Bauer im Zaum, aber nicht mehr den Bürger, und seit langem war sie den Adligen nur noch Anlass für Spott. Es gab keine Spenden mehr, keine Opfergaben, keine Schenkungen an die Klöster; die großen Familien schickten ihre Letztgeborenen nur noch in seltenen Ausnahmefällen dorthin; das Kapital wurde also nicht erneuert, und der Besitz verlotterte. Der Mönchsstand war nicht mehr in Mode, wenn es darum ging, der Kirche etwas zu geben; lieber war man Abbé und bekam etwas vom Staat.
Darum hatte das Kloster Valcreux nur noch sechs Mönche anstatt zwölf, und als die Gemeinschaft später aufgelöst wurde, waren es nur mehr drei.
Ich will mich wieder meinem Schafsvolk widmen oder, besser gesagt, nur einem einzigen Schaf, meiner lieben Rosette. Der Sommer war angebrochen, und das Gras wurde so spärlich, selbst an den Straßengräben, dass ich nicht mehr wusste, was ich mir noch ausdenken sollte, um sie zu füttern. Ich musste weit hinaufgehen in die Berge, und ich fürchtete mich vor Wölfen. Ich war verzweifelt, es wollte nicht regnen, und Rosette wurde mager. Vater Jean sah meinen Kummer und machte mir keine Vorwürfe, freilich ärgerte er sich, denn er hatte sein Geld, seine drei Livre aus Tours, in einen Kauf gesteckt, der so viel Mühe kostete und so wenig Gewinn versprach.
Eines Tages, als ich an einer kleinen Wiese vorbeikam, die zum Kloster gehörte und die grün und üppig geblieben war, weil ein Fluss sie durchzog, hielt Rosette vor dem Gatter und begann so jämmerlich zu blöken, dass ich ganz den Kopf verlor vor Kummer und Mitleid. Das Gatter war nicht verriegelt, sondern nur dicht an den Pfosten geschoben, und es schloss sogar ziemlich schlecht, denn Rosette schob ihren Kopf durch, dann ihren Leib und schlüpfte zuletzt ganz hinein.
Ich war zunächst sehr erschrocken, als ich sie auf einer Weide sah, wo ich nicht hinterher konnte, ich, ein verständiger Mensch, ich, eine Person, die wusste, dass sie kein Recht hatte zu tun, was sie gerade tat, das arme Unschuldslamm. Langsam spürte ich mein gutes Gewissen und meinen Stolz, denn ich hatte nie geklaut, was mir immer das Lob meines Onkels eintrug und den Respekt meiner Cousins, obwohl diese nicht so penibel waren wie ich. Und ich fragte mich also, ob es nicht meine Pflicht sei, nach meinem Glaubensgrundsatz zu handeln, gerade weil er Rosette fehlte. Ich rief sie, sie stellte sich taub. Sie fraß so herzhaft, sie wirkte so zufrieden!
Nach einer Weile rief ich sie abermals, nach einer geraumen Weile, muss ich gestehen, da sah ich plötzlich, auf der andern Seite des Gatters, das junge und sanfte Gesicht eines Novizen, der mich lachend beobachtete.
II.
Ich schämte mich sehr; bestimmt machte der Bursche sich über mich lustig, und offenbar besaß ich eine gehörige Portion Eigenliebe, denn diese Scham bedrückte mein Herz, und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten.
Das überraschte den jungen Geistlichen, und er sagte mit einer Stimme so sanft wie sein Gesicht:
»Du weinst, Kleine? Hast du Kummer?«
»Es ist«, erwiderte ich, »wegen meinem Schäflein, das weggelaufen ist, auf Eure Wiese.«
»Aber deshalb ist es doch nicht verloren. Es ist doch zufrieden, denn es frisst?«
»Zufrieden ist es, das weiß ich wohl; aber ich bin wütend, weil es Feldraub begeht.«
»Was soll das heißen, Feldraub?«
»Es frisst auf fremdem Hab und Gut.«
»Auf fremdem Hab und Gut! Du weißt nicht, was du sagst, Kleine. Das Hab und Gut der Mönche gehört allen.«
»Ach! es gehört also nicht mehr den Mönchen? Das wusst ich nicht.«
»Hast du gar keine Religion?«
»Ja doch, ich kann mein Gebet aufsagen.«
»Na also, du bittest Gott jeden Morgen um dein tägliches Brot, und die Kirche, die reich ist, muss denen geben, die im Namen des Herrn bitten. Sie wäre zu nichts gut, wäre sie nicht dazu gut, Wohltätigkeit zu üben.«
Ich machte große Augen und verstand wenig, denn auch wenn sie nicht besonders böse waren, die Mönche von Valcreux wehrten sich, so gut es ging, gegen Plünderer, und es gab Pater Fructueux, der das Amt des Cellerars ausübte und viel Geschrei machte und wüste Drohungen ausstieß gegen auf frischer Tat ertappte Schäfer. Er verfolgte sie mit einer Weidenrute, nicht sehr weit, das stimmt schon, er war fürs Rennen zu fett; aber er machte ihnen Angst, und es hieß, er sei böse, und doch hätte er keine Katze verprügelt.
Ich fragte den jungen Burschen, ob es Pater Fructueux billigen würde, dass mein Schaf sein Gras frisst.
»Das weiß ich nicht«, antwortete er; »aber ich weiß, das Gras gehört nicht ihm.«
»Und wem gehört’s dann?«
»Es gehört Gott, der es wachsen lässt für alle Herden. Glaubst du mir nicht?«
»Himmel! ich weiß nicht. Aber was Ihr da sagt, käme mir gut zupass! Könnte sich meine arme kleine Rosette während der großen Dürre bei Euch sattfressen, ich verbürge mich, ich würde deswegen nicht faulenzen. Sowie das Gras oben am Berg nachwächst, führe ich sie wieder hinauf, ich sag Euch die Wahrheit.«
»Nun, dann lass sie, wo sie ist, und komm sie heute Abend holen.«
»Heute Abend? O nein! Wenn die Mönche sie sehen, wird sie eingefangen, und mein Großonkel muss dann um sie betteln gehen und sich Vorwürfe anhören: Und mich wird er auszanken und sagen, ich bin so schlimm wie die andern, das tut mir sehr weh.«
»Ich sehe, du bist ein guterzogenes Kind. Wo wohnt er denn, dein Großonkel?«
»Da oben, das kleinste Haus auf halber Anhöhe. Seht Ihr’s? Das nach den drei großen Kastanien?«
»Gut, ich bring dir dein Schaf, wenn es genug gefressen hat.«
»Aber wenn die Mönche Euch auszanken?«
»Sie werden mich nicht auszanken. Ich erkläre ihnen ihre Pflicht.«
»Ihr seid also Herr bei denen?«
»Ich? Kein bisschen. Ich bin nichts als ein Schüler. Ich wurde ihnen anvertraut, damit sie mich unterrichten und darauf vorbereiten, Geistlicher zu werden, wenn ich alt genug bin.«
»Und wann seid Ihr alt genug?«
»In zwei, drei Jahren. Ich werde bald sechzehn.«
»Also seid Ihr Novize, wie man so sagt?«
»Noch nicht, ich bin erst seit zwei Tagen hier.«
»Darum also hab ich Euch noch nie gesehen? Und wo kommt Ihr her?«
»Ich komme von hier aus der Gegend; hast du von der Familie und vom Schloss Franqueville gehört?«
»Meiner Seel, nein. Ich kenn nur die Gegend um Valcreux. Sind Eure Eltern arm, dass sie Euch so wegschicken?«
»Meine Eltern sind sehr reich; aber wir sind drei Kinder, und da sie ihr Vermögen nicht auseinanderreißen wollen, bewahren sie es für den Ältesten. Meine Schwester und ich, wir erhalten jeder nur einen einmaligen Anteil, mit dem wir in den Konvent eintreten.«
»Wie alt ist sie denn, Eure Schwester?«
»Elf: und du?«
»Ich bin noch keine dreizehn.«
»Dann bist du groß, meine Schwester ist einen ganzen Kopf kleiner als du.«
»Bestimmt liebt Ihr sie, Eure kleine Schwester?«
»Ich liebte nur sie.«
»Wirklich! Und Vater und Mutter?«
»Ich kenne sie fast nicht.«
»Und Euren Bruder?«
»Den kenne ich noch weniger.«
»Wie kann das sein?«
»Unsere Eltern haben uns auf dem Land großziehen lassen, meine Schwester und mich, und da kommen sie nicht oft hin, sie leben mit dem ältesten Sohn in Paris. Aber von Paris hast du wohl noch nie gehört, wo du nicht mal Franqueville kennst.«
»Paris, wo der König ist?«
»Richtig.«
»Und Eure Eltern wohnen beim König?«
»Ja, sie dienen in seinem Haus.«
»Sie sind Dienstboten des Königs?«
»Sie sind Würdenträger; aber davon verstehst du nichts, und es muss dich auch nicht kümmern. Erzähl von deinem Schaf. Gehorcht es dir, wenn du rufst?«
»Nicht, wenn es hungrig ist wie heute.«
»Wenn ich’s dir also zurückbringen will, gehorcht es mir nicht?«
»Gut möglich. Ich warte lieber, wenn Ihr’s ein wenig bei Euch daheim duldet.«
»Bei mir daheim? Ich habe kein Daheim, Kleine, und werde nie eins haben. Ich bin mit der Vorstellung erzogen, dass mir nichts gehören darf, und du, du hast ein Schaf, du bist also reicher als ich.«
»Und macht es Euch Kummer, dass Ihr nichts habt?«
»Nein, überhaupt nicht; ich bin froh, dass ich mich nicht abplagen muss mit vergänglichen Gütern.«
»Vergänglich? Ach ja! mein Schaf kann zugrunde gehen!«
»Und solange es lebt, bereitet es dir Sorgen?«
»Gewiss, aber ich liebe es, und mir ist nicht leid um meine Arbeit. Ihr liebt also gar nichts?«
»Ich liebe alles.«
»Aber Schafe nicht?«
»Ich liebe sie nicht und hasse sie nicht.«
»Sie sind aber ganz sanftmütige Tiere. Liebt Ihr Hunde?«
»Ich hatte einen, den liebte ich. Bloß, ich durfte ihn nicht mitnehmen in den Konvent.«
»Also habt Ihr Kummer, weil Ihr so allein seid, weg von daheim, unter Arrest bei Fremden?«
Er betrachtete mich verwundert, als hätte er niemals nachgedacht über das, was ich gesagt hatte, und dann antwortete er:
»Ich darf mich über nichts grämen. Mir ist immer gesagt worden: ›Schert Euch um nichts, bindet Euch an nichts, lernt, nichts ins Herz zu schließen. Das ist Eure Pflicht, und Glück werdet Ihr nur empfinden in der Pflichterfüllung.‹«
»Merkwürdig! Mein Großonkel sagt genau dasselbe; aber er sagt, meine Pflicht ist, dass ich für alles sorge, mich überall im Haus nützlich mache und Freude habe an jeder Arbeit. Wahrscheinlich sagt man das zu den Kindern der Armen, und etwas anderes zu den Kindern der Reichen.«
»Nein, das sagt man zu den Kindern, die in Konvente eintreten müssen. Es ist Zeit, ich muss jetzt in den Vespergottesdienst. Du rufst dein Schaf, wann du willst, und wenn du es morgen wieder herbringen möchtest …«
»Oh! ich würd mich nie unterstehn!«
»Du kannst es herbringen, ich rede mit dem Cellerar.«
»Er wird Eurem Wunsch folgen?«
»Er ist sehr gut, er wird’s mir nicht abschlagen.«
Der junge Mann ging, und ich sah ihn durch die Gärten schreiten, im Glockengeläut. Ich ließ Rosette noch ein Weilchen grasen, dann rief ich nach ihr und führte sie heim. Von diesem Tag an habe ich mich sehr genau erinnert an alles, was in meinem Leben geschehen ist. Ich redete zunächst nicht viel über mein Gespräch mit dem jungen Mönch. Mich beschäftigte vor allem der lockende Gedanke, er könnte mir vielleicht, von Zeit zu Zeit, eine Weideerlaubnis für Rosette erwirken. Ich hätte mich mit wenig begnügt. Ich war von Natur aus verschwiegen, mein Onkel hatte mir stets ein gutes Beispiel gegeben für Höflichkeit und Zurückhaltung.
Ich war keine große Geschichtenerzählerin, meine Cousins, üble Spötter, ermutigten mich nicht dazu; aber die Weideerlaubnis rumorte in meinem Kopf, und deshalb erzählte ich an jenem Abend beim Essen alles, was ich soeben erzählt habe, und ich machte es so genau, dass ich bei meinem Großonkel Aufmerksamkeit weckte.
»Oh! ja doch!«, sagte er, »der junge Monsieur, den sie Montagabend in den Konvent gebracht haben und den noch niemand gesehen hat, das ist der kleine Franqueville! ein Zweitgeborener aus großem Haus, so heißt das. — Ihr kennt doch Franqueville, Burschen? Ein schöner Herrensitz, ja!«
»Ich bin da mal hingekommen«, sagte der jüngere. »Das ist weit, weit bei Saint-Léonard im Limousin.«
»Pah! zwölf Meilen«, lachte Jacques, »so weit ist das nicht! Ich war da auch mal, da hat mir der Superior von Valcreux einen Brief zum Überbringen gegeben, und er hat mir die Klostereselin geliehen, damit ich Zeit spare. Sicher war’s eilig, denn gern leiht er sie nicht, die große Eselin!«
»Dummkopf!«, erwiderte mein Großonkel, »was du Eselin nennst, das ist ein Maultier.«
»Macht nichts, Großvater! Ich hab aber die Küche vom Schloss gesehen und mit dem Aufseher geredet, der heißt Monsieur Prémel. Ich hab auch den jungen Monsieur gesehen, und jetzt versteh ich, der Brief hat seine Aufnahme in den Konvent eingefädelt.«
»Die Sache war eingefädelt, seit er auf der Welt ist«, erwiderte Vater Jean. »Die haben nur zugewartet, bis er alt genug ist, und ich, wie ich hier sitze, ich hab meine Nichte selig gehabt, die Mutter von der Kleinen da, die war Kuhhirtin genau in dem Schloss. Ich kann euch sagen, was es auf sich hat mit der Familie. Das sind Leute, die haben für zweihunderttausend gute Écus Land unter der Sonne, und dazu ertragreiches Land. Nicht vernachlässigt und ausgeplündert wie das vom Kloster hier. Der Aufseher, der Verwalter, wie sie ihn nennen, ist ein erfahrener und sehr strenger Mann, aber so muss man sein, wenn man Verantwortung trägt für eine große Wirtschaft.«
Pierre bemerkte, wozu man denn so reich sei, wenn man zwei von drei Kindern abschiebe. Er tadelte aus Sicht der neuen Ideen, die allmählich vordrangen bis in unsere Hütten, jenen Weg, den manche Adligen ihren jüngeren Kindern immer noch aufzwangen.
Mein Onkel war ein Bauer von altem Schrot und Korn; er verteidigte das Erstgeburtsrecht und sagte, ohne dieses Recht würden große Besitztümer zerstückelt.
Sie zankten sich ein wenig. Pierre, der ein Hitzkopf war, redete laut mit seinem Großvater und sagte zuletzt:
»Was für ein Glück, dass die Armen nichts zum Aufteilen haben, denn meinen älteren Bruder, der hier sitzt und den ich sehr liebe, müsste ich dann wohl hassen, wenn ich wüsste, bei uns gibt es etwas, von dem ich nichts bekomme.«
»Ihr wisst nicht, was Ihr sagt«, entgegnete der Alte; »das sind doch nur Lumpenpackgedanken. Im Adel denkt man höher, man schaut nur auf den Erhalt der Größe, und für die Jüngeren ist es eine Ehrensache, sich zu opfern und die Besitztümer und Titel in der Familie zu erhalten.«
Ich fragte, was sich opfern bedeute.
»Du bist zu klein, um das zu verstehen«, antwortete Vater Jean.
Und er ging schlafen, leise sein Gebet vor sich hin brummelnd.
Während ich halblaut das Wort opfern wiederholte, weil es ganz neu für mich war, sagte Pierre, der gern den Erfahrenen spielte:
»Ich weiß, was Großvater damit sagen will. Auch wenn er die Mönche verteidigt, und auch wenn die Mönche Besitz haben und das Vergnügen, nichts zu tun, so weiß doch jeder, es gibt keine unglücklicheren Menschen.«
»Warum sind sie unglücklich?«
»Weil man sie verachtet«, erwiderte Jacques achselzuckend.
Und ging ebenfalls schlafen.
Ich blieb noch einen kleinen Augenblick, nachdem ich ganz leise das Abendessen weggeräumt hatte, um Vater Jean nicht zu wecken, der bereits schnarchte, und als Pierre das Feuer abdeckte, unsere einzige Lichtquelle im Raum, trat ich zu ihm, denn ich wollte noch ein wenig reden. Es ließ mir keine Ruhe, ich musste wissen, warum die Mönche verachtet wurden und unglücklich waren.
»Du siehst doch«, sagte er, »diese Männer haben weder Frauen noch Kinder. Man weiß nicht mal, ob sie Vater und Mutter haben, Brüder oder Schwestern. Sobald sie eingelocht sind, werden sie von ihrer Familie vergessen oder ihrem Schicksal überlassen. Sie verlieren sogar ihren Namen, es ist, als wären sie vom Mond gefallen. Sie werden alle fett und hässlich und dreckig in ihren weiten Gewändern, obwohl sie sich leicht sauber halten könnten. Und dann langweilen die sich beim Herunterleiern ihrer Gebete zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es ist gut, wenn man zu Gott betet, aber ich stell mir vor, so viel verlangt der gar nicht, und diese Mönche trampeln ihm auf dem Kopf rum mit ihren Glocken und ihrem Latein. Und schließlich, diese Leute sind zu nichts nutze. Man sollte sie nach Hause schicken und ihr Land denen geben, die es zu bearbeiten verstehen.«
Nicht zum ersten Mal hörte ich diese Überlegung, doch sie schien mir müßiges Gerede. Ich hatte Achtung vor dem Eigentum gelernt. Ich hielt es für unmöglich, irgendetwas zu verändern, und für zwecklos, sich danach zu sehnen.
»Du sagst dummes Zeug«, antwortete ich dem kleinen Pierre. »Man kann die Reichen nicht daran hindern, reich zu sein; aber was hältst du von diesem jungen Mönchslehrling, der mir erlaubt hat, dass ich Rosette auf der Klosterwiese grasen lasse? Glaubst du, man wird auf ihn hören?«
»Man wird nicht auf ihn hören«, sagte Pierre; »der ist ein Füllen, der kann noch keinen Pflug ziehen. Die Alten verstehen sich auf ihr Handwerk und werden dir dein Schäflein wegnehmen, wenn sie’s bei sich sehen, und der Novize bekommt eine Strafe aufgebrummt, weil er ungehorsam war.«
»Oh! dann geh ich nicht mehr hin. Ich will nicht, dass er bestraft wird, er ist so gut und so anständig!«
»Während der Morgenandacht kannst du hingehen. Um diese Zeit verlässt Pater Fructueux seine Kirche nie.«
»Nein, nein!«, rief ich, »ich will nicht lernen, wie man stiehlt!«
Beim Einschlafen war ich voller Sorgen. Ich dachte nicht so sehr an Rosette, als vielmehr an diesen gutherzigen Burschen, der dazu verurteilt war, unglücklich zu sein, verachtet, geopfert, wie mein Großonkel sich ausdrückte. In der Nacht kam ein schweres Gewitter mit Blitzen, die alles in rote Glut tauchten, und Donnergrollen, dass einem die Haare zu Berg standen. Wenigstens sagte das mein Großonkel am Morgen, denn er hatte als Einziger im Haus den Krach gehört: Die Jugend schläft so gut, selbst in einer schlecht verschlossenen Kate! Doch als ich den Holzladen öffnete, der als Fenster diente — den Gebrauch von Glas kannten wir nicht —, sah ich, die Erde war triefnass und das Wasser rieselte noch rund um den Fels in tausend kleinen Rinnsalen herab, die es in den Sand gegraben hatte. Ich rannte los, wollte sehen, ob der Wind nicht meinen Schafstall fortgerissen hatte. Er stand aufrecht, und ich war froh, denn Regen, das bedeutete Gras innerhalb weniger Tage.
Gegen Mittag kam die Sonne hervor, und ich machte mich mit Rosette auf den Weg zu einer gutgeschützten kleinen Stelle zwischen den großen Felsen, wo immer ein bisschen Grün zu finden war und wo die andern Schäfer nicht hingingen, der Abstieg war nämlich mühsam und nicht ganz ungefährlich. Ich war allein und setzte mich ans trübe, stark schäumende Wasser des Wildbachs. Ich saß schon eine Weile da, als ich meinen Namen rufen hörte, und bald darauf sah ich den jungen Mönch die Schlucht herabsteigen und auf mich zukommen. Er war blitzsauber in seinem neuen Gewand; er wirkte fröhlich, er sprang keck von Stein zu Stein. Mir schien er hübsch wie niemand sonst auf der Welt. — Und doch war er nicht schön, mein armer lieber Franqueville; aber seine Miene war so gütig, er hatte so helle Augen und ein so sanftes Gesicht, dass seine Erscheinung nie bei irgendwem Missfallen oder gar Widerwillen erregt hat.
Ich war sehr überrascht:
»Wie kommt es«, sagte ich, »dass Ihr mich gefunden habt, und wer hat Euch meinen Namen gesagt?«
»Das sage ich dir später«, antwortete er. »Jetzt lass uns essen, ich hab großen Hunger.«
Und er holte unter seinem Gewand ein Körbchen hervor, in dem eine Pastete und eine Flasche lagen, zwei Dinge, von denen ich niemals gekostet hatte, Fleisch und Wein! Ich ließ mich sehr bitten, bevor ich von dem Fleisch aß. Halb aus Zurückhaltung, halb aus Misstrauen spürte ich nur Ekel vor dieser neuen Nahrung, die ich trotz alledem gut fand; der Wein aber schmeckte abscheulich, und meine Grimasse brachte den neuen Freund sehr zum Lachen.
Während wir aßen, erzählte er Folgendes:
Man dürfe ihn nicht mehr Monsieur nennen oder de Franqueville; fortan sei er Bruder Émilien, denn Émilien war sein Taufname. Er hatte den Cellerar um die Weideerlaubnis für Rosette gebeten und diese, zu seiner großen Überraschung, nicht erhalten. Pater Fructueux hatte ihm allerhand Gründe angeführt, von denen er nichts begriff; als dieser jedoch seinen Ärger sah, hatte er ihm erlaubt, mir Essen zu bringen, wann immer es ihm beliebe, und das hatte Bruder Émilien sich nicht zweimal sagen lassen, sondern hatte seine Ration in einen Korb gepackt und war zu dem Haus hinaufgestiegen, das ich ihm am Vortag gezeigt hatte. Er hatte niemanden angetroffen, doch eine alte Frau, der er begegnete, die er mir beschrieb und in der ich die Mariotte erkannte, hatte ihm mehr oder weniger die Stelle erklärt, wo ich zu finden sein müsste, und ihm auch gesagt, ich hieße Nanette Surgeon. Er hatte sich nicht verlaufen und schien es gewöhnt, durch die Berge zu streifen. Im Grunde war er, wie ich später feststellen konnte, mehr Bauer als ein Monsieur. Er war in nichts unterrichtet worden, alles hatte er sich selbst beigebracht. Man hatte ihm nicht einmal erlaubt, mit den anderen Edelleuten auf die Jagd zu gehen, er war zum Wilderer geworden auf dem eigenen Land und erlegte geschickt Rebhühner und Hasen; weil ihm das aber verboten war, schenkte er sie den Bauern, die ihm Unterschlupfe verrieten und sein Geheimnis wahrten. Mit ihnen hatte er schwimmen gelernt, auf einem Pferd zu sitzen, auf Bäume zu klettern und sogar genau wie sie zu arbeiten, denn er war kräftig, trotz seiner eher schmächtigen Statur.
Natürlich wurde mir alles, was ich jetzt über ihn erzähle, um seinen Charakter und seine Lebenslage zu beschreiben, nicht an jenem Tag und an jenem Ort gesagt; ich hätte nicht ein Viertel davon verstanden, ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, was ich hier zusammenfasse.
Émilien de Franqueville war von Geburt intelligent und entschlossen. Um zu verhindern, dass er nach dem ersten Rang in der Familie strebte, hatte man sich bemüht, seine Seele und seinen Geist abzutöten. Sein Bruder war offenbar nicht so begabt wie er, doch er war der Älteste, und in der Familie Franqueville waren alle jüngeren Kinder Geistliche geworden. Das war Gesetz, dagegen hatte nie irgendwer verstoßen, und es wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Der Marquis, Émiliens Vater, fand das ganz richtig; es war eine Rangordnungsregel, und die stand über dem staatlichen Gesetz. Er sagte, das vereinfache Erbschaftsangelegenheiten, bei denen Staatsanwälte, sobald sie ihre Nase hineinsteckten und Prozesse anstrengten, immer Mittel und Wege fanden, einen Besitz zu zerschlagen. Ein für das Klosterleben mit Geld ausgestatteter Bursche konnte keine Ansprüche mehr erheben. Er hatte keine Nachkommenschaft, folglich hinterließ er keine Zankäpfel für die Zukunft. Mit einem Wort, alles war arrangiert, und der kleine Émilien wusste kaum die rechte Hand von der linken zu unterscheiden, da wurde ihm die Sache mitgeteilt, und die Familie duldete keine Widerrede.
Man kann sich denken, dass mitunter Auflehnung in ihm keimte. Sie wurde so schnell und so gut erstickt, dass er gegen viele Dinge bereits abgestumpft ins Leben trat und mit sechzehn so naiv war wie ein anderer mit acht. Als Hauslehrer hatte man ihm einen Schwachkopf vorgesetzt, dessen Verstand gerade so weit reichte, dass er begriff, er musste sich Mühe geben und aus seinem Schüler einen ebenso großen Schwachkopf machen. Weil er das nicht schaffte, denn Émilien besaß von Natur aus Geist und gesunden Menschenverstand, heuchelte er, ihn zu unterrichten und zu überwachen, überließ ihn aber völlig sich selbst. Und so konnte der Junge kaum lesen und schreiben, als er in den Konvent kam; doch er hatte viel nachgedacht und viel gegrübelt, nach eigenem Gutdünken, und hatte ganz allein eine Seele entwickelt.
Er hatte sein Herz Gott geschenkt, wie Menschen es gerne tun, die nur ihn als Freund haben und als Stütze; doch je mehr der Hauslehrer ihm Gott auf seine Weise erklären wollte, desto mehr verstand der Schüler ihn auf die seinige. Er muckte nicht gegen die Kirche. Er betrachtete sie bloß als etwas Diesseitiges, eine Sache, die man nicht allzu hoch stellen darf und die man tadeln und kritisieren kann, wenn sie nicht auf dem rechten Weg zum Himmel wandelt. Was er mir schon am ersten Tag gesagt hatte, das dachte er sein ganzes Leben lang. Die Kirche sollte ihm zufolge nichts anderes tun, als die Liebe zu Gott wecken, Leid lindern und dem Unglück abhelfen. Alles Übrige scherte ihn nicht, er zankte sich nicht, ließ die andern reden und handelte nach seinem Gewissen. Kurzum, nachdem er so lange vernachlässigt und auf sich selbst gestellt war, zugleich ausgeschlossen von allem, hatte er sich eine besondere Welt nach seinen Träumen erschaffen und Gefallen an eigenbrötlerischer Unabhängigkeit gefunden. Er leistete niemandem Widerstand und gab sogar in allem nach, aus Freundlichkeit oder aus Überdruss; doch er ließ sich nichts einreden und entzog sich rasch jedem Zwang, sobald keiner mehr von ihm Notiz nahm. Weil man ihm stets alles vorenthalten hatte, was allgemeinhin begehrt ist, verachtete er alles, was man ihm nicht gönnte.
III.
Nachdem wir gegessen hatten, hielt er ein Schläfchen auf dem Fels, den die Sonne wärmte. Beim Aufwachen fragte er, woran ich denn so dächte, während ich strickte und mein Schäflein bewachte.
»Meistens«, sagte ich, »denke ich an fünfzig Dinge, von denen ich hinterher nichts mehr weiß; aber heute habe ich nur daran gedacht, mich über Euch zu wundern. Ihr macht also, was Ihr wollt mit den Mönchen, wenn Ihr den Tag einfach so verbringt, wo Ihr wollt und wie’s Euch gefällt?«
»Ich weiß nicht, ob die Mönche mich dafür maßregeln«, antwortete er. »Ich glaube nicht, ich verschaffe ihnen ein hübsches Sümmchen, wenn ich mein Gelübde ablege, und sie haben keine Lust, mir ihre Gesellschaft zu verleiden, bevor sie mein Geld kriegen; das hab ich schon begriffen. Und was meine Ausbildung angeht, die liegt ihnen wohl nicht sehr am Herzen.«
»Und warum nicht?«
»Aus einem ganz einfachen Grund, sie wissen nicht viel mehr als ich selber, und wenn sie das wenige, das sie mir beibringen können, nicht in die Länge ziehen, wären sie allzu schnell am Ende.«
»Ihr verachtet sie also auch, Eure Mönche?«
»Ich verachte sie nicht, ich verachte niemand. Sie machen auf mich einen ganz sanftmütigen Eindruck, und ich werde ihnen nicht mehr Kummer bereiten als sie mir.«
»Also werdet Ihr hin und wieder zu mir herauskommen aufs Feld?«
»Ich wüsste nicht, was ich lieber täte, ich bring dir zu essen, so viel du willst.«
Ich wurde rot vor Ärger.
»Ich brauch Euer Essen nicht«, sagte ich: »ich hab alles Nötige zu Hause, und unsere Kastanien schmecken mir besser als Eure Pasteten.«
»Dann sagst du also, ich soll wiederkommen, weil du mich gern siehst.«
»Ja, darum; aber wenn Ihr glaubt …«
»Ich glaube einzig und allein, was du sagst: Du bist ein gutes kleines Mädchen, und außerdem erinnerst du mich an meine Schwester; ich sehe dich gern wieder.«
Von diesem Tag an sahen wir uns sehr oft. Er hatte ganz richtig eingeschätzt, wie die Mönche von Valcreux sich ihm gegenüber verhalten würden; sie ließen ihm alle Freiheit, über seine Zeit zu verfügen, wie es ihm beliebte, und verlangten nur, dass er bei einigen Gottesdiensten anwesend war, worein er sich fügte. Bald lernte er auch meine beiden Cousins kennen, und eines Tages brachte er uns zum Lachen, als er erzählte, der Prior habe ihn rufen lassen, um ihm zu sagen, nach reiflicher Überlegung gelange er wegen seines jugendlichen Alters zu der Entscheidung, ihn von der Frühmesse zu befreien.
»Könnt ihr’s glauben«, fügte Émilien hinzu, »ich habe mich in aller Schlichtheit bedankt und erklärt, ich sei daran gewöhnt, mit Tagesanbruch aufzustehen, und deshalb verdrieße es mich keineswegs, die Frühmessen aufzusuchen? Er blieb hartnäckig, und ich blieb auch hartnäckig, um ihm meinen Gehorsam zu beweisen. Das war eine hübsche Szene. Am Ende stieß mich Bruder Pamphile mit dem Ellbogen, und ich folgte ihm hinaus auf den Hof, wo er sagte: ›Mein Junge, wenn Ihr unbedingt in die Frühmesse wollt, dann geht Ihr allein, denn seit mehr als zehn Jahren ist dort keiner von uns gewesen, und der Pater Prior käme arg in Verlegenheit, wollte er uns dazu zwingen, denn er war’s, er hat uns aufgefordert, diese sinnlose Kasteiung abzuschaffen.‹ Ich habe ihn noch gefragt, warum zu dieser Messe geläutet wurde. Er gab zur Antwort, der Glöckner muss doch sein Brot verdienen, er ist ein armer Mann im Kirchsprengel und versteht sich auf nichts anderes.«
Jacques behauptete, es gebe einen besseren Grund.
»Die Mönche«, sagte er, »sind Heuchler; die Pfarrkinder sollen glauben, sie verrichten ihre Gebete, währenddessen liegen sie auf der faulen Haut in ihren dicken Federbetten.«
Jacques versäumte keine Gelegenheit, den Geistlichen eins auszuwischen, und er hatte auch keine Hemmungen, Émilien zu sagen, es sei falsch, sich diesem Regiment von Faulpelzen anzuschließen. Wenn mein Großonkel das hörte, hieß er ihn still sein, aber der kleine Bruder — so nannten wir Émilien — antwortete Vater Jean:
»Lasst ihn reden; über die Mönche soll man genauso urteilen dürfen wie über andere Menschen. Ich kenne sie, ich muss mit ihnen auskommen. Ich klage sie nicht an, aber ich halte es auch nicht für meine Pflicht, sie zu verteidigen. Wenn ihr Metier überflüssig erscheint, dann ist es ihre Schuld.«
Sobald wir in der Familie unter uns waren, redeten wir fast immer vom kleinen Bruder. Unser armseliges Leben kannte zu wenig Abwechslung, als dass die häufigen Besuche eines Neuen und die Stunden, die er zuweilen mit uns verbrachte, uns nicht vorkamen wie große Ereignisse. Klein Pierre liebte ihn von ganzem Herzen und verteidigte ihn gegen Jacques, der ihn geringschätzte. Darin war er sich halbwegs einig mit meinem Großonkel, der Émilien vorwarf, er zeige sich seines Standes nicht würdig, vergesse, dass er ein Franqueville sei, und schließlich, er sei nicht so fromm, wie es sich für einen zukünftigen Geistlichen gezieme.
»Er ist ein Flattergeist«, sagte er, »aus dem wird nie ein guter Adliger oder ein guter Mönch. Der ist nicht böse, der ist eher zu gut; der wirkt anständig, der denkt noch nicht an Mädchen, aber den kümmert diese Welt genauso wenig wie die andere, und doch, wenn man nicht fürs Schwert taugt, sollte man für den Altar taugen.«
»Wer sagt euch, dass er nicht fürs Schwert getaugt hätte?«, rief Pierre ganz erregt. »Er hat vor nichts Angst, und seine Schuld ist es nicht, wenn man ihn nicht zu einem guten Soldaten gemacht hat anstatt zu einem kleen Mönch.«
Ich hörte mir alle diese Urteile an, ohne recht zu wissen, wem ich glauben sollte. Zuerst hatte ich von einer großen Freundschaft mit dem kleinen Bruder geträumt; doch er schenkte mir nicht so viel Beachtung wie ich ihm. Stets gut, hilfsbereit, geneigt, seine Zeit aufs Geratewohl mit dem Erstbesten zu verbringen, dachte er an mich, nur wenn er mich sah. Ich hatte mir ausgemalt, ich könnte ihm seine kleine Schwester ersetzen und seinen Kummer lindern, doch es gab keinen Kummer mehr, den er mir hätte anvertrauen können. Er beschrieb allen und jedem seine Lage, ohne lang zu überlegen, und erzählte die Unglücksgeschichten seiner Kindheit, ohne dass es schien, er habe sie erlitten; das lag vielleicht an seinem ständigen Lächeln, denn das wurde noch breiter, wenn er traurige Dinge sagte, und verlieh ihm einen Ausdruck von gefühlloser Dummheit. Kurz gesagt, er war nicht das geopferte Kind, von dem ich mir was weiß ich für Vorstellungen gemacht hatte, und ich begann ihm wieder Rosette vorzuziehen, die mich brauchte, während er gar niemand brauchte.
So verging der Winter, ein strenger Winter im Jahr 88, und ebenso der Frühling 89. Man kümmerte sich nicht viel um Politik in Valcreux. Wir konnten nicht lesen, wir waren, wenigstens die meisten von uns, wenn nicht von Rechts wegen, so doch de facto, Leibeigene der Abtei und der Toten Hand unterworfen. Die Mönche drangsalierten uns nicht allzu sehr mit Fronarbeit, aber was den Zehnten anging, hatten sie kein Nachsehen, und da wir immer aufmuckten, redeten sie mit uns so wenig wie möglich. Wenn sie Neuigkeiten von draußen erfuhren, sagten sie uns nichts. Unsere Provinz war überaus friedlich, und Leute aus der Umgebung, die im Kloster zu tun hatten, verplauderten sich nicht mit uns. Ein Bauer zählte wenig in jener Zeit!
Die Revolution war also im Gange, und wir wussten von nichts. Dennoch verbreitete sich an einem Markttag die Nachricht vom Sturm auf die Bastille, und weil das einige Aufregung hervorrief im Kirchsprengel, wollte ich unbedingt wissen, was das wohl sein mochte: die Bastille!
Die Erklärungen meines Großonkels stellten mich nicht zufrieden, denn meine Cousins widersprachen ihnen ständig; manchmal auch in seiner Gegenwart, was ihn sehr kränkte. Also lauerte ich auf den kleinen Bruder, denn ihn wollte ich ausfragen, und als ich ihn endlich während seiner Herumstreifereien abfangen konnte, bat ich ihn, der mehr wissen musste als unsereins, mir zu sagen, warum sich die einen freuten und die andern sorgten über diese Bastille. In meiner Vorstellung war das eine Person, die man ergriffen und ins Gefängnis geworfen hatte.
»Das bedeutet«, antwortete er, »die Bastille war ein schreckliches Gefängnis, und die Bewohner von Paris haben es niedergerissen.«
Und er erklärte auf sehr revolutionäre Weise die Sache und das Ereignis. Als Antwort auf andere Fragen verriet er mir, dass die Mönche von Valcreux den Sieg der Pariser als sehr großes Unglück betrachteten. Sie sagten, alles sei verloren, und überlegten, sämtliche Löcher in der Klostermauer ausbessern zu lassen, damit sie geschützt wären gegen die Räuber.
Neue Fragen meinerseits. Émilien kam in Verlegenheit. Er wusste nicht viel mehr als ich.
Wir waren Ende Juli, und ich kannte den kleinen Bruder nun schon fast ein Jahr. Ich redete mit ihm so offen wie mit allen Leuten aus der Gegend, und ich war empört, dass er genauso wenig wusste wie unsereins.
»Merkwürdig«, sagte ich, »dass Ihr nicht besser unterrichtet seid! Ihr sagt, zu Hause habe man Euch nichts beigebracht; aber seit all der Zeit, die Ihr nun im Konvent lebt, um was zu lernen, hättet Ihr doch wenigstens das Lesen lernen müssen, und Jacques sagt, Ihr könnt es fast gar nicht.«
»Jacques kann es überhaupt nicht, also vermag er’s auch nicht zu beurteilen.«
»Er sagt, er habe aus der Stadt ein Papier mitgebracht, und Ihr habt es so schlecht gelesen, dass er nichts verstanden hat.«
»Vielleicht ist es seine Schuld; aber ich will nicht lügen. Ich lese sehr schlecht, und ich schreibe wie ein Schmierfink.«
»Könnt Ihr wenigstens rechnen?«
»O nein! Das lerne ich nie und nimmer. Was soll’s mir nützen? Ich darf niemals irgendwas besitzen!«
»Ihr könntet, wenn Ihr alt seid, Cellerar im Konvent werden, wenn Pater Fructueux stirbt.«
»Gott bewahre! Ich gebe gern, verweigern hasse ich.«
»Mein Großonkel sagt, wegen Eures hohen Adels könnt Ihr sogar Superior des Klosters werden.«
»Ach, ich hoffe, dazu bin ich niemals imstande.«
»Warum seid Ihr bloß so? Es ist eine Schande, dumm zu bleiben, wenn man ein Gelehrter werden kann. Ich, wenn ich könnte, ich würde alles lernen.«
»Alles! mehr nicht? Und warum möchtest du so gelehrt sein?«
»Kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich will; wenn ich was Geschriebenes sehe, ärgert es mich, dass ich nichts verstehe.«
»Soll ich dir das Lesen beibringen?«
»Wo Ihr’s doch selber nicht könnt?«
»Ein bisschen schon, und ich lerne es richtig, während ich dir Unterricht gebe.«
»Das sagt Ihr jetzt, aber morgen ist’s vergessen. Ihr seid so ein Wirrkopf!«
»Hoppla, heute schimpfst du aber tüchtig mit mir, kleine Nanon. Sind wir keine Freunde mehr?«
»Ja doch; aber ich frage mich oft, ob man mit so einem befreundet sein kann, der sich weder um sich selbst schert noch um die anderen.«
Er betrachtete mich mit seinem unbekümmerten Lächeln, wusste jedoch keine Antwort; und ich sah ihn hocherhobenen Hauptes davongehen, ohne dass er in die Hecken schaute, wie gewöhnlich, um Nester auszuspähen; vielleicht dachte er an das, was ich ihm gesagt hatte.
Zwei oder drei Tage später, ich war gerade mit anderen Kindern meines Alters auf der Weide, kamen die Mariotte und fünf, sechs andere Frauen ganz verschreckt angelaufen, um uns nach Hause zu holen.
»Was ist geschehen?«
»Schnell, schnell! Nehmt eure Tiere mit, beeilt euch, es ist allerhöchste Zeit.«
Wir bekamen Angst. Jeder versammelte seine kleine Herde, und geschwind trieb ich Rosette heimwärts, die unzufrieden war, denn so früh wollte sie nicht von der Wiese.
Ich fand meinen Großonkel in heller Sorge um mich. Er packte mich am Arm und schob mich mitsamt Rosette ins Haus, dann befahl er meinen Cousins, gut abzuschließen und alle Öffnungen zu verrammeln. Sie wirkten beunruhigt, sagten aber, so drohend sei die Gefahr auch wieder nicht.
»Die Gefahr ist nah«, erwiderte mein Onkel, als wir gut eingeschlossen waren. »Jetzt sind wir zu viert, da müssen wir uns drüber verständigen, was getan werden soll. Und ich rate Folgendes. Solange noch Tag ist, brauchen wir nichts zu unternehmen; alles liegt in Gottes Hand; aber nach Einbruch der Nacht suchen wir Zuflucht im Kloster, und jeder nimmt mit, was er hat, Mobiliar und Vorräte.«
»Und Ihr glaubt«, sagte Jacques, »die Mönche werden einfach den ganzen Kirchsprengel aufnehmen?«
»Das ist ihre Pflicht! Wir sind ihre Untertanen, wir schulden ihnen den Zehnten und Gehorsam, aber sie schulden uns Obdach und Schutz.«
Pierre, verängstigter als sein älterer Bruder, war diesmal einer Meinung mit dem Großvater. Das Kloster war befestigt; mit ein paar guten Burschen konnte man die schwachen Stellen verteidigen. Jacques beteuerte zwar, die ganze Mühe sei überflüssig, begann aber dennoch unsere armseligen Betten auseinanderzunehmen; ich sammelte meine Kochgerätschaften zusammen, vier Näpfe und zwei irdene Krüge.
Die Wäsche war kein großer Packen, die Kleider ebenso wenig.
»Hoffentlich«, sagte ich mir, »sind die Mönche einverstanden, auch Rosette aufzunehmen!«
Da ich nichts wusste und nichts zu fragen wagte, gehorchte ich unterdessen gedankenlos den Befehlen, die ich erhielt. Irgendwann begriff ich, die Räuber würden kommen, uns alle umbringen und alle Häuser niederbrennen. Da begann ich zu weinen, nicht so sehr aus Angst, mein Leben zu verlieren, ich hatte noch keine rechte Vorstellung vom Tod, als vielmehr aus Kummer, den Flammen unsere ärmliche Hütte zu überlassen, die mir so lieb und teuer war, als hätte sie uns gehört. Da war ich nicht viel einfältiger als Vater Jean und seine Enkelsöhne. Sie klagten über den Verlust ihrer elenden Habe und dachten nicht an die Gefahr für Leib und Leben.
Der Tag verstrich im Dunkel dieses verschlossenen Hauses, und wir aßen nicht zu Abend. Um unsere Rüben zu kochen, hätten wir Feuer anzünden müssen, und Vater Jean war dagegen, denn er meinte, der Rauch überm Dach würde uns verraten. Wenn die Räuber kamen, würden sie das Land für verlassen halten und die Häuser für leer. Sie würden nicht hierbleiben, sondern weiterziehen zum Kloster.
Sobald es Nacht war, beschlossen Jacques und er, hinabzusteigen in die Schlucht und ans Tor des Konvents zu klopfen; doch es war den ganzen Tag verschlossen gewesen und war es noch immer, niemand machte auf. Keiner ließ sich blicken, um wenigstens durchs Guckfenster zu verhandeln. Das Kloster wirkte wie ausgestorben.
»Seht Ihr«, sagte Jacques beim Heimkommen, »sie wollen niemand aufnehmen. Sie wissen, dass keiner sie mag. Sie haben vor ihren eigenen Pfarrkindern genauso viel Angst wie vor den Räubern.«
»Mir scheint«, sagte mein Onkel, »sie haben sich in den unterirdischen Gewölben versteckt und hören nichts.«
»Mich wundert«, sagte Pierre, »dass sich der kleine Bruder einfach mit ihnen zusammen versteckt hat. Er ist nicht ängstlich, und ich hätte gedacht, er kommt uns verteidigen oder holt uns zu sich ins Kloster.«
»Dein kleiner Bruder ist genauso eine Memme wie alle Übrigen«, sagte Jacques, ohne sich einzugestehen, dass er selbst ebenso viel Angst hatte wie jeder andere auch.
Nun kam mein Großonkel auf den Einfall, sich erkundigen zu gehen, ob man in der Umgebung etwas Neues erfahren und irgendwelche Vorkehrungen getroffen hatte gegen die allgemeine Gefahr. Er zog wieder los, mit Jacques, alle beide barfuß und im Dunkel des Gebüschs, als wären sie selbst Räuber und hätten Übles im Sinn.
Wir blieben allein zurück, Pierre und ich, mit der Ermahnung, uns vor die Tür zu setzen, die Ohren gespitzt und fluchtbereit, sollten wir ein verdächtiges Geräusch hören.
Es herrschte prachtvolles Wetter. Der Himmel war voll schöner Sterne, die Luft roch gut, und so aufmerksam wir auch lauschten, wir vernahmen nicht das leiseste Geräusch, ob Gutes oder Böses verheißend. In allen Häusern, die längs der Schlucht verstreut lagen, fast alle einsam und allein, hatte man es gemacht wie wir; man hatte die Türen verschlossen, die Feuer gelöscht und redete nur flüsternd miteinander. Es war erst neun Uhr, und alles still wie mitten in der Nacht. Doch niemand schlief in dieser Nacht, alle waren wie betäubt vor Angst, kaum wagte man zu atmen. Die Erinnerung an diese Panik ist in unsern Landstrichen erhalten geblieben als das Eindrücklichste während der Revolution. Man spricht noch immer vom Jahr der großen Angst.
Nichts rührte sich in den hohen Kastanien, die uns umhüllten mit ihrem Dunkel. Diese Ruhe draußen drang in unser Inneres, und halblaut begannen wir zu plappern. Wir dachten nicht an den Hunger, doch allmählich wurden wir müde. Pierre streckte sich auf den Boden, palaverte ein bisschen über die Sterne, erklärte mir, sie wären nicht an der gleichen Stelle um die gleiche Uhrzeit im Jahreslauf, und fiel endlich in tiefen Schlaf.
Ich nahm mir fest vor, ihn zu wecken. Ich war überzeugt, ich könnte ganz allein aufpassen, aber ich glaube nicht, dass ich länger als einen Atemzug durchhielt.
Geweckt wurde ich durch einen Fuß, der im Dunkel gegen mich stieß, und als ich die Augen aufschlug, sah ich etwas wie ein graues Gespenst, das sich über mich beugte. Für Angst hatte ich keine Zeit, die Stimme des Gespenstes beruhigte mich, es war der kleine Bruder.
»Was machst du denn hier, Nanon?«, sagte er; »warum schläfst du draußen, auf der nackten Erde? Fast wäre ich auf dich getreten.«