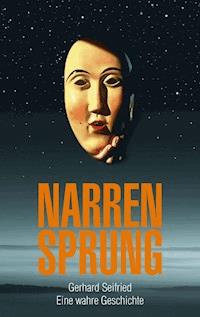
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fast schon unglaublich: NarrenSprung ist durch und durch eine wahre Geschichte. Die 260 Seiten sind prall gefüllt mit turbulenten, teils bizarren, aber immer authentischen Erlebnissen, die immer wieder auf überraschende Weise mit den wunderlichen Ritualen der schwäbisch-alemannischen Fasnet verwoben sind. Etwas ganz Neues in der Literatur: Am Ende des Buches läßt der Autor seine Leser nicht allein-es geht in der Realität weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint:
NarrenSprung Eine wahre Geschichte Gerhard Seifried
published by:
epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de copyright: © 2012 Gerhard Seifried
Der Adler kann nicht vom flachen Boden wegfliegen; er muß mühselig auf einen Fels oder Baumstrunk hüpfen: Von dort aber schwingt er sich zu den Sternen.
Hugo von Hofmannsthal
1
Schömberg, im April 1948. Die Frühlingsluft an diesem Spätnachmittag ist frisch und rein. Es beginnen gerade die wenigen Minuten, in denen der Tag ganz behutsam von der beginnenden Dämmerung umfangen wird und das Licht die Eigenschaft annimmt, um Ecken zu biegen, und selbst riesige Baumkronen bis in ihre kleinsten Verästelungen sichtbar werden.
Und es ist die Zeit, in der die Wunder geschehen. Dass Wunder etwas mit dem Himmel zu tun haben, das hatte mir, dem damals gerade neunjährigen Jungen, meine streng katholische Mutter längst beigebracht. Sicherlich, es gab auch die kleinen Wunder, die sich eher auf irdischer Ebene abspielten, zum Beispiel wenn wir in dem von unserer Familie bewohnten großen Bauernhaus wieder mal was verlegt hatten und meine Mutter ein kurzes, aber inbrünstiges Gebet an den heiligen Antonius richtete, worauf dieser verlässlich dafür sorgte, dass sich der gesuchte Gegenstand in Kürze wieder einfand. Das Kruzifix aber, das ich an diesem Spätnachmittag am hellblauen, mit wenigen Wolken durchsetzten Himmel erblickte, musste ein echtes Wunder sein, und natürlich konnte ich nicht wissen, was es für mich zu bedeuten hatte und dass von jetzt an nichts mehr so war, wie ich es kannte und so sehr liebte.
Es schien mir, dass es kein besonderes Kruzifix war, eher eines von der schlichten Sorte, mit metallenem Christuskörper, dicken Nägeln und wuchtiger Dornenkrone, so wie sie im streng katholischen Schömberg in jeder Bauernstube hingen und täglich großzügig mit „Gegrüßet seist du Maria“s bedacht wurden, bisweilen allerdings auch derb-bäuerliche Flüche vom Kaliber „Himmelherrgottsakrament“ über sich ergehen lassen mussten.
Es war also nicht das Kreuz an sich, das mich damals so sehr verwunderte und in eine seltsame Stimmung versetzte, es war das Kreuz an dieser ungewöhnlichen Stelle, hoch oben am Himmel, inmitten einer wie an der Schnur gezogenen dünnen Wolkenkette, die in der beginnenden Abenddämmerung purpurrot am westlichen Horizont stand.
„Wie schön, wie wunderschön“, dachte ich, und mein Herz schlug in großer Aufregung. Es war mir nicht möglich, den Blick auch nur eine Sekunde von dem leuchtendroten Himmelsbild zu lösen, und es schien mir, als würde der Gekreuzigte meinen Blick erwidern. Weil sich die Wolkenkette samt Kruzifix jetzt in Richtung Zimmern unter der Burg bewegte, rannte auch ich los, immer dem Kreuz nach und so schnell ich konnte. Alles vergebens, nach einigen hundert Metern hielt ich keuchend inne und musste zusehen, wie die Konturen des wunderlichen Bildes zerflossen und das Kruzifix innerhalb von Minuten wie beiläufig vom dunkler werdenden Abendhimmel aufgesogen wurde.
Ich stellte mir vor, wie alle Schömberger aufgeregt vor ihren Häusern stehen, um sich über die Erscheinung am Himmel auszulassen. Zu meinem Erstaunen konnte ich auf dem Heimweg aber nichts derlei feststellen. „Mal sehen, was die anderen dazu sagen“, dachte ich jetzt. Die anderen, das waren meine fünf besten Freunde. Alle wohnten dicht beieinander „Auf dem Flügel“, wie der Schömberger Ortsteil genannt wurde.
„Hast du das Kreuz gesehen?“, rief ich als erstem Alfons, dem Sohn des Bauern, der das Haus neben meinen Eltern bewohnte, schon von weitem zu. Dazu machte ich eine vielsagende Bewegung nach oben.
„Klar“, sagte Alfons, der zwar keine Ahnung hatte, um was es ging, dies aber wie immer nicht zugeben wollte.
„Sag schon, wo genau hast du das Kreuz gesehen?“ Alfons faselte etwas von einem französischen Militärflieger, der den Himmel über Schömberg aus Richtung Rottweil kommend überquert und durch seine breit abstehenden Flügel fast wie ein Kreuz ausgesehen habe. Also Fehlanzeige. Ich wollte jetzt schnell nach den anderen Freunden sehen, auf die hoffentlich mehr Verlass war. Aber weder Walter, der gerade vor seinem Elternhaus gegenüber der alten Sägerei an einem defekten Volksempfänger herumschraubte, noch Dieter und Bernhard, die sich am gusseisernen Dorfbrunnen langweilten, konnten mit einem Kruzifix am Himmel etwas anfangen - ja, die beiden Letzteren nahmen das, was ich gesehen hatte, sogar zum Anlass, mich zu hänseln und sich über Kruzifixe, die am Himmel rumschwirrten, lustig zu machen.
Mir war nicht zum Spaßen zumute. Ich stand immer noch unter dem Eindruck meines Erlebnisses, das mich gewaltig beschäftigte und das ich unbedingt mit jemandem teilen musste. Leider war von Gertrud weit und breit nichts zu sehen. Wahrscheinlich musste sie mal wieder ihrer Mutter beim Nähen zur Hand gehen. Deshalb machte ich mich auf den Weg zu meiner Mutter, die von Natur aus recht neugierig war, und allein schon deshalb Augen und Ohren stets offen hielt. Sie hörte aufmerksam zu.
„Hm, ein Kreuz am Himmel.“ Sie war sehr nachdenklich geworden und blickte mich lange an.
„Weißt du“, sagte sie schließlich und hielt meine Hände ganz fest, „viele Menschen tragen Bilder in sich, ohne es zu wissen, und manchmal kommen sie aus großer Tiefe hervor und man weiß nicht so recht, was sie bedeuten. Wenn so ein Bild dann plötzlich auftaucht, irgendwann, irgendwo, kann es keiner sehen außer demjenigen, dem es gehört.“
Meine Mutter war eine gottesfürchtige Frau. Sie kannte sich mit Bildern aus, ging jeden Tag in die Kirche, und wenn sie dann in tiefer Frömmigkeit ins Gebet versunken war, erschienen ihr oft Bilder, „die etwas zu sagen hatten“, wie sie es ausdrückte. Wer allerdings Genaueres wissen wollte, bekam ausweichende Antworten.
„Das geht nur den Herrgott und mich was an“, pflegte sie zu sagen, und das musste man halt so akzeptieren.
Die Geschichte mit dem Kreuz am Himmel beschäftigte sie noch einige Tage lang.
„Es sieht so aus, als hätte ich meinem Jüngsten in dieser Hinsicht etwas vererbt“, sinnierte sie, und je mehr sie darüber nachdachte, umso weniger konnte sie sich darüber freuen.
Ich selbst musste mich schließlich damit abfinden, der einzige zu sein, der das Kruzifix am Himmel gesehen hatte. Mit dem, was ich von der Mutter erfahren hatte, konnte ich nichts anfangen. Das Bild am Himmel war mir fremd gewesen, also konnte ich es nicht in mir getragen haben, schon gar nicht hätte ich es dort oben an den Himmel bringen können, schließlich war es ohne mein Zutun plötzlich aufgetaucht und genauso plötzlich wieder verschwunden. In dieser kurzen Zeit hatte es mich aber seltsam berührt, so sehr, dass ich das Kruzifix am Himmel in meinem ganzen Leben nie mehr vergessen konnte.
Als ich am nächsten Tag gegen 9 Uhr aufwachte, kurz nach dem Wetter blinzelte und danach flugs aus dem Bett sprang, war der ziehende Schmerz am Rücken wieder da, zwar nicht sehr stark, aber immerhin doch recht unangenehm. Es erschien mir ratsam, meiner Mutter nichts davon zu erzählen, denn schließlich waren mir meine drei Tage Stubenarrest wegen einer lumpigen kleinen Erkältung noch in denkbar schlechter Erinnerung. Meine Mutter nämlich, die „heilige Lioba“, wie Nachbarn gern spöttelten, weil ihre Eltern sie mit diesem schrecklich altmodischen Vornamen einer heiliggesprochenen Nonne gestraft hatten, nahm selbst kleinste Anzeichen einer Krankheit ernst. Man war entweder krank oder gesund. Ein bisschen krank gab es für sie nicht. Auch kleine körperliche Signale, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, eine heisere Stimme oder ein geschwollenes Fußgelenk, waren für sie „Hilferufe des Körpers, der uns etwas sagen will“. Egal was nun tatsächlich dahinter steckte - das festzustellen war natürlich Sache des Dorfarztes Fricker — eines war aus ihrer Sicht immer richtig: der betroffenen Person respektive ihrem Körper einige Tage Ruhe zu gönnen.
Um alles in der Welt: Ich legte wenig Wert darauf, gerade jetzt einige Tage Bettruhe einzulegen. Dafür war es draußen viel zu schön, mit einer so klaren Fernsicht, dass man an den beiden kahlen Steilhängen des drei Kilometer entfernten Plettenberges, dem 1005 Meter hohen Hausberg der Schömberger, mit bloßem Auge einzelne der kalkig-weißen Geröllbrocken erkennen konnte. Und — das war noch weit wichtiger — weil es gerade Osterferien gegeben hatte und man den lieben langen Tag zusammen mit den Freunden herumstrolchen und unendlich viel unternehmen konnte.
In der Wohnküche der Seifrieds saßen schon Rudi, mein 10 Jahre älterer Bruder, und Elfriede, die jüngere meiner beiden Schwestern. Es fehlte wie üblich Gisela, die ohne zwingenden Grund nie vor 10 Uhr aus dem Bett kroch.
„Einen recht schönen guten Morgen, die Herrschaften.“ Diese für Schömberger Ohren ziemlich albern klingende Begrüßungsformel von Onkel Christof, dem aus Wuppertal stammenden, etwas spinnerten Mann meiner geliebten Patentante Luise, war an diesen Tagen unter den Geschwistern gerade in Mode. Denn obwohl die beiden ihr Domizil seit vielen Jahren im schönen Uberlingen am Bodensee hatten, fanden sie sich zwei-bis dreimal im Jahr für ein paar Tage oder gar Wochen in Schömberg ein, was dann jedes Mal zur Folge hatte, dass es am Frühstückstisch und auch sonst wo im Haus der Familie Seifried mit ihren immerhin sechs Personen nicht nur etwas enger, sondern auch etwas vornehmer zuging.
„Morgen, alter Stromer“, sagte Rudi im gönnerhaften Ton des großen Bruders. Während er dabei von seinem „Schwarzwälder Bote“ erst gar nicht hochblickte, strahlte Elfriede mich an und zwinkerte zur Begrüßung kumpelhaft. Sie war seit Tagen gut drauf, weil sie sich mit ihren dreizehn Jahren mal wieder unsterblich verliebt hatte, diesmal in Willi Wuhrer, den Jüngsten aus der Sippe des Rössle-Wirtes.
„Willi“, so hatte Elfriede unter dem Siegel der Verschwiegenheit ihren wenig vertrauenswürdigen Freundinnen zugeflüstert, „Willi und ich werden heimlich in Frankreich heiraten, weil es den Franzosen nämlich egal ist, wie alt man ist, Hauptsache, du zahlst hundert Franken Traugeld.“
Ich wusste bestens Bescheid. Erst vorgestern hatte mir Wiltrud, die Tochter des Sägereibesitzers und Elfriedes beste Freundin, scheinheilig besorgt und bestimmt auch etwas neidisch alles brühwarm erzählt, wohl auch in der Hoffnung, ich würde es bei der erstbesten Gelegenheit meinen Eltern verraten und damit weitere Alleingänge von Elfriede stoppen.
Von wegen! Ich teilte mit Elfriede ein geräumiges Zimmer. Wir kamen bestens miteinander klar, und das sollte aus gutem Grund auch so bleiben, denn gelegentliche nächtliche Ausflüge, die über das kleine schräge Dach und die anschließende Hühnerleiter hinter dem Schlafzimmer ihren Anfang nahmen, fielen im gegenseitigen Interesse unter das gemeinsame Geheimhaltungsabkommen.
2
Für die Familie Seifried hatten sich die ersten Monate des laufenden Jahres 1948 gut angelassen. Von der Schömberger Sparkasse war die lang ersehnte Nachricht gekommen, dass Josef Seifrieds Beamtengehalt schon bald wieder überwiesen werde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte keiner gewusst, wovon man in der nächsten Zeit leben sollte und ob Josef Seifried überhaupt noch als Zollbeamter im Dienst war. Die Zeiten waren zwar immer noch recht lausig, es gab fast nichts zu kaufen, aber so schrecklich wie unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges, insbesondere im trostlosen Hungerjahr 1946, ging es nicht mehr zu. Als Nichtbauern hatten die Seifrieds in den zwei Jahren nach dem Krieg, in denen es ums pure Überleben ging, recht wenig zu lachen und noch weniger zu essen. Auch sie mussten sich mit Hamsterfahrten in die benachbarten Dörfer durchschlagen, und diverser Hausrat, aber auch einige der wenigen Schmuckstücke im Familienbesitz wechselten im Tausch gegen einen Sack Kartoffeln, einige Kilo Mehl oder ein paar Eier den Besitzer. Die Tauschbedingungen waren nicht immer fair, sie wurden diktiert von denen, die über das knappe Gut Lebensmittel verfügten. Am wenigsten kam meine Mutter mit dem Geschäftsgebaren einiger Bauern klar.
„Ich weiß ja“, sagte sie, „Geschäft ist Geschäft, aber Mensch ist Mensch“, und schüttelte dazu den Kopf.
Dass Josef Seifried ein geschickter Hufschmied war, wusste in Schömberg praktisch jeder. Als Vollwaise aufgewachsen, steckte ihn sein damaliger Vormund nach der Volksschule ohne viel Aufhebens zu einem Schmied in der Nähe von Karlsruhe in die Lehre. In jungen Jahren hatte Josef diesen Beruf so lange ausgeübt, bis der Erste Weltkrieg begann und er sich als Freiwilliger zum Kriegsdienst meldete.
Leider gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Schömberg nur noch drei Pferde, alle anderen hatte die Deutsche Wehrmacht zwischen 1939 und 1943 als kriegswichtig eingezogen. Das war natürlich Pech für meinen Vater, der mit seinem erlernten Handwerksberuf in dieser schwierigen Zeit bei den Bauern kaum etwas dazuverdienen konnte.
Eine Chance, an Lebensmittel zu kommen, bot sich unserer Familie durch Tagelöhnerarbeit bei einzelnen Bauern. Vor allem in der Erntezeit waren Arbeitskräfte knapp, und als kräftiger junger Mann Jahrgang 1929 musste mein älterer Bruder Rudi nicht lange fragen — er war in Schömberg durchweg beliebt, und jeder wusste, dass er zulangen konnte. Was er heimbrachte, konnte sich denn auch in aller Regel sehen lassen, da ließen sich die Schömberger nicht lumpen.
Bei allem Organisationstalent, das die Beamtenfamilie Seifried in dieser Krisenzeit an den Tag legte, wäre sie trotzdem kaum über die Runden gekommen, wenn ihr nicht zuweilen nette Nachbarn ein paar Eier, einen Liter frische Kuh- oder Geißenmilch oder gar ein Stück geräucherten Speck zugesteckt hätten. Das alte Bauernhaus an der B 27, das sie in Miete bewohnten, war zwar riesig, außer einem winzigen Kräutergärtchen an der Stirnseite des Hauses bot es jedoch keine weiteren Möglichkeiten, irgendetwas Essbares anzubauen.
Geld befand sich in der Nachkriegszeit ausreichend unter den Leuten — Hitler hatte schließlich eine Menge davon drucken lassen - leider war die alte Reichsmark aber nichts wert. Kein Bauer ließ sich dazu überreden, dafür auch nur ein paar Kartoffeln rauszurücken - es sei denn, diese waren genauso wenig wert, weil sie getrieben oder infolge der Kälte eine blaugrüne Farbe angenommen hatten und somit kaum genießbar waren. Dass man mit der alten Reichsmark so wenig anfangen konnte, empfand man in meiner Familie als doppelt schade, denn davon gab es im Haus überreichlich. Das hatte nichts mit dem Salär des Josef Seifried zu tun, das für einen Beamten im Rang eines Zollsekretärs recht bescheiden war. Nein, den Reichsmark-Segen im Hause hatten wir Onkel Christof zu verdanken. Er sammelte die gute alte Reichsmark, nicht nur die kleinen Scheine, nein, er berauschte sich auch an den großen Banknoten, die schon gegen Kriegsende und natürlich noch mehr danach günstig zu haben waren. Eine Million, zwei Millionen? Die Geldsumme, die er gegen Wertgegenstände eintauschte, konnte sich sehen lassen, und garantiert war er auf dem Papier längst ein stinkreicher Mann. Er versteckte das Geld überall, auch bei uns auf dem weitläufigen Speicher unseres Bauernhauses, und wenn man ihn fragte, was er denn damit vorhabe, dann schmunzelte er geheimnisvoll und sagte, er habe so seine Pläne. Der kleine Mann mit Nickelbrille und blauem Siegelring am rechten Mittelfinger galt als intelligent, allerdings mit kauzigem Einschlag. Man ließ ihn gewähren.
Nicht nur als Sammler von Reichsmarknoten, auch als Tüftler und Erfinder wurde Onkel Christof auffällig. Diverse seiner Erfindungen waren sicherlich ihrer Zeit voraus oder erfuhren einfach nicht die ihnen gebührende Wertschätzung. Volle Anerkennung zollte mein Vater, ein starker Pfeifenraucher, seinerzeit allerdings der technisch perfekten, halbautomatischen Tabakblätterschneidemaschine, die Onkel Christof anlässlich eines Besuches im Sommer 1947 als fix und fertigen Prototyp mitbrachte. Nicht nur die Technik der Maschine, auch die kaufmännische Idee, die dahintersteckte, war überzeugend: Mangels anderer Beschaffungsmöglichkeiten hatten sich in der Nachkriegszeit Millionen deutscher Pfeifenraucher in ihrem Schrebergarten oder notfalls auf dem Balkon eine Mini-Tabakplantage eingerichtet. Jeder davon — allein in Schömberg waren es mehrere hundert — kam deshalb als Käufer für die Christof’sche Wundermaschine in Frage. Leider erwiesen sich derlei Spekulationen wieder einmal als blanke Theorie.
Eine Umfrage im Testmarkt Schömberg brachte es denn auch zweifelsfrei an den Tag: Die Tabakblätterschneidemaschine von Onkel Christof war viel zu teuer. Pfeifenraucher in Schömberg schärften lieber das große Küchenmesser und schnippelten sich ihre Mixtur von Hand zurecht — „alles Banausen“, wie Onkel Christof knurrte. So ging der Prototyp dieser Monsterschneidemaschine mangels zahlungskräftiger Nachfrage zwar nie in Serie, kam aber immerhin im Hause Seifried zu Ehren und erfreute sich dort bei meinem Vater großer Beliebtheit.
Es gäbe noch viel zu erzählen über Onkel Christofs Emsigkeit im Austüfteln bahnbrechender Erfindungen, unter anderem seine im Anschluss an einen stürmischen Wirtshausabend gemachte Erfindung einer seitenwindunempfindlichen Kopfbedeckung. Besondere Erwähnung verdient aber auf jeden Fall seine genial einfache, überaus menschenfreundliche Erfindung eines sogenannten Blähungsverhinderers. Mit einem kleinen Trichterröhrchen wollte er die Millionen Menschen, die an lästigen Darmblähungen litten, von ihrer Pein befreien. Dieses Röhrchen, gefertigt aus hautverträglichem Material, Länge 7 Zentimeter, konnte bei Bedarf unauffällig und vor allem unsichtbar am Darmausgang eingeführt werden und sorgte fortan für einen kontinuierlichen, absolut geräusch-, wenn auch nicht geruchlosen Abgang der überflüssigen Darmwinde.
Obwohl auch diese vielversprechende Erfindung leider kein Verkaufsschlager wurde („Kein Wunder,“ schimpfte Onkel Christof, „die Bauern hier furzen gern und laut“), unterstützte Tante Luise ihren Mann treu und brav bei all seinen Bemühungen, mit guten Ideen die schnelle Mark zu machen. Weil es damals ja noch minderwertige Reichsmark waren, wurde die sehr mangelhafte wirtschaftliche Verwertbarkeit des Erfindungsgeistes von Onkel Christof nicht so sehr tragisch genommen. „Er greift manchmal nach den Sternen“, pflegte Tante Luise zu ihrer Schwester Lioba zu sagen und lächelte milde dazu.
„Und manchmal greift er halt auch in Kuhscheiße“, nörgelte mein Vater, der immer mit halbem Ohr zuhörte. Es behagte ihm überhaupt nicht, dass er in Schömberg dank der Verkaufsaktivitäten seines Schwagers Christof monatelang bei allen möglichen und teilweise recht unpassenden Gelegenheiten scheinheilig auf seine persönlichen Erfahrungen mit dem „Blähungsverhinderungsrohr“ angesprochen wurde, für dessen Erprobung er sich in Verbindung mit einer garantierten fünfzehnprozentigen Erfolgsbeteiligung eine Woche als Testperson zur Verfügung gestellt hatte. Er musste auf seinen Ruf achten, schließlich war er hier in Schömberg einer der wenigen Beamten, somit eine Amtsperson, die man wegen der wahrzunehmenden hoheitlichen Aufgaben bei der Überprüfung aller Schnapsbrenner der Region in Bezug auf ihre Steuerehrlichkeit respektvoll den „Steuerwächter“ nannte.
So nach und nach zehrte die Serie von Onkel Christofs wirtschaftlich nicht ganz zufriedenstellenden Unternehmungen und Erfindungen nicht nur etwas an seiner ausgeglichenen, stets Optimismus ausstrahlenden Persönlichkeit, sondern — und das beunruhigte jetzt auch seine Gemahlin Luise — auch an seinem bescheidenen ererbten Wohlstand. Als kluger Kopf behielt er jedoch den Überblick und analysierte zunächst einmal die Situation.
„Siehst du, Josef“, erläuterte er seinem Schwager, der ihn insgeheim ob seiner Scharfsinnigkeit bewunderte, „bei den Leuten zählt halt nicht die Leistung, die man erbringt, sondern nur der Erfolg, den man erzielt.“
Er philosophierte noch eine Weile über diese Erkenntnis und leitete daraus kluge Folgerungen ab. Bei dieser Gelegenheit zog er auch etwas wehleidig Parallelen zu Leonardo da Vinci, dem wohl berühmtesten Erfinder und Universalgenie des Mittelalters, der bereits um 1500 herum heute so allgegenwärtige Vehikel wie Fahrrad, Auto und Flugmaschine ziemlich präzise angedacht und sogar konstruiert hatte, aber ebenfalls, wie Onkel Christof bei seinen Zeitgenossen, auf wenig Anerkennung oder gar auf totales Unverständnis gestoßen war.
Jedenfalls wollte er, Onkel Christof, von jetzt an ohne Umwege den direkten Erfolg suchen und somit auch automatisch die Anerkennung der Leute gewinnen. Erfindungen zu machen und auszuwerten erschien ihm jetzt plötzlich als Irrweg und reine Zeitvergeudung.
„Josef“, fragte er mit gedämpfter Stimme, „kann ich dir vertrauen?“
Sie waren allein, beide rauchten Pfeife und hatten einen Selbstgebrannten vor sich.
„Habe ich dich schon einmal enttäuscht?“
„Unsinn, aber weißt du, diesmal geht es um eine ganz große Sache, da kann verdammt viel für uns beide rausspringen...“
Er hob sein Glas und lächelte unwiderstehlich.
„Prost, alter Freund, auf ein gutes Geschäft!“
Josef kannte seinen Schwager. Nach der letzten Pleite mit dem Blährohr hatte er sich geschworen, Christofs Ideen ab sofort mit großer Vorsicht zu begegnen. Aber natürlich war er auch neugierig.
„Na ja“, sagte er bedächtig, „ein gutes Geschäft können wir alle gebrauchen. Kannst du mir mal genauer sagen, um was es geht?“
Jetzt war Christof in seinem Element.
„Die Sache ist absolut vertraulich“, sagte er. Seine Stimme war leise geworden und bekam einen verkäuferischen Unterton. „Ich habe da von höchster politischen Stelle Informationen erhalten. Das wird eine absolute Rakete. Bist du interessiert, ja oder nein?“
Es entstand eine längere Pause, in der Christof seinen Schwager fixierte. Schließlich nickte dieser wortlos mit dem Kopf.
„Dachte ich mir“, sagte Christof. „Ich wusste doch, du bist schlau genug, dir so eine Sache nicht entgehen zu lassen. Und du bist Gott sei Dank auch jemand, dem man vertrauen kann.“
Nachdem beide sich noch einige Male auf die Schultern geklopft hatten und die Schnapsflasche schon fast leer war, rückte Christof mit seinem Plan heraus. Er habe von einem verlässlichen Freund, der früher bei der Bank Deutscher Länder beschäftigt war und angeblich immer noch allerbeste Beziehungen zu Geldkreisen auch auf höchster politischen Ebene habe, ein hochbrisantes und topgeheimes Detail zu der noch im laufenden Jahr 1948 anstehenden Umstellung von Reichsmark auf die neue „Deutsche Mark“, abgekürzt D-Mark, erfahren. Onkel Christof zierte sich noch ein wenig, dann ließ er seine „Rakete“ steigen:
„Das Umtauschverhältnis Reichsmark zu D-Mark wird eins zu eins sein. Was sagst du nun?“
Josef war sprachlos, und Christof kam immer mehr in Fahrt. „Erfindungen sind Kokolores“, rief er, „diese Information wird uns reich machen.“ Und er musste Josef jetzt nicht mehr erzählen, wieso er seit gut einem Jahr alle Reichsmarkscheine, derer er habhaft werden konnte, in seinen Besitz gebracht hatte.
„Also Christof, wenn das stimmt.“, Josef war beeindruckt, insbesondere als ihm sein Schwager noch die Kopie einer dick mit „Streng vertraulich“ abgestempelten Gesprächsnotiz zeigte. Die Formulierung „Ersetzung der Reichsmark durch die D-Mark im Verhältnis eins zu eins“ war dort schwarz auf weiß zu lesen.
Christof erwies sich mal wieder als echter Freund, der auch anderen was gönnte. Dank seines Informationsvor-sprungs hatte er natürlich wesentlich mehr Reichsmark gehortet als sein Schwager, obwohl auch Josef von jetzt an die verbleibenden Monate gut nutzte, um seinen Bestand aufzubessern. Trotzdem versprach Christof ihm, den satten Gewinn nach dem Umtauschtag großzügig zu teilen, schließlich, so sagte er gönnerhaft, würde das auch für zwei reichen.
Die Währungsreform machte Fortschritte, und erst wenige Tage vor dem eigentlichen Umtausch sickerte auch bei weniger gut informierten Kreisen durch: Der Umtausch Reichsmark zu D-Mark wird im Verhältnis eins zu eins erfolgen.
Christof und Josef prosteten sich von dem Moment an nur noch zu und sortierten ihre riesigen Geldbündel. Dann kam die Einschränkung, die mächtig weh tat. Sie lautete wörtlich, und das war jetzt amtlich: „Am Währungsstichtag erhält jede natürliche Person vierzig D-Mark gegen Reichsmark im Verhältnis eins zu eins.“
Christof verfiel drei Tage in tiefe Depression. Er war mal wieder ganz nah dran gewesen, und schließlich hatte sich seine Information ja durchaus als wahr erwiesen. Eine Verschwörung.
Josef tauchte ein paar Tage unter, er war einfach nicht mehr da. Später sickerte durch, er sei bei einem der von ihm kontrollierten Schnapsbrenner in Deilingenge-strandet.
Die beiden Damen des Hauses hatten natürlich alles haarklein mitbekommen. Sie sahen das Ganze noch am gelassensten.
„Stell dir vor, Luise, die beiden hätten wirklich soviel Geld kassiert. Ob das gut gegangen wäre?“
Und klammheimlich kicherten sie sogar und machten sich über ihre Finanzgenies lustig.
3
April 1948, Osterferien. „Gehen wir zum Stausee, dort finden wir heute jede Menge Versteinerungen“, schlug ich meinen Kumpanen vor. Ein paar Tage zuvor waren heftige Regenschauer niedergegangen, es hatte dazu gestürmt, und bei solchem Wetter, das wusste jeder von uns, schwemmte das bewegte Wasser am linken Steilufer des Schömberger Stausees massenweise die für Schiefergesteine typischen dunklen Versteinerungen frei. Einige der Ammoniten hatten metallene Oberflächen und glänzten wie Gold. Ich erntete keine Begeisterungsstürme, heute war Faulsein angesagt. Wir lungerten alle im „Bunker“ herum und ließen uns die nach einem strammen Winter lang vermisste Frühlingssonne auf den Bauch scheinen. Alle, das waren neben mir noch Bernhard, der Stärkste und Älteste, Walter, der immer gern das letzte Wort hatte, dazu Dieter und Alfons und die blonde Gertrud, das Flüchtlingsmädchen, das seit letztem Sommer dazugehörte.
Gertrud war hübsch, mit gelbblonden Haaren, die schon von weitem leuchteten wie ein Weizenfeld im Sommer. Ich war insgeheim ein bisschen verliebt in sie. Selbst ihre Bewegungen waren irgendwie anders als bei den beileibe nicht hässlichen Schömberger Mädchen. Wenn man Gertrud anblickte, dann sah man zuallererst ihre großen blauen Augen. Sie zählte mit ihrer Mutter zu den sogenannten Einquartierungen, die 1945 und vor allem 1946, gleich nach dem Krieg, über Monate hinweg die Schömberger ganz schön auf Trab hielten. Einquartiert wurden ganze Familien, aber auch Einzelpersonen, die der Vormarsch der Roten Armee aus den deutschen Ostgebieten, vor allem aus Ostpreußen, vertrieben hatte. Für die Schömberger waren es eben „Flüchtlinge“, und dieses Wort hatte damals keinen guten Klang und bedeutete so etwas wie ein notwendiges Übel. Hinter vorgehaltener Hand sprachen die Leute schon auch mal von „Polacken“, die einem der verlorene Krieg beschert hatte, und das war natürlich gar nicht nett, denn diese Menschen — man sah es ihnen an -hatten eine schlimme Zeit hinter sich, und selbst die Kinder der Flüchtlinge hatten in den wenigen Monaten ihrer Vertreibung und Flucht zweifellos mehr mit ansehen und durchmachen müssen, als dies normalerweise einem Bewohner von Schömberg in seinem ganzen Leben passieren konnte.
Der Unmut in Schömberg rührte auch daher, dass bei Einquartierungen keinesfalls darauf gewartet wurde, ob sich etwa Besitzer von Häusern freiwillig meldeten, um Platz zur Verfügung zu stellen, nein, die Flüchtlinge wurden mir nichts dir nichts zwangseinquartiert, das heißt, das Gemeindeamt legte nach kaum nachvollziehbaren Regeln fest, wer in seinem Haus enger zusammenzurücken hatte für einen oder mehrere „Ostpreußen“. Es war eine vorübergehende Notmaßnahme, wie es hieß, ein sogenanntes Provisorium, und manche Schömberger mussten erfahren, wie lange so ein Provisorium tatsächlich dauern kann.
Gertrud gehörte zu den Flüchtlingen, denen es besonders schwerfiel, sich in Schömberg zurechtzufinden. Sie redete anfangs kaum und bewegte sich auch in der Schule so unauffällig, dass man sie fast gar nicht wahrnahm. „Ach ja, dat Kind hat nejanze Menge mitje-macht“, pflegte Gertruds Mutter zu sagen und zog ihr Töchterchen an sich.
Einige der Flüchtlinge verschwanden schon bald wieder, andere blieben länger, und ganz wenige wurden in Schömberg sesshaft und erlangten mit der Zeit Anerkennung. Es wurde ihnen dafür mehr Fleiß, Leistung und Standvermögen abverlangt, als dies bei den Einheimischen üblich war. Die fremde Sprache verlor sich allerdings nie ganz, und genau genommen blieb ein Flüchtling in Schömberg immer ein Flüchtling.
Gertrud und ihre Mutter blieben da. Die Mutter war fleißig, sie konnte gut nähen und fand eine Dauerbeschäftigung beim „Rager“, in der Trikotagenfabrik. Gertrud taute so nach und nach etwas auf, insbesondere nachdem sie mit ihrer Mutter Anfang 1948 eine eigene kleine Etagenwohnung auf dem Flügel bezogen hatte. Ein typisches Schömberger Mädchen wollte sie aber offensichtlich nicht sein, vielleicht fand sie auch nur nicht die passenden Freundinnen. Irgendwann im Sommer 1947 jedenfalls begann sie, ihr Interesse für die in etwa gleichaltrigen Jungen von der Flügelbande zu zeigen, vielleicht deshalb, weil sie deren raue Spiele und Drang nach Abenteuern mehr schätzte als Puppenspielen und Häkeln.
Zunächst wurde Gertrud ganz einfach ignoriert, wenn sie anscheinend gelangweilt und immer etwas unbeteiligt da auftauchte, wo sich auch die Flügelbande gerade aufhielt. Irgendwann hatten es die Jungen aber satt. Sie fürchteten, Gertrud könnte zum Beispiel herausfinden, dass sie sich sehr häufig in ihrem Bunker auf der Sägerei aufhielten - was verboten war -, dass sie sich sogar manchmal nachts trafen und heimlich rauchten und einiges mehr unternahmen, was nur sie etwas anging. „Man könnte sie einfangen und im Bunker martern,“ regte Walter an. Obwohl das natürlich eine verlockende Aussicht war, trauten sich die Jungen das ganz einfach nicht, weil Gertruds flotte Mutter inzwischen mit dem Xaver Faulhaber liiert war, der als recht jähzornig galt, und man schließlich nicht wissen konnte, wie er darauf reagierte, wenn das Töchterchen seiner Freundin zerzaust und heulend daheim auftauchen und Schauergeschichten erzählen würde.
Gertrud war zäh, und deshalb erreichte sie irgendwann, was sie wollte. Vielleicht hing es ja auch mit ihrem MIR zusammen. So nannte Gertrud den sehr schönen, etwa 4 Zentimeter breiten, flach geformten Rosenquarz-Halbedelstein, den sie immer, nahezu unsichtbar in die linke Hand geschmiegt, bei sich trug.
Wenn man sie nach dem MIR fragte, antwortete sie etwas einsilbig, dies sei ein ganz besonderer, schon viele Millionen Jahre alter Stein, den sie von ihrem im Russlandfeldzug vermissten Vater erhalten habe. Er würde ihr bei allem helfen, was auch immer passiere, und außerdem besitze ihr Vater den gleichen Stein, so dass sie auf diese Weise immer mit ihm verbunden sei. Wahrscheinlich hatte der MIR auch dafür gesorgt, dass Bernhard ihr an einem Nachmittag so ganz nebenbei erzählte, dass Mitglied der Flügelbande nur werden könne, wer in aufrechter Position in der Lage sei, mindestens zwei Meter weit zu pinkeln. Jedes andere Schömberger Mädchen hätte sich in dieser Situation kichernd aus dem Staub gemacht, nicht Gertrud.
„Mal sehen“, sagte sie kurz und trottete Bernhard hinterher.
Wir anderen hatten gegen diese Aufnahmeprüfung nichts einzuwenden, es wurde sofort ein geeigneter Platz auf der Sägerei ausgesucht. Gertrud pinkelte. Sie stellte sich dabei auf einen Bretterstapel, schob das Becken vor, drückte dann mit dem linken Zeigefinger (Gertrud war Linkshänderin) auf einen bestimmten Punkt zwischen den Beinen und - ssst - ein dünner Strahl schoss durch die Luft. Walter maß sofort nach - heilige Mutter Gottes, sie hatte trotz anatomischer Benachteiligung die zwei Meter geschafft. Na gut, das mit dem Bretterstapel war etwas geschummelt, aber alle waren sehr beeindruckt von der Vorstellung. Gertrud gehörte ab sofort dazu. Schließlich hatte eine weibliche Spielgefährtin im bigotten Schömberg auch Vorteile, man konnte sich mit einem gelegentlichen Blick unter Gertruds großen geblümten Rock von der weiblichen Anatomie einen Eindruck verschaffen, und in dieser Hinsicht zeigte sich das neue Bandenmitglied auch durchaus großzügig.
Der Bunker auf der alten Sägerei war der Ort, an dem sich die Flügelbande fast jeden Tag einmal traf. Man fühlte sich dort unbeobachtet und sicher und einfach gut. Mehr durch Zufall, bei einem unserer Streifzüge über das ausgedehnte Gelände der Sägerei, hatten wir den Bunker entdeckt. Natürlich war es kein echter Bunker aus Beton, denn auf der Sägerei - wie hätte das auch anders sein können - gab es nur Holz, dies aber in riesigen Mengen, das meiste davon als breite, 5 bis 10 Zentimeter dicke Holzscheiben, bis zu 3 Meter hoch gestapelt. Am äußersten Ende des Sägereigeländes, da, wo es sehr eng zuging und Holzstapel neben Holzstapel zum Austrocknen gelagert waren, hatten die Arbeiter wahrscheinlich aus Versehen vier der Stapel jeweils so im rechten Winkel zueinander gestellt, dass sich ein viereckiger Turm ergab mit fast 3 Meter hohen und etwa 70 Zentimeter dicken Holzmauern und einem recht geräumigen Innenraum von etwa 4 mal 4 Metern. Für uns war es „der Bunker“. Wir hatten sofort erkannt, was man alles damit anfangen konnte, und machten den Bunker „bewohnbar“, mit einem Ausguck ganz oben und versteckt angebrachten Bretterstufen, die bei Gefahr von innen eingezogen werden konnten. Der Innenraum ließ sich sogar mit einer alten Wagenplane, die Alfons bei seinem Vater „ausgeliehen“ hatte, wetterfest machen, kurzum, der Bunker war ein fantastischer Unterschlupf, nahezu unangreifbar, und - das Allerwichtigste - außer der Flügelbande wusste niemand von seiner Existenz.
Es war fast schon ein Ritual: Irgendwann begann Alfons die Literflasche mit sechsprozentigem Most kreisen zu lassen, einem Teufelszeug, das auch manch trinkfestem Erwachsenen schon mächtig zugesetzt hatte. Bernhard nahm einen kräftigen Schluck, dazu rülpste er betont männlich. Seine Erfahrungen mit einem ausgewachsenen Rausch und den Folgen waren noch frisch: Erst wenige Tage zuvor hatte die Bande im Bunker Dieters Geburtstag gefeiert, mit zwei statt wie üblich einer Flasche Most und dazu einigen Apfelsinen, für damalige Zeiten eine wahre Rarität, die man dem großem Bruder von Alfons zu verdanken hatte, der als Techniker in Nordafrika arbeitete. Außerdem gab es noch ein solides Stück Speck, das Walter seiner Mutter abgeluchst hatte. Mein Mitbringsel war ein Stück von einem Weichgummischlauch, etwas, was für die Flügelbande einen enormen Wert besaß, weil sich damit hervorragende Steinschleudern herstellen ließen. Von Gertrud kam eine Flagge aus Stoff, tiefblau, mit einem roten Pfeil diagonal nach oben gerichtet, dazu das Wort „Flügel“ und die sechs Initialen A, B, D, G, G, W in goldgelb. Die Flagge sah toll aus - Gertruds Mutter hatte ein Meisterstück geliefert - sie wurde sofort seitlich an einer Bunkerinnenwand befestigt, und jeder sagte, dass es genau das war, was noch gefehlt hatte.
Zu fortgeschrittener Stunde hieß es dann wie immer: „Gerhard, spiel uns was“, und ich zog meine Hohner





























