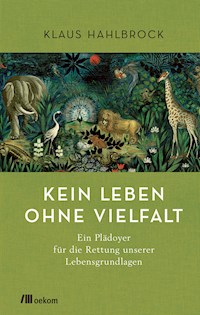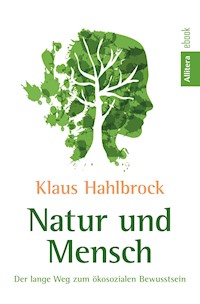
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Bedrohung der Erde hat viele Gesichter: Übervölkerung, Umweltzerstörung, Klimawandel, Wüstenbildung, Artenschwund und Ressourcenknappheit sind nur einige. Eine Milliarde Menschen verfügen nicht über ausreichend Nahrung, Millionen von ihnen verhungern jährlich. Wo bislang der Mensch im Überfluss lebte und unseren Planeten bedenkenlos schröpfte, ist nun ein Wandel hin zu einem ökosozialen Bewusstsein - bestimmt von Gemeinsinn und Vorsorge - zwingend notwendig. Denn nur so kann, wie Klaus Hahlbrock, Professor für Biochemie und ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln, zeigt, der Fortbestand des Homo sapiens im Einklang mit der Natur auch für die kommenden Generationen gesichert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allitera Verlag
KLAUS HAHLBROCK, Professor für Biochemie, war Direktor am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln sowie Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Von ihm erschien bereits der Titel »Kann unsere Erde die Menschen noch ernähren?« (2007).
Klaus Hahlbrock
Natur und Mensch
Der lange Weg zum ökosozialen Bewußtsein
Allitera Verlag
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unterwww.allitera.de
Dezember 2013 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2013 Buch&media GmbH, München Umschlaggestaltung unter Verwendung eines Motivs von © puckillustrations - Fotolia.com Printed in Europe · isbn 978-3-86906-604-2
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Einheit und Trennung von Mensch und Natur
Das biologische Erbe
Programmierung und Bewußtsein: Partner und Antagonisten
Normen, Schrift und Gesetze
Denken und Sprache in Symbolen
Weltbild – Spiegelbild – Selbstbild
Täuschung und Selbsttäuschung
Ritus, Kult, Religion und Kunst
Gut und Böse
Gestalten und Zerstören
Wissen und Nichtwissen
Das kulturelle Erbe Europas
Erkenntnis und Anwendung
Handeln als Zweckerfüllung und Bedürfnisbefriedigung
Industrialisierung und Maßlosigkeit
Wachstum und Maß
Anonymität und Vermassung
Reglementierung contra Verantwortung
Mensch und Natur
Entfaltung des Bewußtseins
Prägung, Gedächtnis und Erinnerung
Bewußtes und Unbewußtes
Individuelles und kollektives Bewußtsein
Dynamik, Plastizität und Grenzen des Bewußtseins
Archaisches Leben im Paradies
Magische Beschwörung von Geistern und Dämonen
Mythische Spiegelung in der Götterwelt
Mentales Vermessen und Rationalisieren der Welt
Beharren und Entfaltung
Integrales Bewußtsein von Ganzheit und Durchblick
Gestörtes / Gespaltenes Bewußtsein
Meinung, Urteil und Vorurteil
Handeln aus ökosozialem Bewußtsein
Natur und Mensch
Die Rolle des Bewußtseins
Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft
Wissensgesellschaft
Handeln aus Einsicht?
Kontra-Punkt: Es ist, wie es ist
Pro-Position: Menschsein ist Menschwerden
Bewegter Beweger
Standpunkt und Wegbereiter
Der Andere
Ich / Du / Wir-Gemeinschaft
Die kleinen und die großen Hebel
Körper – Seele – Geist
Fazit: Vom Unwissen und Bewähren zum Wissen und Bewahren
Literatur- und Quellenhinweise
Bildnachweis
Namensregister
Gewidmet der Generation meiner Enkeltochter und deren Zukunft
Mein herzlicher Dank für wertvolle Hinweise, fachlichen Rat, stimulierende Gespräche und kritische Begleitung dieses Buches gilt Rainer Ahrendt, Carl-Lutz Geletneky, Manfred Görg, Christoph Joachim, Bernd-Olaf Küppers, Ulrike Leutheusser, Manfred Milinski, Max von Tilzer und Wolfgang Wickler
Vorwort
Ein Problem kann nicht von demselben Bewußtsein gelöst werden, das es geschaffen hat.
(ALBERT EINSTEIN)
Sind wir uns immer dessen bewußt, was wir tun? Wie oft denken wir darüber nach, warum wir etwas tun – ob wir es wirklich tun wollen oder vielleicht nur deshalb tun, weil »es schon immer so war« und »andere es ja auch tun«? Wird unser Handeln nicht viel mehr von eingeprägten Gewohnheiten, Konventionen und einem angeborenen Herdentrieb bestimmt als von eigenen, bewußten Entscheidungen? Und denken wir, bevor wir etwas tun, auch immer an die möglichen Konsequenzen?
Machen wir uns zum Beispiel die langfristigen globalen Folgen unseres Lebens im Überfluß, des Raubbaus an den tropischen Regenwäldern, der Verschmutzung unserer Umwelt und der zunehmenden Versiegelung der Böden bewußt? Oder das absehbare Ende unserer auf andauerndes Wachstum fixierten Konsumwelt sowie die sozialen, ökologischen und ökonomischen Konsequenzen der rasch mitwachsenden Armut vieler Menschen auf Kosten des rapide zunehmenden materiellen Reichtums vergleichsweise weniger?
Ist es überhaupt denkbar, daß unser Bewußtsein noch rechtzeitig von einer derart fest eingeprägten Gewinnund Konsumorientierung auf ein vorausschauendes und zukunftsicherndes Verhalten umsteuert? Die Fülle kaum noch zu bewältigender Probleme – heute nennen wir sie »Krisen« – müßte doch längst ausreichen, um ein problembewußtes Handeln einzufordern.
Bei der Suche nach einer Antwort gibt uns das oben zitierte Wort von Albert Einstein einen wertvollen Hinweis. Denn neben einer grundsätzlichen Aussage über unser Bewußtsein enthält es implizit auch eine Aufforderung und eine entscheidende Frage. Indirekt fordert es uns zu Problembewußtsein auf und stellt damit zugleich auch die ergänzende Frage, inwieweit die Bereitschaft und die Fähigkeit dazu überhaupt vorhanden sind. Und dahinter steht wiederum die unüberhörbare Forderung, uns der vielen selbstgeschaffenen Probleme bewußt zu werden, sie ernst zu nehmen und dann auch tatsächlich zu lösen.
Doch wenn das Verhältnis zwischen Bewußtsein und Handeln so einfach wäre, hätte Einstein den Satz wohl kaum so formuliert. Denn die Entwicklung jedes einzelnen Bewußtseins ist ein lebenslanger und äußerst komplexer Prozeß, auf den die Betroffenen nur sehr begrenzten Einfluß haben. Entscheidende, vielleicht die entscheidenden Entwicklungsschritte erfolgen sogar schon so frühzeitig, daß wir dies weder bewußt wahrnehmen noch uns später daran erinnern. Die früheste, zunächst noch sehr sporadische Erinnerung an bewußt wahrgenommene Begebenheiten setzt normalerweise erst im Alter von ungefähr drei Jahren ein, wenn wesentliche Grundlagen des Bewußtseins bereits gelegt sind.
Um dies an einem konkreten Beispiel zu erläutern, beginne ich mit einem eigenen frühkindlichen Erlebnis, das mein weiteres Leben, einschließlich der Motivation zum Schreiben dieses Buches, stark geprägt hat.
Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört die »Arbeit« im Garten meiner Großmutter. Ein Foto aus dieser Zeit – ich muß etwa zwei Jahre alt gewesen sein – zeigt mich mit Gartenschürze und einer kleinen Gießkanne beim Blumengießen.
Meine eigene Erinnerung beginnt damit, daß ich von der Großmutter lernte, daß Pflanzen regelmäßig Wasser brauchen, außerdem genügend Licht, das ihnen die Kraft zum Wachsen gibt, lockeren Boden, damit die Regenwürmer und andere Kleintiere ihre Arbeit verrichten können, und ab und zu Dünger als Nahrung – wie ich meinen Grießbrei und meinen Kakao. Vorsichtig grub sie mit mir Regenwürmer aus, wir staunten über ihre Beweglichkeit ohne Beine und legten sie ebenso vorsichtig wieder zurück in ihre unterirdische Werkstatt. Wir suchten nach Spinnennetzen, um die Kunstfertigkeit der flinken Achtbeiner beim Knüpfen ihrer Netze und beim Einspinnen der Beute zu bewundern, und wir jubelten gemeinsam, wenn bunte Schmetterlinge auf den Blüten landeten und mit ihren Rüsseln Honig saugten.
Später im Jahr ernteten wir die Früchte und das Gemüse, deren Entwicklung wir von der Blüte oder der Aussaat bis zur Reife verfolgt hatten. Dabei erinnerten wir uns noch einmal an alles, was wir über die verschiedenen Wachstumsstadien vom Samen bis zur reifen Frucht, über die Pflege der Pflanzen und über die Rolle der Bienen bei der Bestäubung der Blüten und der Ameisen, Vögel und Eichhörnchen bei der Samenverbreitung gelernt hatten. Bald bekam ich auch ein eigenes Beet und durfte selbst entscheiden, was ich säte, pflanzte, pflegte und erntete – unter einer Bedingung: Ich mußte ein fürsorglicher Gärtner sein. Dann waren jede Blüte und jede Ernte ein kleines Fest und jeder Mißerfolg ein Ansporn.
Diese beeindruckenden und weit über die Kindheit hinauswirkenden Erlebnisse haben so tiefe Spuren hinterlassen, daß mein Bewußtsein dadurch eine lebenslange Prägung erhalten hat. Der Grundstein dazu – belegt durch Erzählungen und Fotos – wurde vor Beginn meiner bewußten Erinnerung gelegt.
Als die Großmutter starb, war ich zu jung, um zu begreifen, welch unschätzbaren Wert sie mir damit hinterlassen hatte. In dieser frühen, so entscheidenden Phase meiner Bewußtseinsbildung hatte sie mir unbemerkt einen bleibenden Eindruck von dem vermittelt, was ich heute als »die komplexe Dynamik ökologischer Zusammenhänge« bezeichnen würde: kein Wachstum ohne die dafür notwendigen Umweltbedingungen, keine Frucht ohne die verschiedenen im Samen angelegten Entwicklungsstadien, keine lebendige Vielfalt ohne Rücksicht auf die inneren Gesetze der Natur.
Und über das unmittelbar Erlebte hinaus wurde dem aufkeimenden Bewußtsein ein erstes Gefühl dafür vermittelt, wie sehr letztlich alles um uns herum und in uns selbst in Zusammenhänge eingebettet ist – wie sehr alle Aspekte unseres Erlebens, Denkens und Bewußtseins miteinander verbunden sind und ein in sich geschlossenes Ganzes bilden.
Meine berufliche Entwicklung war damit vorgeprägt. Nach einiger Zeit als Hochschullehrer arbeitete ich in einem Forschungsinstitut, das sich mit den Grundlagen der Pflanzenzüchtung und der Welternährung beschäftigt. Daraus entstand ein Buch mit dem Titel »Kann unsere Erde die Menschen noch ernähren?«. Die Schlußbilanz lautete, daß wir als global vernetzte Menschheit nur dann eine Zukunft haben, wenn wir die rücksichtslose Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen unverzüglich beenden und durch bewußtes und vernetztes Denken und Handeln in ökologischen und sozialen Zusammenhängen ersetzen.
Offenbleiben mußte allerdings die unmittelbar anschließende Frage, ob und wie dies geschehen kann. Bisher waren das menschliche Bewußtsein und Handeln in ihrer langen Evolution auf genau diejenigen Verhaltensweisen ausgerichtet, die es nun so plötzlich zu ändern gilt: Wachstum, Vermehrung sowie Aneignung und Ausbeutung aller erreichbaren und nun zunehmend versiegenden Ressourcen. Liegt der Schlüssel also in der Natur und der Anpassungsfähigkeit unseres Bewußtseins?
Daraus ergaben sich die Kernfragen dieses Buches: Wie flexibel ist unser Bewußtsein? Kann es innerhalb kürzester Zeit von einer Jahrmillionen lang dominierenden Zielrichtung in eine andere umschwenken? Oder geht es vielleicht gar nicht um ein völliges Umschwenken, sondern eher um eine entscheidende Kurskorrektur – um den nächsten Schritt in unserer evolutionären Anpassung an die sich ständig verändernden Umweltbedingungen? Und vor allem: Welche Schlüsse ziehen wir aus den Antworten auf diese Fragen für unser künftiges Verhalten?
Bei näherer Betrachtung haben die Fragen einen sehr elementaren Hintergrund. Was ist überhaupt Bewußtsein? Wie ist es möglich, daß wir uns zwar im Prinzip der vielen krisenhaften Zuspitzungen unserer Lebensumstände bewußt sind, unser Handeln jedoch höchstens durch Minimalkorrekturen, nicht aber durch zukunftsfähige Maßnahmen darauf abstimmen? Klimakrise, Finanzkrise, Bildungskrise, Sinnkrise – kaum eine Wortkombination ist so en vogue und kaum ein Problem beschäftigt die Politik, die Medien und die Stammtische so sehr wie die Soundso Krise.
Am Bewußtsein sollte es also eigentlich nicht liegen – oder vielleicht doch? Eine Krise ist schließlich kein unabwendbares Schicksal, sondern »der kritische Höhe- und Wendepunkt einer schwierigen Lage«. Von Beginn an war die Menschheitsgeschichte eine Geschichte der Überwindung von Krisen. Und das wird auch immer so bleiben; es ist die Vorgabe unserer natürlichen Lebensbedingungen. Offenbar mangelt es uns aber trotz des ständigen Beschwörens von Krisen daran, uns diese unausweichliche Tatsache bewußt zu machen und entsprechend zu handeln. Doch dazu müssen die täglichen Krisenmeldungen wenigstens so tief in unser Bewußtsein eindringen, daß sie uns nicht nur als emotional reizvolle, aber unverbindliche Unterhaltung dienen, sondern persönlich ansprechen und zu ihrer Bewältigung aufrufen. Nichts stumpft so sehr ab wie die ständige Überflutung mit denselben Reizen.
Bereits bei den ersten Überlegungen über einen geeigneten Zugang zu diesem Themenkomplex zeigte sich, wie breit er angelegt sein muß, um nicht in Teilaspekten steckenzubleiben. Das verlangt vom Autor strikte Beschränkung auf das Wesentliche und vom Leser das entsprechende Verständnis, einschließlich der eng begrenzten und naturgemäß äußerst subjektiven Auswahl von weiterführender und möglichst allgemeinverständlicher Literatur sowie von Originalzitaten mit den zugehörigen Quellenangaben. Um den Lesefluß nicht unnötig zu stören, habe ich beides, die Literatur- und die Quellenhinweise, nicht im fortlaufenden Text, sondern erst am Ende des Buches angegeben.
Ein wichtiger Teil der Ausführungen wird sich auf ältere Bewußtseinsformen und auf die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Bewußtseins beziehen. Das birgt eine oft übersehene Gefahr: Wir haben eine tiefsitzende Neigung, uns selbst zum Maßstab zu nehmen und frühere wie auch andere heutige Lebensweisen aus persönlich-subjektiver Perspektive zu beurteilen. Doch gerade im Zusammenhang mit der Bewußtseinsgeschichte ist es unerläßlich, sich klarzumachen, wie begrenzt unsere Fähigkeiten sind, uns in das Denken und Fühlen anderer, schon gar von Steinzeitmenschen, hineinzuversetzen.
Es kann nicht Ziel dieser Ausführungen sein, detaillierte Sachinformation über die einzelnen Teilgebiete zu vermitteln. Zentrales Anliegen ist es vielmehr, die verschiedenen Arten der Bedrohung des eigenen und allen übrigen Lebens auf der Erde sowie das dem zugrundeliegende menschliche Verhalten zu analysieren und für eine entsprechend problembewußte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Lebensweise zu werben.
Zur Einstimmung in dieses doppelte Anliegen beschließe ich das Vorwort mit einem kurzen (ge-dichteten) Prolog, auf den ich im Schlußwort mit einem Epilog in ähnlicher Form antworten werde:
Verlust der Mitte und der Pole, wer hält mit diesem Tempo schritt? Selbst unsre heiligen Symbole vollziehen diesen Wandel mit.
Erst Pyramide, erdgebunden, dann Kathedrale, Drang zum Licht, jetzt Fernsehturm für Talkshow-Runden, die Satelliten sieht man nicht.
War am Anfang noch die Erde Muttergöttin, scheint es jetzt, daß sie ungenießbar werde, während man aufs Weltall setzt.
Was ist es, das dem Vorwärtsstreben die selbstentfernte Richtung weist? Auch Leib und Seele sind das Leben, Drei-Einheit mit dem forschen Geist.
Einleitung
Πολλά τά δεινά, κούδέν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει Ungeheuer ist viel, und nichts ungeheurer als der Mensch.
(SOPHOKLES, »ANTIGONE«)
Kein anderes Lebewesen hat sich jemals so erfolgreich an die unterschiedlichsten Lebensbedingungen angepaßt und sich so weitgehend »die Erde untertan gemacht« wie der Mensch. Das war ihm keineswegs in die Wiege gelegt. Erst vor einigen Millionen Jahren entwickelte sich der erste menschenähnliche Urahn vom hangelnden Baumbewohner zum aufrechten Steppenläufer. Das Überleben dieser neuen Primatenart war während der längsten Zeit ihrer Evolution höchst unsicher gewesen. Nur eine von zahlreichen Entwicklungslinien hat bis heute überlebt: Homo sapiens. Sein bekanntester Vetter und letzter lebender Konkurrent um Nahrung und Lebensraum, der Neandertaler, war vor ca. 30 000 Jahren ausgestorben, alle übrigen schon wesentlich früher.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Homo sapiens nicht nur den langen und harten Überlebenskampf in der afrikanischen Savanne bestanden, sondern sich über weite Teile Europas und Asiens bis nach Amerika und Australien ausgebreitet. Heute gibt es auf der gesamten Erdoberfläche kaum noch von ihm unberührte Gebiete.
Für einen Abkömmling von zentralafrikanischen Klettertieren war diese globale Ausbreitung allein schon eine einmalige Erfolgsgeschichte. Noch einmaliger war der evolutionsgeschichtlich ungewöhnlich kurze Zeitraum, in dem sich diese Entwicklung abspielte. Die einander ergänzenden Schritte der biologischen und der kulturellen Evolution erfolgten in immer kürzeren Abständen: nur wenige Millionen Jahre vom Nestbauer in Tropenwäldern zum wandernden Steinzeitmenschen mit Werkzeug, Waffen und Herdfeuer; kaum 100 000 Jahre vom Afrikaner zum Kosmopoliten auf allen Kontinenten der Erde; und keine 10 000 Jahre vom verstreut umherziehenden Sammler und Wildbeuter zum automobilen, global vernetzten Land- und Stadtbewohner mit mehr als sieben Milliarden Artgenossen.
Dazu bedurfte es außergewöhnlicher körperlicher, geistiger und handwerklicher Fähigkeiten, die Homo sapiens von allen übrigen Lebewesen unterschieden und ihm einzigartige Überlegenheit verliehen. Alles, was ihm Lebensraum, Nahrung und sonstige Ressourcen streitig machte, fiel seinem Drang nach Überlebenssicherung, Expansion und Vorherrschaft zum Opfer. Verglichen mit dem tausendfach längeren Zeitraum, in dem die ganze Vielfalt der vergangenen und jetzt lebenden Arten entstand, brauchte Homo sapiens nur einen winzigen Bruchteil der jüngsten Erdgeschichte, um vom Bedrohten zum Bedroher einer Biosphäre zu werden, der er seine Existenz verdankt und die auch weiterhin seine unverzichtbare Lebensgrundlage bildet. Der scheinbar unaufhaltsame Erfolg ist seinem abrupten Ende bedrohlich nahe gekommen.
Die Bedrohung hat viele Gesichter. Übervölkerung, Umweltzerstörung, Klimawandel, Wüstenbildung, Artenschwund und Ressourcenknappheit sind nur einige der Schlüsselbegriffe, die das Ende der bisherigen Entwicklung markieren. Selbst ein großer Teil der eigenen Artgenossen ist hart betroffen. Soziales, wirtschaftliches und politisches Dominanzstreben erzeugen ein steiles Gefälle zwischen Reich und Arm, Macht und Ohnmacht, Aneignung und Ausbeutung. Eine Milliarde Menschen hungern, Millionen von ihnen verhungern in jedem Jahr.
Auf der Gegenseite stehen vergleichbare Zahlen für diejenigen, die im Überfluß leben oder daran sterben. Aufstrebende Entwicklungs- und Übergangsländer versuchen, den Lebensstil der Überflußländer zu kopieren – einen Lebensstil, der schon jetzt ein Mehrfaches dessen erfordert, was eine zukunftsfähige Weltwirtschaft an Ressourcennutzung und Abfallproduktion zulassen würde. Unersetzliche Ökosysteme werden ohne Rücksicht auf ihre Bedeutung für die Stabilität der Biosphäre und des Klimas für Siedlungsraum, Verkehrswege, industrielle Nutzung, Massentierhaltung und Freizeitanlagen »erschlossen« und damit unwiederbringlich zerstört. Gewässer, Böden und Luft werden zunehmend mit Schadstoffen befrachtet.
Die Grenzen einer nachhaltigen Belastbarkeit unseres Lebensraums sind längst überschritten. Nach derzeitigen Schätzungen beträgt der »ökologische Fußabdruck« des Menschen auf der Erde schon jetzt das Mehrfache ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit.
Wir verantworten nicht den Zustand, in dem wir dieses Erbe übernommen haben, wohl aber, wie wir es verwalten und weitervererben. Wir, die jetzt Lebenden, verantworten die Lebens- und Überlebensmöglichkeiten der uns nachfolgenden Generationen. Und genau darin liegt die historisch einmalige Herausforderung: Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist ein sofortiger, radikaler Kurswechsel unausweichlich, wenn wir einen plötzlichen Abbruch der bisherigen Entwicklung verhindern wollen. Mehr Lebensraum und Reichtum an natürlichen Ressourcen bietet die Erde nicht. Bis jetzt waren Wachstum und Dominanz der bestimmende Kurs. Der neue Kurs muß bestimmt sein von Gemeinsinn und Vorsorge (Abbildung 1).
Ursachen und Folgen der Ausbreitung des Menschen
Aber so unausweichlich wie dieser Kurswechsel, so schwer lösbar ist die Aufgabe. Wie soll der Wechsel geschehen? Ist eine derart drastische Wende angesichts einer so langen und kontinuierlichen Entwicklung überhaupt denkbar? Oder konkreter, auf die uns tatsächlich verfügbaren Denk- und Handlungsoptionen bezogen: Schließen die natürlichen Veranlagungen von Homo sapiens die Möglichkeit eines so radikalen Umdenkens und Umsteuerns ein, d. h., ist ein plötzlicher Wechsel von ungebremster und unhinterfragter Ausbreitung und Ausbeutung ohne Maß und Ziel zu maßvollem und vorausschauendem Bewahren einer menschenverträglichen Biosphäre grundsätzlich möglich?
Um auf diese Kernfrage zur Zukunft der Menschheit eine möglichst realistische Antwort zu finden, scheint es mir unerläßlich, uns zunächst die biologischen und kulturellen Grundlagen der bisherigen Entwicklung zu vergegenwärtigen. Entscheidend ist dabei die Entwicklung des menschlichen Bewußtseins und des daraus entspringenden Handelns. Nur aus sicherer Distanz zur eigenen, subjektiven Befindlichkeit und zeitbezogenen Sichtweise können wir hoffen, die Frage einigermaßen zuverlässig zu beantworten. Bestimmender Leitfaden muß der lange Weg von der ursprünglichen Einheit mit der Natur über die zunehmend selbstgefährdende Trennung zur Neubesinnung auf die Unauflöslichkeit dieser Einheit sein. Die absehbare Alternative wäre Selbstzerstörung bei vollem Bewußtsein.
»Ungeheuer ist viel, und nichts ungeheurer als der Mensch.« So beginnen die berühmten Mahnworte des Chors der thebanischen Alten in Sophokles‘ »Antigone«. Der Doppeldeutigkeit des Wortes »ungeheuer« (δεινός) entspricht die sich anschließende Aufzählung vieler einzigartiger Fähigkeiten des Menschen – im Gestalten ebenso wie im Zerstören. Heute, nach fast 2500 Jahren eindrücklicher Bestätigung dieser Feststellung, sollte es jeder Mühe wert sein zu ergründen, ob zum Ungeheuren im Menschen auch die Fähigkeit gehört, die eigene Zukunft langfristig zu gestalten anstatt sie in bedrohlich kurzer Frist zu zerstören.
Einheit und Trennung von Mensch und Natur
Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.
(CHARLES DARWIN)
Wie jedes andere Lebewesen sind auch wir Menschen Produkte einer langen Evolution. Das einzige, was uns von allem übrigen Leben grundsätzlich unterscheidet, ist ein Gehirn mit überdurchschnittlicher Befähigung zu analytischem Verstand, reflektierendem Bewußtsein und bis ins Transzendente reichender Empathie. Zwar ist auch dieses Gehirn ein Ergebnis der natürlichen Evolution, jedoch mit einzigartigen Rückwirkungen auf die weitere Entwicklung der gesamten irdischen Biosphäre, einschließlich unserer eigenen Überlebensmöglichkeiten. Wir sind nicht nur Produkte, wir sind auch aktive Gestalter und Zerstörer unserer Mitwelt – Bestandteil und zugleich Mit- und Gegenspieler der natürlichen, vom Menschen unbeeinflußten Evolution.
Um dieser Doppelrolle Rechnung zu tragen, werde ich im Folgenden alles mit »Natur« bezeichnen, was außerhalb unseres spezifisch menschlichen Denkens, Wollens und Handelns liegt. Also auch unsere eigene Natur in allen sonstigen Erscheinungsformen. Treffpunkt beider Sphären ist die Verknüpfung der »natürlichen«, unbemerkt ablaufenden Tätigkeit unseres Gehirns mit dessen darüber hinausgehender Sonderbegabung.
Die Begabung als solche ist Teil unseres biologischen Erbes, ihre Anwendung und ihre Äußerungen sind Ausgangspunkt und Träger unseres spezifisch menschlichen kulturellen Erbes. Während das kulturelle Erbe rapide anwächst und seine Folgeerscheinungen zunehmend in den Vordergrund treten, hat sich das biologische Erbe in der evolutionsgeschichtlich kurzen Zeit seit der Entstehung der unmittelbaren Vorläufer von Homo sapiens vor ca. ein bis zwei Millionen Jahren kaum verändert.
Bevor ich darauf näher eingehe, sollte ich die drei Schlüsselbegriffe Verstand, Bewußtsein und Empathie so definieren, wie ich sie im Folgenden verwenden werde, insbesondere die Bevorzugung von »Verstand« gegenüber der häufig benutzten Alternative »Vernunft«. Vernunft impliziert, vor allem seit Kants Unterscheidung von theoretischer und praktischer Vernunft, eine qualitative Wertung im Sinne von »vernünftig handeln« oder »vernünftig sein«. Gerade das ist aber hier nicht gemeint. »Verstand« soll in diesem Zusammenhang ausdrücklich wertneutral die Fähigkeit bezeichnen, Zusammenhänge von Fakten und Ereignissen zu »verstehen« und daraus Schlüsse zu ziehen.
Bewußtsein ist dann die darüber liegende Ebene des »Wissens um das Wissen«, das bewußte Erleben der eigenen Verstandestätigkeit im Wahrnehmen, Denken, Reflektieren und Vorstellen des Selbst und der übrigen Welt. Das nochmals darüber hinausreichende Phänomen der Empathie ist das Einfühlungsvermögen in die Seelen- und Bewußtseinszustände anderer sowie dessen philosophische und religiöse Überhöhung. Daß das Selbstbild nicht ohne Empathie und Spiegelung im anderen vorstellbar ist, wird noch besonders zu betonen sein.
In diesem Sinne sind die Sonderbegabungen Verstand, Bewußtsein und Empathie sowie deren kulturelle Auswirkungen der spezifisch menschliche Teil unseres biologischen Erbes. Soweit dieselben Begriffe überhaupt für das Tierreich angewendet werden, geschieht dies aus anthropozentrischer Sicht und erfordert entsprechende analytische Distanz und semantische Differenzierung.
Auch die Unterscheidung von biologischer und kultureller Evolution verlangt eine begriffliche Präzisierung, da letztlich auch die kulturelle eine Folge der biologischen Evolution ist. Hier sollen »biologisch« für »genetisch vererbt oder erworben« und »kulturell« für »kulturell überliefert« stehen.
Das biologische Erbe
Träger des biologischen Erbes, das bis zu unserem heutigen Bewußtsein geführt hat, sind die chemische Struktur und die Ausprägungsmuster der Gene. Beides unterscheidet sich je nach Verwandtschaftsgrad mehr oder weniger zwischen einzelnen Individuen. Nicht einmal eineiige Zwillinge sind genetisch absolut identisch. Doch selbst die unterschiedlichsten Individuen derselben Art sind einander genetisch wesentlich ähnlicher als irgendeinem beliebigen Individuum einer noch so nahe verwandten anderen Art. Dennoch unterscheiden wir, der jetzt lebende Homo sapiens, uns in der chemischen Grundstruktur aller bisher untersuchten Gene von unserem nächsten Verwandten unter den Menschenaffen, dem Schimpansen, nur um wenige Prozent.
Deutlich geringer als mit den Menschenaffen, aber immer noch bemerkenswert nah ist unsere genetische Verwandtschaft mit den übrigen Säugetierarten wie Hund, Pferd oder Maus. Trotz der sichtbaren (z. B. Augen- und Haarstruktur) und unsichtbaren Übereinstimmungen (z. B. Immun- und Verdauungssystem) verringert sich diese Verwandtschaft mit den äußerlich erkennbaren Unterschieden.
Nicht weniger entscheidend als die chemische Grundstruktur der Gene sind jedoch deren bisher noch vergleichsweise weniger gut untersuchten Ausprägungsmuster.
Den Verwandtschaftsgrad bestimmen alle genetisch festgelegten anatomischen, physiologischen und instinktgebundenen Unterschiede zwischen den Arten. So besitzen zum Beispiel nur Wirbeltiere wie Fisch, Frosch, Maus, Hund, Affe und Mensch vergleichbare Anlagen eines Knochengerüsts, Blutkreislaufs und Nervensystems. Dagegen stimmen viele Reaktionen des Grundstoffwechsels (Fett-, Zucker-, Eiweißumsatz usw.) sogar noch zwischen Mensch, Fliege, Reis und Hefe überein. Es sind nicht die relativ geringen Unterschiede im Grundstoffwechsel, sondern die sehr viel stärker voneinander abweichenden Merkmale im Körperbau, in der Wahrnehmung und im Verhalten, die die jeweiligen Abstände im Stammbaum der Arten ausmachen. So zeichnet Affe und Mensch ein stark ausgeprägtes visuelles Wahrnehmungsvermögen aus, den Hund oder den Wolf statt dessen ein besonders hochentwickelter Geruchssinn.
Beim Affen ist die Betonung eines guten räumlichen Sehvermögens das offensichtliche Ergebnis seiner evolutionären Anpassung an zielsicheres Klettern und Springen zwischen Ästen und Bäumen. Für den Hund ist dagegen eine sensible Differenzierung verschiedener Gerüche zum Aufspüren von Nahrung sowie zum Erkennen und Unterscheiden von Artgenossen wichtiger als visuelle Orientierung.
Unserem gemeinsamen biologischen Erbe mit Schimpansen und anderen Menschenaffen verdanken wir neben dieser bevorzugt visuellen Veranlagung auch die anatomischen Voraussetzungen für die Entwicklung zum aufrecht gehenden, geistig, handwerklich und sprachlich begabten Homo sapiens. Der bereits zum Aufrichten begünstigte
Körperbau ermöglichte einige für die Menschheitsentwicklung entscheidende morphologische Veränderungen: die Vergrößerung des Kopfvolumens und damit die Ausbildung eines komplexeren und leistungsfähigeren Gehirns, das Umfunktionieren der Hände vom Hangeln und Laufen zu geschicktem »Hantieren« sowie eine veränderte Atemrhythmik und Kehlkopfstellung als anatomische Grundlagen für differenziertes Sprechen.
Daß diese Entwicklung einerseits überhaupt, andererseits sogar in evolutionsgeschichtlich ungewöhnlich kurzer Zeit stattfinden konnte, war der Entstehung einer großräumigen »ökologischen Nische« vor etwa acht bis zehn Millionen Jahren zu verdanken: der klimabedingten Umwandlung von dichtem afrikanischem Tropenwald in offene Savannenlandschaft. In dieser Geländeform waren ausdauerndes Laufen, gutes räumliches Sehvermögen auf weite Distanzen, sozialer Zusammenhalt in wehrhaften Gruppen und flexibler Wechsel zwischen pflanzlicher und tierischer Nahrung entscheidende evolutionäre Vorteile.
Vorteilhafte körperliche Merkmale sind jedoch nur ein Teil dessen, was Überlebensfähigkeit in einem komplexen Ökosystem ausmacht. Jedes Tier, vom kleinsten Wurm oder Insekt bis zum höchstentwickelten Primaten, ist mit einem ebenfalls genetisch verankerten Programm ausgestattet, das neben den Körperfunktionen auch die artspezifischen Verhaltensmuster steuert. Wir bewundern die scheinbar ungeordnete und dennoch harmonisch aufeinander abgestimmte Betriebsamkeit und soziale Rangordnung in einem Bienenstock oder Ameisenhaufen, die exakt eingehaltenen Regeln bei der Balz eines Vogelpaares oder das geordnete, durch regelmäßigen Positionswechsel stabilisierte Band eines Vogelschwarms während des Zuges in ein weit entferntes Winterquartier.
Keines dieser Verhaltensmuster wird durch bewußtes, handlungsorientiertes Denken gesteuert, ebensowenig wie etwa die perfekte Koordination der Beinbewegungen eines Tausendfüßers oder eines galoppierenden Pferdes. Es sind genetisch fixierte Verhaltensprogramme und Bewegungsabläufe. Bei »niederen« Tieren, etwa bei Insekten, sind sie schon bei der Geburt fertig ausgebildet, bei »höheren« Tieren wie Vögeln und Säugetieren müssen sie zunächst noch durch Übung präzisiert werden.
Daß dies auch für die Koordination der Muskelbewegungen und für den überwiegenden Teil des Verhaltens beim scheinbar so verstandes- und willensgeleiteten Homo sapiens gilt, ist den meisten seiner Repräsentanten kaum bewußt. Nicht nur die vielen vegetativ und hormonell gesteuerten Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag und Verdauung, auch die Koordination der Nerven und Muskeln beim Gehen, Sprechen, Essen und anderen Körperbewegungen laufen ohne Beteiligung unseres Verstandes ab.
Analoges gilt für die vielen instinktiven Reflexe und Gefühlsregungen wie Schreckstarre, angsterfüllte Flucht oder liebevolle Zuwendung. Auch wenn höher entwickelte Formen von Verstand, Bewußtsein und Empathie – soweit wir wissen können – unsere Sonderstellung und Abgrenzung vom Tierreich ausmachen, sind dennoch die weitgehend feste Programmierung unseres Verhaltens und die vegetative, von Bewußtsein und aktivem Handeln unabhängige Steuerung der Organ- und Bewegungsfunktionen lebensnotwendige Grundbedingungen.
Die artspezifischen Verhaltensprogramme und die vegetativen Funktionssteuerungen sind ebenso biologisches, genetisch festgelegtes Erbe wie das auf den ersten Blick auffälligere äußere Erscheinungsbild. Und hinter dem Erscheinungsbild verbirgt sich ein weiterer, in seiner Bedeutung oft unterschätzter Teil dieses Erbes: Nicht nur die Verhaltensmuster und die anatomischen Grundlagen für unsere Sonderbegabungen – Größe und Komplexität des Gehirns, Sprachfähigkeit und Fingerfertigkeit – sind phylogenetisch (im Lauf der Evolution) erworbenes und fixiertes Erbe. Auch der ontogenetische (persönlich-individuelle) Entwicklungsablauf von der befruchteten Eizelle bis zum ausgewachsenen Organismus ist Bestandteil dieses Erbes.
Beim Menschen kommt dabei der Gehirnentwicklung eine herausragende Bedeutung zu. Gemessen an der durchschnittlichen Lebensdauer durchläuft kein Säugetier vergleichbarer Größe ein so langes Entwicklungs- und Lernstadium von der Geburt bis zur Geschlechtsreife wie der Mensch. Entscheidend dafür ist die höchst komplexe, aber noch weitgehend formbare Gehirnstruktur mit einem ungewöhnlich hohen Anteil an Plastizität während der Individualentwicklung. Über 100 Milliarden Nervenzellen, jede einzelne mit bis zu 10 000 mehr oder weniger variablen Verbindungen zu anderen Gehirnzellen, lassen neben den einprogrammierten Verhaltens- und Funktionssteuerungen Freiraum für eine praktisch unendliche Vielfalt an persönlichen Wesensmerkmalen, Gedächtnisinhalten, Verstandesleistungen und geistig-seelischen Empfindungen.
Jedes menschliche Individuum ist, je jünger desto mehr, ein weit offenes und unerschöpfliches Gefäß mit einzigartigem Entwicklungspotential – »ungeheuer« in Segen und Fluch, vom schöpferischen Genie und aufopfernder Hilfsbereitschaft bis zu gezielter Manipulation, Folter, Massenhysterie und Massenmord.
Voraussetzung für diese außergewöhnliche Plastizität der menschlichen Hirnfunktionen war eine zunehmende Lockerung derjenigen aus dem Tierreich ererbten Verhaltensmuster, die nun anstelle fester Einprogrammierung bewußten Willensäußerungen zugänglich wurden. Soweit es diese Lockerung zuließ, wuchs allerdings auch die Konkurrenz zwischen genetischer Programmierung und »freiem«, wenn auch stark kulturell geprägtem Willen um die beherrschende Rolle bei den nunmehr von Programmierung und Wollen gemeinsam gesteuerten Aktivitäten. Nicht selten erzeugt daher das unbewußte Dominanzstreben unseres willensbetonten Verstandes ein schwer beherrschbares Konfliktpotential, oft mit harten Konsequenzen für die individuelle Entscheidungsfähigkeit und für das gesellschaftliche Zusammenleben.
Dieser Zwiespalt hat erhebliche Konsequenzen, für die eigene Seinsbestimmung ebenso wie für das Gruppenverhalten im Innern und nach außen. Solange ein genetisch festgelegtes Verhaltensmuster autonom und unhinterfragt abläuft, verleiht es entsprechende Sicherheit. Je größer jedoch der Einfluß des Bewußtseins und damit die Möglichkeiten des Hinterfragens und Zweifelns werden, desto größer wird neben der produktiven inneren Spannung auch die Unsicherheit in Entscheidungssituationen. Die allenthalben erkennbaren Folgen sind innere Zerrissenheit und Ziellosigkeit sowie individuelle und kollektive Ängste und Aggressivität.
Verhaltensprogrammierung und »freier Wille« geraten immer mehr in ein zwiespältiges Wechselspiel von Partnern und Antagonisten.
Programmierung und Bewußtsein: Partner und Antagonisten
Die meisten unserer einprogrammierten, nicht bewußt gesteuerten Verhaltensweisen nehmen wir kaum als solche wahr: das Wegducken vor einem vorbeifliegenden Objekt, das spontane Greifen nach einem fallenden Gegenstand oder das Wegzucken von einer heißen Herdplatte. Ein bewußtes Auslösen derart spontaner Reaktionen mit vergleichbarer Geschwindigkeit würde unsere verstandesgeleiteten Fähigkeiten weit übersteigen. Neurophysiologische Messungen haben ergeben, daß die gesamte Reaktionskette des Hitzereflexes bereits nach 50 Millisekunden (dem 20. Teil einer Sekunde) abgeschlossen ist – von der Übermittlung des Nervenreizes zum Gehirn, der komplexen Entscheidungsfindung zwischen allen daran beteiligten Gehirnzellen und -arealen sowie der Aussendung von gegenläufigen Nervenreizen bis zur koordinierten Bewegung sämtlicher für das Weckzucken benötigten Muskeln. Bis dasselbe Gehirn diesen unbewußt ablaufenden Reflex bewußt wahrnimmt, vergeht das Zehnfache an Zeit: 500 Millisekunden (eine halbe Sekunde).