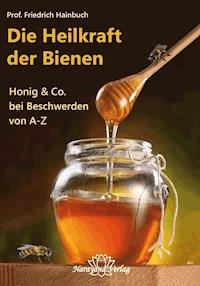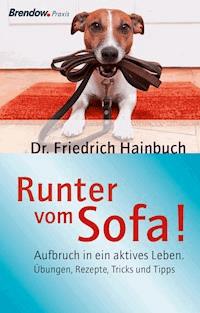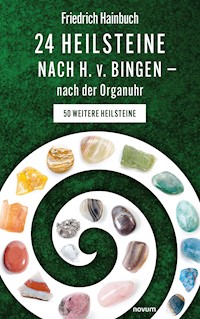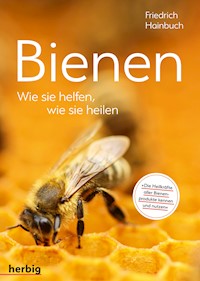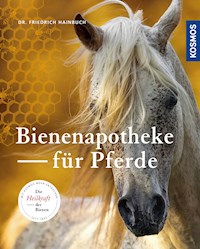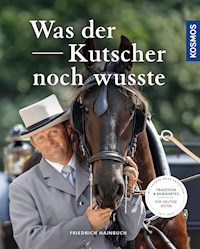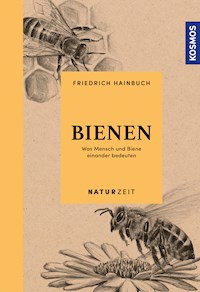
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Naturzeit – ein ganz besonderer Naturführer über die faszinierende Lebensweise der Bienen. Dieser Band beschreibt das Sozialgefüge des Schwarms, skizziert biologische Grundlagen in gut lesbarer, unterhaltender Sprache und widmet sich der Kulturgeschichte der Biene und der Bienenhaltung von den Anfängen bis zu den Herausforderungen der Gegenwart. Friedrich Hainbuch erläutert zudem, was nachhaltiges Imkern bedeutet und wie der Mensch zur Gesundheit und Widerstandskraft des Schwarms beitragen kann. Die Natur ist kostbar – dieser aufwändig in zweierlei offene Papiere gebundene, mit Lesebändchen und farbigem Kapitalband ausgestattete Band für Naturliebhaber ist es auch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
1
EINLEITUNG
2
UNSERE BIENEN–EIN ÜBERBLICK
3
DAS LEBEN DER BIENEN
4
BIENE UND MENSCH
5
IMKEREI
6
DIE GABEN DER BIENEN
7
DAS BIENENSTERBEN
8
LITERATURHINWEISE, AUTOREN, IMPRESSUM
„Seid mir gegrüsst ihr lieben Bienen,
Vom Morgenstrahl beschienen!
Wie fliegt ihr munter ein und aus
In Imker Dralles Bienenhaus
Und seid zu dieser Morgenzeit
So früh schon voller Tätigkeit.“
Wilhelm Busch
Seit einigen Jahren ist ein bemerkenswerter Boom der Imkerei zu beobachten. Auch immer mehr jüngere Menschen finden zu diesem anspruchsvollen und vielseitigen Hobby, ganz gleich ob auf dem Land oder in der Stadt.
So sind in unserem Imkerverein die angebotenen Einführungskurse regelmäßig ausgebucht und wir führen seit einigen Jahren Wartelisten zur Teilnahme an diesen Kursen. Häufig höre ich von den Interessierten, das Insektensterben, das ja auch die Bienen betrifft, sei derart gravierend, dass etwas dagegen unternommen werden müsse. Und da erfülle gerade die Biene als Bestäuberinsekt einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag, um unsere Nahrungsgrundlagen wie Obst und Gemüse zu erhalten.
Andere berichten, sie hätten den Film „More than honey“ gesehen und seien entsetzt, wie man mit der zum „Nutztier“ degradierten Biene umgehe.
So unterschiedlich die Motivation des Einzelnen sein mag, die Wertschätzung der Biene scheint mit ihrer Gefährdung zu steigen.
VIELE GELEGENHEITEN DES ENGAGEMENTS
Inzwischen hat sich auch eine große Zahl von Initiativen zur Erhaltung der Insekten und vor allem der Bienen gebildet. Aus dieser Vielzahl möchte ich Ihnen drei kurz vorstellen:
Das „Netzwerk Blühende Landschaft“ entwickelt in Zusammenarbeit mit einem Netzwerk aus Landwirten, Naturschützern, Gärtnern, Imkern, Wissenschaftlern, betroffenen Interessenverbänden, Landschaftsplanern und Verbrauchern neue, insektenfreundliche Bewirtschaftungskonzepte, in denen sich Menschen und Tiere wohlfühlen können. Das geschieht durch Anlage einer „Blütenparadiesfläche“. Die Institution hilft, wenn man selbst eine dafür geeignete Fläche zur Verfügung stellen möchte. Oder im Rahmen einer Blühpatenschaft, die man übernehmen kann, wenn man die Initiative unterstützen möchte.
Oder das Projekt „Bienen machen Schule“, eine Initiative von Mellifera e.V. Bienen eignen sich hervorragend, Kinder und Jugendliche die Liebe zur Natur entdecken zu lassen. Imker und Lehrer werden zusammengebracht, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, mit und von den Bienen zu lernen. Es geht um eine praxisbezogene Umweltbildung, in der fachbezogen und fächerübergreifend gearbeitet wird, was die Initiative mit Arbeitsanleitungen und Vorschlägen unterstützt.
Oder die Initiative „Bee careful“, eine Einrichtung der Schwartau-Werke zum Schutz der Bienengesundheit und Fruchtvielfalt. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Bienen zu verbessern und die Bienenpopulation wachsen zu lassen. Die Firma Schwartau kooperiert mit den „HOneyBee Online Studies“ von Prof. Dr. Jürgen Tautz an der Universität Würzburg, deren gemeinsames Engagement darin besteht, Informationen rund um den Themenkomplex Biene für jeden Interessierten frei verfügbar zu machen. So sollen Menschen für die Bedeutung und Notwendigkeit der Honigbiene sensibilisiert werden.
Darüber hinaus gibt es noch eine Menge anderer, sehr rühriger und bemühter Vereine, Verbände und Initiativen, die sich um unsere Bienen Sorgen machen und etwas für dieses Insekt tun.
Vielleicht möchten auch Sie sich, geneigte Leserin, geneigter Leser, nach der Lektüre dieses Bandes in diesem Bereich engagieren, sei es mit tatkräftiger Hilfe, mit finanzieller Unterstützung oder gar selbst als Imker.
Auch wenn Ihnen in der Stadt nur ein kleiner Balkon zur Verfügung steht, mag das eine Überlegung wert sein: Es wird mitunter sogar argumentiert, in der Stadt hätten die Bienen eine „sauberere“ Umwelt als auf dem Land, wo die Natur häufig durch den Einsatz von Pestiziden in der konventionellen Landwirtschaft arg strapaziert ist. Tatsächlich gibt es in der Stadt ein reiches Angebot an Blühpflanzen: Viele Haus-, Garten- und Balkonbesitzer stellen vom frühen Frühjahr bis in den Spätherbst hinein eine bunte Palette und Pracht von Blühpflanzen zur Verfügung, um sich an den frischen, frohen Farben zu erfreuen und vielleicht um der dunklen Jahreszeit möglichst viel Farbe entgegenzusetzen.
URALTE WESEN, DIE IMMER NOCH RÄTSEL AUFGEBEN
Denken Sie immer daran: Bienen sind viel, viel älter als wir Menschen. Im Laufe ihrer Evolution haben sie ein erstaunliches Zusammenleben entwickelt, von dem wir einige Aspekte bis heute noch nicht erklären können.
Da wären zum Beispiel die Fragen: Wie finden tausende Drohnen (die männlichen Bienen) und die unbegatteten Jungköniginnen zu ihren Paarungsritualen zusammen? Und warum treffen sie sich immer an den gleichen Drohnensammelplätzen, die nach uns Menschen unbekannten Kriterien im Land verteilt sind?
Dabei kommen aus einem Umkreis von bis zu zehn Kilometern bis zu 20.000 Drohnen zielstrebig an einem Ort zusammen. Alle in der Hoffnung, eine Jungkönigin zu ergattern, um sie mit ihrem Samen zu beglücken. Man weiß heute, dass es mindestens 10.000 Drohnen sein müssen, die sich versammeln, damit sich ein Sammelplatz auf Dauer etablieren kann. Obwohl Forscher seit Jahrzehnten versuchen, dieses Phänomen zu ergründen, weiß man bis heute nicht, wie die Tiere wissen, wohin sie fliegen müssen. Denn nie zuvor in ihrem kurzen Leben sind sie dort gewesen, und die Drohnen des Vorjahres, die es gewusst hätten, sind längst gestorben.
Manche dieser Orte sind seit mehr als 100 Jahren bekannt, aber keiner weiß, ob sich die Drohnen und die Königinnen möglicherweise am polarisierten Licht, an Helligkeitsverteilungen, an Landschaftsmerkmalen oder am Bewuchs orientieren und deshalb zielsicher zu ihrem Daseinsziel navigieren.
WIE ICH ZU DEN BIENEN FAND
Ich selbst wurde durch meine Heilpraktikerin vor etwa zwölf Jahren zu den Bienen gebracht. Sie sprach mich an, ob ich mir nicht vorstellen könnte, etwas mehr als das Übliche für die Umwelt zu tun. Ich entgegnete, dass ich zusammen mit meiner Frau seit 1984 viele Erfahrungen in der Pferdezucht und -haltung gemacht hätte. Hier verzichten wir auf Kunstdüngung und setzen auf keiner unserer Weiden Spritzmittel ein. Alles wird mit natürlichem, verwittertem Kompost gedüngt, alle Zaunränder, Brennnesseln und Disteln mit den entsprechenden, möglichst umweltschonenden Geräten gemäht.
Das genügte der Dame aber nicht, denn sie ließ nicht locker und regte an, wir beide sollten doch bei einer bekannten und begabten Bienenmentorin im nahen Bonn einen Kurs zum Erlernen der Imkerei absolvieren. Mentorinnen und Mentoren sind erfahrene, mitunter betagte Imkerinnen und Imker, die man beim örtlichen Imkerverein in Erfahrung bringen kann. Der Plan war, im Jahr darauf mit zwei Völkern in die Imkerei zu starten.
Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich wusste, dass eine Ausbildung zum Imkergesellen und darauf aufbauend zum Imkermeister in der Regel etwa fünf bis acht Jahre in Anspruch nimmt. Die Aussicht, die Fülle des Stoffs und die praktische Erfahrung in recht kurzer Zeit verinnerlichen zu müssen, flößte mir Respekt ein. Aber wie heißt es doch: „Schwimmen lernst du nur im Wasser!“
Wir beide sind dann in das laufende Bienenjahr – es war kurz vor der Sommerhonigernte – sozusagen in den Bienengarten, der nur ein kleines Wasserbecken beherbergte und keinesfalls zum Schwimmenlernen geeignet war, in die anstehenden Arbeiten „geworfen“ worden. Plötzlich waren wir Mitglieder einer schon länger bestehenden Imkergruppe von sechs Personen, die sich mit der Mentorin zusammen um ihre acht Bienenvölker kümmerten.
Wir beide geben heute zwischen zwei und vier Bienenvölkern ein Zuhause – meine Heilpraktikerin hat ihre zwei Völker im Garten am Haus stehen und ich meine im Nationalpark Eifel, zusammen mit einem dortigen Imkermeister.
Ein abenteuerliches, aber auch spannendes Erlebnis mit „unseren“ Bienen war das Einfangen eines großen Schwarms, der sich unweit von den Bienenstöcken in etwa zehn Metern Höhe in einer Fichte niedergelassen hatte. Mit einem Schwarmfangkasten unterm Arm sah ich mich gezwungen, die Queräste ohne Leiter und Sicherung hinaufzuklettern, um den Schwarm nach Besprühen mit Wasser schließlich in diesen Schwarmfangkasten „einzuschlagen“. Diese waghalsige Aktion ist bis heute in unserer kleinen Imkergruppe eine immer wieder gern gehörte Anekdote.
Mich rührt es zutiefst, wenn zweimal im Jahr der Honig aus der Honigschleuder in die bereitstehenden „Hobbocks“ (Honigaufbewahrungsgefäße) hineinfließt und eine kleine Probe zwischendurch gekostet wird. Da werde ich schon ehrfürchtig vor der Natur und ihren Köstlichkeiten. Und wir als Imker klauen den Bienen ja eigentlich ihren Wintervorrat! Umso wichtiger ist es, mit den Bienen respektvoll und ebenbürtig umzugehen, und sie nicht auf einen Wirtschaftsfaktor reduziert zu betrachten.
So erfreuen wir uns an dem köstlichen Honig, ernten ihn aber nur zu zwei Dritteln im Sommer. Der Rest verbleibt in der „Beute“ bzw. wird als Beimenge für die Winterfutterlösung benutzt.
Wir treffen uns nun seit etwa zwölf Jahren auch heute noch regelmäßig alle 14 Tage, um Beobachtungen, Probleme, Fragen und Anregungen rund um die Imkerei auszutauschen und weiterzugeben. Und seien Sie versichert, verehrte Leserin, verehrter Leser: Langweilig war es nie in dieser doch schon recht langen Imkerzeit, sondern stets interessant und spannend. Und bis heute lernen wir voneinander immer noch viel für unser eigenes imkerliches Handeln. Die Beschäftigung mit den Bienen ist und bleibt eine wunderbare und zufriedenstellende Freizeitbeschäftigung.
SCHÄTZE AUS DEM BIENENSTOCK
Aufgrund meines Hintergrunds und meiner Ausbildungen (Theologie, Sport- und Medizinische Wissenschaften sowie Umweltwissenschaften) habe ich mich stets auch für die historischen Zusammenhänge die Imkerei betreffend interessiert. Ich wollte Zusammenhänge nicht nur in ihrer Tiefe verstehen und ergründen, sondern im Idealfall auch selber Neuentdeckungen und Verbesserungen dazu beitragen. Das betrifft beispielsweise den Einsatz von Bienenprodukten im humanmedizinischen Einsatz oder die Bedeutung einer wirklich wesensgemäßen Bienenhaltung.
Zum Thema Antibiotikaresistenzen stoße ich bei meinen wissenschaftlichen Recherchen immer wieder auf Studien, die sich eben mit den natürlichen Alternativen aus dem Bienenstock wie Honig, Propolis, Bienenwachs und Pollen beschäftigen und den Einsatz dieser Bienenmedizin nahelegen.
Inzwischen benutze ich als Heilpraktiker zum Beispiel das Bienengift zur Behandlung von Arthritis und vielen anderen Gelenkerkrankungen. Sie werden später in diesem Band die Gelegenheit haben, mehr zum Thema Bienenmedizin zu lesen. Doch habe ich im Laufe der Jahre noch andere Bücher veröffentlicht, die sich noch ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen.
ZUKUNFT VON BIENE UND MENSCH
Für die Zukunft wünsche ich mir ein tiefgehendes Verständnis einer breiten Öffentlichkeit für die Zusammenhänge einer naturgemäßen Nahrungsproduktion. Und einen würdigen Umgang mit allen Insekten, von denen nahezu alle wesentlich länger auf dieser Erde leben als wir Menschen – und die es vermutlich auch noch geben wird, wenn es den Menschen nicht mehr gibt. Der direkte Umgang und die eigenen Erfahrungen mit Bienen können dabei einen wichtigen Beitrag leisten.
Wenn keine Bienengiftallergie vorliegt, ist die Beschäftigung mit diesen Tieren faszinierend und ungefährlich. Ein Test beim Allergologen verschafft hier Klarheit.
Und falls die praktische Arbeit der Imkerei nichts für Sie ist, dann unterstützen Sie die Bienen mit einer bienengerechten Gartenanpflanzung (der super gemähte „englische“ Rasen hat nichts mit bienengerecht zu tun) oder einigen bienenfreundlichen Pflanzen auf Ihrem Balkon. Die Bienen und andere Insekten werden es Ihnen danken.
UNSERE BIENEN – EIN ÜBERBLICK
Bienen üben seit einigen Jahren eine wachsende Faszination auf die Menschen aus. Wenn ich jemanden frage, warum er oder sie sich für die Bienenhaltung interessiert, erzählen manche, sie seien dabei gewesen, als ein geschwärmtes Bienenvolk eingefangen wurde. Andere haben Imker in der Familie. Wieder andere waren bei einer Veranstaltung zum Thema und wieder andere wollen etwas für die Umwelt tun und sehen das Engagement für die bedrohten Bienen als ökologische Notwendigkeit.
Oft sind es solche Anstöße und die ersten Begegnungen am Bienenstock, die schließlich dazu führen, dass die Imkeraspiranten ihr Herz an diese wunderbaren Geschöpfe verlieren und sie von ihnen nicht mehr losgelassen werden.
Die Biene ist etwa 100 Millionen Jahre alt und ihre Evolution ist eng mit der Evolution der Blütenpflanzen verknüpft. Als die Pflanzen begannen, bunte duftende Fortpflanzungsorgane, also Blüten, mit Nektar und Pollen zu entwickeln, gaben einige Wespen ihre auf Fleischverzehr basierende, räuberische Lebensweise zum Teil auf und stellten ihre Ernährung auf Nektar und Blütenpollen um. Aus ihnen entwickelten sich die Bienen, die im Gegensatz zu den Wespen auch ihre Larven mit Nektar und Pollen ernähren.
Im Gegenzug dienen die Bienen nun vielen Pflanzen als Bestäuber und garantieren somit deren Fortbestand.
VON WEHRHAFTEN VEGETARIERN UND DEN WAFFEN DER JÄGER
Bienen und Wespen ähneln sich nur auf den ersten Blick im Aussehen. Wer genau hinsieht, wird einen deutlichen Unterschied zwischen den Insekten erkennen.
Während der Hinterleib der Biene eher bräunlich erscheint, besitzt die Wespe meist auffällige schwarz-gelbe Streifen. Die fälschliche Annahme, dass auch Bienen schwarz-gelb gestreift sind, geht wahrscheinlich auch auf ihre Darstellung in der Populärkultur wie in der Kinderserie „Biene Maja“ zurück. Insgesamt ist der Bienenkörper eher rundlich und stark behaart, während Wespen nur wenige Haare besitzen. Nicht ohne Grund spricht man von einer Wespentaille: Sie ist deutlich schmaler als die der Biene. Dadurch sind Wespen sehr beweglich und schneller als die eher behäbig wirkenden Bienen.
Bienen und Wespen gehören zu den staatenbildenden Insekten. Je nach Wespenart kann ein Staat aus bis zu 7.000 Tieren bestehen, ein Bienenvolk im Sommer, wenn es zahlenmäßig am stärksten ist, sogar aus 40.000 bis 60.000 Tieren. Dabei ist ein Insektenstaat immer arbeitsteilig organisiert. Sowohl bei Bienen als auch bei Wespen gibt es eine Königin, Arbeiterinnen und Drohnen. Ein Wespenstaat besteht immer nur für einen Sommer. Im Herbst stirbt das Volk und nur die begatteten Jungköniginnen überwintern. Im nächsten Jahr beginnen diese dann, ein neues Nest zu bauen und damit einen neuen Staat zu gründen. Im Gegensatz zu Bienen nutzen Wespen keinen Schwänzeltanz zur Kommunikation.
Bei Bienenvölkern überwintert die Königin mit einem Teil der Arbeiterinnen im Bienenstock. Im nächsten Frühjahr beginnen die Arbeiterinnen dann erneut mit der Brutpflege. Die Königin kann fünf bis sieben Jahre alt werden. Auch der Bienenstock wird daher über mehrere Jahre bewohnt.
Und was das Essverhalten angeht, gibt es ebenfalls Unterschiede:
Die Honigbiene ist Vegetarierin, denn sie ernährt sich ausschließlich von süßen Pflanzensäften, Nektar und Pollen. Daher verfügt sie über einen Saugrüssel, mit dem sie Nektar aus Blüten saugen kann. Wespen hingegen besitzen Beißwerkzeuge und sind Allesfresser, die auch gerne Fleisch fressen. Das ist der Grund, weshalb Wespen von unserem Essen angelockt werden. Sie erbeuten aber auch jene Insekten, die dem Menschen lästig werden können.
Ein weiteres wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der Stachel. Während Wespen mehrmals zustechen können und ihren Stachel bei der Jagd einsetzen, können Bienen ihren Stechapparat nur einmal – und das stets zur Verteidigung, nicht zur Jagd – benutzen. Die Biene zahlt den Einsatz ihres Stachels mit ihrem Leben und stirbt ein bis zwei Tage später. Der Widerhaken am Bienenstachel bewirkt, dass der Stachel stecken bleibt und die Biene die Giftblase in ihrem Hinterleib beim Versuch ihn wieder herauszuziehen vollständig herausreißt. Bienen schützen mit dieser „Waffe“ vor allem ihren Bienenstock vor Honig- und Bruträubern, und so muss leider auch manchmal der Mensch darunter leiden.
Da die Bienen ihr gesamtes Gift mit einem Stich injizieren, ist ein Bienenstich wesentlich schmerzhafter als ein Wespenstich. Wespen teilen ihr Gift für mehrmaliges Zustechen auf. Bienen stechen jedoch nur zur Verteidigung – und sind in der Regel nicht aggressiv. Erstes Gebot, wenn einem eine Biene zu nahe kommt, ist also: Ruhe bewahren, nicht anpusten und nicht wegscheuchen. Wildes Umherfuchteln verunsichert die Insekten nur, sodass sie sich mit einem Stich verteidigen wollen.
EINE WEITLÄUFIGE VERWANDTSCHAFT
In den 100 Millionen Jahren der Entwicklung hat es zwischen Bienen und Pflanzen bemerkenswerte Anpassungsprozesse gegeben. Auch das erstaunliche Sozialleben der Bienen hat sich in diesem Zeitraum entwickelt. Manche Bienenarten leben zwar solitär, d.h. sozusagen als Einsiedlerbienen, doch Honigbienen leben in großen, gut organisierten Familiengruppen zusammen und weisen komplexe, bis heute noch nicht in allen Einzelheiten erforschte, soziale Verhaltensweisen auf.
Man findet heute etwa 20.000 Bienenarten auf dem gesamten Globus, die eine erstaunliche Vielfalt an Anpassungsleistungen an ihre Umwelt zeigen. Einige Arten haben ihr Nest im Boden, andere in hohlen Bäumen und wieder andere bauen ihr Nest in Hohlräumen von Hauswänden.
Bei den Bienen lassen sich vier Gruppen unterscheiden: Die Honigbienen (Apis mellifera – je nach Taxonomie sieben bis zwölf Arten), die Stachellosen Bienen (500 bis 600 Arten), die Hummeln (ca. 250 Arten) und die Solitärbienen (ca. 570 Arten).
Darüber hinaus hat sich der Mensch die Haltung von Honigbienen in mehr oder weniger großem Umfang angeeignet. Die Bienen sind Teil unseres Lebens geworden: Einerseits ernten wir von ihnen erzeugte Produkte wie Honig, Bienenwachs, Pollen und Propolis, anderseits setzen wir sie als notwendige Bestäuber für unseren Obst- und Gemüseanbau ein, und nur mit ihrer Hilfe kann unsere Versorgung mit Lebensmitteln sichergestellt werden. So gesehen bedrohen der Verlust der Lebensräume, die Spritzmittelbelastung und Epidemien nicht nur die Bienen selbst, sondern auch die menschliche Existenz.
Unter allen Bienenarten ist die Honigbiene, die auch Europäische oder Westliche Honigbiene genannt wird, die wohl bekannteste und am besten untersuchte Art.
Die Gruppe der solitär lebenden Bienen wird umgangssprachlich oft auch Wildbienen genannt. Über diese Arten wissen wir relativ wenig, und es kommt auch heute noch vor, dass vor allem in den Tropen bisher unbekannte Arten entdeckt werden. Man hat allerdings festgestellt, dass es unter den Solitärbienen Arten gibt, die wesentlich bessere Bestäubungsleistungen erbringen als die Honigbienen. So sind auch manche Arten der Solitärbienen für den Menschen durchaus von wirtschaftlicher Bedeutung, auch wenn sie für die Erzeugung von Bienenprodukten keine Rolle spielen.
Einige bemerkenswerte Bienenarten möchte ich hier mit kurzen Porträts vorstellen.
DIE LUZERNE-BLATTSCHNEIDERBIENE(Megachile rotundata)
Diese Bienenart wird in Kanada als Bestäubungshelferin beim Anbau der Luzerne eingesetzt. Diese Nutzpflanze spielt vor allem als Futterpflanze eine Rolle. Die Bienen werden dort erwerbsmäßig gezüchtet und nehmen bereitwillig künstliche Nisthilfen an. Die Kokons (Brutzellen) werden dann entnommen und in großen Fabriken auf ihren kommenden Einsatz vorbereitet.
Blattschneiderbienen sind in vielen Ländern der Erde verbreitet. Die Männchen können sich mit mehreren Weibchen paaren, wenn sich auch jedes Weibchen nur ein einziges Mal paart. Um die Eier zur Reife zu bringen, müssen die Weibchen zuerst viel Pollen fressen. Dann beginnt der Nestbau und die Vorratsbeschaffung. Interessant ist bei diesen Insekten die Fähigkeit, Blätter zu zerschneiden und daraus Brutzellen in ihren Nestern zu bauen, die sie in bereits vorhandene Hohlräume einfügen. Die Blattstücke schneiden sie mit ihren Mandibeln wie mit Scheren aus, dann werden die Blattränder gekaut, um sie klebrig zu machen, sodass sie an der vorgesehenen Stelle eingefügt werden können. Auf dem Grund der Brutzellen wird ein Pollen-Nektar-Vorrat angelegt, dann legt das Weibchen ein Ei ab und verschließt die Brutzelle. In seiner Lebensspanne von acht Wochen legt ein Weibchen um die 60 Eier.
DIE ROTE MAUERBIENE(Osmia Bicornis)
Die Rote Mauerbiene wird in mehreren Pilotprojekten, u.a. der Universität Bonn, als sehr effiziente Bestäuberin von Obstplantagen eingesetzt.
Sie kommt in Europa und Nordafrika und von Nordrussland über Zentralasien bis zum östlichen Ende des asiatischen Kontinents vor. Als Nistgelegenheiten dienen Mörtel, Totholz, Lücken unter Dachpfannen, gebündelte Strohhalme, Pappröhren Bambusstücke oder ähnliche Nisthilfen aus diesen Materialien, die auch vom Menschen bereitgestellt werden können. Das Weibchen trägt einen Vorrat aus Pollen und etwas Nektar ein, den es zu einer Paste kaut. Das Ei legt sie auf dieser Paste ab, anschließend wird jede Brutzelle mit Lehm verschlossen. Die jungen Larven schlüpfen und entwickeln sich im Laufe des Sommers in ihrer Brutzelle. Sie überwintern dann als vollständig entwickelte Imago (geschlechtsreife Form des Insektes) in einem braunen, seidigen Kokon.
In der Zucht wird dieser dann im nächsten Frühjahr in ein vorbereitetes Brutnest gesteckt, damit die Biene schlüpfen kann. Die Überwinterung der Kokons funktioniert in der Natur natürlich ohne menschliche Eingriffe. Allerdings gilt es zu bedenken, dass diese Bienen auf ein spezifisches Blütenangebot in deren Nähe angewiesen sind. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und die Zersiedlung der Landschaft werden ihre Habitate immer seltener, sodass die Wildbienen immer weniger geeignete Orte für die Aufzucht ihrer Brut finden. Umso wichtiger ist es, dass es auch Privatinitiativen gibt, um diese Arten zu unterstützen. Denn die harmlosen und nützlichen Mauerbienen sind auf ein kontinuierliches Blütenangebot angewiesen und benötigen enorme Pollenmengen, um ihren Nachwuchs ausreichend ernähren zu können. Mit dem Pflanzen von geeigneten Wildstauden kann ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um diese wertvollen Bestäuber zu unterstützen, mehr jedenfalls, als die moderne Landwirtschaft das leisten kann.
DIE DUNKLE ERDHUMMEL(Bombus Terrestris)
Die ca. 250 Hummelarten der Gattung Bombus sind auf der gesamten Nordhalbkugel sowie in Südamerika verbreitet. Ihre nahe Verwandtschaft zu den Bienen dürfte sich auch im englischen Wort „bumblebee“ abbilden. Die meisten leben in gemäßigten Klimazonen, ein paar wenige in den Tropen.
Die Dunkle Erdhummel ist sozusagen die Hummel schlechthin. Sie ist wahrscheinlich die Spezies, von der die Rede ist, wenn wir landläufig von Hummeln reden.
Die Dunkle Erdhummel lebt nur einen Teil des Jahres über in Kolonien. Die Königinnen überwintern meist allein in einem Erdloch, erscheinen erst wieder im Frühjahr und suchen dann nach einem geeigneten Nistplatz. Wie der Name verrät, nistet die Art gerne unterirdisch und oft werden verlassene Mäusenester besiedelt.
In Anpassung an die gemäßigten Klimazonen sind Hummeln groß, pelzig behaart und fliegen im Gegensatz zu den Honigbienen auch bei Tempera- turen deutlich unter zehn bis zwölf Grad Celsius.
Die Königin lässt sich in ihrem Nest nieder und trägt Pollen und Nektar ein. Sie baut mehrere Zellen aus Wachs, versieht eine davon mit einem Nahrungsvorrat aus Nektar und Pollen, legt mehrere Eier hinein, verschließt die Zelle von innen und bebrütet sie. Die frisch geschlüpften Larven werden von ihr mit Nektar und Pollen gefüttert. Diese Larven verpuppen sich dann und schlüpfen als sterile kleine Arbeiterhummeln. Während die Arbeiterinnen Aufgaben im Nest und die Nahrungsbeschaffung übernehmen, wendet sich die Hummelkönigin wieder der Eiablage zu, sodass die Kolonie sehr schnell größer werden kann. Die jetzt schlüpfenden Arbeiterinnen sind auch vom Körperbau größer.
Die Größe der Hummelkolonie kann von 30 bis etwa 600 Arbeiterinnen reichen. Die im Spätsommer abgelegten Eier entwickeln sich zu neuen Königinnen (Jungköniginnen) und Drohnen. Diese Nachkommen der Altkönigin verlassen das Nest und paaren sich mit weiteren Jungköniginnen und Drohnen aus anderen Kolonien.
Im Gegensatz zur Honigbienenkönigin paart sich eine Hummelkönigin meist mit nur einem Drohn. Im Spätsommer stirbt die Altkönigin, die Arbeiterinnen und die Drohnen und nur die (befruchteten) Jungköniginnen überwintern, um im folgenden Frühjahr einen neuen Zyklus zu beginnen. Das heißt es gibt bei den Hummeln in aller Regel nur eine Generation pro Jahr.
Seit einigen Jahren werden Hummeln für die kommerzielle Blütenbestäubung zum Beispiel in Folientunneln oder Gewächshauskulturen gezüchtet. Daraus hat sich sehr schnell ein weltweiter Handel entwickelt.
Hummeln sind aufgrund ihrer besonderen Fähigkeit zur Vibrationsbestäubung besonders nützlich, vor allem bei der Bestäubung von Tomatenblüten. Dabei landen die Hummeln auf der Blüte, umfassen die Blüte mit ihren Beinen oder Mundwerkzeugen und vibrieren mit ihren Flugmuskeln, sodass der Pollen aus den Staubgefäßen geschüttelt wird. Die Staubbeutel dieser Pflanzen besitzen eine kleine Pore am Ende und setzen, wenn sie in Schwingung versetzt werden, durch diese Pore den Pollen frei, damit sie ihn dann einsammeln können. Die Tomaten, aber auch Kartoffeln, Auberginen, Heidel- und Preiselbeeren sind auf diese Bestäubungsart angewiesen, weil der Wind oder die gewöhnliche Bienenbestäubung nicht ausreichen, um den Pollen aus den Staubbeuteln freizusetzen.
DIE STACHELLOSEN BIENEN (Tribus Meliponini)
Die ungefähr 370 Arten der sogenannten Stachellosen Bienen leben in den Tropen Australiens, Afrikas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas. Es handelt sich bei der Gruppe um eine Tribus, in der biologischen Systematik eine Kategorie zwischen Familie und Gattung. Gemessen an ihrer Vielfalt und wirtschaftlichen Bedeutung sind die Stachellosen Bienen bisher nicht besonders gut erforscht worden.
Weil sich diese Arten unabhängig von den anderen Bienengruppen entwickelt haben, weisen sie einige charakteristische Anpassungen und Merkmale auf: Meliponini-Weibchen besitzen einen nutzlosen Reststachel, daher rührt die Bezeichnung stachellos. Dennoch sind sie nicht wehrlos, sondern können sich zum Beispiel durch ätzende Flüssigkeiten oder Beißen gegen Feinde wehren. Sie bilden dauerhafte Kolonien mit einer einzigen Königin, sterilen Arbeiterinnen und Drohnen. Die Königin paart sich nur einmal und bleibt bis zu ihrem Tod im Nest. Für Neugründungen werden Jungköniginnen nachgezogen. Die Arbeiterinnen besitzen, wie die Honigbienen, zum Pollensammeln Körbchen oder auch Höschen anstelle von Haarbürsten.
Sie besuchen eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen, wenn sie Vorräte für den Stock sammeln. Wie die Honigbienen kommunizieren sie bei der Nahrungssuche und teilen sich die besten Trachtquellen mit, allerdings wurde der Schwänzeltanz der Honigbienen bei ihnen bislang noch nicht beobachtet. Auch sie produzieren Honig, allerdings weniger als Honigbienen, und sie lagern den Honig innerhalb ihres Nestbaus in Vorratstöpfchen. Der Melipona-Honig gilt als etwas Besonderes, denn er ist nicht einfach zu gewinnen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Stachellosen Bienen gründet vor allem in ihrer Rolle als Bestäuber von Nutzpflanzen wie Kokosnuss, Mango, Makadamianüssen und Kaffee.
Als Beispiel möchte ich von der in Südamerika heimischen Trigona spinipes erzählen, die dort auch den Namen „abelha-cachorro“ (Hundebiene) trägt. Es ist eine dunkle, schwarzbraune Biene mit spärlicher Behaarung, die Hinterbeine erscheinen rötlich braun.
Die Bienen sind außerdem in der Lage, die Duftspuren anderer Spezies wahrzunehmen und sich so Informationen zu anderen Nahrungsquellen zu verschaffen.
Ihre Staaten können 5.000 bis 100.000 Arbeiterinnen zählen. Ihre Nester legen sie auf den Ästen großer Bäume an. Die Arbeiterinnen vermischen Batumen (ein Harz-Lehm-Wachs-Gemisch)und Pflanzenmaterial wie Blatt-, Rinden- und Blütenstücke und formen daraus einen schützenden Schild bzw. eine harte Schale, die die Wabenschichten mit Brutzellen und Vorratstöpfen für Honig und Pollen umgibt.
Die Spur zur Futterquelle wird durch Pheromone markiert, sodass andere Sammlerinnen ihr folgen können. Die Biene streckt dazu ihre Zunge aus, gibt einen Speicheltropfen ab, der einen aromatischen Ester enthält, und legt so eine etwa 20 Minuten haltbare „Duftspur“ zur Nahrungsquelle, an der ihre Artgenossen entlangfliegen können.
Dass die Bienen keinen Stachel haben, tut ihrer Wehrhaftigkeit keinen Abbruch. Angreifende Bienen versuchen in Körperöffnungen wie Mund und Ohren einzudringen, um Feinde des Stocks abzuwehren.
DIE WESTLICHE HONIGBIENE(Apis Mellifera)
Die Honigbienen (Gattung Apis) sind hochsoziale Bienen und stellen die höchste Evolutionsstufe in der Bienenwelt dar. Apis mellifera dürfte die bekannteste Biene überhaupt sein.
Die Honigbienen bilden große, langlebige Staaten, die im Winter ca. 6.000 bis 8.000, im Sommer sogar bis zu 60.000 Bienen umfassen können. „Staatsoberhaupt“ ist eine Königin (auch Weisel genannt), mit einer Lebenserwartung von fünf bis sieben Jahren. Neben der Königin teilt sich ihr Volk in Drohnen – Männchen, die nur in den Sommermonaten auftreten – und in viele Tausend sterile Arbeiterinnen auf.