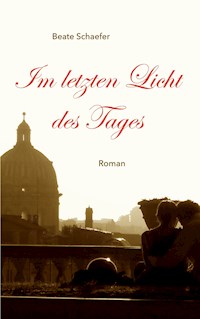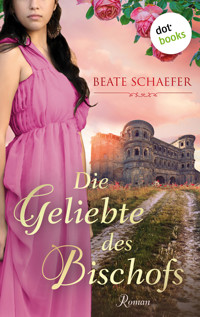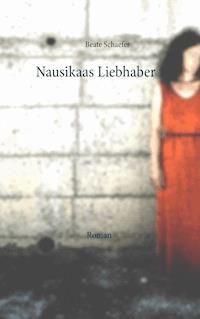
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem heißen Julitag treffen für die Ich-Erzählerin Yvonne Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinander. Vincent, ihr neuer Freund, nimmt sie zu einem spontanen Besuch bei seinen Eltern mit, die in der idyllischen Wilstermarsch ein Landhaus besitzen. Sobald Yvonne Vincents Vater gegenübersteht, erkennt sie in ihm den Mann, mit dem sie vor 17 Jahren als Austauschstudentin in Padua ein Liebesverhältnis hatte. Ein gewagtes Versteckspiel beginnt, und am Ende muss sich zeigen, ob die Vergangenheit die Macht hat, die Zukunft zu zerstören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nausikaa ist von einer unsagbaren Lieblichkeit, indem sie furchtlos Odysseus bewundert und einen solchen Gemahl zu bekommen wünscht. Die anmutige Lösung, wonach Nausikaa später Telemach, den Sohn des Odysseus, heiratet, fand sich schon bei Hellanikos und Aristoteles.
(Jacob Burckhardt)
Er schlief, schlief den Morgenschlaf eines Erwachsenen, auf dem Rücken mit halb offenem Mund, leise und regelmäßig atmend. Ab und zu schnarchte er ein wenig, aber nicht lange und nicht so, dass es mich störte. Ich fand, er sah älter aus als vierunddreißig, auf eine entspannte, naive Weise älter, sodass ich ahnen konnte, wie er später einmal aussehen würde, mit sechzig, mit siebzig vielleicht; ich stellte mir seine Ohren vor, die dann größer geworden sein würden, ich sah die Haare darin, die er dann nicht mehr abschnitt, sah die Bartstoppeln, die dann weiß oder grauweiß sein würden, nicht dunkel wie jetzt.
Ich lag da und betrachtete ihn und stellte mir vor, wie er mit siebzig aussehen würde, dabei kannte ich ihn erst ein halbes Jahr und liebte ihn seit vier Monaten, und ich war glücklich, so glücklich, dass ich aufstehen musste, jetzt, so früh an diesem Samstagmorgen, in die nur halb vertraute Küche gehen musste, hellwach, verstört von einer Nähe, die vollkommen selbstverständlich schien, obwohl sie so neu war. Ich wollte nicht bei ihm sein, wenn er aufwachte, weil ich dann Lust gehabt hätte, mit ihm zu schlafen; die Sonne ging gerade auf, und das Glück sah aus wie von Ikea, aber so ist es wohl, wenn das Glück einen schließlich einholt: gnadenlos pastellfarben, lichtdurchweht und kitschig.
In der Küche machte ich die Tür hinter mir zu, füllte den kleinen Espressokocher, den ich in diesen Haushalt eingebracht hatte, weil Vincent ausschließlich Tee trank, stellte ihn auf den Gasherd, setzte mich an den Tisch und wartete, bis der Kaffee fertig war. Ich wärmte Milch, ohne sie aufzuschäumen, goss Kaffee und Milch in einen Becher und setzte mich wieder an den Tisch, beide Hände um die Tasse gelegt. Ich atmete den Kaffeeduft ein, schaute dabei aus dem Fenster auf die Platanen und die Brücke über den Fleet. Was war schiefgegangen, dass ich so glücklich war? So unerwartet, nach all den Jahren, in denen sich kurze Affären und ein paar längere Liebesgeschichten mit Phasen extremer, selbstverordneter Enthaltsamkeit abgewechselt hatten. Sex, hatte ich erfahren, konnte ich immer bekommen, auch Bewunderung, Aufregung, Glanz. Gesucht hatte ich dagegen immer etwas ganz anderes: Vertrauen, Liebe, Zartheit, Gespräch – Gespräch vor allem, Worte, die Gedanken trugen, Gedanken über Dinge, die mir etwas bedeuteten, Gedanken, die als Kunstwerke oder Bücher verpackte Wunderkisten aufbrachen und mit ihrem Inhalt spielten. Die Art der Gedanken, die ich denken wollte, für die ich Worte suchte, Worte, die mir ein Gegenüber zukommen lassen sollte oder mit einem Blick, einer Geste, hervor kitzeln würde, änderte sich mit den Jahren. Anfangs traf meine ungeübte Stimme auf Worte wie Leben, Glück, Gott, Liebe, Schicksal, Verdammnis. Später wurde ich bescheidener, da war es der Geruch eines Stoppelfeldes im heißen August, den ich beschreiben wollte, der Geruch von warmem Staub und Stroh und Sommer, der feine, helle Staub, der sich in die Rillen der Schuhe setzte und den ich zu Hause nicht wegwischte, weil er eine Erinnerung sein würde an den letzten Sommer, den ich mit dem Hund auf den Äckern verbracht hatte; für diese Dinge, den Staub und das Stroh und für Ähnliches, suchte ich Worte, suchte ich ein Gegenüber, als ich bescheiden geworden war.
Doch an diesem Julimorgen des Jahres 2005, hier an diesem Küchentisch, in dieser nur halb vertrauten Wohnung, schienen sich endlich die Erinnerungen und Wünsche, die mich so lange gehemmt und angetrieben hatten, aufzulösen, und übrig blieb jenes hartnäckige Glück, jenes unaufwändige und doch höchst solide Gebilde Zukunft, auf dem unsere Liebe Platz genommen hatte, breit und sorglos.
Ich sah auf meine Hände und lachte leise, da fiel mir ein, dass Vincent mich neulich gefragt hatte, ob ich wüsste, dass ich manchmal im Schlaf lachte – ja, weiß ich, habe ich gesagt, aber nicht im Schlaf, sondern kurz vor dem Einschlafen oder im Aufwachen, wenn ich träge bin und an Dinge denke, die ich gelesen oder gesehen habe und die ich lustig fand wie die junge Muslimin auf der Brücke im schwarzen, bodenlangen Kleid; sie trug einen hellgrauen, fast weißen Schleier; ich habe sie nur vom Fenster im dritten Stock aus und von hinten gesehen, und der helle Schleier auf dem schwarzen Gewand war ein so starker Kontrast, eine so akkurate grafische Form, wie die Feder eines Füllhalters – Aber was ist daran so lustig, dass du im Schlaf darüber lachst?, hat Vincent mich gefragt. Ich weiß es nicht, habe ich gesagt, vielleicht habe ich nur gelacht, weil es so hübsch war; lachst du nicht auch manchmal über schöne Dinge, weil du verblüfft bist, dass es sie gibt? Kleine Spinnerin hat er mich daraufhin genannt, und mir gesagt, dass er mich dafür liebe, für genau das und für noch viel mehr. Bei jedem anderen Liebhaber hätte es mich gestört, dass er auf das Bild nicht mit einem Bild, dass er auf die Geschichte nicht mit einer Geschichte antwortete; die wichtigen Männer in meinem Leben waren Intellektuelle gewesen oder sie hielten sich wenigstens dafür; sie hatten mich enttäuscht, betrogen, verlassen, aber sie hatten mit mir geredet, mit mir konkurriert, mich herausgefordert, meinen Ehrgeiz angestachelt, selbst zu schreiben, und ihn genauso oft mit Kritik erstickt. Vincent wusste, dass ich schrieb; er hatte die paar kleinen Geschichten gelesen, die ich in den vergangenen Jahren in Literaturmagazinen veröffentlicht hatte. Er lobte sie, ermutigte mich, weiter zu schreiben und meine Geschichten an Verlage zu schicken, und freute sich fast mehr als ich, als vor drei Wochen tatsächlich ein Lektor anrief und meinte, ich habe wohl meinen Stil gefunden, es sei da offensichtlich eine Serie entstanden, etwas, das, wenn ich es verfolgte, einen Erzählungsband ergeben würde. Seltsamerweise – und dieser Prozess musste bereits vor einer Weile eingesetzt haben – fand ich meine Geschichten plötzlich zu stilsicher, zu virtuos, zu seriell. Sie erzählten immer das Gleiche, täuschten selbst zu Beginn der Erzählung nie darüber hinweg, dass es um das große Nichts ging, die Leere, die Hoffnungslosigkeit, und als ich mir den Spaß machte, einmal nur die Schlüsse der einzelnen Geschichten nacheinander zu lesen, entdeckte ich, dass sich das Ende nahezu jedes Mal im gleichen Sprachrhythmus vollzog, ein über vier oder drei Sätze schwingendes lakonisches Dannhaltnicht, und als ich daraufhin noch bemerkte, dass ich bei zwei Geschichten sogar den gleichen Schlusssatz verwendet hatte, nur durch ein einziges Wort, im Übrigen eine Konjunktion, unterschieden, da packte ich sie weg in eine Kiste, und nach einer Weile hatte ich sie fast vergessen. An die Stelle der Literatur war Vincent getreten, das neue, fremde Leben an der Seite eines Mannes, der mir von Anfang an das Gefühl gab, dass ich Partnerin war, Gefährtin, und nicht nur, wie ich es bisher gewohnt gewesen war, Geliebte oder Seelenverwandte, in der ein Künstler sich spiegeln konnte. Vincent war kein Intellektueller, kein Künstler. Er war promovierter Chemiker, arbeitete viel, spielte in seiner Freizeit Cello in einem Hobbyquartett, kochte gern und besaß Freunde, die verheiratet waren, Häuser besaßen und Kinder aufzogen. Dass er jünger war als ich, störte mich nicht, denn Vincent war geradezu atemberaubend seriös. Etwas, das mich ungemein anzog, etwas, das sogar einen sexuellen Reiz für mich zu besitzen schien, denn manchmal, wenn wir uns liebten, stellte ich mir vor, wir wären zwanzig Jahre älter, ein lang verheiratetes Paar, das immer noch scharf aufeinander ist. Intellektuell waren andere Männer für mich wichtiger gewesen, doch ich vermisste nichts. Am Anfang hatte ich mich noch öfter gefragt, ob ich nicht bald etwas vermissen würde, aber ein Gefühl des Mangels wollte sich nicht einstellen, oder es blieb zumindest nicht in nachhaltiger Erinnerung, tauchte es einmal auf. Ich dachte daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit noch verständnislos gelacht hatte, als mir meine Freundin Elaine erzählte, sie und ihr Mann redeten zu Hause nie über die Arbeit, sondern vorzugsweise über Windeln und die Zubereitung von Babynahrung. Das ist ja grauenvoll langweilig!, sagte ich zu ihr, aber sie meinte nur: Da irrst du dich komplett, es gibt nichts Spannenderes. Was nicht ganz ernst gemeint war, aber den Kern der Sache wohl traf. Seit ich Vincent kannte, konnte ich mir vage vorstellen, dass sie recht hatte.
Im Übrigen hatte ich vor dem Aufwachen heute geträumt, einen jener Träume zum Aufschreiben; ich besaß eine ganze Sammlung davon, aber schon seit ein paar Monaten hatte ich keinen mehr gehabt vor lauter Glück; ich hatte sie fast vermisst, hatte fast bedauert, dass ich sie los war, dass mich die nächtlichen Bilder in Ruhe ließen, nur weil ein Mensch mich liebte, mich neben sich schlafen ließ, mich streichelte, küsste, mich bekochte und sich eine Zukunft mit mir wünschte. Ich hatte geträumt, dass ich mich selbst ins Krankenhaus einweise, obwohl ich völlig gesund bin. Ich wandere durch die Flure, rieche den sterilen Krankenhausgeruch, höre das Summen der Automatiktüren, sehe das Licht, das durch die großen Fenster der Warteräume fällt. Eine ganze Weile empfinde ich nur Neugier, fühle mich fremd, aber nicht unbehaglich, wandere weiter und weiter, bis sie kommen, die Enge in der Kehle, der Ekel vor dem Desinfektionsmitteldunst, die Angst vor dem Eingesperrtsein. Ich versuche auf verschiedenen Wegen, aus dem Krankenhaus zu fliehen, stoße auf verschlossene Türen, gerate in Räume, in denen sich Menschen befinden, die mich bedrohen. Zuletzt finde ich jenes Büro, in dem die Entlassungsscheine ausgefüllt werden, aber man gibt mir ein Formular, dessen Buchstaben mir aus dem Blick gleiten. Ich verlasse das Büro, entschlossen, selbst einen Ausweg zu finden, irre durch die Korridore, komme schließlich in einen Gang, in dem auf absurd hohen Betten Frauen liegen, die gerade geboren haben. Sie sind verschwitzt, ihre Gesichter geschwollen, aber sie alle lächeln glückselig. Neben ihnen, auf hohen, winzigen Bettchen ohne Gitter, liegen die neugeborenen Kinder. Ich finde sowohl die Frauen als auch die Säuglinge ungemein hässlich und ekelerregend. Ein Baby streckt mir eine monströs dicke Zunge heraus. Integriert in die Betten der Mütter ist am Fußende jeweils eine Wanne, in der im Schaumbad die dazugehörigen Ehemänner sitzen, sozusagen eingeweicht zu Füßen ihrer Frauen. Auch sie lächeln glückselig. Ich ekle mich und gehe, und diesmal gelingt es mir, das Krankenhaus zu verlassen. Dann wache ich auf.
Ich muss ihn gleich aufschreiben, diesen Traum, dachte ich und wollte aufstehen, um meinen Laptop zu holen, aber da kam Vincent in die Küche, ganz verschlafen, und fasste mir von hinten an die Brust. Komm ins Bett, sagte er. Das ist ein Befehl.
Später, unter der Dusche, fragte er: Was ist? Hast du Lust auf eine kleine Autotour?
Wohin?, wollte ich wissen, während Vincent hinter mir stand, mir die Haare einschäumte und sie dann sorgfältig wie ein Friseur ausspülte. Am Anfang unserer Beziehung war mir dieser Liebesdienst peinlich gewesen, aber Vincent hatte nur gelacht und gesagt: Das geht weg. Es ging zwar nicht ganz weg, doch ich konnte es mittlerweile genießen, wie so vieles, was er für mich tat, obwohl ich immer wieder Momente hatte, in denen mir plötzlich klar wurde, dass er das für seine anderen Freundinnen auch getan hatte. Sie hatten sich daran gewöhnt, es vielleicht sogar gefordert, es jedenfalls genossen, bis Schluss war mit Vincent. Jetzt hatte er mich und seifte mir den Rücken ein, mir dabei sanft die Schultern massierend, nicht einer anderen, und ich fand mich bescheuert wegen meiner Eifersucht.
Lass dich überraschen, flüsterte er mir ins Ohr.
Nicht heute, sagte ich. Ich bin total überarbeitet. Ich brauche mal einen Tag nur für mich. Montag ist die erste Präsentation für die neue Kampagne, und ich möchte perfekt vorbereitet sein. Morgen früh wollte ich den Vortrag nochmal in Ruhe üben. Vielleicht magst du mir ja zuhören? Es sind drei ganzseitige Anzeigen, die auf drei folgenden Seiten nacheinander in derselben Ausgabe erscheinen, und wir fangen an mit ... Vincent unterbrach mich. Nicht sprechen, sagte er und stellte den Duschkopf auf Massage. Er richtete ihn genau auf den Punkt rechts der Wirbelsäule, in Höhe der Brustwirbel, wo es immer so gemein wehtat. Au!, rief ich. Eben, antwortete er ungerührt. Halt still. Ich drehte den Kopf, entdeckte, dass er eine Erektion hatte und beschloss es zu ignorieren. Montagmittag habe ich außerdem einen Termin in der Druckerei, versuchte ich es noch einmal. Er begann, mit dem harten Wasserstrahl aus dem Duschkopf meinen Po zu massieren. Was hältst du davon, wenn du kündigst und nach Hamburg kommst?, fragte er beiläufig. Werbeagenturen gibt es hier so viele wie in keiner anderen deutschen Stadt. Wir suchen uns eine größere Wohnung und ...
Da war es. Ich hatte es erwartet, aber nicht, dass es so schnell kommen würde. Kündigen. Zusammenziehen. Das große Wir. Und dann ... Kinder, ein Haus irgendwann ...
Warum sagst du nichts?, fragte Vincent mitten in meine Gedanken.
Ich schwieg.
He, sag was! Er stupste mich an.
Ich kann nicht, war alles, was ich herausbrachte.
Vincent lachte. Warum? Ist mein Vorschlag so abwegig?
Ich wandte mich ganz zu ihm um, schaute ihm kurz in die Augen und dann auf seine Füße. Große, solide Füße mit gepflegten Zehennägeln. Er achtete auf sich, sogar dort. Nein, nicht abwegig, sagte ich kleinlaut.
Aber?
Aber ... aber ich habe das Gefühl, angekommen zu sein, ohne dass ich überhaupt aufgebrochen wäre!, rief ich trotzig.
Er lachte erneut. Na und?, meinte er.
Ich begriff, dass er mich nicht verstand. Nahm an, dass es zu viel verlangt wäre, zu wollen, dass er verstand. Also hob ich den Kopf und lächelte ihn an. Ich denk drüber nach, sagte ich. Den Rest sagte ich nicht, denn ich wusste selbst noch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wartete seit fünf Tagen auf meine Periode. Normalerweise kam sie regelmäßig, so präzise und planbar, dass wir nur während der fruchtbaren Tage mit Gummi verhüteten. Und jetzt ... Wir hatten über Kinder gesprochen. Vincent wünschte sich Kinder, wenigstens eins. Ich war immerhin schon siebenunddreißig, er drei Jahre jünger. Wir hatten darüber gesprochen wie über eine Selbstverständlichkeit. Irgendwie schien für ihn alles klar. Von Anfang an. Es gab kein vielleicht. Oder besser später. Kein Zögern, kein Warten, eigentlich keine Zweifel. Und doch hatte ich Angst. Angst davor, schwanger zu sein, ohne dass ich mich klar entschieden hatte. Deshalb hatte ich auch noch keinen Test gemacht. Ich wollte Zeit schinden, sicher sein. Welche Art von Sicherheit ich noch begehrte außer Vincents Liebe, seinen Wunsch, mit mir zusammen zu sein, seine klaren „Absichten“, wie man das früher nannte, wusste ich nicht genau. Hätte er mich gefragt, ob ich ihn heiraten wollte, hätte ich vermutlich ja gesagt. Hätte meine beste Freundin mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihn zu heiraten, hätte ich gesagt: Vielleicht, aber es geht mir alles zu schnell. Warum gerade jetzt? Warum gerade ich? Ein Buchtitel fiel mir ein, „Verfolgte des Glücks“. Was klang wie ein Groschenroman, war mit Anfang zwanzig jahrelang eines meiner Lieblingsbücher gewesen. Die Geschichte der Henriette Vogel, Seelenfreundin Heinrich von Kleists, die sich am Wannsee gemeinsam mit ihm erschoss.
Vincent stellte das Wasser ab und fuhr sich ungelenk mit einer Hand durchs nasse Haar. Also, was ist jetzt mit dem kleinen Ausflug?
Ich schwieg.
Bitte, sagte er.
Und du verrätst mir nicht, wohin wir fahren?
Er schüttelte den Kopf. Nicht weit, versicherte er. Nur raus aufs Land.
Hinter Itzehoe, als wir die Autobahn verließen, nahm Vincent endlich den Bleifuß vom Gaspedal, und ich ließ den Haltegriff los. Dabei fing ich einen kurzen Blick Vincents auf.
War es so schlimm?, fragte er und grinste zufrieden.
Ich wollte ihm den Spaß an seinem neuen BMW nicht verderben, lächelte und sagte: Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt.
Wir fuhren jetzt am Fuß der Geest entlang, auf einer schmalen Landstraße, in ganz gemütlichem Tempo. Vincent legte seine rechte Hand auf mein Knie, ohne Druck, ohne Flirt, nur warm und Vertrauen erweckend. Rechts von uns die sandigen Hügel mit ihren niedrigen Eichenwäldern, gesäumt von Ginster. Links von uns die Marsch, grün, unendlich grün, Weizenfelder, noch nicht ganz reif, Wiesen, gemäht, dösende Kühe, hellbraune Pferde mit schwarzen Mähnen, schwarzen Schweifen und schwarzen Beinen. Rote, spitzgiebelige Höfe mit den typischen Wellblechscheunen nebenan. Ulmenalleen, Birkenalleen, ein Stück Moor. Diese virtuose Sommerfläche. Diese spektakuläre Abwesenheit von Spektakel, wie sie jenem norddeutschen Kulturland eigen ist, eingedeicht, befriedet, fruchtbar. Nur scheinbare Trägheit, der Himmel so überspannt, als wolle er das flache Land an den äußeren Rändern zu sich emporreißen. Vertikal gegen Horizontal. Höchste Konzentration widerstrebender Energien. Mir fiel ein, dass auf den Bildern der alten Meister der Horizont, und sei die Landschaft auch noch so eben, niemals ganz gerade ist, immer etwas geneigt oder sogar gewölbt; strichgerade Horizonte malen nur Dilettanten; aber wenn der Horizont für uns, die wir uns ja im rechten Winkel zum Erdboden wähnen, nicht gerade ist, müsste auch jede Vertikale, ein Kirchturm beispielsweise, eine Windmühle oder wir selbst, ein wenig aus der Senkrechten gekippt sein, oder war es nur der Trick der Maler, die die perfekte Illusion von Natürlichkeit durch genaueste mathematische Berechnung ihres Bildraumes herzustellen wussten?
Draußen in der Marsch entdeckte ich im weißen Licht einen Kirchturm mit bleistiftspitzem Dach; ganz nah ganz weit und durchaus nicht aus der Senkrechten geneigt, was mir meine Spekulationen fragwürdig erscheinen ließ, denn ich war kein Geometer und würde die Gesetze der Malerei in dieser Hinsicht nur mit dem Gefühl begreifen, nicht mit dem Verstand, ebenso wie ich, die ich einmal versucht hatte, mich auf dem platten Land mit dem Fahrrad einem bequem erreichbar scheinenden Kirchturm zu nähern, zwar bald erkannte, dass das Auge in dieser Gegend hier ein unzuverlässiger Entfernungsmesser ist, jedoch niemals die wissenschaftliche Erklärung dafür begriff, weshalb ich radelte und radelte und der Kirchturm auch nach einer halben Stunde noch ebenso nah wie entfernt aussah.
Entlang der Landstraße kamen vier oder fünf Häuser ins Blickfeld, weiter hinten war ein Raiffeisenmarkt, ihm gegenüber eine Rosenzucht; rechts von uns, am Straßenrand, stand eine Dönerbude, direkt an der Bushaltestelle. Wie der Ort hieß – keine Ahnung – ich hatte das Schild verpasst. Vincent bog so plötzlich links ab, dass meine Hand sich automatisch wieder um den Haltegriff krallte. Einspurige Geleise, die wir überquerten, dann eine Allee marscheinwärts, scheinbar schnurgerade, links Felder und Marschweiden, rechts zwei, drei alte Bauernhäuser in ähnlicher Bauweise, spitzgiebelig, die Schmalseite der Straße zugewandt, ihnen gegenüber längsseits die obligate Scheune. An einer der Scheunen ein großes gemaltes Schild „Fine English Antiques“.
Gleich darauf bremste Vincent und fuhr auf den kiesbestreuten Hof, zu dem diese Scheune gehörte. Dort parkten bereits ein orangefarbener VW-Bus mit weißem Aufbau und ein cremefarbenes altes Mercedes-Cabrio mit roten Ledersitzen.
Du meine Güte, bemerkte Vincent und stellte den Motor aus. Die Schmarotzer sind da. Und der Mittler.
Der Mittler?, fragte ich verständnislos.
Er heißt eigentlich Maximilian Schrey, aber wir nennen ihn nur den Mittler.
Wir?, wiederholte ich zunehmend panisch. Könntest du mir bitte sagen, wo wir hier sind? Wer wohnt hier?
Meine Eltern.
Ich schluckte. Nach einem Moment: Ich dachte, die leben in Berlin.
Dort haben sie eine Wohnung. Der Hof gehörte meinen Urgroßeltern. Zuletzt dem Bruder meiner Mutter. Er ist vor sechs Jahren gestorben. Seine Kinder konnten nichts damit anfangen, da haben ihn meine Eltern gekauft. Meine Mutter ist seitdem meistens hier, mein Vater kommt am Wochenende. Es gibt einen guten Golfplatz in der Nähe ...
Aha, sagte ich, dann sagte ich eine Weile gar nichts und schaute nur. Schaute links auf das alte rote Haus, einstöckig, mit weißen Fenstergewänden und der Zahl 1883 in schief hängenden Metallziffern unter dem Giebel. Schaute auf den spärlichen Kies im Hof, zwischen dem das Gras wuchs. Schaute rechts auf die Scheune, unten weiß getünchtes Mauerwerk, oben helles Wellblech mit großen neuen Fenstern. Ich schaute auf die Blumenbeete, die das schmucke Portal des Haupthauses – mit seinem weißen Türstock und zwei schlanken Säulen fast ein Portikus – einrahmten. Die blaugestrichene Holztür hatte ein rundes von weißem Ornament gerahmtes Fenster, dahinter ein blauweiß karierter Vorhang. Zu beiden Seiten des Portals ragten zweieinhalb Meter hohe Stockrosen empor, rosa und weinrote Obelisken. Daneben fast obszön fette Edelrosen, weiß und rosa, noch übertroffen von den Lilienstauden in Rosa und Lachsrot. Über die Ränder der Einfassung aus Backsteinen kroch Kapuzinerkresse in Cadmiumorange und Gelb. Am Regenrohr rankte sich kobaltviolette Clematis bis zum Dach. Vor dem Haus, fast an der Straße, hatte ich, als wir einbogen, zwei riesige, uralte Birken gesehen. Weiter hinten wuchs zwischen Haus und Scheune dichtes, weiß blühendes Buschwerk und grenzte den Hof hufeisenförmig ab. Selbst bei geschlossenen Wagenfenstern hörte man Vogelgezwitscher. Ansonsten Stille. Idylle. Perfekte Idylle an einem perfekten Julitag.
Ich will nicht, sagte ich.
Vincent nahm meine Hand und küsste sie zärtlich. Keine Angst, sie beißen nicht.
Wissen sie, dass wir kommen?
Er schüttelte den Kopf.
Dann will ich nicht, sagte ich.
Er schwieg und wartete.
Wissen sie denn überhaupt von mir?, fragte ich.
Nur, dass es dich gibt.
Ich holte tief Luft. Findest du es nicht ein bisschen zu früh?
Vincent lachte. Nein, erwiderte er dann ruhig.
Aber ich, entgegnete ich.
Warum?
Weil ... weil ..., stammelte ich. Ich habe ... ich hätte dann wenigstens was anderes angezogen. Nicht bloß das Fähnchen hier. Ich zerrte an einem blauen Spaghettiträger.
Vincent wandte mir den Kopf zu und musterte mein Outfit. Sein kritischer Blick irritierte mich; er sah mich an, als ob er mich an diesem Morgen noch gar nicht vollständig wahrgenommen habe, als ob er tatsächlich prüfe, ob mein Aufzug dem Anlass angemessen sei. Das „Fähnchen“, wie du es nennst, ist völlig in Ordnung, sagte er dann ernsthaft; und nun glaubte ich ihm erst recht nicht.
Wir haben noch nicht mal Blumen dabei. Oder eine Flasche Wein, wandte ich ein.
Blumen gibt es hier, wie du siehst, genügend. Und an Wein mangelt es in diesem Haushalt auch nicht.
Aber ...
In diesem Augenblick kamen zwei Kinder um die Hausecke gelaufen, Hand in Hand, Mädchen, dunkle Locken, etwa sechs oder sieben Jahre alt. Zwillinge. So gleich, dass das Auge es nach wenigen Sekunden aufgab, auch nur den geringsten Unterschied entdecken zu wollen. Als sie uns bemerkten, blieben sie stehen, blickten äußerst ernsthaft herüber, tuschelten dann kurz, kicherten und rannten Hand in Hand davon. Gleich darauf waren sie hinter dem Haus verschwunden.
Vincent öffnete seine Wagentür. Komm, forderte er mich auf.
Als wir ausstiegen, kamen die Tiefflieger. Laut, fast unvorstellbar laut, und so schnell, dass ich sie mit dem Blick nicht erwischte. Mein Herz raste, so erschrocken war ich. Die Tiefflieger hatte ich ganz vergessen. Ich war lange nicht mehr auf dem platten Land gewesen und nahm ihre Existenz mit einer gewissen Erleichterung erneut in mein Gedächtnis auf. Et in Arcadia ego. Der Tod auch in Arkadien. Zwar nicht ganz der Tod, aber auch ein Zerstörer. Ruhestörer, Idyllenzerstörer. Vincent ging mir voraus, und jetzt sah ich auch den Hund, der vor dem Eingang in der Sonne gelegen hatte, grau und flach wie eine Fußmatte. Er erhob sich mühsam, als ob ihm etwas wehtäte, und kam dann schwanzwedelnd mit stockenden Schritten auf uns zu. Es war ein riesiges, mageres Tier mit eisgrauem, drahtigem Fell und scheuen, braunen Augen. Das ist Chevalier, sagte Vincent. Ein irischer Wolfshund. Er ließ ein graues Hundeohr liebevoll durch seine Hand gleiten.
Hallo, Chevalier, sagte ich, und der Hund sah mich einen Moment lang aufmerksam an, ehe er sich abwandte, zurück zu seinem Sonnenplatz vor der Haustür trottete und sich steif und vorsichtig niederließ.
Lass uns hier links ums Haus herum gehen, meinte Vincent. Bestimmt sind alle auf der Terrasse.
Wir nahmen also denselben Weg, den die Zwillinge vor uns gekommen und gegangen waren. Dabei stellte ich fest, dass das Haus auf dieser Seite einen Vorbau besaß, niedriger als das Hauptgebäude, und mit einem Erker als Abschluss, der hohe Fenster hatte, die vermutlich wenig nützten, denn direkt davor standen mehrere hohe Fichten, die das Licht nahmen und den Boden mit ihren braunen alten Nadeln übersäten, sodass kein Grashalm dort wuchs. Ein gepflasterter Weg, uneben und mit teils wackligen Platten, führte ums Haus herum. Gleich darauf befanden wir uns auf der Terrasse, von der aus der Blick weit ins Marschland ging, über den hinteren Teil des Gartens hinweg, wo zwischen zwei alten Apfelbäumen eine Hängematte schaukelte und wo ein angepflocktes Schaf gemächlich weidend im Kreis zog. In der Hängematte befand sich ein Wesen, von dem man nur ein Jeansknie sah sowie einen Unterarm plus Hand plus das Cover eines Buches. Auf der Terrasse saßen zwei Frauen an einem großen Holztisch. Sie hatten offenbar gerade begonnen, zwei riesige Weißkrautköpfe kleinzuhobeln. Ein Mann lag hinter einer Zeitung verborgen in einem Liegestuhl. Neben ihm stand ein Kinderwagen, dessen Verdeck gegen die Sonne zusätzlich mit einer Stoffwindel geschlossen war.
Hallo, begrüßte Vincent die Terrassengesellschaft und beeilte sich dann, die ältere der beiden Frauen von hinten zu umarmen und auf die Wange zu küssen. Hallo, Mama. Ich habe Yvonne mitgebracht.
Die Angesprochene stand auf, legte den Hobel weg, wischte sich die Hände an einem Küchenhandtuch ab und zog ihre Schürze aus. Dann erst reichte sie mir die Hand. Willkommen, sagte sie kühl. Was für eine Überraschung. Und zu Vincent gewandt: Männe ist unterwegs, eine neue Gasflasche kaufen und Holzkohlen für den Grill.
Männe ist mein Vater, klärte Vincent mich auf.
Der Mittler ist mit ihm gefahren, fügte seine Mutter hinzu.
Und dies hier ist Julia Panndorf-Schöner, stellte Vincent vor. Julia, das ist Yvonne.
Ich gab Julia Panndorf-Schöner die Hand. Mein Mann, sagte sie dann und wies auf den Zeitungsleser. Er hatte die Zeremonie verfolgt, legte nun die Zeitung weg und kam herüber. Herbert Panndorf, begrüßte er mich, und ich gab auch ihm die Hand. Das Baby dort ist Laura, fuhr Julia fort. Wo die Zwillinge sind, weiß ich im Moment nicht, aber ...
Sie haben uns bereits besichtigt, als wir ankamen, mischte sich Vincent ein. Yanna und Ulrika, fügte er zu meiner Information hinzu.
Ich nickte und war nicht sicher, auch nur einen der Namen behalten zu haben.
Vincent hat gar nicht gesagt, dass er Sie heute mitbringen will, begann seine Mutter das Gespräch. Sie war relativ groß, hager, mit klassischem Profil und tiefen Magenfalten seitlich der Nase bis hinunter zu ihrem Mund, dessen Oberlippe ein wenig ausgeprägter war als die Unterlippe – das einzig Verspielte, Mädchenhafte in einem herb-arroganten Gesicht. Melancholische graue Augen dominierten dieses Gesicht, dessen Ausdruck in unbeobachteten Momenten ins Mürrische umschlagen mochte. Ihr Haar war so gut gefärbt, dass es natürlich braun wirkte, ihre Hände waren groß, energisch, mit gepflegten Nägeln, die perfekt farblos gelackt waren, und sie trug zur braunen, schmalen Hose eines Edel-Labels einen Aigner-Gürtel, ein gelbes Poloshirt und, trotz der sommerlichen Temperaturen, ein Hermès-Tuch. Hamburger Chic, wozu auch ihr deutlicher Hamburger Akzent passte. Sie mochte Ende fünfzig sein und war auch jetzt noch eine attraktive Frau. Vincent sah ihr sehr ähnlich, was mich rührte und mich für sie einnahm.
Wir haben uns spontan entschlossen, sagte Vincent. Ich hoffe, es passt. Wenn nicht, können wir auch ...
Nein, nein, bleibt ruhig da. Es gibt Krautsalat mit Speck zum – allerdings verspäteten – Mittagessen, dazu Gegrilltes.
Sie sind aus Hamburg?, fragte mich Herbert Panndorf.
Nein, aus Köln, antwortete ich.
Peinliches Schweigen.
Vincent hat bisher nur einmal eine seiner Freundinnen mitgebracht, bemerkte seine Mutter. Sie waren verlobt …
Susanne!, fuhr Vincent auf, und so erfuhr ich auch ihren Vornamen. Das ist sechs Jahre her!, fügte er hinzu.
Seine Mutter schwieg, und er sah sich zu der Erklärung genötigt: Nein, wir sind nicht verlobt, okay?
Habt ihr euch auf der Arbeit kennengelernt?, wollte Julia wissen.
Sozusagen, erwiderte Vincent. Bei einem Geschäftsessen. Yvonne arbeitet für die Werbeagentur, die die Kampagnen für meine Firma entwirft.
Dann sind Sie Grafikerin?, fragte seine Mutter.
Nein, ich bin Kundenberaterin.
Dann sprechen Sie sicher Englisch?, erkundigte sie sich.
Darum kommt man in dieser Branche nicht herum, erwiderte ich lächelnd.
Yvonne hat Kunstgeschichte und Romanistik studiert, verkündete Vincent. Sogar in Italien.
Wo denn in Italien?, fragte Julia.
Vincent war schneller als ich. In Palermo, sagte er.
Ich liebe Sizilien, schwärmte die Frau mit dem Doppelnamen. Als ich vor vier Jahren in Taormina war ...
Wir sind hier alle sehr anglophil, unterbrach Susanne Schmidt den drohenden Exkurs.
Meine Mutter handelt mit englischen Antiquitäten, beeilte sich Vincent anzufügen. Aber mehr als Hobby.
Mir fiel nichts ein, was ich dazu hätte sagen können, und das Gespräch brach ab. Herbert Panndorf räusperte sich und wollte zu seiner Zeitung zurückkehren, als Stimmen und Schritte hörbar wurden.
Da kommt Männe, rief Frau Schmidt sichtlich erleichtert.
Ich drehte mich um und sah zwei Männer herankommen. Der eine trug eine Gasflasche, der andere einen Sack Holzkohle. Ich schaute hin, schaute noch einmal hin, wurde knallrot und spürte den fast unwiderstehlichen Impuls, zu lachen. Es ging alles so schnell, dass ich einen Moment lang nicht wusste, ob ich nicht tatsächlich gelacht und gesagt hatte: Verzeihung, gnädige Frau, aber mit Männe hatte ich vor – tja, vor wie vielen Jahren? – vor siebzehn Jahren ein Verhältnis – nur, dass ich damals nicht wusste, dass man ihn Männe nennt.
Sekundenlang starrte ich Susanne Schmidt an, mein Herz raste, und ich überlegte hektisch: Habe ich nun gelacht und diese Dinge zu ihr gesagt oder nicht? Da sie und auch die anderen ganz ruhig blieben und mich erwartungsvoll anblickten, musste ich es mir wohl bloß eingebildet haben. Immer noch spürte ich das hektische Pulsieren meiner Halsschlagader. Bestimmt sahen es alle. Vorsichtig wandte ich den Blick meinem vor langer Zeit Geliebten zu, der auch mit sechzig immer noch wunderschön war – vielleicht ein wenig breiter, ein wenig grauer, ein wenig kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte –, und wieder zuckten meine Mundwinkel. Uwe Schmidt hatte immer noch diese dicken, glänzenden, immer etwas zu langen Locken, die in der Mitte des Kopfes ein Büschel bildeten, was ihm im Profil, in Kombination mit der hohen Stirn, den lebhaften schwarzen Augen, der geraden Nase, dem schmallippigen, spitzen Mund und dem nicht sehr ausgeprägten Kinn etwas Kiebitzhaftes gab. Ich stand da, mir war immer noch nach Lachen, aber dann sah ich die Panik in seinen Augen, wusste, dass auch er mich erkannt hatte, und dass ihm nicht zum Lachen war.
Mein Vater, sagte Vincent. Papa, das ist Yvonne.
Wir gaben uns die Hand. Wenn es ein Film wäre, dachte ich, würde die Kamera diesen Händedruck in Zeitlupe filmen. Mir kam es vor wie Zeitlupe, aber wahrscheinlich ging es ganz schnell.
Maximilian Schrey, stellte Vincent den Mittler vor. Ich schüttelte auch ihm die Hand, aber ich glaube nicht, dass ich ihn wahrnahm. Siebzehn Jahre, dachte ich. Immer und immer wieder. Siebzehn Jahre. Und dann wäre ich am liebsten weggerannt, so weit weg wie möglich, weiter als irgend möglich.
Hallo, sagte ich, und es klang in meinen Ohren wie von weit her.
Mein Sohn hat gar nicht gesagt, dass er Sie heute mitbringen will, bemerkte Uwe Schmidt.
Seine Stimme. Da war sie wieder. Nach so langer Zeit. Die Stimme, von der ich gedacht hatte, ich würde sie nie wieder hören.
Das hat Mama auch gesagt. Stören wir?, fragte Vincent lächelnd.
Aber nicht im Geringsten, antwortete sein Vater. Er mied meinen Blick. Ich will nur gleich die Gasflasche anschließen. Sonst hat der Herd keinen Saft. Und der Mittler soll den Grill aus der Garage holen.
Kann ich was helfen?, fragte Vincent eifrig.
Nimm die Gasflasche, sagte Maximilian Schrey, der den Kohlensack wieder aufnahm. Dein Vater ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ich möchte mir gern die Hände waschen, piepste ich.
Das Bad ist im Flur, zweite Tür links. Sie müssen durchs Wohnzimmer und dann nach rechts, erklärte Susanne Schmidt hastig.
Von der Veranda aus konnte man entweder durch die offenen Glastüren direkt ins Wohnzimmer gehen oder nebenan durch eine einfache Tür in die Küche. Ich betrat das Wohnzimmer mit den roten Terrakottafliesen. In der Mitte des Raumes gab es einen enormen offenen Kamin. An den Wänden alte Gemälde, Porträts und Landschaften in realistischer Manier, neunzehntes Jahrhundert, zweitklassig, aber dekorativ. Möbel in verschiedenen Stilen, aus verschiedenen Hölzern, Kirschbaum, Wurzelholz, Eiche, Mahagoni. Scheinbar zufällig ausgewählt, trotzdem ein Ensemble. Ach ja, ich erinnerte mich. Englische Antiquitäten. Wo immer Platz dafür war, standen Silberschalen mit getrockneten Rosenblättern. Im Hintergrund eine Bücherwand vom Boden bis zur Decke, mindestens fünf