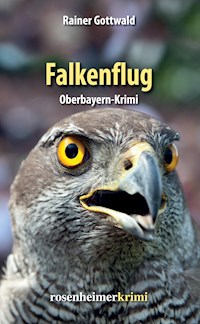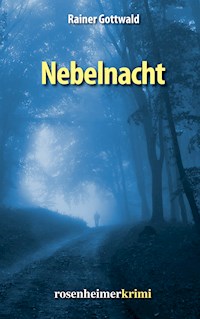
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In einer nebligen Herbstnacht wird im Hof eines Landgasthofes die Leiche einer Studentin abgelegt. Den Ermittlern ist schnell klar, dass sie an einem anderen Ort ums Leben gekommen sein muss. Kommissar Melchior und sein Team stoßen bei ihren Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod der jungen Frau und einem Bootsunglück, das sich einige Monate zuvor auf dem Chiemsee ereignet hat. Bald wird klar, dass in diesem Fall vieles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten der Romanfiguren mit lebenden oder toten Personen sind nicht beabsichtigt, ebenso wenig eine Beschreibung der Verhältnisse in tatsächlich existierenden Institutionen, Organisationen oder Vereinigungen.
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Lektorat und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH,Heimstetten
Titelfoto: © andreiuc88 – fotolia.com
eISBN 978-3-475-54400-2 (epub)
Worum geht es im Buch?
Rainer Gottwald
Nebelnacht
In einer nebligen Herbstnacht wird im Hof eines Landgasthofes die Leiche einer Studentin abgelegt. Den Ermittlern ist schnell klar, dass sie an einem anderen Ort ums Leben gekommen sein muss. Kommissar Melchior und sein Team stoßen bei ihren Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod der jungen Frau und einem Bootsunglück, das sich einige Monate zuvor auf dem Chiemsee ereignet hat. Bald wird klar, dass in diesem Fall vieles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint …
Prolog
Manche Nächte sind dunkel, andere mondhell. Im herbstlichen Bayern überwiegen die Nächte, in denen man fast gar nichts mehr sieht – außer Nebel. Die Scheinwerfer des Autos, das südwestlich von Rosenheim zwischen Thansau und Stephanskirchen über die Landstraße kroch, durchschnitten diesen Nebel nicht, sie diffundierten nur in dem wabernden Leuchten und machten es demjenigen, der da hinter dem Steuer saß, nicht wirklich leichter, den richtigen Weg zu finden.
Das Auto hielt auf eine Hofeinfahrt zu und bremste. Ein Beobachter, der Zeuge der Szene geworden wäre – wenn es ihn denn gegeben hätte – hätte die grellroten Bremslichter gesehen, dann das Knirschen der Reifen auf dem Kiesboden der Hofeinfahrt gehört und dann nach einer Weile zuerst das Öffnen, gefolgt vom Schließen einer Autotür. Er hätte versucht, etwas zu erkennen, aber einsehen müssen, dass gegen den Nebel kein Kraut gewachsen war, und sich weiter nur auf sein Gehör verlassen müssen. Er würde das Öffnen der Kofferraumklappe gehört haben, einige Geräusche, die kaum zu identifizieren waren, darunter einige angestrengte, keuchende Atemzüge, dann aber endlich wieder ein eindeutiges Geräusch, das klang, als würde etwas über den Kiesboden geschleift.
Schließlich noch das Zuschlagen des Kofferraumes, das Öffnen der Fahrertür, wieder das Zuschlagen, Motorengeräusch – und dann hätte der Beobachter sehen können, wie sich die roten Lichter langsam von ihm weg bewegten, um nach nur wenigen Metern vom Novembernebel verschluckt zu werden. Aber, wie gesagt, so einen Beobachter gab es nicht in jener Nacht …
1.
Handyalarm ist schlimm. Handyalarm plus Vibrationsalarm ist schlimmer. Handyalarm plus Vibrationsalarm plus schlafender Kriminalkommissar um halb acht Uhr morgens an einem Sonntag ist eine Brutalität! Vor allem dann, wenn sich der betreffende Kriminalkommissar nicht in seinem angestammten Bett befand und sich zuerst mühsam orientieren musste. Das Handy lag auf einem Nachttisch – nicht seinem Nachttisch - und vibrierte mit einer solchen Heftigkeit, dass Caspar Balthasar Melchior das Wettrennen gegen die Schwerkraft verlor und sich mit einem Seufzer nach dem auf den Boden gefallenen Telefon strecken musste.
»Melchior, vermutete Uhrzeit: fünf Uhr dreißig«, meldete er sich mit belegter Stimme.
»Oh! Aha, sieben Uhr dreißig ... Knapp daneben ist auch vorbei. Was gibt’s?«
In weiser Voraussicht der Dinge, die jetzt unweigerlich kommen würden, schlug Melchior schon einmal die Bettdecke zurück, und sofort wurde ihm unangenehm kalt.
»Ja … natürlich bin ich wach – jetzt! … Aha! … Sagen Sie, können sich die Leute keine andere Zeit zum Sterben aussuchen? Klasse! … Ja, natürlich komm ich. Wo? … Wo ist das? – Wie weit ist das draußen? … In Ordnung. In einer halben Stunde bin ich da. Geben Sie mir die genaue Adresse per SMS für mein Navi … Alles klar. Schönen Sonntag noch!«
Das Letzte war ironisch gemeint. Es hätte ein wenigstens halbwegs erträglicher Sonntag werden können. Aber jetzt war diese Hoffnung verloren … A propos verloren: mitten hinein in diesen wenig erfreulichen Gedankengang verlor Melchior schon das zweite Duell des frühen Tages. Nachtkästchen versus kleiner Zeh 1:0. Humpelnd und fluchend ging Melchior Richtung Bad. Nicht sein Bad, natürlich.
Melchior verbrachte diesen Novembersonntag nicht in seinem angestammten Heim, sondern in einer kleinen Pension am südlichen Stadtrand von Rosenheim. Nicht dass er es so schön gefunden hätte, in einer Pension zu wohnen, sondern weil er aus seiner eigenen Wohnung ausgezogen war. Und ausgezogen war er, um genau zu sein, zwei Tage zuvor, pünktlich zum Wochenende, weil es ihm angebracht erschien, nicht mehr unter einem Dach mit seiner zukünftigen Ex-Frau zu leben, da er nun schon einmal beschlossen hatte, die Scheidung einzureichen.
Deshalb war Melchior heute in ungewohnter Umgebung aufgewacht. Nichts gegen die kleine Pension in Aising, man gab sich dort alle Mühe, den Gast gut zu versorgen. Auch das Essen war durchaus genießbar. Aber Melchior vermisste sein Bett, sein Badezimmer, seinen Fernseher und noch einiges mehr. Trennungsschmerz? Nein! Den empfand er höchstens wegen seines Sohnes, ganz bestimmt nicht um der Frau willen, mit der er die letzten elf oder zwölf Jahre verbracht hatte. Schlussendlich hatte er nur die Konsequenz aus diesem Debakel namens Ehe gezogen und war gegangen. Manche Ehen sollten, wenn sie schon unglücklicherweise geschlossen worden waren, wenigstens beizeiten beendet werden. Diese war so eine – gewesen … Was würde nun kommen? Noch keine Ahnung. Aber seine Scheidungsklage würde spätestens am Montag bei der gegnerischen Partei ankommen. Im Moment konnte er nicht mehr tun, als in dieser kleinen Pension zu bleiben – mit dem bisschen Zeug, das er mitgenommen hatte. Er hatte eigentlich heute zu Hause vorbeischauen wollen, um Nachschub zu holen und vielleicht ein paar Worte auszutauschen, wobei er befürchtete, dass besagter Austausch ohnehin nichts bringen würde. Mal sehen, ob es überhaupt dazu kam.
Wie schon erwähnt, schlurfte Melchior leicht hinkend ins Badezimmer, knurrte verkniffen »Abruhigen, Alter!« Das war seine eigene Wortschöpfung – oder die von Schweingruber? Er beschloss, ganz einfach darauf zu hoffen, dass ihm wenigstens ein schöner Mord beschieden sein und die Arbeit wieder mehr Spaß machen würde als in letzter Zeit.
2.
Was wäre man ohne die moderne Technik? Tatsächlich wäre Melchior, dessen Orientierungssinn von dem einer Brieftaube etwa so weit entfernt war wie die Erde vom Mond, ohne sein Navigationsgerät sicher erst eine Stunde später angekommen. Ja, sicher. Das war eine gut ausgebaute Hauptstraße. Sie verband zwei weltberühmte Orte miteinander, Thansau und Stephanskirchen. Aber dennoch: Die kleine Abzweigung hinüber zum Waldrand, wo der Gasthof stand, hätte Melchior auch bei längerer Suche nicht gefunden, wenn ihm das Navi nicht eindeutig: »Die nächste Straße links!« befohlen hätte. Dabei musste man ihm allerdings zugutehalten, dass die Sichtweite auf Grund des Nebels nicht mehr als vielleicht zwanzig Meter betrug und er daher den Gasthof von der Straße aus gar nicht sehen konnte.
So verging in der Tat nicht mehr als eine halbe Stunde vom Zeitpunkt des Anrufes in der Pension bis zum Anhalten des … o ja! Inzwischen fuhr Melchior anstelle eines kleinen Japaners einen ebenso kleinen Koreaner! Also bis zum Anhalten des kleinen Koreaners im Hof der Gastwirtschaft.
Melchior stieg aus und zog erst einmal fröstelnd den Kragen seines Mantels hoch. Die nasse Kälte war ihm – auf Grund der schwächelnden fernöstlichen Heizung – schon während der Fahrt unangenehm in die Knochen geschlichen, ganz besonders in Kontrast zur behaglichen Wärme des Bettes, obgleich es nicht sein Bett war. Aber jetzt schlug der oberbayerische November mit aller Macht zu! Er atmete Nebel ein, und er atmete Nebel aus. Nahe an einem Schüttelfrost schlug er die Autotür zu und ging die letzten Meter zu Fuß zum Ort des Geschehens.
Er durfte nicht vergessen, sich ein paar warme Pullover einzupacken, wenn er nach Hause kam – wenn!
Doktor Gerstner war bereits da. Wie er es schaffte, immer schneller zu sein als alle anderen, hatte Melchior nie herausbekommen! Er hatte ihn im Verdacht, angezogen und mit dem Arztkoffer neben dem Bett zu schlafen. Ansonsten standen nur die fast obligatorischen zwei Streifenpolizisten herum, die als Erste herbeigerufen worden waren und dann die notwendigen Meldungen erstattet hatten.
»Morgen, Kollegen, so eine Saukälte, was?« Gut, man hätte eine Konversation sicher intellektueller eröffnen können, aber das durfte man bei so einem Wetter nicht von Melchior erwarten.
Die Kollegen nickten zustimmend, was sonst. Sie waren gerade mit der ordnungsgemäßen Absperrung des Tatortes beschäftigt – und vermutlich auch damit, selbst möglichst wenig zu schlottern.
Melchior wandte sich dem Pathologen zu: »Morgen, Doc. Was haben wir denn da? Wer konnte da mit seinem Ableben nicht warten, bis ich ausgeschlafen hatte?«
Gerstner sah kurz auf. »Ach, unser Herr Oberkommissar! Tagchen auch. Nicht ausgeschlafen? Genau so sehen Sie auch aus…«
Er stutzte, sah Melchior genauer an, dann legte er den Kopf schief und kniff die Augen zusammen. Nach einem medizinisch-fachmännischen Blick ergänzte er: »Genau gesagt sehen Sie scheußlich aus, Melchior!«
»Ja, ja. Dank auch schön! Nur immer drauf auf die Kleinen. Wenn’s Spaß macht … Kommen wir lieber zum Geschäft!«
Gerstner deutete auf die Leiche. »Ja, nun: weibliche Leiche, Anfang bis Mitte zwanzig. Ich bin selbst erst zwei Minuten da, hab noch nicht mit der genauen Untersuchung angefangen, kann Ihnen noch nicht viel sagen. Nur, dass sie an der Vorderseite keine sichtbaren Verletzungen hat.«
Einer der Polizisten, die Melchior nicht kannte, fühlte sich zu einer Erklärung genötigt.
»Die Wirtin hat sie heute Morgen gefunden und uns verständigt. Sie macht uns übrigens gerade eine Tasse Kaffee, also – ich meine die Wirtin.«
»O ja, danke, das könnte ein paar Probleme lösen. Also keine sichtbaren Verletzungen … Merkwürdig, sie hat nur ein T-Shirt an und die Jeans. Hatte sie sonst nichts bei sich? Eine Jacke? Handtasche? Irgendwas?«
»Wir haben nichts gesehen.«
Melchior sah sich unnötigerweise kurz um und meinte dann: »So kann sie doch nicht hierhergekommen sein – viel zu kalt! Also war sie entweder im Wirtshaus oder … nicht anzunehmen, dass sie sich hier zum Sterben hergelegt hat. Vielleicht war sie drogensüchtig?«
Gerstner fuhr ihm sofort in die Parade. »Keine Einstiche am Arm. In den Augen kann ich auch nichts erkennen. Drogentod kann, denke ich, ausgeschlossen werden. Helfen Sie mir mal!«
Der Arzt hob die Leiche mit geübtem Griff an und drehte sie herum, noch ehe Melchior mit anpacken konnte. Doch nach einem kurzen Blick hätte er das auch nicht mehr gekonnt. Auch Doktor Gerstner entrang sich ein Ausruf der Überraschung.
»Na, sieh mal einer da! Dann ist ja fast alles klar! Aha! Melchior, schauen Sie mal! Melchior! Ihr Genick ist gebrochen. Was ist denn?« Höhnisch setzte er hinzu: Ach du meine Güte, unser Sensibelchen schon wieder! Lernen Sie es denn nie?«
In dem Moment, in dem der Kopf der Leiche beim Herumdrehen in unnatürlichem Winkel nach hinten weggeknickt war, hatte sich Melchior sofort abgewandt. Nicht auf nüchternen Magen! Genau betrachtet, auch nicht auf vollen Magen. Auf keinen Magen!
Er knurrte nur: »Warum glauben Leute wie Sie eigentlich immer, dass der Anblick einer Leiche etwas Appetitliches ist. Also mir vergeht er dabei jedenfalls …«
»Mir nicht!«, versetzte der Pathologe. »Heut Mittag macht mir meine Frau einen anständigen Schweinsbraten mit Blaukraut und … oh, sorry, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder?«
Gerstner verzog reumütig das Gesicht. Melchiors gegenwärtiger familiärer Status war Tagesgespräch in der gesamten Polizeiinspektion und daher natürlich auch ihm bekannt.
Melchior winkte nur ab. »Das mit dem Braten oder das mit der Frau? Ach, egal - beides nicht!«
»Also, ich kann nichts dafür, dass Sie zu Hause rausgeflogen sind«, verteidigte sich Gerstner.
»Ich bin nicht rausgeflogen, ich bin ausgezogen, das ist ein Unterschied!«
Dr. Gerstner hob beschwichtigend die Hände.
»Jetzt haben Sie sich nicht so, Mann Gottes! Ich wollte auch nicht … nichts für ungut! Können wir jetzt? Also, die Tote ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit an einem Genickbruch gestorben. Das ist ja zunächst offensichtlich. Sie hat eine quer verlaufende, deutliche Verletzung am Hinterkopf, was bedeuten könnte – wieder mit aller Vorsicht –, dass sie sich den Bruch beim Aufprall auf eine harte Kante zugezogen hat. Der Wunde nach war es eine eher rundliche Kante, würde ich sagen, nicht scharfkantig. Es könnte sich um Holz gehandelt haben, eine abgerundete Tischkante zum Beispiel, aber wie gesagt …«
»Mit aller Vorsicht, ich weiß. Genaueres nach der Obduktion, auch das hab ich schon öfters gehört. Die Frage ist nun: Unfall oder Verbrechen? Hier an dieser Stelle ist sie ja wohl nicht gestorben?«
Der Arzt winkte sofort ab. »Auf keinen Fall. Die Wunde muss stark geblutet haben, zwar nur für kurze Zeit, aber dennoch: Hier ist kein Tropfen Blut zu sehen. Das heißt: Als sie hier abgelegt wurde, war sie schon längst tot.«
Melchior nickte zufrieden. Na also, das war doch schon was. »Und ich sehe hier auch keine Kante, egal ob aus Holz oder sonst was, an der man sich das Genick brechen könnte, habe ich recht?«, ergänzte er. »Allerdings, im Gasthaus selber … Ich werde, glaube ich, doch mal hinein schauen. Kann ja nichts schaden. Ich bring dann den Kaffee mit raus. Kollegen …«
Er tippte mit den Fingern an die nicht vorhandene Mütze und ging langsam in Richtung des Einganges. Seine Beine waren etwas wackelig, teils von der Kälte, teils von dem unangenehmen Anblick, den er da über sich ergehen lassen musste.
Melchior war sich seiner Defizite – und seine übermäßige Empfindlichkeit gegenüber dem Anblick von Leichen gehörte sicherlich dazu – durchaus bewusst und arbeitete daran, gewisse Dinge zu verbessern. Man sagte ihm zum Beispiel eine gewisse Tollpatschigkeit nach – nicht ganz zu Unrecht, wie die Aktion »Nachtkästchen« am Morgen gezeigt hatte. Aber so oft wie in früheren Jahren erwischte es ihn nicht mehr und wenn, dann wenigstens nicht vor anderen Menschen, so wie heute! Alles eine Frage der Betrachtungsweise, wie der Philosoph zutreffend anmerkte! Wenn im Wald ein Baum umfällt, und keiner hat’s gesehen, hat sich dann Oberkommissar Caspar Balthasar Melchior wirklich den kleinen Zeh am Nachtkästchen gestoßen?
Nur seine tiefe, urtypische Abneigung für die Auswirkungen von Gewaltverbrechen, die konnte und konnte er nicht abstellen. Da helfen auch keine hundert Berufsjahre, dachte er für sich. Ein gebrochenes Genick, klaffende Wunden, Blut, abgetrennte Gliedmaßen – so etwas war und blieb für ihn Horror, noch dazu bei einem jungen, durchaus hübschen Mädchen wie dem, das jetzt tot auf dem kalten Kiesboden des Hofes lag. Es würde ihm wohl noch in hundert Jahren den Magen umdrehen, wenn er so was sehen musste.
Die Wirtin hieß Schifferer und entsprach genau dem gängigen Bild einer Gastwirtin auf dem Land. Sehr gemütlich, wie es der Deutsche liebt, umgänglich, freundlich, dabei aber resolut und mit Oberarmen, die bei anderen als Wadln durchgehen würden. Sie räumte gerade das Geschirr aus der Spülmaschine, der Kaffee lief geräuschvoll in eine große Kanne und duftete fantastisch. Melchior klopfte an die schon offen stehende Tür zur Gastschänke.
»Immer herein da!« Die Wirtin richtete sich auf und sah Melchior mit festem Blick offen und erwartungsvoll entgegen. Nach zwei Sekunden war Melchior bereits fest überzeugt, dass die Tote nicht in diesem Raum gestorben sein konnte. Was ihn allerdings nicht daran hinderte, den Fußboden und die Tischkanten genau zu inspizieren. Also, Blutlache war da keine, aber das war ja nun wirklich nicht zu erwarten gewesen.
»Guten Morgen! Oberkommissar Melchior, Kripo Rosenheim. Haben Sie kurz Zeit für ein paar lästige Fragen, Frau …?«
»Schifferer. Natürlich. Kommen S’ nur her. Ungemütlich draußen, gell. Hier drin ist’s schön warm. Wollen S’ einen Kaffee zum Aufwärmen?«
»Danke, sehr freundlich. Würde mir guttun.«
Melchior setzte sich an den nächstbesten Tisch, warf noch mal ein paar Blicke in die Ecken des Raumes und rieb sich die Hände. Die Wirtin nahm eine Tasse und einen Löffel und stellte sie vor ihn auf den Tisch.
»Frische Semmeln hab ich leider noch nicht, sonst tät ich sie Ihnen gern anbieten. Warten Sie, der Kaffee ist sofort fertig.«
Melchior winkte ab. »Kein Problem. Herzlichen Dank. Dass es halt auch immer so kalt und nass sein muss …«
»Mei! Ist halt die Jahreszeit. Da kann man nichts machen!«
Auch diese Konversation ließ ein gewisses intellektuelles Niveau durchaus vermissen. Aber da kann man halt nichts machen.
Die Wirtin schraubte den Deckel auf eine große Thermoskanne und stellte sie auch auf den Tisch.
»Da stehen Milch und Zucker. Bedienen Sie sich! Aber lassen Sie den Kollegen draußen noch was übrig!«
Melchior ließ sich nicht zweimal bitten.
»Vielen Dank. Schwarz. Süßstoff haben Sie nicht? Egal, geht so auch… Mich würde interessieren …« Melchior nahm einen kleinen Schluck. »Mmh, der Kaffee ist gut!« Er trank einen größeren Schluck. »Frau Schifferer, ob Sie die Tote da draußen schon einmal gesehen haben, vor allem am gestrigen Abend.«
Die Wirtin schüttelte energisch den Kopf. »Ah, woher denn! Sie können mir glauben, dass ich jeden meiner Stammgäste kenne. Wissen Sie, sonst kommen um die Jahreszeit nicht allzu viele Leute hierher. Wir liegen ja ein bisserl ab von der Hauptstraße, verstehen Sie? Ja, im Sommer, da ist der Biergarten immer randvoll, jedenfalls am Samstag. Aber jetzt... Gestern Abend waren vielleicht zehn Leute da, mehr nicht, alles Stammgäste aus der Umgebung. Das Mädchen wär mir sicherlich aufgefallen. Die gehört doch auch eher in eine Disco, so eine kommt doch da nicht her. Haben Sie gesehen, wie die geschminkt war? Dafür hat sie eine Stunde vor dem Spiegel gestanden, da wette ich!«
Notiz im Hinterkopf: Die Tote war für eine Party geschminkt. Jetzt, da die Wirtin es sagte, fiel es Melchior auch auf. Wo sie recht hat, hat sie recht …
»Trotzdem«, wandte Melchior ein. »Auch wenn nur Stammgäste da waren… ist gestern Abend irgendetwas liegen geblieben? Ich meine, Mantel, Jacke oder eine Tasche? Auch auf den Toiletten zum Beispiel? Die Tote könnte sich ja unbemerkt eingeschlichen haben.«
»Nein, sicher nicht. Mein Mann kontrolliert das immer ganz genau, bevor wir zumachen. Äh, der schläft übrigens noch, mein Mann. Wenn Sie ihn brauchen, wecke ich ihn natürlich, aber ich bin sicher, der weiß auch nicht mehr. Hier hat niemand etwas vergessen … Sie meinen, weil sie fast nichts anhat, das arme Ding?«
Melchior nickte. »Genau deshalb. Weil Sie es schon sagen – zumachen! Wann haben Sie denn gestern zugemacht?«
»Um elf haben wir die letzte Runde ausgegeben, das machen wir immer so. Der letzte Gast ist dann ungefähr um zwölf gegangen. Der Luggi war’s. Wissen S’, ich finde das auch seltsam, dass sie so wenig anhat. Sie muss doch gefroren haben wie ein Schneider da draußen. Oder meinen Sie, dass sie mit dem Auto gekommen ist?«
»Na, dann müsste doch ein Auto da sein. Ist denn eines auf dem Parkplatz, das nicht hierher gehört?«
»Nein, nein! Das sehen Sie ja selbst. Da ist nur unserer, sonst nix.«
Melchior hob die Arme. »Sehen Sie? Und haben Sie in der Nacht ein Auto gehört?«
»Also bestimmt nicht im Hof. Wir schlafen nach der anderen Seite raus. Und selbst wenn! Autos kommen immer wieder welche vorbei, auch in der Nacht. Woher soll ich wissen …«
»Ist schon klar…« Melchior trank seinen Kaffee aus. »Ja, danke. Ich glaube, für den Moment reicht mir das. Wenn Sie noch so freundlich wären: Ich meine, wenn Sie Ihre Stammgäste schon alle kennen, könnten Sie mir dann eine Liste schreiben, wer gestern von elf bis zwölf noch da war? Wenigstens die Namen.«
Frau Schifferer zögerte etwas. »Ja, schon! Also, wie gesagt: Da war der Luggi – wie heißt denn der bloß mit Nachnamen? Da wäre es besser, wenn Sie meinen Mann fragen täten. Der kennt sie alle auch beim Nachnamen. Wissen Sie, ich frag da net, wer wer ist.«
Melchior winkte bloß ab. »Jetzt nicht. Das pressiert nicht. Warten Sie, bis Ihr Mann aufgestanden ist. Sie können sich ruhig Zeit lassen. Ich hol mir die Liste dann morgen ab. Also, vielen Dank für den Kaffee und für die Auskünfte. Sehr freundlich von Ihnen.«
Melchior stand auf, kam aber nur geschätzte zwanzig Zentimeter weit.
»Warten Sie, der Kaffee für Ihre Kollegen!«
Höflicher Einwand: »Aber das wäre doch nicht nötig gewesen.«
»Aber was! Mache ich gerne.« Die Wirtin hatte das Tablett schon in der Hand. »Die tun auch nur ihren Job und das bei der Kälte. Drei Tassen, gell? So, und die Kanne! Halt! Der Zucker noch... Geht’s so? Lassen Sie’s fei nicht fallen…«
O ja, die Gefahr bestand durchaus.
»Warten S’, ich halt Ihnen die Tür auf!«
Melchior lieferte eine zirkusreife Vorstellung, aber er schaffte es, das Tablett schadenfrei in den Hof zu transportieren – wieder ein kleiner Sieg, auch wenn das der Menschheit ziemlich egal war!
Doktor Gerstner packte gerade seine Utensilien zusammen. Melchior stellte das Tablett, als ob es das Leichteste auf der Welt gewesen wäre, auf die Kühlerhaube des Polizeiwagens und schenkte drei Tassen ein. Dann griff er in seine Manteltasche, holte ein Päckchen heraus und zündete sich eine Zigarette an.
»Oha«, knurrte Gerstner unwirsch. »Seit wann denn das, Melchior? Hab ich ja noch nie gesehen.«
Melchior zuckte mit den Achseln und genehmigte sich einen tiefen Zug und noch eine Tasse Kaffee.
»Hab auch nicht vor, mir das wieder anzugewöhnen. Nur im Moment …«
Gerstner verstand und widmete sich seiner Kaffeetasse.
»Themawechsel: Hat sich noch irgendwas ergeben, Doc? Vor allem wegen der Identität der Toten?«
»Nein. Die Tote hat keine Papiere bei sich. Die Taschen waren leer. Und die Antwort auf Ihre nächste Frage: Mit der Todeszeit ist es wegen des Wetters so eine Sache: vermutlich zwischen Mitternacht und drei Uhr.«
Melchior seufzte. »Wussten wir es doch, nicht wahr? Wenn wir die Identität nicht haben, dann war es das auch schon. Ich kann hier nichts mehr tun. Na dann, Kollegen: Ist die Spurensicherung schon verständigt? Die sollen sich hier auf dem Hof noch ein wenig umsehen. Okay, gut. Dann leiten Sie bitte alle üblichen Verfahren ein. Vor allem brauchen wir die Identität der Toten. Ohne die kommen wir nicht weiter. Foto an alle einschlägigen Stellen, Vermisstenmeldungen, et cetera, et cetera …«
Die Polizisten bestätigten nickend.
»Wissen Sie, was passiert sein könnte?«, fragte Gerstner.
»Hm?«
»Das Mädchen verläuft sich spät abends in diese Kneipe, will telefonieren oder einfach nur einen warmen Platz … ein paar besoffene Deppen machen sich an sie ran …«
»›Geh, hock di her, Madl, sei a weng nett zu mir‹, hm?«
»Genau. Ein Wort gibt das andere, das Mädchen will sich losreißen, fällt hin – bums!« Der Doktor schlug mit der Faust in die Hand.
Melchior nickte. »Hm, schon möglich. Ich hab auch schon daran gedacht, aber glauben Sie im Ernst, die legen sich ihre Tote in den eigenen Hinterhof und gehen dann nach Hause? Ha? Das wäre zu einfach! Nein, ich glaube das nicht. Das Mädchen ist ganz woanders gestorben und hierher transportiert worden. Reifenspuren werden auf dem Kiesboden keine zu finden sein. Pech. So! Ich für meinen Teil bin ausnahmsweise für den Rest des Tages unabkömmlich. Ich habe einen dringenden Termin mit meinem Bett. Mir reicht es!«
Doktor Gerstner hob einen Arm zum Gruß. »Klingt vernünftig. Sie haben meine volle Unterstützung. Ich bin morgen früh bis neun bei Ihnen im Büro – mit dem Autopsiebericht. Bin schon gespannt, was ich noch alles finde!«
»Ich auch. Also dann, frohes Schaffen – und guten Appetit mit Ihrem Schweinsbraten.« Melchior winkte kurz zurück, trat seine Zigarette aus und ging langsam zu seinem Auto. Bett! Warm! Schlafen! Gut! Aber es war nicht sein Bett …
3.
Wenn man Casper Balthasar Melchior länger kannte, war es beunruhigend, in welchem Zustand er sich zu jener Zeit befand. In Zeiten, in denen die Polizisten reihenweise an ihrem Beruf verzweifelten, weil sie keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung bekamen, weil die Straftäter immer jünger und brutaler und die Hemmschwellen, auch gegen Polizisten mit Gewalt vorzugehen, immer niedriger wurden, in solchen Zeiten gab es einen einzigen Polizeibeamten, eine Art letzten Mohikaner, der diesem Beruf fast ausschließlich schöne Seiten abgewinnen konnte, und das war normalerweise eben Melchior.
Er liebte seinen Beruf, egal was woanders passierte, wie die öffentliche Meinung gerade war. Ihm gefiel die Jagd auf Mörder und Schurken. Irgendwo war er wohl in einem kindlichen Cowboy- und Indianerspiel hängen geblieben. Für ihn gab es keine größere Befriedigung, als einen von der anderen Seite zu erwischen. Und er erwischte sie praktisch alle! Der letzte Misserfolg in seiner persönlichen Statistik lag etliche Jahre zurück.
Das alles hatte immer dafür gesorgt, dass Melchior ein ausgeglichener, energiegeladener, gesunder Mensch war. Aber momentan war in seinem Leben so vieles in Bewegung. Dinge waren aus dem Ruder gelaufen, und so was geht auch an einem Oberkommissar Melchior nicht spurlos vorbei. Die Psyche gibt die Meldung an den Körper weiter: Fehlfunktion. Und irgendwann sagt dann auch der Körper: Fehlfunktion. Lange durfte das nicht mehr so weitergehen. Das wusste er.
Als Melchior am nächsten Morgen um neun in seinem Büro saß und gedankenverloren mit einem Bleistift spielte, hätte man auf den Gedanken kommen können, er langweile sich. Aber seine Gedanken kreisten in Wirklichkeit um höchst private und höchst unangenehme Probleme. Die Aussprache, die er später am gestrigen Sonntag noch mit seiner Frau gehabt hatte, hatte prompt in den üblichen gegenseitigen Anschuldigungen geendet. Natürlich wusste Melchior, dass Scheidungen bei Polizisten so etwas wie Berufskrankheit waren. Nur erstens hatte er sich eingebildet, dass ausgerechnet ihm so etwas nicht passieren könnte, und zweitens lagen die Gründe gar nicht so sehr in seiner Arbeit wie bei anderen Polizisten. Anders ausgedrückt: Wäre er nicht so in seiner Arbeit aufgegangen, hätte ihm vielleicht schon erheblich früher auffallen können, dass dieser Abschnitt seines Lebens zu Ende ging – zu Ende gegangen war – oder werden würde – ach, egal! Es machte ihn krank, dass er einfach nicht wusste, was passiert war. Darauf hätte er gern eine Antwort gehabt, aber er bekam nur Streit. Das kann nicht sein, oder? dachte er wehmütig.
»Morgen, Melchior!«
Er zuckte regelrecht zusammen. Gut, man klopft eigentlich an, auch wenn die Tür offen steht. Aber vor lauter Grübeln hatte er Doktor Gerstner tatsächlich weder kommen noch eintreten hören. Er bemerkte ihn erst, als er schon direkt vor seinem Schreibtisch stand. Bedenklich. Höchst bedenklich!
Er meinte nur müde: »Guten Morgen, Doc.«
Wieder dieser Blick, mit dem Gerstner ihn schon gestern taxiert hatte … und prompt folgte die Moralpredigt. Einem so erfahrenen alten Arzt kann man eben nichts vormachen.
»So, zunächst einmal, wenn Sie meine Meinung als Arzt hören wollen – nichts da, Sie werden sie sich anhören müssen! Sie sehen im Moment nicht gesund aus. Was auch immer Sie um die Ohren haben, versuchen Sie, sich ein wenig zu schonen. Mit so einer Trennung ist nicht zu spaßen. So was hat schon ganz andere umgeworfen. Dazu dann noch das Rauchen …«
Melchior drohte in die Defensive zu geraten.
»Machen Sie einen Punkt, Doc. Genug der Fürsorge. Ich gebe ja gerne zu, dass mein Leben schon mal heiterer war, aber ein Fall für den Psychologen oder gar für den Pathologen bin ich deswegen noch lange nicht. Ich hasse den November, das ist alles. Und da stehe ich nicht alleine. Wissen Sie was, geben Sie mir eine gute Therapie: einen ordentlichen Fall. Daran hapert es nämlich seit einiger Zeit.«
»Ach ja, ist das so?« Der Zweifel war Gerstner deutlich anzuhören.
»Natürlich! Nur immer derselbe Kram. Im Moment ist meine Arbeit eben nicht meine Arbeit, verstehen Sie mich? Schauen Sie her: Der Stapel Akten, das sind die Fälle der letzten sechs bis acht Wochen. Wollen Sie eine kleine Zusammenfassung? Wirtshausschlägerei in Kolbermoor – ich dachte, der Brauch stirbt langsam aus, aber nein! Dann Messerstecherei vor einer Disco, Ehemann schlägt Ehefrau, Ehefrau schlägt Ehemann, Russengang fängt einen Kleinkrieg gegen Türkengang an, Türkengang verprügelt Albanergang – und die Krönung von allem: Mann ertrinkt beim Versuch, seinen Goldfisch aus dem Gartenteich zu retten. Also, falls Sie sich nicht mehr erinnern sollten: Der Goldfisch wurde von einer Katze bedroht! Der Mann wollte die Katze verscheuchen, rutschte aus und schlug mit seinem Kopf auf einen Stein. Er kam unter Wasser, wurde ohnmächtig und … blubb, blubb! Das ist meine Arbeit zur Zeit! Frust, Frust und nochmals Frust! Ich brauche einen anständigen Mord! Sie haben nicht zufällig einen für mich in der Tasche?«
Doktor Gerstner warf Melchior einen sehr, sehr skeptischen Blick zu.
»Okay, Melchior. Aber ich habe Sie ausdrücklich gewarnt! Wenn sich Ihr Zustand nicht bessert, mache ich eine entsprechende Meldung. Meiner Meinung nach sind Sie urlaubsreif – mindestens!«
Aber dann griff er in die Hosentasche, holte einen imaginären Mord heraus und warf ihn Melchior über den Tisch, was diesen immerhin zu einem Grinsen verleitete.
»Zu unserer Toten: Die Todesumstände habe ich gestern schon richtig geschildert. Wir haben in der Wunde am Hinterkopf Holzpartikel gefunden – Eiche, um genau zu sein. Kein Knüppel oder Schläger, das steht fest. Behandeltes Holz, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Tisch oder eine Bank. Glatter Genickbruch, sie war sofort tot. Wo sie allerdings gestorben ist, das müssen Sie herausfinden. Am Fundort jedenfalls nicht, das ist klar. Soweit ich gehört habe, hat ja auch die Spurensicherung überhaupt nichts gefunden, was darauf hindeuten könnte, dass die Tote in dem Hof gestorben ist.
Die Frau war ohne jeden Befund bezüglich Drogen oder sonstiger Suchtmittel, wie sie ja zum Beispiel von Ihnen bevorzugt werden.«
Die Spitze musste nicht sein, dachte Melchior und warf einen strafenden Blick auf den Arzt, den dieser jedoch komplett ignorierte.
»Am Rücken der Toten fanden sich Fusseln eines Teppichs – guter Stoff. Ich kann nur sagen: Bringen Sie mir diesen Teppich. Der Nachweis ist dann kein Problem.
Wir haben mehrere DNA-Spuren an der Toten sichergestellt. Dauert noch ein wenig mit der Bestimmung, vielleicht können Sie damit etwas anfangen. Die Tote hatte einige Zeit vor ihrem Ableben Geschlechtsverkehr. Keine Vergewaltigung. Der genaue Zeitpunkt ist sehr schwer zu bestimmen, aber es dürfte etliche Stunden vorher gewesen sein. Ein Zusammenhang mit der Tat ist daher nicht ersichtlich. Ich erwähne es nur.
Womit wir bei der Todeszeit wären. Ich würde sagen, deutlich nach Mitternacht. Zwei Uhr, plusminus. Wann die Leiche in den Hof gelegt wurde, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber noch vor Tagesanbruch. Wie gesagt: kein Verdacht auf Vergewaltigung, keine Spuren von Abwehr oder überhaupt eines Kampfes, bis auf ein leichtes prämortales Hämatom an ihrem Bauch. Also, wenn da ein Kampf stattgefunden haben sollte, dann war es nur ganz minimal. Keine Hautpartikel unter den Fingernägeln, et cetera. Wir müssen eher davon ausgehen, dass es sich bei der Tat um Totschlag handelt, sogar ein Unfall ist nicht auszuschließen. Allerdings: Immerhin haben Sie die offensichtliche Vertuschung, die ist zumindest strafbar. Das wäre soweit alles.«
Wie auf ein Stichwort stürmte in diesem Moment, fröhlich ein Blatt Papier schwenkend, Kommissaranwärter Hans Schweingruber in das Zimmer. Zu dem semmelblonden und leicht rundlichen Strahlemann und seinem Verhältnis zu Melchior sollte man vielleicht ein paar Worte verlieren.
Von jeher, aber besonders während seiner Zeit in München, war Melchior der typische Eigenbrötler gewesen. »Unfähig zur Teamarbeit«, hatte es einmal ein Psychologe ausgedrückt. Seiner Karriere war das natürlich nicht förderlich gewesen. Der lonely wolf, der Einzelgänger. Alles wahrscheinlich bedingt durch Kindheit und Pubertät, seinen ausgefallenen Namen – egal warum, es war einfach so.
Nach seinem Wechsel nach Rosenheim änderte sich das alles, langsam, ganz langsam, aber stetig. Und begonnen hatte diese Veränderung Melchiors mit Schweingruber. Denn mit diesem sonnigen Gemüt hatte Melchior zum ersten Mal einen Partner zugeteilt bekommen, mit dem er sich zu hundert Prozent verstand. Sie sprachen die gleiche Sprache, konnten hervorragend miteinander blödeln, wenn die Arbeit zu ernst zu werden drohte, aber auf der anderen Seite hatte sich Schweingruber auch als akribischer, exakter Ermittler herausgestellt, der von Melchior viel, wenn nicht alles schnell gelernt hatte und ihn dort ergänzte, wo dieser seiner Schwächen hatte.
Melchior seinerseits hatte, nachdem er früher den Menschen in seiner Umgebung eher mit Distanz und Misstrauen begegnet war, durch seinen neuen Freund zu seiner eigenen Verwunderung nach und nach zu allen anderen in der Inspektion ein ebenso gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Was das betraf, fühlte sich Melchior in Rosenheim pudelwohl. Die beiden Männer arbeiteten jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen, und was Melchior anging, durfte dieser Zustand ruhig auch noch zweieinhalb Jahrzehnte andauern, bis zu seiner Pensionierung.
Auf der einen Seite gewinnst du, auf der anderen verlierst du. Aber das stand ja auf einem anderen Blatt. Das Verhältnis zu seiner Frau war in derselben Zeit jedenfalls immer schlechter geworden. Na ja.
Jedenfalls war Schweingruber mal wieder allerbester Laune und brachte dies auch, so wie bei ihm üblich, durch fröhliches Herumblödeln zum Ausdruck. Es war bei ihm wie bei so vielen Menschen: So lange er ein Publikum hatte, produzierte er sich. Nachdem er einmal festgestellt hatte, dass Melchior ein gutes Publikum war, weil er es mochte, bei seiner Arbeit aufgelockert zu werden, machte er eben fröhlich weiter – meist, bis Melchior auf die Bremse trat.
»Salve beisammen! Darf ich es wagen, die edlen Herren zu stören?«
Melchior sah seine Rettung im Anmarsch, bevor Gerstner wieder zurück zu seinen Problemen kommen konnte. Er zwinkerte Schweingruber verstohlen zu und ging auf dessen Steilvorlage ein.
»Es sei Ihm gestattet, Junker Hans. Wohlan, sprich denn!«, antwortete er in salbungsvollem Ton.
Schweingruber grinste von einem Ohr zum anderen, nickte unmerklich zum Zeichen, dass er verstanden hatte, und legte eine Schippe drauf:
»So wollen wir es Euch danken, Herr! Ich bringe überaus erfreuliche Mär, Edelster! Auf Eurer Majestäts Geheiß hin durchkämmten Seine Schergen das ganze Land von der Loretowiese bis zu den Höhen des Schlossberges und fanden, wie mir just in diesem Moment über das Netzwerk zugetragen wurde, einen Manne, dem die Beschreibung der Unbekannten bekannt vorzukommen dünkt.«
Melchior deklamierte, ebenfalls fröhlich grinsend und sogar noch geschraubter, mit einer dezenten Prise K. u. K.-Monarchie-Akzent zurück: »Oh, welch frohe Botschaft, lasst uns frohlocken!«
Doktor Gerstner freilich zeigte sich in diesem Moment überaus humorlos, obwohl er dies eigentlich gar nicht war. »Könnten Sie diesen Quatsch mal lassen, wenn’s leicht geht? Meinen Sie, ich merke nicht, woher der Wind weht? Sie beide spielen mir den Lockeren vor, dabei sieht’s inwendig ganz anders aus…«
Schweingruber salutierte lässig. »Zu Befehl, Quatsch bleiben lassen, jawohl! Aufgrund des Artikels, den unsere Kollegen dankenswerterweise in die Morgenzeitung gesetzt haben, hat sich eben ein junger Mann, seines Zeichens Student, gemeldet, der die Tote kennt. Seine Angaben wurden bereits überprüft. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Toten um eine gewisse Michaela Griese, 23 Jahre alt, eingetragene Studentin der Informatik an der Rosenheimer Hochschule. Geboren in Castrop-Rauxel – mit Verlaub, ich bin lieber in Rosenheim geboren, aber nix für ungut –, vor zehn Jahren von Castrop-Rauxel nach Bochum umgezogen, dort ihr Abitur gemacht und seit vorigem Herbst hier polizeilich gemeldet. Adresse bekannt, bla, bla, bla... Hab ich das jetzt brav gesagt?«
»Sehr brav, Herr Assistent! Großes Lob! Nun denn: wenn die Adresse der Toten bekannt ist … Ja … Was tun wir dann noch hier? Satteln wir die Pferde! Äh - dann fahr schon mal den Wagen vor, Harry!«
Schweingruber verzog das Gesicht. »Deine Witze werden immer älter und schlechter. Der hat sooo einen Bart!«
Melchior spielte das Theater weiter. »Ich sehe es ein, ich sehe es ein!«, lamentierte er. »Ich werde in mich gehen und mich bessern, großes Indianerehrenwort!«
Schweingruber wandte sich zu Gerstner um und deutete auf Melchior. »Ja, so ist er nun mal, mein Chef! Ständig auf der Suche nach dem Gestern von morgen!«
Dafür erntete er ein paar Sekunden verdutztes Schweigen. Dann meinte Melchior: »Der war gut. Respekt – der war gut! Eins zu null für dich …«
Nur einer fand das gar nicht so gut. »Ihnen beiden ist auch nicht zu helfen«, meinte Doktor Gerstner resigniert. »Das ist nun die Polizei von heute. O tempora, o mores! Wenn die Herren mich dann entschuldigen würden. Ich habe zu viel zu tun, um hier weiter das Publikum geben zu müssen. Viel Erfolg bei Ihren Ermittlungen! Und denken Sie daran, Melchior. Wenn Sie nicht bald etwas gegen Ihre Situation tun, werde ich Sie gnadenlos dem Psychologen überstellen.«
Melchior schlug die Hände vors Gesicht. »O Graus! Nur das nicht, nicht den Psychologen! Folter, Blutegel, Zeugen Jehova, kein Problem, aber nicht den Psychologen! Haben Sie Erbarmen!«
»Ach, machen Sie doch, was Sie wollen!«
Okay, sagte sich Melchior. Genug ist genug. Gerstner hatte sich schon abgewendet und wollte gehen, da hielt ihn Melchior zurück.
»Doc?«, sagte er in normalem Ton. »Herzlichen Dank auch – und Doc? Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Unkraut vergeht nicht! Okay? Hans! Setz dein schickes Mützchen auf. Es geht in feindliches Gebiet …«
Diese Bemerkung bezog sich auf Schweingrubers neueste modische Fehlleistung. Gegen die Kälte und vermutlich auch die Polizeiordnung trug er gern eine Zipfelmütze, auf der ein Abbild des Rappers Eminem zu sehen war. Aus Gründen, die nie bekannt werden sollten, zog sie Schweingruber aber jetzt nicht über.
4.
Melchior ließ sich mehr Zeit als üblich, um über den Parkplatz zum Wagen zu gehen, und Schweingruber konstatierte das sehr wohl. Natürlich hatte er die Verfassung seines Freundes bemerkt, konnte sich auch in etwa vorstellen, was los war, wusste aber nichts Konkretes über den aktuellen Stand der Dinge. Melchior, jetzt völlig ernst, zog den Kragen seines Mantels hoch und fröstelte. Das Wetter war immer noch genauso trübsinnig wie am gestrigen Tag und passte zu seiner Weltuntergangsstimmung wie die Faust aufs Auge.
Schweingruber brach als Erster das Schweigen.
»Jetzt mal ohne Jux, Chef, so gut die Nummer eben war, keine Frage! Aber irgendwo hat der Doc schon recht, du bist zur Zeit nicht bei hundert Prozent – ganz vorsichtig ausgedrückt! Was ist los mit dir?«
Melchior druckste ein wenig herum. »Na ja, was wohl … Weißt du doch … Scheidung liegt in der Luft.«
»Oha! So ernst also? Keine Chance mehr?«
Die Männer kamen am Auto an. Melchior warf dem Jüngeren die Schlüssel zu.
»Du fährst«, bestimmte er. »Nein, keine Chance mehr. Es langt endgültig! Ich spiel das Affentheater nicht mehr mit und geh wieder zurück. Lohnt nicht! Mal sehen, dass ich mich heute Abend um eine anständige Bleibe umschauen kann. In der Pension, in der ich jetzt hause, kann ich auf keinen Fall bleiben. Die macht mich depressiv.«
Schweingruber startete den Wagen. »Woran liegt es? Ich meine, wenn du darüber sprechen willst …«
»Ja, wieso denn nicht? Ich schätze, das übliche Problem bei Polizisten. Ach Quatsch, ist doch in allen Ehen so! Ich bin selten zu Hause, hab immer nur die Arbeit im Kopf, die Frau kriegt angeblich keine Aufmerksamkeit, immer dieselbe Leier. Es passt ihr nicht, wer ich bin, was ich bin, und vor allem passt es ihr nicht, wo wir sind! Sie will nach München zurück, aber pronto, will dort arbeiten und sich selbst verwirklichen! Ich hatte mal eine Ehefrau, jetzt habe ich eine Karrierefrau. Sie will ihr eigenes Leben, Ende der Durchsage.«
Schweingruber stoppte an einer roten Ampel. »Na wunderbar. Red nur weiter! Da kann man ja Angst vorm Heiraten kriegen. Aber dass sie arbeiten will, ist ihr gutes Recht, das siehst du schon ein, oder?«
»Klar seh ich das ein!«, kam es verärgert zurück. »Aber man kann das doch unter einen Hut bringen, oder? Und das will sie nicht. Die Planung steht ohne mich, soviel ist klar – oder glaubst du, ich schmeiße meinen Job weg und mache einen auf Hausmann?«
»Du? Das walte Hugo! Bitte nicht! Ich finde nie wieder einen, mit dem man so schön blödeln kann. Also: wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag es, ja? Aber ich sag dir gleich: Bei mir ist kein Platz!«
»Danke, aber ich krieg das schon hin! Lass mich nur meine Arbeit machen, mit dem Rest komm ich schon irgendwann klar. Nur – da ist noch was …«
Melchior kratzte sich am Hinterkopf. Schweingruber schaute interessiert herüber.
»Weißt du, was mir so unsagbar stinkt? Die sagt mir ins Gesicht, ich wäre nicht mehr erotisch!«
Schweingruber verbiss sich mit einiger Mühe ein Lachen: »Oh, oh! Starker Tobak, und das dir!«
Klar, Melchior war kein Hugh Grant, kein Mann für den Laufsteg. Er war ordentlich, aber durchschnittlich in jeder Beziehung, jedenfalls was Aussehen und Auftreten betraf: immer derselbe Anzug, immer dieselbe Frisur, kein Glamour. »Esse quam videri«, hatte Cicero gesagt, mehr sein als scheinen. Das hatte Melchior in seinem Beruf oft wertvolle Dienste erwiesen. Andererseits hatte ein gewisser Herr Hader einmal angemerkt, dass Fliegen für gewöhnlich erschlagen werden, Schmetterlinge aber nicht, woran man erkennen könne, wie wichtig das Outfit wäre.
Sollte doch jeder über diesen Konflikt mit seiner Frau denken, was er wollte. Auf alle Fälle hatte Melchior nie an der Vergangenheit gehangen. Er hatte eine Zukunft, und für diese lebte er. Warum denke ich jetzt permanent mit so viel Wehmut an vergangene Dinge? fragte er sich. Warum musste er sich im Moment ständig vor sich selbst rechtfertigen für all die Verluste, die er in letzter Zeit erlitten hatte?
Beide Männer schwiegen einige Zeit. Dann begann Melchior: »Hans, sag mal ehrlich: Wenn ich drei Millionen im Lotto gewinnen würde, würde mich das erotischer machen?«
Schweingruber seufzte schmachtend: »Schatzi …«
Beide lachten herzlich. Doch dann wurde Melchior aber übergangslos wieder ernst. »Hans, sag mal: Gibt es da vielleicht etwas, das ich über dich bis jetzt Gott sei Dank nicht gewusst habe?«
»Hä? Ach so! Na, na, sonst noch was? Und? Was machst du? Was nun, spricht Zeus, die Götter sind besoffen!«
Melchior schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht… Ich möchte nur eine Weile alleine sein, niemand mehr, der mir sagt, wann ich rülpsen oder fluchen darf und wann nicht, verstehst du?«
Schweingruber nickte nur voller Überzeugung. »O ja! Und wie ich das verstehe!«
5.
In der weiteren Umgebung des Hochschulgeländes im Nordwesten Rosenheims gab es ein paar hohe Wohnsilos, nötig, aber unpassend. Auf Schönheit wurde in dieser Gegend der kleinen Stadt nicht so sehr geachtet. Das Appartement von Michaela Griese lag im fünften Stock eines dieser Wohnblöcke. Es war geräumig, hatte drei Zimmer, Küche, Bad. Für eine Studentin war es sogar äußerst geräumig, wie Melchior fand, als ihm der Hausmeister die Schlüssel aushändigte und die Wohnung beschrieb. Zumal sie die Wohnung allem Anschein nach alleine bewohnte.
Da der Lift kaputt war – es gibt eben Tage, an denen kommt alles zusammen – mussten die beiden Polizisten bis in den fünften Stock hinaufsteigen. Der Hausmeister hatte Wichtigeres zu tun – konnte man ihm nicht verdenken.
Nach der vierten Treppe hörte man Melchior keuchen. Seine Kondition war scheinbar auch schon mal besser gewesen, was den zwar gewichtigeren, aber fitteren Schweingruber ziemlich amüsierte. Er konnte sich einen Kommentar über den Zigarettenkonsum Melchiors nicht verkneifen, was diesen wiederum so ärgerte, dass er Schweingruber mit einem überraschend kraftvollen Endspurt klar auf den zweiten Platz verwies. Oben angekommen, sah er auf Schweingruber hinab, der gemütlich hinterherkam, und klapperte aufreizend mit dem Wohnungsschlüssel.
»Ich sag dir, wenn der nicht passt und wir die ganzen fünf Treppen wieder runter müssen, nur weil der scheiß Aufzug kaputt ist, dann aber…«
»Keine Kondition, Chef, was? Treppensteigen ist gesund!«
»Aber nicht abwärts! Außerdem ist die Luft hier oben schon so dünn. Da rechts: Appartement 505, hat der Hausmeister gesagt.«
»So entfloh es seinem Munde. Und er muss es wissen… Da ist es.«
Melchior schloss auf und ließ Schweingruber höflich den Vortritt. Der aber blieb schon in der Tür wie angewurzelt stehen. Auch Melchior konnte sehen, warum.
»Ach, du dickes Ei!«
Melchior nickte. »Definitiv zweiter Sieger… Sieht so aus, als hätte da schon vor uns jemand die Wohnung inspiziert.«
Das Wohnzimmer, das man gleich durch die Eingangstür betrat, war durchaus nett eingerichtet. Der Architektur nach war die Wohnung wohl als eine Zweier-WG gedacht. Es gab ein Wohn- und Gemeinschaftszimmer von circa 25 Quadratmetern Größe, zur Rechten eine offen stehende Tür zum Bad und eine Schiebetür zur Küche. Diese beiden Räume waren eher minimalistisch. Auf der linken Seite deuteten zwei weitere Türen auf zwei Zimmer hin, die im Normalfall von zwei Personen bewohnt werden konnten. Aber die Griese hatte allein hier gewohnt.
Die Einrichtung war nicht erste Wahl, aber gemütlich. In der Mitte eine große u-förmige Sitzgruppe schwedischer Herkunft mit einem niedrigen Glastisch in der Mitte. Neben dem Fenster ein Computertisch. Dazu noch ein Fernseher, integriert in eine schmale Regalwand, ebenfalls schwedisch. Laminatboden ohne Teppich, ein paar Topfpflanzen, keine Tapeten, aber etliche Bilder an der Wand, von denen die meisten so aussahen, als wären sie selbst fotografiert worden.
Es mochte sein, dass Michaela Griese für gewöhnlich kein Putzteufel gewesen war, aber für die Unordnung, die in diesem Raum herrschte, konnte sie nicht verantwortlich sein.
Die beiden Männer schauten sich lange und gründlich um und gingen vorsichtig durch das Chaos.
»Sauber…«, merkte Melchior an, nachdem er durch die eine Tür auch in das benachbarte Schlafzimmer getreten war. »Alle Schränke durchwühlt, alles umgeräumt, da, sogar die Sitzkissen rausgerissen. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer das war!«
Schweingruber legte einen Finger an die Unterlippe. Das Spiel machten sie nicht zum ersten Mal. Er wusste, was Melchior jetzt von ihm hören wollte. »Hm, lass mich überlegen … Pumuckls Poltergeist? Nein? Der Bofrost-Mann? Auch nicht? Aah! Dann vielleicht der Typ, der die Tote in den Hinterhof drapiert hat?«
Melchior schnippte mit dem Finger. »Bingo! Das wäre mein Tipp!«
»Und das heißt jetzt also, dass vorgestern Abend hier ein Einbrecher war. Michaela Griese kommt nach Hause – warum schüttelst du dauernd den Kopf? – sie überrascht ihn, Handgemenge … Uh! Ah! Zack, bumm!«
»Nein!«, sagte Melchior entschieden.
»Nein?«, fragte Schweingruber enttäuscht.
»Nein, junger Mann! Denk doch mal nach! Wenn das wirklich hier so abgelaufen wäre, hätte der Einbrecher die Leiche wegen des kaputten Liftes fünf Stockwerke nach unten tragen müssen – durch ein Mietshaus voll mit Menschen! Gut, vorausgesetzt jedenfalls, dass der Lift am Samstag auch schon kaputt war. Aber egal, Lift hin, Lift her! Wozu zum Henker soll er denn die Leiche überhaupt wegschaffen? Er kann sie doch einfach hier liegen lassen. Stört doch keinen. Capito?«
Schweingruber bückte sich, hob einen überdimensionalen Teddybären auf, der vermutlich vom letzten Rosenheimer Herbstfest stammte, und setzte ihn auf die Couch. »Leuchtet ein. So also nicht. Also ist der Mörder nach der Tat hier eingebrochen; denn hätte der Einbruch vorher stattgefunden, hätte die Griese hier noch aufgeräumt. Er muss ihr die Schlüssel abgenommen haben, und – hey, er wusste, wo sie wohnt!«
Melchior nickte. »Jetzt denkst du richtig! Ein weiterer Punkt auf dem Weg zum Kommissar, Herr Anwärter! Ja, er muss sie gekannt haben, dafür spricht einiges. Wie eng, kann man nicht sagen, aber eng genug, um zu wissen, wo sie wohnt und dass sie allein wohnt. Das darf man auch nicht vergessen. Wer will schon gestört werden, wenn man eine Wohnung umräumt? Ganz was anderes: Wie kann sich eine Studentin überhaupt so eine große Wohnung leisten und wofür? Ich meine: Die Bude wär doch für mich allein zu groß! Aber sie hat hier allein gelebt!«
»Vielleicht plante sie Familienzuwachs in näherer Zukunft … Könnte ja sein …«
»Ja«, meinte Melchior nachdenklich. »Mal rumfragen, ob es einen Freund gibt. Quatsch! Natürlich gibt es einen Freund. Hat ja der Gerstner schon rausgefunden.«
Melchior erklärte Schweingruber kurz, was er damit meinte.
»Also! Der Täter nimmt ihr die Schlüssel ab. Und dann durchsucht er hier die Wohnung. Fragt sich, wonach um alles in der Welt?«
Nachdenklich bückte sich jetzt Melchior und hob ein Kissen auf. »Ich werde aus alledem noch nicht recht schlau. Der Mörder – wir nennen ihn jetzt einfach mal so – hat Michaela Griese gekannt. Okay, so weit, so gut. Er weiß oder glaubt zu wissen, dass hier etwas zu holen ist. Geld? Nie im Leben! Rauschgift vielleicht. Aber sie war clean. Sie könnte gedealt haben. Das wäre möglich. Was gibt es noch, verdammt noch eins? Und hat er gefunden, was er gesucht hat, oder nicht?«
Schweingruber war in der Zwischenzeit ins Badezimmer gegangen. Plötzlich schrie er entsetzt auf. Melchior lief sofort Richtung Badezimmertür.
»Was ist?«
»Bäääh! In der Toilette schwimmt ein Kondom … iiih! Benutzt auch noch!«
Melchior blieb stehen und verdrehte die Augen. Und deshalb so ein Aufstand! Zeit für einen Blödelnachschlag, dachte er und rief Schweingruber zu: »Jetzt hab Er sich nicht so, Junker! Er wird doch schon mal ein Kondom gesehen haben!«
Aber Schweingruber war überraschenderweise gar nicht nach Blödeln zumute. »Ja schon«, stotterte er. »Aber das ist rosa!«
»Rosa?«
»Rosa!«, bestätigte Schweingruber mit hörbar angeekelter Stimme.
Melchior gab sich nachdenklich, solange er noch konnte, ohne zu lachen. »Oh! Das ist … in der Tat bedenklich. Es muss Gründe … dafür geben …« Jetzt musste er doch lachen. »Lass es schwimmen, Mann! Die Spurensicherung soll sich darum kümmern.«
Er grinste noch immer breit, dachte aber kurz daran, was der Pathologe gesagt hatte. Das Kondom passte dazu. DNA gab es auf diese Weise auch. Man würde sehen, was sich ergab.
Als er vor der Regalwand stand und sie betrachtete, wurde er aber sofort wieder ernst.
»Komm mal her!«, rief er Schweingruber durch die offene Tür zu. Dieser kam der Aufforderung sofort – und scheinbar sehr gerne – nach.
»Schau mal. Die Regalwand hier. Hier fehlt etwas! Siehst du den Staubrand da? Das könnten Bücher gewesen sein, oder vielleicht Kassetten oder CDs, und zwar viele, mindestens ein Dutzend.«
»Darf man fragen, was Sie hier machen?«
Durch die offen gelassene Tür waren, ohne dass es die Polizisten bemerkt hatten, zwei Frauen in das Appartement gekommen. Sie standen in der Tür mit Blicken wie Racheengel.
»Noch einmal: Was tun Sie hier?«, rief die eine wieder. Melchior drehte sich um und hob beschwichtigend die Hände. »Dasselbe könnte ich Sie auch fragen. Aber keine Aufregung, wir sind von der Polizei.«
Er griff in seine Tasche und holte seinen Dienstausweis hervor. »Ich bin Oberkommissar Melchior. Das ist mein Assistent Schweingruber.«
Die beiden Frauen warfen sich einen kurzen, vielsagenden Blick zu.
»Dann stimmt es also …«
»Was stimmt?«
Das zweite Mädchen sagte mit leichtem ausländischen Akzent und sehr rauer Stimme: »Sandra hat in der Zeitung ein Bild gesehen und glaubt, dass es Michaela sein könnte. Wir wollten gleich nachsehen, wie es ihr geht … Und dann sahen wir Sie. Ist sie wirklich…?«
»Ja, tut mir leid. Sie ist tot.«
Das Mädchen, das eben Sandra genannt worden war, begann leise zu weinen. Melchior wandte sich ab. So etwas war noch nie sein Ding gewesen. Er holte inzwischen sein Handy heraus, verständigte die Kollegen von der Spurensicherung und überließ es Schweingruber, sich um die beiden Frauen zu kümmern.
Die setzten sich auf das Sofa. Sandra war etwa einen Meter siebzig groß, sehr schlank und hatte kurze, brünette Haare. Auf den ersten Blick wirkte sie weder besonders attraktiv noch hässlich. Am ehesten hätte man sie als unscheinbar bezeichnen können. Sie trug Jeans, was wenig überraschend war, sowie eine dunkelblaue Winterjacke. Ein ganz normales, natürliches, junges Mädchen, stellte Melchior fest.
Das zweite Mädchen, das mit dem Akzent, war das schiere Gegenteil. Offene, glatte, pechschwarze Haare fielen bis zum Bauch herunter, streng in der Mitte gescheitelt. Sie war noch etwas größer als Sandra und im Gegensatz zu dieser sehr geschickt geschminkt, mit allem, was der Markt so hergab. Dabei hatte sie das sicher nicht nötig, denn sie war bestimmt auch ohne Schminke hübsch genug für jede Party. Gekleidet war sie wie Sandra mit Jeans und Winterjacke, nur war das gesamte Outfit passend zu ihrem Haar tiefschwarz. Im rechten Ohr trug sie ein auffälliges Piercing. Melchior wettete, dass unter der Montur auch das eine oder andere Tattoo erscheinen würde. Sie war ganz der Typ dafür. Entweder Heavy oder Grufti, da war er sich nicht sicher.
»Geht’s wieder?«, fragte Schweingruber voll Anteilnahme, als Melchior sein Telefonat beendete. »Ich meine, könnten Sie uns sagen, wer Sie sind? Äh … Bitte.«
»Wir … also, ich heiße Andrea, Bartalus Andrea. Meine Freundin ist Sandra Witt. Wir sind … wir waren Kommilitoninnen von Michaela.«
Schweingrubers Interesse war echt. Natürlich. Aus mehreren Gründen. »Ach, Sie studieren auch Informatik?«
»Ja«, bestätigte Andrea. »Hier in Rosenheim. Unsere Wohnung ist oben, genau über der von Michaela. Ich stamme aus Ungarn, aus Debrecen. Mein Vater ist Ungar, meine Mutter war Deutsche, aus Dresden. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Sie wollte, dass ich in Deutschland studiere.«
»Wie lange kannten Sie Michaela schon?«
»Also ich kenne Michaela seit dem ersten Semester, also seit einem Jahr. Sandra …«
Die Angesprochene ergänzte, immer noch mit Tränen in den Augen: »Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. In Bochum. Sie war meine beste Freundin. Es ist …«
Sandra fing wieder stärker an zu weinen. Melchior, dem die Szene nach wie vor peinlich war, ging nach seinem Telefonat ziellos in der Wohnung herum und betrachtete die Fotos, die Michaela überall aufgehängt hatte.
»Wie ist das eigentlich passiert?«, fragte Andrea.
Schweingruber zuckte die Schultern und setzte eine wichtige Miene auf. »So ganz genau wissen wir das auch noch nicht, aber sie wurde gestern früh in der Nähe von Stephanskirchen tot aufgefunden.«
»Ein Unfall, oder was?«
»Eher nicht. Also bestimmt kein Verkehrsunfall oder so. Sie hatte …« Schweingruber druckste ein wenig herum. »… Ihr Genick war gebrochen. Wir vermuten Fremdeinwirkung, wenn Sie verstehen. Mehr wissen wir auch nicht, es tut mir sehr leid.«
Sandra schluchzte auf. »Entschuldigen Sie, bitte …«
»Aber, aber«, meinte Schweingruber. »Wir müssen um Entschuldigung bitten, dass wir Sie ausgerechnet jetzt mit unseren Fragen belästigen.«
Melchior verzog das Gesicht. Der Junge übertrieb ein wenig … Fehlte noch, dass er ihr ein Taschentuch gab und die Tränen persönlich abwischte. Halt, Alter! Werd nicht ungerecht … Doch. Genau das mit dem Taschentuch machte Schweingruber tatsächlich.
»Vielen Dank.«
»Keine Ursache.«
»Warum schaut es hier eigentlich so aus? Waren Sie das?«, fragte Andrea etwas angriffslustig.
»Nein. Jemand war hier und hat die Wohnung durchsucht«, antwortete Schweingruber. Zu Melchiors Überraschung ging niemand weiter darauf ein. Merkwürdig – als ob das normal wäre, dass die Wohnung einer toten Freundin durchsucht wurde!
Eines der Bilder fiel Melchior ins Auge. Michaela war darauf zu sehen, wie sie am Ufer eines Sees stand. Sie hatte sich mit ausgestrecktem Arm selbst fotografiert. Mit der anderen Hand formte sie ein V-Zeichen für Victory. Die strähnigen, nach allen Seiten abstehenden roten Haare und das knallrote T-Shirt … So eigentümlich. Melchior schüttelte kurz den Kopf. Das war doch nicht möglich! Andererseits: der See, der Bootssteg im Hintergrund … Er glaubte sich an etwas zu erinnern!
Schweingruber hatte bemerkt, dass Melchior intensiv nachdachte und war aufgestanden und zu ihm herübergegangen.
»Was hast du?«
Melchior lächelte versonnen. »Déjà vu!«
Natürlich musste Schweingruber sofort blödeln, aber mit Rücksicht auf die Mädchen wenigstens nur ganz leise. »Lass das! Du weißt genau, wie scharf es mich macht, wenn du französisch sprichst! Was meinst du mit déjà vu, s’il vous plait?«
»Hier. Das Bild. Michaela! Das Foto ist mit einer Digitalkamera aufgenommen und mit dem Computer ausgedruckt. Der Tag des Ausdrucks steht rechts unten auf dem Bild: 20. Mai. Ich habe das schon einmal gesehen.«
Melchior drehte sich zu den beiden Frauen um.
»Entschuldigen Sie... Dieses Foto hier, wo ist das aufgenommen? Wissen Sie das zufällig?«
Andrea stand auf und kam herüber. Sie betrachtete das Bild nur kurz. »Auf jeden Fall am Chiemsee. Wir waren oft zusammen an dieser Stelle. Aber das Foto hat sie wohl selbst gemacht. Wir waren da nicht dabei, glaube ich. Kann mich jedenfalls nicht daran erinnern.«
Sandra lachte auf der Couch sogar kurz auf. »Das war ihr Hobby. Da war sie total fanatisch. Ständig hatte sie ihren Camcorder dabei und quälte jeden damit, dass sie ihn filmte. Echt, das hat so genervt!«
Sie stand auf und ging zum Regal. »Mit dem Computer konnte sie dann alles aufbereiten und schneiden. Schauen Sie, alles das sind …«
Sie unterbrach sich. Melchior nickte wissend.
»Da fehlt etwas, nicht wahr? Hab ich auch schon bemerkt. DVDs?«
»Ihre DVDs! Ihre ganzen Videos sind weg! Andrea, schau her! Sie sind alle weg! Gestohlen!«
Allmählich begann Melchior die Sache zu gefallen. Das gewohnte Gefühl in seiner Magengrube stellte sich ein, und er atmete ruhig und tief ein. Egal, was in seinem Leben sonst alles schieflaufen mochte: Jetzt war er in seinem Element und fühlte sich wohl. Das heißt, da gab es noch etwas in Verbindung mit dem Bild und seinen Erinnerungen, wovon er spontan ein schlechtes Gewissen bekam, vorausgesetzt, sein Gedächtnis hatte ihn nicht getäuscht. Aber das hatte Zeit bis später!
»Ja, also, dann sollten wir uns unterhalten«, meinte er.
»Und Sie müssen mir jetzt helfen. Schauen Sie sich um, ob noch mehr in der Wohnung fehlt. Vielleicht fällt Ihnen etwas auf. Und erzählen Sie mir mehr über Michaela.«
»Was denn zum Beispiel?«, fragte Andrea naiv.
Melchior breitete die Arme aus. »Fangen wir mal damit an: Hat Michaela hier allein gelebt? Die Wohnung ist doch ganz schön groß für eine einzige Person.«
»Ja. Ich meine: allein. Und ziemlich groß, auch ja. Wir wohnen ja genau drüber. Die beiden Appartements sind gleich. Für zwei ideal, aber allein …«
»Ziemlich viel Kohle, die Eltern, was? Ich meine, die Wohnung, die kostet doch eine Stange Geld?«
Sandra winkte ab. »So teuer ist es gar nicht. Das ist irgendwie – sozialbegünstigt oder so was Ähnliches. Und ihre Eltern sind ganz einfache Leute. Die haben kein Geld.«
Andrea widersprach heftig. »Hey, das ist aber trotzdem ganz schön teuer, ja? Für die Miete von einem Jahr krieg ich in Ungarn ein ganzes Haus! Aber zum Kaufen!«
»Jetzt übertreibst du aber, Andrea! Und wenn, dann höchstens in der Puszta!«, meinte Sandra nur.
»Okay. Wie konnte Michaela sich diese Wohnung leisten? BAFÖG allein wird ja wohl nicht reichen.«
Sandra wurde nachdenklich. »Ja, das war irgendwie seltsam. Bis zum Sommer hat sie mit uns zusammen oben gewohnt, um Geld zu sparen. Zu dritt oben, das war ganz schön eng. Sie hat sogar regelmäßig jobben müssen – in einer Gastwirtschaft gleich hier um die Ecke. Aber dann hat sie auf einmal den Job gekündigt und ist gleich danach ausgezogen.«
Melchior wurde noch hellhöriger, als er es ohnehin schon war. »Wann war das genau?«
»Am 27. Mai hat sie es uns gesagt. Mein Geburtstag, deswegen weiß ich es so genau. Auf der Geburtstagsparty hat sie es gesagt, erinnerst du dich, Andrea?«
27. Mai. Und das Foto datierte vom 20. Mai. Bingo!
»Natürlich erinnere ich mich«, sagte Andrea. »Sie hat gemeint: Diese Sklaventreiber können sich eine andere Blöde suchen. Sie macht das nicht mehr mit, hat sie gesagt. Und zum 1. Juli ist sie dann aus unserer WG ausgezogen – na ja, es war ja wirklich ziemlich eng. Hier war diese Bude frei, und weg war sie! Für uns war es natürlich nicht so toll. Ich meine, wir haben zwar mehr Platz, aber seitdem müssen wir auch mehr bezahlen.«
Wieder lachte Sandra kurz auf. »Wir haben sie alle für ganz schön verrückt gehalten, aber was soll’s.«
»Und woher hatte sie plötzlich das Geld für solche Extratouren?«
Andrea zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
»Na ja, sagen wir mal so«, meinte Sandra. »Wir hatten da so einen Verdacht.«
Melchior bemerkte in der Regalwand einen dieser kleinen Ordner, wie sie von Banken zum Aufbewahren von Kontoauszügen ausgegeben werden. Er nahm ihn heraus und blätterte ihn von hinten nach vorn durch. »Was für einen Verdacht?«
»Na ja, ein Mann halt…«, murmelte Sandra.
»Einer, der zahlt, meinen Sie?«
Sandra rief empört: »Was glauben Sie denn? So eine war Michaela nicht!«
»Keine Panik, ich wollte nichts unterstellen. Was meinen Sie dann?«
»Ich … äh, wir meinten, sie hätte vielleicht einen Freund, mit dem sie zusammenziehen wollte, aber sie wollte ihn vor uns geheim halten. Vielleicht ein älterer oder sogar ein verheirateter. Na ja, wenn es so war, dann ist es ihr geglückt. Wir haben ihn jedenfalls nie gesehen. Und hier eingezogen ist er auch nicht.«
Melchior blätterte weiter interessiert in dem Ordner. »Was aber nicht heißt, dass es ihn nicht gibt – und was nicht erklärt, wo sie das Geld her hatte. Schauen Sie jetzt mal herum, ob was fehlt, bitte?«
Die Mädchen nickten nur und verteilten sich auf die beiden hinteren Zimmer.
»Was hast du da?«, fragte Schweingruber.
»Ihre Kontoauszüge. Fein säuberlich geordnet und aufgehoben. Bis Mai ganz miese Karten: niedriger Kontostand, ständig überzogen. Und dann hier, am fünften Juni: Schau dir das da an. Dieser Einzahlungsschein, eine Bareinzahlung…«
Schweingruber zog geräuschvoll die Luft ein. »Wow! Soviel verdiene ich im ganzen Jahr nicht: 25 000 Euronen…«
»Nun halt mal an dich! Dein Gehalt ist schon angemessen. Sie hat das Geld ganz konservativ angelegt, steht alles hier drin. Und es kommt noch dicker: Hier, Datum 1. September. Noch einmal dasselbe, noch mal 25 000 und wieder in bar.«
»Ein Geldgeber, wie praktisch! Hätte ich auch gern. Was muss man tun, um an die Kohle zu kommen?«
Melchior ahnte da etwas, weit hergeholt, zugegeben, aber nicht ausgeschlossen. »Ich hab da so einen Verdacht nein, reden wir später darüber! Schließen wir einmal aus, dass es legale Arbeit war, ja? Ein Geldgeber, du hast recht, und zwar in bar. Stellt sich die Frage, wofür er gezahlt hat! Für einen Lover, der die Fähigkeiten seiner Liebsten generös zu würdigen weiß, ist das ein wenig zu generös. Du gehst jetzt jedenfalls an Michaelas Computer und suchst, was immer du dort finden kannst.«