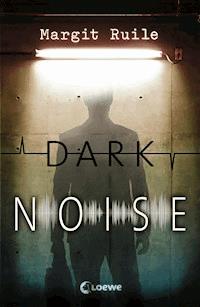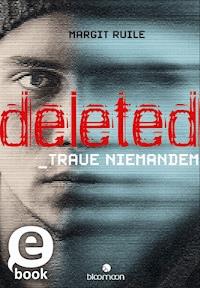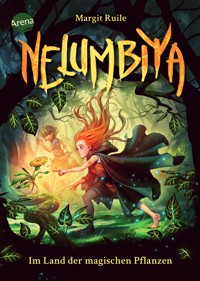
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Launische Baumriesen, ein heldenhafter Löwenzahn und ein Mädchen mit ungeahnten Kräften. Nelumbiya entführt Fantasy-Fans ab 10 Jahren in eine Pflanzenwelt voller Wunder und Magie. Als Waisenkind und Diebin lebt Tara in der Felsenstadt Ornata. Hier gibt es nur Staub, Sonne und endlose Felder mit Nutzpflanzen. Das verbotene Land Nelumbiya jenseits der Berge, so erzählt man sich, wird von gefährlichen, wilden Pflanzen bevölkert, die den Menschen feindlich gesonnen sind. Doch als Tara den sprechenden Löwenzahn Dandelion trifft, spürt sie sofort, dass er ihr nichts Böses will. Im Gegenteil: Er warnt sie vor einer großen Gefahr. Denn Askiel, der finstere Magier, ist nach Ornata zurückgekehrt und jagt alle Menschen, die wie Tara mit einem Pflanzenzeichen auf der Haut geboren wurden. Tara muss fliehen und bekommt dabei Hilfe vom Bäckerjungen Semur und der Fürstentochter Helena. Die Freunde begeben sich auf eine abenteuerliche Reise ins Land der magischen Pflanzen, um herauszufinden, was wirklich vor so langer Zeit zwischen Pflanzen und Menschen geschah. Als Tara dort erkennt, welches geheime Erbe sie in sich trägt, setzt sie alles daran, Askiel zu besiegen und damit die Menschen wieder mit der Natur zu vereinen. Dieses bildgewaltige und actionreiche Abenteuer lädt von der ersten Seite an zum Staunen und Träumen ein. Eine zeitlos schöne Geschichte über Naturverbundenheit, Mut und Freundschaft. Für Leser*innen von "Flüsterwald" und "Ein Mädchen namens Willow" und für alle, die es lieben, in fantastische Welten abzutauchen. Mit farbig gestaltetem Vor- und Nachsatzpapier sowie ganzseitigen Illustrationen von Helge Vogt. Gedruckt auf Recycling-Umweltschutzpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Ähnliche
Margit Ruile
wurde 1967 in Augsburg geboren und studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, wo sie nach ihrem Abschluss auch unterrichtete. Zudem arbeitete sie als Regieassistentin, Drehbuchlektorin und Autorin fürs Fernsehen. 2012 wurde ihr erster Roman veröffentlicht, seitdem widmet sie sich ganz dem Schreiben. Margit Ruile lebt mit ihrer Familie in München. Sie liebt Bäume und geht gerne wandern, am liebsten entlang von Flüssen.
Helge Vogt,
Jahrgang 1976, arbeitet als Illustrator und Comiczeichner (»Alisik«) für zahlreiche Verlage. Er lebt in Berlin und ist Fan von magischen Figuren – vor allem in Buch und Film.
Ein Verlag in der Westermann Gruppe
1. Auflage 2023
© 2023 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Lizenzgeber »Nelumbiya«: new!move films & buzzin bus media
Cover und Innenillustrationen: Helge Vogt
Umschlaggestaltung: Juliane Lindemann
Lektorat: Lisa-Marie Reuter
E-Book ISBN 978-3-401-81053-9
Besuche uns auf:
www.arena-verlag.de
@arena_verlag
@arena_verlag_kids
GewidmetFranziska und Viktoriaund allen, denen die Zukunft gehört.
Inhalt
Teil 1: Ein Bote von weit her
1. KapitelTamerans Auftrag
2. KapitelDandelions Flug
3. KapitelDas große Fest
4. KapitelDas Zeichen
5. KapitelLichter
6. KapitelDreißig Kupfermünzen
7. KapitelEine kleine Gestalt mit Kapuze
8. KapitelPirilla und Antonio
9. KapitelDas gläserne Herbarium
10. KapitelAsche
11. KapitelDie geheime Strophe
12. KapitelDas Versprechen
13. KapitelEin prall gefüllter Rucksack
Teil 2: Nacht, Nacht und wieder Tag
14. KapitelDie blauen Stufen
15. KapitelAuf dem Schwarzwasser
16. KapitelDer verhängnisvolle Koffer
17. KapitelDie offene Tür
18. KapitelHelenas Kissen
19. KapitelIm Tal des Dunklen Waldes
Teil 3: Über den Fluss
20. KapitelQuercus
21. KapitelAuf dem Ast
22. KapitelArmillarion
23. KapitelNichts ist so stark wie die Sehnsucht
24. KapitelEntscheidung am Brückenbaum
25. KapitelDie wütenden Weiden
26. KapitelDas Silbergraswesen
27. KapitelZwei miteinander verwachsene Äste
28. KapitelSchattenblatt
29. KapitelBlätter und Staub
30. KapitelMauer und Meer
Teil 4: Wo alles begann
31. KapitelDer Rat der Farne
32. KapitelDer Wasserspiegel
33. KapitelEin kleiner weißer Funke
34. KapitelVerwandlungen
35. KapitelDie Spur des Pfeils
36. KapitelArmillarions Brunnen
37. KapitelGefangen!
38. KapitelVom Dunkel ins Licht
39. KapitelTamerans Truhe
40. KapitelChirons großes Lied
Teil 1
Ein Bote von weit her
1. Kapitel
TAMERANS AUFTRAG
Inmitten der quirligen Wellen der Silbernen Wasser lag eine kleine Insel. Sie wurde von einem riesigen alten Baum überschattet, der weit über die Insel und den Fluss hinaus berühmt war. Viele hielten ihn für gefährlich, andere nur für übellaunig. Manche behaupteten auch, sein Ruhm habe ihn eigensinnig und eingebildet werden lassen. Aber sah man genauer hin, so traf das alles auf Quercus, den mächtigen Eichenbaum, nicht zu.
Er war einfach nur alt.
Unzählige Tage war die Sonne in ihrem Lauf über ihn hinweggezogen, Hunderte Male hatte er im Herbst seine Blätter abgeworfen und war im Frühjahr wieder ausgetrieben. Er war schon da gewesen, bevor es Menschen auf beiden Seiten des Flusses gab, und er hatte miterleben müssen, wie die wilden Bäume des Ringwaldes sie wieder vertrieben.
Er selbst hatte keine Ahnung davon, wie alt er war. Seit sich seine ersten Triebe aus der Erde geschoben hatten, waren die Jahre verflogen wie der Wind, der durch seine Zweige streifte. Aber an jenem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, spürte Quercus tief in seinen Wurzeln, dass dieser Sommer sein letzter sein würde.
Als die Sonne gerade flimmernd am Horizont aufgestiegen war, drang ein durchdringendes Schnarchen aus seinem Stamm. Von außen sah es beinahe so aus, als würde Quercus selbst schnarchen, so sehr zitterten seine Äste, doch das Geräusch stammte von einem alten Mann mit silbrigem Bart und langen grauen Haaren, der hinter einem großen Astloch in seinem Bett lag.
»Tameran«, flüsterte der Baum und gab dem Mann mit einem seiner Zweige einen Schubs. »Wach auf.«
Wie?, werdet ihr fragen. Quercus konnte sprechen?
Nun, nicht so, wie ihr sprecht. Die Sprache der Pflanzen ist anders als alle Sprachen der Menschen. Wenn der Wind durch die Blätter fährt, dann hören diejenigen, die die Sprache noch nicht kennen, nichts anderes als ein Rauschen. Aber wer den Baum versteht, hört ein Wispern in den Zweigen, eine Stimme aus tausend raschelnden Blättern, die im Morgenlicht tanzen. »Tameran«, wisperten die Blätter. »Es ist Zeit.«
Der alte Mann, den Quercus Tameran nannte, hörte auf zu schnarchen und öffnete ein Auge.
»Die Nacht ist vorbei«, flüsterten die Eichenblätter. »Lange vorbei.«
Tameran öffnete das zweite Auge, dann setzte er sich langsam auf. Dabei musste er achtgeben, dass er sich den Kopf nicht anstieß, denn das Zimmer in dem Astloch war winzig. Sah man genau hin, so konnte man hinter den Astlöchern, die sich über den Stamm verteilten, überall runde Zimmer entdecken. Manche waren so klein wie das Schlafzimmer. Doch andere waren größer und beherbergten Truhen und Bücherschränke, Tische aus Ästen und krumme, aus Zweigen geformte Stühle.
Verwirrt streckte Tameran seinen Kopf nach draußen. Es kam nicht oft vor, dass Quercus ihn morgens weckte. Das letzte Mal war vor vielen Jahren gewesen, als die Silbernen Wasser die ganze Insel überflutet hatten.
»Ich habe nachgedacht«, sagte der Baum langsam und bedächtig.
»So?« Tameran gähnte und sah zu den Zweigen hoch. Wenn Quercus nachgedacht hatte, dann musste darüber viel Zeit vergangen sein. Er brauchte meistens eine halbe Ewigkeit dafür. Also mindestens ein paar Monate.
»Der Sommer geht bald zu Ende. Und wir müssen die Pfeilträgerin finden, bevor es zu spät ist«, sagte Quercus.
Seine Blätter bewegten sich in einem leichten Windzug und warfen ihre gefleckten Schatten auf Tamerans zerfurchtes Gesicht, das nun sehr ernst aussah. Ja, er wusste, dass die Zeit drängte. Wie oft in diesem langen Sommer hatte er das, was er tun musste, immer wieder verschoben. Es war gefährlich – gefährlich für ihn und vor allem für Quercus! Aber der alte Eichenbaum hatte recht. Ihnen blieb nicht mehr viel Zeit.
»In einer Woche ist Vollmond und danach ist es für immer zu spät!«, flüsterten die Blätter.
»Ich werde heute einen Boten schicken«, erklärte Tameran. »Einen Boten aus Nelumbiya.«
»Weißt du schon, wen?«
»Oh«, Tameran sah den Stamm hoch und kratzte sich am Kopf. Das, was jetzt kam, würde Quercus sicher nicht gefallen. »Also … es muss jemand sein, der absolut vertrauenswürdig und unauffällig ist. Jemand, der gut fliegen kann, und vor allem jemand, der immer wieder zurückkommt, egal, was geschieht.«
»Und wer soll das sein?«, fragte Quercus misstrauisch.
»Nun, äh«, Tameran räusperte sich. »Ich habe da an Dandelion gedacht.«
»Dandelion?« Die Blätter raschelten ungläubig.
»Ich wüsste nicht, wer besser geeignet wäre.«
Der Baum schwieg. Wer genauer hinhörte, so wie Tameran das tat, konnte so etwas wie ein leichtes Ächzen vernehmen. »Dandelion!?! Du willst diesen kindischen Löwenzahn schicken?«
»Ich glaube, du unterschätzt ihn!«, sagte Tameran beschwichtigend und klopfte auf das Holz. »Er … also … er ist vernünftiger, als du denkst.«
Es antwortete ihm nur ein verärgertes Gurgeln, das von unten aus den Wurzeln aufstieg. Tameran seufzte. Nein, er würde nun nicht mit Quercus streiten. Wenn Quercus verstimmt war, dann war das eine ernste Sache. Bäume, so müsst ihr wissen, können jahrelang beleidigt sein.
Tameran beschloss daher, dass es nun besser war, nichts mehr zu sagen, und so strich er Quercus nur über die Rinde. Dann kletterte er aus dem großen Astloch, das sich viele Meter über der Erde befand. Zwischen ihm und dem Boden wuchsen dicke Äste, auf denen er nun nach unten spazierte. Jedem anderen wäre schwindelig geworden, aber Tameran wohnte in dem Baum, seit er sich als Kind mit ihm verbunden hatte, und kannte jede Kerbe und jeden Zweig. So sah es ganz leicht aus, wie er sich von Ast zu Ast bewegte. Vorbei an den flatternden Wäschestücken, die oben in der Krone trockneten. Vorbei an Rabennestern und tellergroßen Baumpilzen, die weich wie ein Sessel waren. Er wich geschickt den geflochtenen Körben aus, die von den Zweigen baumelten. Unten angekommen nahm er seinen Umhang von einem Haken aus Rinde und lief mit schnellen Schritten zur Spitze der Insel.
Dort stand er eine Weile still und sah, wie der Nebel über den Silbernen Wassern schwebte. Wie viel hätte er gegeben, noch einmal hinter die Nebel nach Nelumbiya zu gelangen! Doch nach allem, was vor langer Zeit passiert war, blieb ihm nur die Hoffnung, hin und wieder einen flüchtigen Blick auf das Land zu erhaschen. Tameran holte eine kleine Holzflöte aus einer der Taschen seines Umhangs und begann zu spielen. Eine zarte, sehnsuchtsvolle Melodie wehte über das quirlige Wasser und wurde auf der anderen Seite von der Nebelwand verschluckt. Tameran setzte die Flöte ab und wartete. Würden Nelumbiyas Bäume seiner Musik antworten?
Lange Zeit geschah nichts. Doch dann, gerade als Tameran sich enttäuscht abwenden wollte, lichtete sich der Nebel und gab den Blick auf die Baumriesen am anderen Ufer frei. Es waren Weiden, sie standen dicht an dicht, ihre hellen Blätter bewegten sich sanft.
Tameran steckte die Flöte wieder ein und formte mit den Händen einen Trichter. »Dandelion!«, rief er über das Wasser den Weiden zu. »Schickt mir Dandelion!«
Doch die Bäume blieben stumm.
Schließlich kam am anderen Ufer Wind auf, der die Blätter zum Flattern brachte. Sie raschelten leise und da fuhr ein Windstoß durch Tamerans weiße Haare, ein warmer, weicher Wind. Und noch etwas wehte mit dem Wind heran. Manchmal blitzte es im Sonnenlicht golden auf, als es über die Wasseroberfläche tanzte. Es war so winzig, dass man es kaum sehen konnte. Doch Tameran hatte trotz seines hohen Alters gute Augen. Als es bei ihm angekommen war, pflückte er es aus der Luft. Es war ein zartes weißes Schirmchen, das erst erfreut auf seiner Hand hüpfte, dann zu Boden segelte und sich dort in eine gelbe Löwenzahnpflanze verwandelte. Die Pflanze senkte den Kopf, um Tameran zu begrüßen.
»Dandelion!«, rief Tameran und spürte, wie sein Herz freudig klopfte. »Du bist tatsächlich gekommen!«
Der Löwenzahn richtete sich auf. »Womit kann ich helfen?«, fragte er. Er klang ganz anders als Quercus. Er klang wie ein Kind.
»Ich brauche deine Dienste«, erklärte Tameran. »Ich muss eine Nachricht nach Ornata schicken.«
Der Löwenzahn hob erstaunt den Blütenkopf. Ornata! Die Menschenstadt! »Ich habe schon von der Stadt aus Stein gehört«, sagte er und seine Stimme konnte seine Neugier kaum verbergen.
»Es ist eine gefährliche Mission.« Tameran sah den Löwenzahn besorgt an. Er war so zierlich! Vielleicht hatte Quercus recht und er war zu klein und kindlich für so eine schwere Aufgabe!
»Ich habe keine Angst«, erklärte Dandelion mit heller Stimme, gerade so, als hätte er Tamerans Gedanken erraten. »Ich habe eigentlich vor nichts Angst«, setzte er hinzu.
»Genau das habe ich befürchtet«, raschelten Quercus’ Blätter über ihnen.
Tameran sah von der Baumkrone zu dem kleinen Löwenzahn und räusperte sich. »Wir, Quercus und ich, setzen große Hoffnungen auf dich!«
Dandelion streckte sich. »Was soll ich tun?«
»Finde ein Mädchen mit dem Zeichen des gefiederten Pfeils auf seinem Arm!«, sagte Tameran. »Und bring sie her. Sie schwebt in höchster Gefahr!«
»Aber wie werde ich sie erkennen?«
»Sie muss nun elf Jahre alt sein und ich weiß, dass sie leuchtend rote Haare hat. Sei vorsichtig, niemand darf merken, dass du sie suchst. Wir wollen keine Aufmerksamkeit auf sie lenken.«
Dandelion nickte. »Hat sie auch einen Menschennamen?«
»Ihre Eltern haben sie Tara genannt. Aber ich weiß nicht, ob sie den Namen noch trägt. Sie wohnt in der Nähe des östlichen Stadttors.«
Der Löwenzahn hob seinen gelben Kopf. »Ich werde sie finden!«, sagte er zuversichtlich. »Und dann bringe ich sie zu euch! In Sicherheit!« Wer genau hinsah, der konnte bemerken, dass Dandelions gezackte Blätter vor Aufregung zitterten. Tameran, dieser alte und berühmte Pflanzenmagier, schickte ihn tatsächlich auf ein Abenteuer! Nein, er würde ihn nicht enttäuschen. Ihn nicht und ganz bestimmt nicht diesen eingebildeten Quercus! Er, Dandelion, würde das Menschenkind finden! Er warf einen kurzen verstohlenen Blick zu der Eiche hoch, doch der große Baum schwieg. Da verneigte sich Dandelion stolz vor Tameran und innerhalb eines Wimpernschlags verwandelte sich die gelbe Blüte in eine weiße flaumige Kugel aus unzähligen kleinen Schirmchen.
»Gute Reise, Dandelion!«, sagte Tameran und pustete auf die Kugel. Die Schirmchen stoben auseinander. Erneut kam Wind auf und wehte sie davon. Sie wirbelten fröhlich in die Luft und stiegen höher, weit über die Insel, weit über Quercus hinaus, höher und höher, ihrem Abenteuer entgegen.
2. Kapitel
DANDELIONS FLUG
Dandelions Reise dauerte einen Tag und eine Nacht. Die Schirmchen wurden vom Südwind über das Land getragen. Unter ihnen breitete sich der Ringwald aus, die wilden Kronen der Bäume wiegten sich im Wind. »Flieg, Dandelion! Flieg!«, flüsterten sie. Weiter, nur weiter! Die Winde trieben die Schirmchen höher, bis sie weit über der Mündung der Silbernen Wasser flogen, wo der Fluss auf das Meer traf. Die Schirmchen überschlugen sich. Weiter, immer weiter!
Dann trieb sie der Wind weg von Nelumbiya über die Grauen Berge. Es wurde dunkel und ein riesiger, ovaler Mond stieg auf, der Dandelion seltsam fremd vorkam. Er war noch nie so weit weg von zu Hause gewesen und für einen kurzen Moment sank ihm der Mut und seine Schirmchen flogen tiefer. Würde er jemals wieder nach Nelumbiya zurückfinden? Würde er die alten Bäume des Ringwaldes wiedersehen, die Silbernen Wasser und den Weltenbaum? Würde er Tameran wieder begegnen? Doch Dandelion hatte nicht viel Zeit nachzudenken, denn der nächste Windstoß riss ihn mit und trieb ihn über die schneebedeckten Gipfel der Grauen Berge. Die Schatten seiner Schirmchen tanzten über das stille Eis, das im Mondlicht glänzte. So etwas hatte er noch nie gesehen!
Als die Nacht endlich den ersten Sonnenstrahlen wich, flog Dandelion über einen menschengemachten Weg, der sich auf der Westseite der Berge herabschlängelte. Er verlief neben einem Rinnsal, das sich rasch verbreiterte und am Fuß der Berge schließlich in einen wilden Fluss mündete, der im Licht der heraufziehenden Dämmerung leuchtete.
Und als die Sonne vollends über dem Fluss aufging, sah Dandelion, dass das Wasser gezähmt wurde und sich auf Kanäle verteilte, die wie ein Schachbrett angeordnet waren. Er wunderte sich. Alles war hier so anders als in Nelumbiya! Das Land war nicht grün und von wilden und stolzen Pflanzen bewohnt. Es gab keine Gräser und Büsche, keine leuchtenden Blumen zwischen den Wiesen, keine verschworenen Wälder mit Baumwipfeln, die sich im Wind einander zuneigten, keine Schlingpflanzen, die an den Stämmen emporkletterten, keine Farne, kein Moos. Nein, hier stand kein einziger Baum, hier wucherten keine Sträucher und Kräuter, es gab nur rechteckige Felder, über denen die Hitze flimmerte.
Und hier waren Menschen! Feldarbeiter kämpften sich durch die Maisstauden, die dicht an dicht in schnurgeraden Reihen standen. Wie eine Armee! Noch nie hatte Dandelion solche Pflanzen gesehen. Sie wuchsen einzeln aus dem trockenen, rissigen Boden ohne ein anderes Gewächs neben ihnen. Das war so verwirrend, dass Dandelion in der Luft kurz innehielt. Noch mehr verstörte ihn, dass die Menschen, die zwischen den Stauden umhergingen, silberne Messer trugen, mit denen sie die reifen Kolben abschnitten. Es war still auf den Feldern, nur das pfeifende Geräusch der Klingen durchzischte die Luft, gefolgt vom trockenen Rascheln der Maispflanzen, wenn ein Kolben von ihnen gelöst wurde.
Es gab viele Kinder, die auf den Feldern arbeiteten. Es schien eine traurige und zähe Arbeit zu sein, denn keines der Kinder sah glücklich aus. Keines sang oder sprach und nirgendwo war ein Lachen zu hören. Dandelions Schirmchen flogen nun tiefer. Überall fragte er die braunen Pflanzen nach dem Mädchen mit dem gefiederten Pfeil, aber keine antwortete ihm. Sie kannten seine Sprache nicht! Wie sollte er die Pfeilträgerin jemals finden?
Ach! So hatte er sich sein Abenteuer nicht vorgestellt! Mit einer warmen Luftströmung stieg er wieder auf und da, in der Ferne, wie eine Fata Morgana lag eine Stadt auf einem Felsen. Sie hatte hohe Mauern, die ein perfektes Fünfeck bildeten. An jeder Seite dieses Fünfecks war ein Tor, von dem große Brücken hinab zu den Feldern führten. Menschen, klein wie Ameisen, strömten über sie in die Stadt. Dandelions Schirmchen tanzten aufgeregt.
Das war sie: Ornata, die Menschenstadt. Er hatte es geschafft! Staunend segelten die Schirmchen tiefer und flogen in die Stadt hinein. Auch hier gab es keinerlei Pflanzen. Keine Blumen, keine Bäume! Nur ein Gewirr aus Gassen, Häusern und Menschen. Dazwischen ragten Türme aus porösem Stein auf, in die spitzgieblige Fenster gehauen waren. Und über allem lag ein geheimnisvolles blaues Leuchten, vor dem sich Dandelion fast fürchtete.
Der Wind trieb die Schirmchen durch die Gassen und über die Türme des großen Palasts. Goldene Kuppeln glänzten in der Sonne. Angezogen von dem Gold flog Dandelion zu einem der Türme und schwebte durch ein geöffnetes Fenster. Hier war es viel kühler als draußen. Wunderschöne Mosaike zierten Boden und Wände und in der Mitte des Raums befand sich ein kleiner Tisch. Erschrocken hielt Dandelion im Flug inne. Auf dem Tisch stand eine durchsichtige Glasflasche, die oben fest verkorkt war, und in ihr befand sich eine Pflanze. Es war eine Lilie mit einem großen weißen Blütenkopf mit rosa Spitzen. Dandelion kannte sie aus Nelumbiya, die wilden Lilien mit ihren hellen Köpfen. Sie waren geschwätzig, fröhlich und laut. Doch diese hier war schöner als alle, die er je gesehen hatte. Ihre Blüte war größer und prächtiger und doch wirkte sie traurig und einsam. Dandelion flog tiefer. Seine Schirmchen stießen an das Glas und er verwandelte sich zurück in eine Löwenzahnpflanze. Die Lilie beugte sich zu ihm und betrachtete erstaunt seinen gelben Kopf. »Wer bist du?«, fragte sie durch die Glasscheibe.
»Ich bin Dandelion!«, rief er erleichtert. Endlich eine Pflanze, mit der er sich unterhalten konnte!
»Flieg weg von hier, schnell, kleiner Dandelion!«, riet ihm die Lilie. »Flieg, wenn dir dein Leben lieb ist! Denn hier ist kein Platz für uns!«
»Ich bleibe bei dir«, wollte Dandelion noch rufen, doch da wurde schon ein feines Netz über ihn geworfen.
»Was für ein perfekter Fang!«, rief eine Männerstimme und steckte den Löwenzahn in eine Flasche.
3. Kapitel
DAS GROSSE FEST
Auf dem Hof der schönsten und größten der vier Burgen der Stadt fand ein Fest statt. Helena, die Tochter des mächtigen Hadrian, wurde elf Jahre alt und wie es sich für den Geburtstag einer Fürstentochter in Ornata gehörte, wurde er prächtig gefeiert. Es gab eine Musikkapelle, lang gezogene Tische mit weißen Tischdecken, auf denen große Teller mit dem herrlichsten Essen standen, und natürlich viele Gäste. Menschen in prächtigen und reich verzierten Gewändern plauderten miteinander. Die Frauen trugen bestickte Kleider mit Röcken, die sich bauschten, und die Männer lange dunkle Umhänge mit geometrischen Mustern am Saum. Die Sonne brannte unerbittlich auf ihre wohlfrisierten Köpfe und sie fächelten sich Luft mit großen runden Fächern zu. Es war fast unerträglich heiß und das bisschen Schatten, das es gab, stammte von den hohen Burgtürmen, deren Silhouetten wie schwarze dunkle Riesen mit spitzen Kappen auf das kunstvolle Mosaikpflaster des Hofes fielen.
Wenn man sich genauer umsah, so war es ein recht sonderbares Fest für einen elften Geburtstag, denn es gab keine Kinder, die eingeladen waren. Helena saß allein auf einem Podest unter einem großen Schirm. Sie war sehr blass und trug ein langes grünes Kleid, das genau ihre Augenfarbe widerspiegelte. Trotz der Hitze hatte sie einen prächtigen Schal mit goldenen Verzierungen um ihren Hals geschlungen, der zu ihren langen blonden Haaren passte. Sie wirkte nicht so, als wäre sie froh, Geburtstag zu haben. Sie sah eher so aus, als hoffte sie, dass die Feier bald vorbei wäre und sie nicht mehr die ganze Zeit fremde Menschen anlächeln müsste, die an dem Podest vorbeiliefen und vor ihr knicksten.
Den Burghof umgab eine hohe Mauer, die oben mit spitzen Zacken aus Glas gespickt war. Über die Mauer lugte ein Mädchen, das sich normalerweise von so etwas Lächerlichem wie Glaszacken nicht aufhalten ließ. Sie hatte verfilzte rote Haare, trug ein graues zerschlissenes Kleid und hatte einen großen Sack um ihre Schultern geworfen. Auch sie war in diesem Sommer elf Jahre alt geworden. Keiner hatte ihr etwas geschenkt oder ein Fest für sie gefeiert und wenn sie genau darüber nachdachte, kannte sie noch nicht einmal den Tag, an dem sie Geburtstag hatte. Ihr Blick schweifte über den Burghof und blieb immer wieder bei Helena hängen. Wie konnte jemand, der alles hatte, nur so unglücklich aussehen?
Unter ihr, im Schatten der Mauer, stand ein anderes Kind, ein kleines dünnes Mädchen mit hellen flaumigen Haaren, das von einem Fuß auf den anderen trat.
»Tara, was siehst du? Wie sieht sie aus?!«, rief es aufgeregt.
Tara, das Mädchen an der Mauer, seufzte. »Wir sind nicht hier, um uns irgendwelche Prinzessinnen anzusehen.«
»Aber … «
»Schau lieber nach, wie wir dort reinkommen!«
»Können wir denn nicht einfach drüberklettern?«
Tara schüttelte den Kopf. »Zwischen diesen Zacken kommst nicht mal du durch, Merle!«
Sie seufzte, sprang von dem Mauervorsprung herunter auf das Pflaster und verzog das Gesicht, als sie unten aufkam. Das Pflaster war glühend heiß und übersät von Kieselsteinen, die sich in Taras Fußsohlen bohrten. Merle sah sie erwartungsvoll an. Sie war einen Kopf kleiner und vielleicht halb so alt. Tara hatte sie eines Tages mutterseelenallein auf der Straße aufgelesen und seitdem folgte Merle ihr wie ein Schatten. Die beiden Kinder liefen ein Stück die Mauer entlang, bis sie in Sichtweite eines großen schmiedeeisernen Tores gelangten, zu dem sich eine staubige Straße von der Unterstadt her hochschlängelte. Das Tor wurde von zwei schwarz gekleideten Männern bewacht.
»Und was machen wir jetzt?«, flüsterte Merle.
»Abwarten«, sagte Tara und zog Merle in eine verborgene Nische zwischen den Mauersteinen.
Eine Weile geschah nichts, nur die Stimmen und die Musik von dem Fest waren zu hören. Dann stieß Tara Merle an und deutete auf die Straße. Ein Handkarren wurde von einem dicken Jungen mit verdrossenem Gesichtsausdruck den Weg heraufgezogen. Neben ihm schlenderte ein anderer Junge. Er sah dem ersten ähnlich, wirkte aber wie eine jüngere, freundlichere Kopie von ihm. Er hatte strohblondes Haar, ein schmales Gesicht und dunkle wache Augen, die fröhlich glitzerten. Der Karren holperte über die Steine. In ihm befanden sich große, runde Brotlaibe, die sich übereinander auf einer Decke stapelten. Die beiden Jungen kamen zu dem Tor. Der Karren stand still. Der dicke Junge spähte durch das Gitter und zog eine Schriftrolle heraus, die er durch die Stäbe reichte. »Essenslieferung!«, brummte er.
Der schwarz gekleidete Palastwächter nahm das Pergament entgegen, entrollte es und kratzte sich am Kopf. Es dauerte eine schiere Ewigkeit, bis er das Blatt durchgelesen hatte. Tara sah sich rasch um. Sie bedeutete Merle mit einem Wink, ihr zu folgen. Geduckt schlichen sie sich hinter den Wagen mit den Broten und stiegen hinein. Tara zog die Decke erst über Merle und versteckte sich dann selbst darunter. Hier war es dunkel und stickig und der Duft der frisch gebackenen Brotlaibe machte Tara ganz schwindelig. Ihr leerer Magen knurrte plötzlich so laut, dass sie sich fragte, ob es irgendjemand gehört hatte. Aber alles blieb ruhig, keiner hatte sie entdeckt. Sie hörte nur die Stimme der Palastwache. »Castor und Semur, Bäckergesellen. Ja, eure Namen stehen hier auf der Liste. Alles in Ordnung, ihr könnt passieren.«
Der Wagen setzte sich in Bewegung, nur um dann gleich wieder anzuhalten. »Semur, hilf mir mal! Ich weiß nicht, warum es jetzt so schwer ist«, rief eine Jungenstimme.
Tara wagte kaum zu atmen. Ihr Herz klopfte und klopfte, aber niemand schien zu bemerken, dass der Wagen neben dem Brot auch zwei blinde Passagiere in den Burghof beförderte. Es holperte einmal hefig und Tara nahm an, dass das die Schwelle am Tor gewesen war. Dann ruckelte es gleichmäßiger, während sie über das Mosaikpflaster des Hofes gezogen wurden, und schließlich blieb der Wagen ganz stehen. Tara lag noch für eine Weile still, dann gab sie Merle einen Schubs. Beide krochen unter der Decke hervor und kletterten schnell aus dem Wagen. Sie hatten es in den Burghof geschafft, aber sie waren noch nicht in Sicherheit: Der Junge mit dem verdrießlichen Gesichtsausdruck entdeckte Merle, wie sie gerade von der Ladefläche sprang. »Zum Teufel! Was macht ihr denn hier?«
Tara nahm Merle an der Hand, verschwand mit ihr blitzschnell in der Menschenmenge und zog sie dann unter einen langen Tisch, hinter dessen tief hängenden Tischdecken sie sich verstecken konnten. Große Schnallenschuhe und Männerwaden traten an ihnen vorbei, gefolgt von hohen, edelsteinbesetzten Damenschuhen. Als die Luft rein war, schlüpfte Merle unter dem Tisch hervor und griff sich wahllos ein paar Köstlichkeiten: Hühnerbeine, Melonenwürfel und puderzuckerbestäubte Krapfen, die Tara und sie dann gierig verschlangen. Als sie endlich satt war, fühlte Tara ein warmes Gefühl in sich aufsteigen, das von ihrem Magen ausging und sich von dort in ihrem ganzen Körper ausbreitete. So war es also, wenn man keinen Hunger mehr hatte! Ein bisschen war es hier unter dem großen Tisch so, wie selbst Geburtstag zu haben. Sie lehnte sich gegen ein Tischbein und lauschte der Musik. Die Kapelle, die zu Helenas Ehren spielte, klang wie ein ganzes Konzert zwitschernder Vogelstimmen.
»Tara!« Merle wischte sich den Mund mit ihrem Ärmel ab. »Jetzt müssen wir uns um den Schmuck kümmern! Auriga wird furchtbar wütend sein, wenn wir nur Essen mit nach Hause bringen!«
Tara seufzte. Merle hatte recht. Auriga wäre ganz und gar nicht begeistert, wenn von ihrem Diebeszug nur ein paar Zuckerkringel übrig blieben. Sie biss sich auf die Lippe und sah sich um. Es war fast unmöglich, den Frauen ihre üppigen Halsketten abzunehmen, aber vielleicht wären ein paar Taschenuhren oder Geldbörsen drin? Während Tara noch nachdachte, spielte die Kapelle einen Tusch. Es folgte eine kurze Stille, bis sich schließlich ein Gemurmel erhob. Tara schob vorsichtig die Tischdecke beiseite. Direkt vor der Prinzessin stand eine hagere Frau in einem gerüschten Spitzenkleid, die eine große bauchige Flasche in der Hand hielt. In der Flasche befand sich eine Pflanze. Keine Nutzpflanze, wie sie draußen auf den endlosen Feldern wuchsen. Nein, diese Pflanze war anders. Sie hatte einen kleinen runden gelben Blütenkopf, der an das Glas drängte, als wollte er jeden Moment ausbrechen. Die Rüschenfrau verneigte sich tief vor der Prinzessin und überreichte ihr die Flasche. In Helenas Gesicht schien zum ersten Mal an diesem Tag echte Freude auf. Sie hielt die Flasche lange in der Hand und betrachtete die Pflanze mit unverhohlener Neugier.
»Was für ein Geschenk!« Ein Raunen lief durch die Menge der Zuschauer. »Seht nur! Eine neue Züchtung!«
»Das ist keine Züchtung!«
»Ich habe gehört, dass das eine echte Wildpflanze ist.«
»Wie kann man so was einem Kind schenken?«, empörte sich eine Frau in einem hässlichen giftgrünen Brokatkleid, dessen Rock sich nun direkt vor Taras Nase bauschte. »Stell dir nur vor, was passieren würde, wenn sie die Flasche öffnet!«
Von dem Rumoren aufgeschreckt, eilte Helenas Vater, Fürst Hadrian, herbei. Er nahm seiner Tochter rasch die Flasche aus der Hand und stellte sie ganz ans Ende des Tischs, auf dem sich auch Helenas andere Geburtstagsgeschenke befanden.
Ja, was würde nur passieren, wenn man die Flasche öffnet?, dachte Tara, während sie Helenas enttäuschtes Gesicht sah. Die gelbe Pflanze würde ausbrechen! Eine gefährliche Wildpflanze, vor der man sich in Acht nehmen musste. Sie schob ihren Ärmel zurück und kratzte sich an ihrem rechten Oberarm. Dort hatte sie ein merkwürdiges Muttermal. Viele kleine Punkte waren so ausgerichtet, dass sie die Form eines Pfeils ergaben.
Und dieses seltsame Zeichen fing rätselhafterweise genau jetzt an zu jucken. Und während sie auf ihr Muttermal starrte, kam ihr eine Idee. Sie blickte zu Merle, die sich nicht im Geringsten für die Pflanze zu interessieren schien und gerade gedankenverloren aus Zuckerkringeln eine kleine Kette fertigte. »Versprich mir, dass du hier unten bleibst, egal, was passiert!«
Merle sah kurz hoch. »Was hast du vor?«
»Ich glaube, ich habe etwas wirklich Wertvolles entdeckt!« Tara nickte Merle zu, dann kroch sie unter dem Tisch hervor und stieß mit der Frau in dem giftgrünen Kleid zusammen. Die sah sie an, als wäre sie ein besonders schmutziges Insekt, wandte sich aber gleich darauf wieder ab, während Tara weiter zu dem Tisch mit den Geschenken lief.
Nun müsst ihr wissen, dass Tara zu einer wirklich geschickten Diebin ausgebildet worden war und die Kunst beherrschte, unsichtbar zu sein. Man brauchte dazu nicht einmal einen Tarnumhang. Um nicht aufzufallen, musste man sich einfach so benehmen, als gehörte man ganz selbstverständlich dazu. Tara ging also aufrecht und ohne sich zu ducken, setzte ein gewichtiges Gesicht auf, nahm einen Teller von einem Tisch und stellte ihn auf den anderen und gelangte so auf die gegenüberliegende Seite des Burghofs zu der Flasche mit der gelben Pflanze, ohne dass jemand Notiz von ihr nahm. Die Flasche stand zusammen mit steifen Puppen, kleinen Porzellanfiguren, Kreiseln und anderen Geschenken auf einem Tisch ungefähr in Taras Augenhöhe. Wie von einer unsichtbaren Kraft angezogen, trat Tara näher und musterte die Pflanze hinter dem Glas. Sie sah aus wie ein kleiner Mensch! Ihr Blütenkopf war zierlich und gelb und hatte einen Flaum, der an Haare erinnerte. Die Blätter wirkten wie Arme und die Pflanze stemmte sie gegen ihren Stängel, was entschlossen aussah, aber auch rührend, weil die Pflanze so klein war. Für einen Moment hatte Tara das seltsame Gefühl, dass diese Pflanze sie entdeckt hatte. Ja, genau sie! Ihr Herz blieb vor Schreck einen Moment lang stehen und schlug dann schneller weiter. Der Kopf der Pflanze wandte sich ihr zu und etwas Seltsames geschah: Die gelbe Blüte begann zu leuchten.
»Du bist es«, flüsterte eine feine, helle Stimme. »Ich habe dich gesucht.«
Konnte sie die Pflanze verstehen? »Wer bist du?«, fragte Tara erstaunt.
Die Pflanze reckte ihren gelben Kopf. »Du sprichst unsere Sprache«, wisperte sie begeistert. »Du musst es sein.«
Tara starrte sie an. Hatte sie tatsächlich eine andere Sprache gesprochen?
»Natürlich hast du das!« Die Pflanze verbeugte sich tief, das heißt, sie ließ den Blütenkopf nach unten hängen und richtete sich dann wieder auf.
»Mein Name ist Dandelion und ich war auf dem Weg zu dir, doch dann hat man mich gefangen genommen.«
»Dandelion?«, flüsterte Tara. »Woher kommst du?«
Da verwandelte sich die Pflanze vor ihren Augen. Der gelbe Blütenkopf wurde rund und weiß und löste sich schließlich auf in viele winzige Schirmchen, die nun in der Flasche tanzten. Jedes dieser Schirmchen war wie ein leuchtender Punkt und sie formten etwas, das Tara erstaunt nach Luft schnappen ließ: Es war ein Baum aus vielen Lichtpunkten.
Da fiel plötzlich ein Schatten über die Flasche und die Lichtpunkte erloschen. Tara drehte sich um. Der dicke Bäckergeselle stand hinter ihr und verdeckte die Sonne. Sein Mund hing offen. »Was machst du denn da mit der Flasche?«, rief er. »Lass bloß die Finger davon. Sie gehört dir nich!« Dann packte er sie hart am Handgelenk. Tara zuckte zusammen und versuchte vergebens, sich aus dem Griff herauszuwinden, doch der Bäckergeselle war kräftig und drückte nur noch fester zu. Da trat sie ihm gegen das Schienbein. Er ließ sie fluchend und mit schmerzverzerrtem Gesicht los. Tara wirbelte herum und fasste blitzschnell einen Entschluss. Sie holte tief Luft, nahm die Flasche vom Tisch und warf sie mit aller Kraft auf den Boden, wo sie in tausend Scherben zersprang.
4. Kapitel
DAS ZEICHEN
Der laute Knall des Aufpralls hallte durch den ganzen Burghof und brachte die Musik und alle Gespräche zum Verstummen. Doch die Stille dauerte nur ein paar Sekunden, in denen alle beobachteten, wie Dandelions Schirmchen eilig nach oben flogen. Sie tanzten fröhlich im Wind und schwebten über dem Burghof. Frei, endlich frei!
»Seht! Die Wildpflanze ist ausgebrochen!«, rief eine Frauenstimme. Tara hatte Glück, dass alle so abgelenkt waren. Niemand außer dem Jungen schien bemerkt zu haben, dass sie es gewesen war, die das Glas heruntergeworfen hatte. Sie sah sich verzweifelt zwischen all den gebauschten Röcken und wehenden Umhängen nach Merle um, als sie plötzlich bemerkte, dass noch jemand sie die ganze Zeit beobachtet hatte. Es war Helena. Sie war aufgestanden und die Goldfäden auf ihrem Schal blitzten in der Sonne. Tara fing ihren Blick auf und blieb für einen Moment stehen. Hatte auch Helena gesehen, dass sie Dandelion befreit hatte? Da spürte sie, wie sie jemand in den Rücken boxte. »Tara! Hier!«, hörte sie Merles Stimme. »Wir müssen weg, schnell!« Merle zerrte Tara zu dem Tor, durch das sie mit dem Wagen hereingefahren waren. Diesmal jedoch waren die Wachen nicht mehr da und sie schlüpften unbemerkt nach draußen.
Tara und Merle rannten den gewundenen Weg von der Burg in die Altstadt hinunter. Er wurde gesäumt von hohen finsteren Gebäuden, die ihre Schatten auf die Kinder warfen. Die Häuser standen hier sehr dicht, die meisten hatten geschlossene Fensterläden und Eingänge, die wie dunkle Löcher wirkten. Die Sonne begann bereits hinter den Türmen unterzugehen. Schwarze Vögel zogen vorbei und suchten sich in den Mauern einen Schlafplatz.
Nach einer Weile blieb Merle stehen. Sie war außer Atem und stemmte die Arme in die Seiten. Lange sah sie Tara, die neben ihr wartete, nicht an. Schließlich tropfte eine Träne auf den Boden. »Warum hast du das gemacht? Warum hast du dieses Glas heruntergeworfen? Ich dachte, du wolltest was stehlen! Auriga wird wütend auf uns sein, wenn wir nichts mitbringen.«
»Merle, ich …«, begann Tara.
»Außerdem …«, unterbrach sie Merle voller verzweifeltem Ärger. »Außerdem wollte ich doch noch die Prinzessin aus der Nähe sehen!«
Tara biss sich auf die Unterlippe. Merle war einen Kopf kleiner und so schrecklich dünn, dass sie manchmal Angst hatte, sie würde gleich vom Wind davongeweht. Langsam ging sie in die Knie und legte ihr die Hände auf die Schultern, als wollte sie genau das verhindern. »Es tut mir leid!«
»Sag mir nur wieso!«
Tara sah sich um, ob noch jemand in der Nähe war und ihr Gespräch belauschte. Aber die Gassen waren leer und vor ihnen auf dem Weg liefen in großer Entfernung nur ein paar kleinere Kinder.
»Kannst du ein Geheimnis behalten? Du darfst es auf keinen Fall weitererzählen.«
»Auch nicht Auriga?«, fragte Merle leise.
Tara schüttelte energisch den Kopf. »Schon gar nicht Auriga.«
Merle nickte ernst. Ihr kurz aufgeflammter Zorn schien verflogen zu sein und war der Neugier gewichen.
»Hast du die Pflanze gesehen?«, begann Tara. »Die Pflanze in dem Glas?«
Merle nickte.
»Sie hat mit mir gesprochen.«
»Sie hat mit dir gesprochen?«
»Na ja …« Tara spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Merle würde sicher denken, die Sonne hätte ihr Gehirn verbrannt. Oder Schlimmeres. »Also … nicht so, wie du jetzt mit mir sprichst. Es war eher so … wie wenn du eine Stimme in deinem Kopf hörst. Oder nicht mal das. Eher so, wie wenn man die Worte fühlt.«
»Du hast die Worte gefühlt?« Merle sah sie mit ihren großen runden Augen an. »Und was hat dir die Pflanze gesagt?«
Tara schaute für einen Moment in den Himmel, der nun schon am Rand dunkler wurde. »Sie war traurig, eingesperrt zu sein.« Sie hielt kurz inne und besann sich. Ja, da war noch was. Etwas Wichtiges. Das seltsame Gebilde, das die Schirmchen geformt hatten. »Und sie hat mir einen Baum gezeigt.«
»Einen Baum? Einen echten Baum?! Bist du dir sicher?«
Tara nickte. »Er sah genauso aus wie die Bilder von Bäumen auf den Zeichnungen am Markt.« Sie kratzte sich am Arm und musterte Merle, die lange nachzudenken schien. Wahrscheinlich musste sie das mit dem Baum verkraften. Schließlich gehörten Bäume zu den gefährlichsten Dingen, die man sich vorstellen konnte. Keiner von ihnen hatte je einen lebendigen Baum gesehen. Auf den Wandgemälden am Markt waren sie als böse Wesen mit vielen Armen dargestellt. Es hieß, dass sie die dicksten Mauern zu Fall bringen und Menschen verschlingen konnten. Aber Merles Gedanken waren tatsächlich schon wieder woanders. »Du hättest die Pflanze nicht freilassen dürfen. Die Prinzessin wird traurig sein. Immerhin ist ihr Geburtstagsgeschenk entwischt!«
Tara lächelte und fuhr dann Merle über die flaumigen Haare. »Ehrlich, Merle, ich glaube, das ist jetzt unsere geringste Sorge!« Sie verließen das Gewirr der Gassen und kamen an den Rand der Stadt. Wäsche blähte sich an langen Stangen im Wind und die Kinder, die eben noch vor ihnen hergelaufen waren, verschwanden in den Hütten, die dicht an die Stadtmauer gebaut waren.
Ganz am Ende der Reihe stand eine halb verfallene Hütte. Sie war kleiner als die anderen und hatte nur ein winziges rundes Fensterloch über einer großen dunklen Tür, was sie so aussehen ließ wie ein einäugiges Ungeheuer, das seinen Schlund aufgesperrt hatte. Drinnen empfingen die Kinder dichte Rauchschwaden, zwischen denen sie Auriga ausmachen konnten. Die alte Frau saß gebückt vor dem Herd und stocherte mit einem Schürhaken in der Kohle herum. Pollux, der dicke schwarz-braun gefleckte Kater, ringelte sich auf ihrer Schulter und starrte die Kinder mit glühenden Augen an.
»Ihr kommt spät«, murmelte Auriga, ohne aufzusehen. Der Schein des Feuers erhellte ihr spitzes Gesicht. Sie trug einen löchrigen wollenen Umhang, in dem ihre magere Gestalt fast zu verschwinden schien. Goldene Ohrringe blitzten an ihren Ohren und die weißen Haare waren zu einem Knoten gebunden, aus denen sich einzelne Strähnen lösten, die sich um ihre eingefallenen Wangen ringelten.
»Es … es war schwer hineinzukommen«, murmelte Tara. »Deshalb hat es so lange gedauert.«
»Ihr seid jung und gelenkig, da kommt man überall rein!«, entgegnete Auriga unwirsch. Sie sah kurz hoch und ihr Blick streifte die Beutel, die Tara und Merle umhängen hatten. »Und?«
Tara legte mit einem flauen Gefühl im Magen ihren Beutel auf den Tisch. Er war viel zu leicht und das sah auch Auriga. Sie zog einen halben Laib Brot und zwei Maiskolben heraus.
»Und das ist von mir!«, rief Merle und legte die Zuckerkringelkette daneben.
Auriga musterte sie mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Das ist alles?«
»Es gab überall Wachen«, erklärte Tara.
Auriga schnaubte. »Ihr wagt es, mir ein altes Brot und ein bisschen Gemüse mitzubringen? Wo sind die Halsketten? Börsen? Geld? Ihr wisst genau, nach was ihr suchen sollt!«
»Wir hatten nicht genug Zeit!«, versuchte sich Tara zu rechtfertigen.
»Aber Zeit genug, sich selbst satt zu essen, oder?« Auriga deutete auf einen Fettfleck auf Merles Kittel. »Und was ist mit mir? Ich sitze hier und hungere! Nur das ist euch ja gleichgültig!« Sie stieß mit dem Schürhaken in das Feuer, sodass die Funken nach oben stoben. »Ihr seid wirklich zu nichts nütze! Zu gar nichts. Ich weiß nicht, warum ich euch hier wohnen lasse …«
»Schick uns nicht weg!«, rief Merle. »Bitte! Es war doch nur wegen der Pflanze!«
Auriga hielt für einen Moment inne und starrte dann Merle an. »Was für eine Pflanze?«
»Die Prinzessin hatte Geburtstag«, sprudelte es aus Merle hervor. »Sie hatte goldene Haare und ein grünes Kleid und war wunderschön! Sie hat eine wilde Pflanze als Geschenk bekommen in einem Glas. Und Tara hat gesagt, dass sie wertvoll ist, und hat dann das Glas … Au!« Merle sah Tara an und wurde plötzlich rot. »Oh, also das ist ein riesengroßes Geheimnis! Davon darfst du nichts wissen!«
»Von was darf ich nichts wissen?«
»Nichts«, sagte Tara schnell.
Auriga baute sich vor Merle auf. »Von was darf ich nichts wissen? Sprich!«
Ein Holzscheit knackte in der Stille.
»Sie hat mit ihr gesprochen. Mit der Pflanze«, sagte Merle und vermied es, Tara anzusehen.
»Gesprochen«, murmelte Auriga und betrachtete Tara aus den Augenwinkeln.
Die warf Merle einen wütenden Blick zu und starrte dann lange ins Feuer. In den Kohlen gingen Städte unter und Armeen traten gegeneinander an. Ab und zu sprangen Funken nach oben.
»Was war das mit der Pflanze?« Aurigas Stimme klang gefährlich leise.
»Sie war eben in einer Flasche eingesperrt«, sagte Tara unbehaglich. »Und ich habe sie mir einfach angesehen.«
»Angesehen! Soso.«
Taras Oberarm juckte wieder und sie kratzte sich. Sie schob schnell den Ärmel ihres Kleides über das Muttermal, als sie bemerkte, dass Auriga es anstarrte. »Sie haben mich entdeckt und als ich weglaufen wollte, habe ich die Flasche umgestoßen.«
»Du hast die Pflanze freigelassen«, stellte Auriga fest.
»Nicht mit Absicht!«, rief Merle dazwischen.
Auriga trat zu Tara und flüsterte so leise, dass nur sie es hören konnte. »Gerade du solltest das nicht tun!«
Tara spürte, wie ein leichter Schauer über ihren Rücken rieselte. Sie sah in Aurigas finsteres Gesicht. »Warum nicht?«
»Es gibt viele Geheimnisse. Dinge, von denen du nichts weißt.«
»Haben sie etwas mit den Bäumen zu tun?«, fragte Merle aufgeregt, die natürlich jedes Wort mitgehört hatte.
»Schsch«, ein scharfes Zischen durchschnitt die Stille. Es war so durchdringend, dass Pollux mit einem Miauen erschrocken von Aurigas Schultern sprang.
»Schhscht! Ihr dürft davon nicht sprechen! Nicht einmal hier.« Auriga sah sich um, als hätten die schiefen Wände Ohren. »Die Nacht ist voller Spitzel.« Sie beugte sich vor und umfasste mit ihren knochigen Händen Taras Arme. »Mit diesen wilden Pflanzen bringst du nicht nur dich selbst, sondern uns alle in Gefahr!« Es war nicht nur Ärger in ihrer Stimme, sondern auch etwas anderes. Tara brauchte eine Weile, bis sie begriff, was es war: Angst. Dann spürte sie, wie sich Aurigas Griff lockerte. »Vergiss die Bäume«, murmelte sie. »Und halte dich von diesen Pflanzen fern. Egal woher sie kommen!«
Wenig später rollte sich Tara auf ihrer Strohmatratze, die sich auf dem Kachelofen befand, unruhig hin und her. Aurigas durchdringendes Schnarchen erfüllte die ganze Hütte. Sie lag als Einzige in einem Bett mit weißen Daunendecken, über die Tara manchmal mit den Fingern fuhr. Sie waren so anders als ihre eigene kratzige Decke, die sie nun über ihren Kopf zog. Doch auch das half nichts. Sie hörte Aurigas Atemzüge und ab und zu Merle, die im Traum sprach. An Schlaf war nicht zu denken. Schließlich setzte sie sich auf. Das Mondlicht schien durch das runde Fenster, unter dem Merle schlief, den mageren Arm um das weiche Fell von Pollux geschlungen. Tara schob den Stoff ihres Kleides hoch und blickte auf ihre Schulter. Dort war das Muttermal, das Auriga vorhin angestarrt hatte. Was hatte dieses Muttermal mit der geheimnisvollen Pflanze zu tun? Eine Pflanze, deren Stimme sie gehört hatte und die sich Dandelion nannte? Aber warum nur hatten ihr Dandelions Schirmchen einen Baum gezeigt? Einen Baum! In Ornata gab es keine Bäume, aber Tara glaubte fest daran, dass sie wirklich irgendwo existierten. Und das hing mit ihrem Geheimnis zusammen. Etwas, das sie aufhob, seit sie ganz klein war. Ihr geheimer Schatz, eine blecherne Kiste, die hier in dem Zimmer unter der Bodendiele des Spülsteins lag. Niemand wusste davon. Tara hatte die Schachtel vor vielen Jahren unter den Sachen ihrer Eltern gefunden, die Auriga zur Aufbewahrung gegeben worden waren. Heimlich hatte Tara sie an sich genommen und versteckt und nicht einmal Merle davon erzählt. Auriga hatte sie seither nicht vermisst.
Leise, ohne ein Geräusch zu verursachen, stieg Tara von ihrem Platz über dem Ofen hinunter und schlich sich an der schlafenden Auriga vorbei zur Spüle. Dort unter dem Stein war das Dielenbrett locker. Sie nahm den Schürhaken, hebelte es auf und holte darunter die kleine Blechkiste hervor. Ihr Herz klopfte. Sie konnte weder lesen noch schreiben, aber sie konnte ihren Namen auf dem Deckel erkennen. TARA. Es waren die einzigen Schriftzeichen, die sie kannte. Der erste Buchstabe, der aussah wie ein Kreuz, der zweite wie ein Hausdach, der dritte wie ein halbes Männchen und dann wieder das Dach. T-A-R-A. Sie fuhr mit dem Finger über die Kratzer. Auriga drehte sich schnarchend um. Tara zuckte zusammen und hätte vor Schreck fast die Kiste fallen lassen, aber es blieb ruhig. Sie wartete, bis Aurigas Atemzüge wieder gleichmäßig wurden, und nahm dann den Deckel ab. In der Blechkiste befand sich ein Lederbeutel und es gab darin … ihr Herz setzte einen Moment aus. War sie weg …? Nein, sie war noch da. Gott sei Dank! In dem Lederbeutel befand sich eine zusammengerollte Karte. Sie war vielleicht so groß wie Taras beide Hände und auf der Karte war Ornata mit seinen fünf Stadtmauern eingezeichnet. Innerhalb der Mauern konnte man Fürst Hadrians Burg sehen, den spitzen Turm mit der gewundenen Außentreppe und auch die kleine Statue des Fischmädchens in der Nähe des Nordtors. Und es standen Wörter daneben. Manchmal konnte Tara ein A oder ein T erkennen, so wie sie es von ihrem Namen her kannte. Aber all die anderen Zeichen waren ein Rätsel für sie. Ach, wenn sie doch nur einmal jemanden fragen konnte, was die Schriftzeichen hießen! Aber wen sollte sie fragen, ohne ihr Geheimnis preiszugeben?
Um die Stadtmauer herum zog sich ein tiefer Graben und dann waren da die Felder, Mais, Weizen, Kartoffeln. Tara erkannte die Nutzpflanzen an ihren Symbolen.
Jenseits der Felder aber war das, was sie sich immer wieder angesehen hatte und was sie nicht vergessen konnte. Da war ein Fluss eingezeichnet, auf dem sogar ein Schiff fuhr, dann hohe Berge und schließlich … Tara schnappte nach Luft. Nein, sie hatte sich nicht getäuscht. Es war genau das, was die Schirmchen in dem Glas ihr gezeigt hatten. Ein breiter Stamm mit unendlich vielen Ästen, die in einem Rund nach oben wuchsen. Dort war ein Baum! Er sah nicht gefährlich aus. Er sah eher so aus, als würde er Tara umarmen wollen. Wie groß er wohl war? So groß wie die Maisstauden, die sie kannte? Oder kleiner?
Alles würde sie darum geben, den Baum einmal zu sehen. Aber das war unmöglich. Nie würde sie aus Ornata herauskommen! Mit einem unterdrückten Seufzen legte Tara die Karte in die Schachtel zurück, schloss den Deckel und versteckte sie wieder unter dem Dielenbrett. In diesem Moment sah sie aus dem Fenster und entdeckte dort etwas, das silbern im Mondlicht glitzerte.
5. Kapitel
LICHTER
War da eines von Dandelions Schirmchen? Taras Herz pochte. Sie kletterte über die schlafende Merle und den Kater zur Tür, die sie so leise wie möglich öffnete. Dann schlüpfte sie nach draußen.
Wie immer hatte sich, nachdem die Sonne untergegangen war, eine durchdringende Kälte über die Stadt gelegt. Nur der Boden unter Taras Füßen fühlte sich noch warm an. Der Mond stand hoch am Himmel, er war noch nicht ganz rund und leuchtete orange. Tara sah sich vor der Hütte um. Es war ganz still, in der Ferne jagten sich mit einem zischenden Geräusch zwei Tiere.
»Dandelion?«, flüsterte Tara. »Bist du hier?« Die gewundene Straße vor ihr schimmerte silbern und außer den geduckten Häusern und ihren schiefen Schornsteinen war nichts zu sehen.
Da hörte Tara plötzlich über sich ein leichtes Rumpeln. Sie hielt inne und lauschte. Ja, es kam vom Dach. Sie ging ein paar Schritte zur Seite und stellte sich auf die Zehenspitzen, doch es war zu dunkel. Sie konnte nur die Umrisse der Stadtmauer erkennen, von der in der Woche vor dem Vollmond stets ein seltsames blaues Leuchten ausging. Tara wartete noch eine Weile, bis sie in der Nachtkälte zu frieren begann und sich eine Gänsehaut über ihre bloßen Arme zog. Nein, hier war niemand. Sie musste mit offenen Augen geträumt haben. Vielleicht hatte sie sich auch so sehr gewünscht, die Schirmchen wiederzusehen, dass ihr Verstand ihr das Bild nur vorgegaukelt hatte.