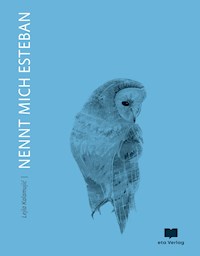
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: eta Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Erzählband liest sich wie ein fragmentarischer Roman. Seine Szenen umkreisen den Schmerz der Protagonistin über den zu frühen Tod der Mutter. Sie wächst mit den vier Großeltern – allesamt eindrückliche Charaktere – und einem trinkenden Vater auf, bis die Belagerung Sarajevos die Familie zerteilt. Die Mutter taucht in Familienlegenden und Erzählungen der Erwachsenen auf, in kindlichen Phantasien, als Lied aus dem Radio oder Geruch in der Erinnerung an die zahlreichen Friedhofsbesuche mit den Großeltern – aber auch als lässige Gesprächspartnerin in Levi‘s Jeans, die mit der jugendlichen Lejla rauchend im Park sitzt. Dabei berührt die Autorin so viele tabuisierte, schwere Themen wie den Verlust naher Menschen, Ängste und Depression, Liebe und Verbundenheit zwischen zwei Frauen sowie die Suche nach Identität, wenn das eigene Land zerfällt und die Gegenwart absurd ist, wie der Zug nach Belgrad, der an drei Landesgrenzen Lok und Schaffner wechseln muss. Es sind Geschichten, die tief berühren und uns am Ende bewegt zurücklassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, KulturKontakt Austria (im Auftrag des Bundeskanzleramts der Republik Österreich), das Goethe-Institut, die Slowenische Buchagentur JAK, das Ministerium für Kultur der Republik Kroatien, das Ressort Kultur der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein, das Ministerium für Kultur der Republik Albanien, das Ministerium für Kultur und Information der Republik Serbien, das Ministerium für Kultur und nationale Identität Rumäniens, das Ministerium für Kultur von Montenegro, das Ministerium für Kultur der Republik Mazedonien, die Leipziger Buchmesse und die S. Fischer Stiftung angehören.
Marie-Luise Alpermann dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Unterstützung durch ein Bode-Stipendium.
Lejla Kalamujić - Nennt mich Esteban
1. Auflage 2020 © eta Verlag Alle Rechte vorbehalten
eta Verlag | Petya Lund Schönhauser Allee 26 10435 Berlin www.eta-verlag.de [email protected]
Aus dem Bosnischen übersetzt von Marie-Luise Alpermann Lektorat: Anne Grunwald Titel-Illustration: Yuliia Smorochynska / Shutterstock
Originaltitel: Zovite me Esteban erschienen bei: Dobra knijga, Sarajevo 2015
ISBN 978-3-9820030-7-8
Für Naida
Was bedeutet mir die Schreibmaschine?
Der Morgen ist verregnet, ich habe überhaupt keine Lust rauszugehen. Ich sitze auf dem Sofa und blättere in der Zeitung. Kiki liegt zusammengerollt neben meinen Beinen und schnurrt. Auf Seite 28 lese ich die Schlagzeile:
LETZTE SCHREIBMASCHINENFABRIK DER WELT SCHLIESST
Es ist Dienstag, der 26. April 2011. Ich lese weiter:
Die Ära der Schreibmaschine, wesentliche Büroausstattung des 20. Jahrhunderts, neigt sich ihrem Ende zu. In Mumbai, Indien, hat die letzte Schreibmaschinenfabrik ihre Arbeit eingestellt.
Meine Mutter war Stenotypistin. In einer Zeit, über die man sagt, sie sei nichts mehr wert. Ein kurzes Leben, das nur 22 Jahre dauerte. Sie starb an einem weit zurückliegenden Freitag, am 20. August 1982. Da war ich gerade zwei Jahre alt.
In meinem Leben gibt es keine Erinnerung an die Mutter. Sie ist nur eine Geschichte, die heilige Geschichte von der Schöpfung, vom intimen Urbeginn. Meine Altersgenossen bekamen vor dem Einschlafen Märchen zu hören, ich dagegen habe den Geschichten über sie gelauscht. Über ihren Tod sprach man leise. Wenn jedoch eine Anekdote aus ihrem Leben oder einer ihrer Streiche nacherzählt wurde, redeten alle durcheinander. Dann erregte die verschwundene Zeit die Stimmbänder. Sie rollte zwischen Zunge und Gaumen hin und her, verwandelte sich an der Luft in Wörter, dann in Sätze. Die Geschichten begleiteten sie auf ihre Reisen. Es machte nichts, dass manchmal eine Geschichte die andere widerlegte und Ungereimtheiten auftauchten: Das Heilige rührt man nicht an, man glaubt daran.
Es war eine Zeit der Arbeitseinsätze, von denen man mit Nierenentzündung zurückkam. Es war eine Welt, in der Stenotypisten-Wettbewerbe abgehalten und Preise für den zweiten Platz nach Hause gebracht wurden. Für den zweiten Platz deshalb, weil irgendein Mädchen weinte, nachdem meine Mutter die Schnellere und Bessere gewesen war. Als Trost gab die Jury ihm den Pokal, und Mama schickten sie mit einer Urkunde für den zweiten Platz heim. Neben den Urkunden sind von ihr ein Bademantel, der Ehering, das Parteibuch und eine Schreibmaschine geblieben.
In der Wohnung meiner Großeltern war die Schreibmaschine eine Reliquie. Sie wurde als Erinnerung sorgfältig im Schrank des Schlafzimmers gehütet. Nur mein hartnäckiges Betteln konnte sie manchmal auf den Tisch locken. Baka und Deda setzten sich dann neben mich und ließen mich tippen. Klappernd hallte es von den Wänden wider. Die Tinte presste Buchstabenformen aufs weiße Papier. Am Anfang waren sie nur zufällig gewählt, später wurden daraus Wörter, Sätze … Bis zum Ende der Zeile, an dem ich die zylindrische Walze mit dem Hebel umlegte und zurück an den Anfang schob. Ein, zwei Stunden konnte ich so vor mich hin tippen. Erst wenn mir die kleinen Finger wehtaten, räumten wir die Maschine in den Plastikkoffer, zurück in die tiefe Stille des verfrühten Todes.
Ob ich damals anfing, das Schreiben zu lieben? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall mochte ich es, die kleinen Ereignisse und Missgeschicke ihres Lebens abzutippen. Wie sie die Fensterscheibe im Wohnzimmer einschlägt und dann so tut, als hätte sie damit nichts zu tun. Oder, noch besser, wie sie eine ganze Schweinskeule aufisst, und dann staunend auf den leeren Teller in Omas Händen starrt und hartnäckig wiederholt: „Wo ist die Keule hin?“
Ich weiß nicht, warum mich die Nachricht aus Indien so verstört hat. Weiß auch nicht, warum ich auf die Leiter geklettert bin und den verstaubten kleinen Koffer vom Schrank geholt habe. Ich hatte ihn wer weiß wie lange nicht mehr angefasst. Bald ist es dreißig Jahre her, dass Mama gestorben ist. Ich denke daran, während ich ein leeres Blatt Papier in die Schreibmaschine einziehe und tippe:
Was bedeutet mir die Schreibmaschine?
Vier Jahreszeiten
Aus den Blicken sprechen Stimmen. Junge und alte. Sanfte, schmeichelnde. Ich könnte sie auf meinem Körper verstreichen, wie Butter auf einem warmen Hörnchen. Mit heißen Wangen würde ich ihre Fragen von den offenen Handflächen ablecken:
Wer bist du? Zu wem gehörst du?
Ich, ihr Sonnenschein (so haben sie mich oft genannt), gehörte zum Sommer. Im Sommer wurde ich geboren. Im Sommer starb meine Mutter. Im Sommer voll Leben und Tod waren wir alle zusammen: meine Großeltern Baka Brana und Deda Boro, die anderen Großeltern Nana Safeta und Dedo Nedžad, und ich. Papa war da und doch nicht da. In einem Zuhause, an zwei Orten, in zwei verschiedenen Stadtteilen aßen wir Pita von Nana Safeta und Sarma von Baka Brana, Dedo und Deda tranken Bier und Schnaps. Unsere Untermieter waren Allah und Tito.
Ich bin ganz aus Sommer! Der Sommer, das bin ich.
Die Stimmen lachten. Ihre dicken Finger kniffen mich in die Wangen, bis sie kupferrot leuchteten. Die Untermieter tauchten immer mal wieder auf. Der eine in Safetas und Nedžads Gebeten, der andere in Branas und Boros Partisanenliedern.
Und dann begann das Schießen …
Mit dem halben Zuhause zogen Baka Brana, Deda Boro und ich nach Šid, zu Omas Schwester. Das war mein erster Verrat. Ich ging mit den einen Großeltern fort und ließ die anderen zurück. In das mitgenommene halbe Zuhause, das sich gar nicht richtig an dem neuen Ort niederlassen wollte, zog ein neuer Untermieter ein: Krieg. So hieß er. Er tauchte ständig auf: ob wir gerade aßen oder badeten, ob wir gerade Verstopfung oder Durchfall hatten. Wellen hatten wir auch. Allerdings nicht die vom Meer, die Fie, Regen und Schnee. Sreten schaltete das Radio ein, bot uns selbstgemachten Holundersirup und drei Hocker an. Wir setzten uns hin und ließen uns – die Stimmen, nicht die Körper – von den Wellen tragen. An guten Tagen erwischten wir die Stimmen von Nana Safeta und Dedo Nedžad: Sie sagten, sie seiensche, Muscheln und Boote treiben lassen. Unsere Wellen wohnten im Haus eines gewissen Sreten. Das war ein guter älterer Mann mit einem großen Radio. Zu ihm gingen wir jeden Samstag, bei Sonn am Leben und diese Scheiße sei wohl hoffentlich bald vorbei. Mit der Zeit hasste ich dieses halbe Zuhause und dessen Untermieter. Ich stellte mir vor, wie ich ihm die Haare ausreiße, die Augen auskratze und Salz in die Nasenlöcher schütte. Aber ich traute mich nicht. Er war groß und stark.
Dann hörte das Schießen kurz auf …
Ich verließ das halbe Zuhause mit Baka Brana und Deda Boro und kehrte zurück in das andere halbe Zuhause, in dem Nana Safeta und Dedo Nedžad lebten. Das war mein zweiter Verrat. In der anderen Hälfte standen die Dinge schlecht. Der Waffenstillstand hatte nur kurz gehalten. Es wurde wieder geschossen. Wir hatten keine Fenster, nur dicke Kunststofffolie, der Ofen, den wir Sanduklija nannten, furzte mehr, als dass er heizte. Ich saß oft in meinem kleinen Zimmer und schrieb Briefe an Baka Brana und Deda Boro auf Zettel vom Roten Kreuz. Auch hier hatten wir einen Untermieter, auch er hieß Krieg. An den traute ich mich nicht ran, ich kannte ihn nicht gut. Ich versteckte nur seine Socken oder Hosen, manchmal spuckte ich ihm in sein Omelett aus Trockenei, in der Hoffnung, er würde die Botschaft verstehen und von selbst abhauen.
Dann kam der Herbst …
Granaten fallen. Nana Safeta und ich sitzen neben dem furzenden Ofen. Ich weine. Mit den Wellen kam die Nachricht zu uns, Deda Boro sei gestorben. Im Schlaf. Mit einer Träne im Augenwinkel. Nana Safeta seufzt, was mich echt nervt. Dedo Nedžad kommt mit einem ehrfürchtigen Lächeln und der Oslobođenje herein. Er setzt sich und schlägt triumphierend die letzte Seite auf.
Bei den Todesanzeigen ist ein Bild von Deda Boro mit einem kurzen Text zu sehen. Dedo Nedžad sagt: „Ganz egal, ob die schießen, hab ich mir gedacht, gestern Abend bin ich hin und habe es in die Zeitung gegeben, die Leute sollen es wissen.“ Ja, erzählten sich die Leute später um unser halbes Zuhause herum, Boro ist gestorben, irgendwo dort, weit weg vom Krieg. Ja, sage auch ich, Boro ist gestorben, mit einer Träne im Auge, und ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass er im Sterben dachte, ich würde ihn nicht mehr lieben, weil ich ja weggegangen war. Mein Verrat wog schwerer.
Es kam auch mal der Frühling …
... in unser halbes Zuhause, wo Nana Safeta, Deda Nedžad und ich wohnten. Krieg ist angeblich ausgezogen. Vor einem Jahr. Aber er hat so eine Unordnung hinterlassen. Ein Dreckschwein, so was habt ihr noch nicht gesehen. Wir warten darauf, dass in das zu vermietende Zimmer endlich Frieden einzieht. Er sollte längst da sein, kommt aber nicht. Wir sind auf die Miete angewiesen. Man muss doch von irgendwas leben. Ich gehe jetzt ins Gymnasium. Das Leben ist teuer. Frieden ist nirgends zu sehen, aber Nana Safeta wird krank. Die Ärzte sagen Hirntumor, höchstens ein, zwei Monate hat sie noch. Alles scheint mir weit weg zu sein, wie auf hoher See. Jetzt hasse ich auch dieses halbe Zuhause. Ich schlafe viel. Eines Morgens ruft mich Nana Safeta, die schwach ist und nicht aufstehen kann, und bittet mich um Hilfe. Wie im Traum kommt es mir vor: Ich höre sie – und höre sie doch nicht. Irgendwie raffe ich mich auf, wanke zu ihrem Bett. Sie reicht mir ihre knorrige, dürre Hand. Ich ziehe und ziehe an ihr, wie an einem alt gewordenen Baum, nichts bewegt sich. Irgendwie ist sie schwer, zu schwer. Ich ziehe noch ein paar Mal, dann gebe ich auf. Ich sage zu ihr: „Es geht nicht“, und lege mich wieder hin. Noch im selben Moment schlafe ich ein. Nana stirbt am nächsten Tag. Ich werde selbst zum Verrat, der immer schwerer wiegt.
Es war auch einmal Winter…
Ah, stimmt. Beinahe hätte ich vergessen zu erzählen, dass Frieden endlich doch noch in unser halbes Zuhause eingezogen ist. Was für ein Schwindler. Ganz geschniegelt, wortgewandt, immer mit einem Lächeln im Gesicht. Zahlt aber ewig die Miete nicht. Immer sagt er morgen, übermorgen, nur noch ein paar Tage… Ein richtig fieser Typ. Dedo Nedžad kommuniziert mit ihm, ich gehe beiden aus dem Weg. Nedžad will sich mit mir aussprechen. Er hat mir sogar erlaubt, beim Kaffeetrinken zu rauchen, nur damit wir zusammen sind. Aber ich hasse das. Er geht mir auf die Nerven, und das Zuhause und dieser Frieden sowieso. Ich habe mich für Philosophie eingeschrieben, in diesem Winter höre ich eine Vorlesung über den Deutschen Idealismus. Ich habe zu jedem Philosophen und seinen Ideen eine super Mindmap gemalt. Wenn ich mit meinen Leuten von der Uni Kaffee trinken gehe, breite ich meine Mindmaps auf dem Tisch aus und wir gehen ganz genau jede Stufe der Entwicklung des Seins durch. In dieser Zeit zieht Baka Brana mit dem anderen halben Zuhause fort nach Bijeljina. Zu ihr ist wohl auch so ein Frieden gekommen. Noch so einer, der seine Miete nicht zahlt. Sie schreibt mir, ruft mich an. Ich sie selten. Vertrackt ist die Entwicklung des Seins, ich habe keine Zeit. Baka wird immer kränker. Sie ist einsam. Und eines Tages erreicht mich die Nachricht, dass sie gestorben sei.
Wir gehen zur Beerdigung. Dedo Nedžad und ich. Ich bin gereizt und würge jedes Gespräch ab. Wir laufen zum Friedhof. Ich in der ersten Reihe, gleich hinter dem Sarg. Die Prozession geht langsam. Mir fällt Sofka Nikolić ein, die größte Sängerin und Star des Königreichs Jugoslawien. Sofka hatte eine Tochter, Marica. Die arme Marica war früh an Tuberkulose erkrankt. Sofka war nicht bei ihr: London, Paris, Wien. Die Königin des Bohème-Viertels Skadarlija erntete Ruhm auf allen Weltbühnen. Dann starb Marica. Mit siebzehn. Man sagt, das habe Sofka den Rest gegeben. Sie kam hierher nach Bijeljina, beerdigte Marica und ließ ihr eine große Krypta errichten. Sich selbst kaufte sie ein Haus direkt neben dem Friedhof, um bei ihr zu sein. So ging das viele Jahre lang. Bis auch Sofka starb. Jetzt sind sie beide in der Krypta, nebeneinander.
So laufe ich hinter Bakas Sarg, denke an Sofka und Marica, alles andere kotzt mich total an, auch die Leute, die neben mir weinen, auch der Himmel, die Erde. Das nehme ich mir heraus. Die Mitarbeiter des Friedhofs lassen Baka Brana ins Grab hinunter. Unangenehme Stille. Alle glotzen mich an. Ich soll als Erste (weil sie nur noch mich hatte) eine Hand voll Erde ins Grab werfen. Jemand flüstert mir zu, ich könne doch, wenn es gar nicht gehe, eine Blume werfen. Das Grab ist tief, dezemberkalt. Meine Mutter, Branas Tochter, ist im August gestorben. In einem weit zurückliegenden Sommer, in einer anderen Stadt. Ich schaue runter ins Grab, in das dieses halbe Zuhause verschwindet und denke mir, wie dumm doch alle sind. Unentschuldbar dumm. Was macht es bitte für einen Unterschied, was nun als Erstes auf diesen Sarg aus geschnitzter und geschliffener Eiche fällt! Wo nun klar ist, dass Brana nicht neben ihrer Tochter liegen wird, die übrigens, auch das soll gesagt sein, Snežana hieß.
Zwischen Sommer und Herbst kam dann auch noch Dedo Nedžad an die Reihe…
Er war völlig meschugge und veranstaltete Chaos im Krankenhaus. Seinem Zimmernachbarn zog er mitten in der Nacht den Katheder heraus und überzeugte ihn, dass er ihn nicht brauche. Er war senil, und wenn ich den Gang entlangging, baten mich die Leute, ihn mit nach Hause zu nehmen. Ich meine, in unser halbes Zuhause. Am Schluss mussten die Schwestern ihn sogar ans Bett fixieren. Fast nicht mehr bei Bewusstsein bedankte er sich freundlich bei ihnen, um mir dann zu befehlen: „Bring mir eine Schere!“ Schon seit zwei Tagen scheint er nicht mehr richtig hier zu sein, obwohl er noch atmet. Dieses Mal bin ich bei ihm, vielleicht wiegt der Verrat so wenigstens ein kleines bisschen weniger schwer. Ich starre auf die Schläuche, die in seinem abgemagerten Körper stecken. Wie Wurzeln, die sein Leben unumkehrbar in unterirdische Totengewässer ziehen. Da sitze ich an seinem Bett, im Flur gehen Leute vorbei. Irgendwann kommt die Ärztin herein, befühlt seinen Puls, kontrolliert Schläuche und Monitor. Dann dreht sie sich zu mir: „Das geht nicht mehr lange, ein, zwei Stunden noch.“





























