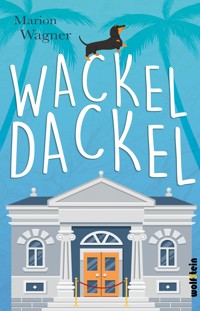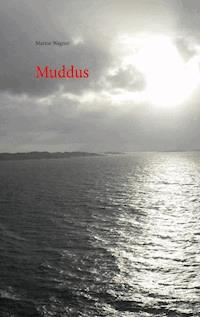Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Evelyn, Ende 40 und notorisch bindungsunwillig, hat ein großes Problem: Der über alles geliebte Hund Fou-fou ihrer Freundin Olivia wurde aus ihrer Obhut entführt. Während Olivia, eine erfolgreiche Schlagersängerin, gemeinsam mit ihrem neuen Grufti-Freund Gregor in einer einsamen Waldhütte ihre "dunkle Seite" erforscht, macht sich Evelyn auf die Jagd nach dem Kidnapper. Unterstützt von ihrem Jugendfreund und Polizist Ludwig stürzt sie sich dabei in eine ganze Reihe von skurrilen und haarsträubenden Situationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nestschubser
Impressum
Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-777-8
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Solange kein Blut fließt
»Eeeeevi!! Parzival stirbt!«
Lucys panischer Ruf erreicht mich auf der Toilette. Eben hat alles noch einen recht friedlichen Eindruck gemacht, sodass ich mich leise davongeschlichen habe, um den einzigen Ort in diesem Gebäude aufsuchen, der dauerhaft einen Lärmpegel von weniger als 60 Dezibel aufweist: die Personal-Toilette. Seufzend unterbreche ich meine Fünf-Minuten-Resillience-Meditation, durch die mich die schmeichelnde Stimme aus meinem Handy führt, und erhebe mich von dem geschlossenen Klodeckel.
Lucy ist siebzehn und unsere neue Praktikantin. Ich habe vergessen, sie auf Parzival vorzubereiten.
»Komme schooon!«, brülle ich, während ich im gestreckten Galopp den Gang in Richtung Ausgang zum Garten entlanglaufe, so schnell meine Birkenstock-Schlappen es erlauben. Auf dem Weg schnappe ich mir vorsorglich ein kleines Verbandspäckchen aus dem mit bunten Marienkäfern dekorierten Erste-Hilfe-Kasten, der neben dem Ausgang hängt. Schwer atmend reiße ich die Glastür auf und betrachte die sich mir bietende Szene. Parzival liegt reglos auf dem Boden, unmittelbar neben dem großen Kletterholzpferd. Lucy ist wimmernd damit beschäftigt, die Gliedmaßen des Kindes brezenartig zu verknoten. Ich vermute, das soll eine stabile Seitenlage werden. Eine Traube Kleinkinder hat sich rund um das Pferd versammelt und reckt die kleinen Hälse, um herauszufinden, weshalb Lucy, die aussieht wie eine Meerjungfrau, nur ohne Fischschwanz und mit obenrum mehr an, so seltsame Geräusche macht.
»Er-er ist auf das Pferd geklettert, u-und dann hörte ich ihn röcheln, u-und als ich das nächste Mal hingeschaut habe, lag er am B-boden!«, schluchzt die Meerjungfrau. »Er bewegt sich nicht!«
»Parzival«, spreche ich den Jungen an. Äußere Verletzungen sind nicht ersichtlich.
In meiner Kindheit galt der Grundsatz: Solange kein Blut fließt, ist alles halb so wild. Dieses Credo ist leider mit den Jahren in Vergessenheit geraten und durch die großzügige Verabreichung kleiner weißer Kügelchen in allen Lebenslagen verdrängt worden.
Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Tochter Romina in der Mutter-Kind-Gruppe mit Schwung von ihrem Hops-Pferd fiel. Das Geheul war infernalisch, wie es nur die Stimmbänder von Vierjährigen hervorzubringen imstande sind, nachdem ihnen schreckliches Leid widerfahren ist. Fernsehverbot. Gummibärchen-Entzug. Ein Zahnarzt-Besuch. Oder eben ein Hopspferd-Absturz. Ich tröstete das plärrende Kind und untersuchte es nach sichtbaren Verletzungen, die nicht vorhanden waren. Dann wurde mir bewusst, dass die Augen der anderen Mütter erwartungsvoll auf mich gerichtet waren. Schließlich, als sich abzeichnete, dass ich nicht beabsichtigte, dem Kind mehr als tröstende Worte und eine liebevolle Umarmung zukommen zu lassen, wurden mir einige kleine Röhrchen mit winzigen Kügelchen über den Tisch zugeschoben. »Arnika« wurde da gemurmelt. »Calendula« und »Symphytum«. Ich schämte mich kurz, bedankte mich herzlich und schickte mich pflichtschuldig an, großzügig Kügelchen in dem weit aufgerissenen Kinderschlund zu versenken. Dabei bemühte ich mich, den Eindruck zu erwecken, ich hätte das schon unzählige Male gemacht. Eine Beule bekam Romy trotzdem. Mal ganz unter uns: Was soll denn auch so ein Zuckerbällchen ausrichten, an dem, wenn überhaupt, nur Moleküle von Wirkstoff feststellbar sind? Außer vielleicht Karies? Ich gebe es zu: Ich bin ein Ungläubige. Aber derartige Blasphemie darf man als Erzieherin niemals in Anwesenheit von Erziehungsberechtigten äußern. Eltern schwören heutzutage auf die Kügelchen mit »Informationen« von allem, was das Kräuterbeet so hergibt. Meine Generation musste es ohne Arnika-Globuli oder Remedy-Essenzen schaffen. Wir haben allein mit einem kühlen Waschlappen und einem Kakao zur Beruhigung überlebt.
»Parzival!«, wiederhole ich lauter und klopfe dem Jungen leicht auf die Wange. Dann kitzele ich ihn am Kinn. Er gibt würgende Geräusche von sich. Ich richte mich auf. »Hol einen Kugelschreiber!«, weise ich Lucy an. »Wir machen einen Luftröhrenschnitt!«
»Wa-wa-wa…«, blubbert die Meerjungfrau panisch. Mit weit aufgerissenen blauen Augen starrt sie mich an, tritt einen Schritt zurück und hebt abwehrend die Hände. »So-soll ich nicht vielleicht einen Krankenwagen rufen?«
»Ach was, bis der Notdienst hier ist, hab ich den Kugelschreiber längst drin. Ich habe alle Chuck-Norris-Filme gesehen, das ist ganz einfach. Wir müssen nur hier einen kleinen Schnitt machen …«, ich deute auf eine Stelle an der Kehle des Jungen, »und dann mit ordentlich Wupps das Röhrchen hinein.«
Lucys Gesichtsfarbe ist mittlerweile bedenklich, selbst für eine Meerjungfrau, die umständehalber nie viel Sonne abbekommen. »A-aber er atmet doch noch …?«, gibt sie schwach von sich.
In mir regt sich mein schlechtes Gewissen. »Du hast recht. In diesem Fall machen wir einfach die Kleinkind-Reanimation nach Liebich.«
»Liebich? So wie dein Nachname?«
»So ist es.« Mit diesen Worten kitzle ich Parzival hinter den Ohren. Das Kind rollt sich zusammen und bricht in prustendes Gelächter aus.
»Du sollst unsere Praktikantinnen nicht erschrecken, das habe ich dir schon tausendmal gesagt!« Ich stemme die Hände in die Hüften und mache ein sehr, sehr strenges Gesicht. Parzival wälzt sich derweil auf dem Boden vor Lachen. Lucy ist der Unterkiefer heruntergeklappt. Fassungslos schaut sie erst den Jungen an, dann mich. Ich ziehe das kichernde Kind am Arm hoch, gehe in die Knie und blicke ihm in die Augen. »Parzival, solche Scherze sind nicht lustig! Stell dir vor, du fällst mal wirklich irgendwo runter und tust dir richtig weh. Vielleicht würde Lucy dann denken, du machst wieder nur Spaß und gar nicht erst nach dir schauen. Du gibst mir jetzt dein größtes Ritter-Ehrenwort, dass so etwas nicht mehr vorkommt, verstanden?«
Parzival guckt mich mit großen blaugrauen Augen treuherzig und leicht bedröppelt an. »Größtes Ritter-Ehrenwort, Evelyn.« Mit für einen Fünfjährigen erstaunlichem Pathos legt er dabei die Hand auf die Brust. »Machichnichmehr.«
»Okay.« Ich richte mich auf und verkünde das Urteil. »Du wirst dich jetzt bei Lucy entschuldigen, das muss ich nicht extra sagen, oder? Und heute kein Eis als Nachspeise für dich.«
Parzivals Gesicht verdüstert sich. Vereinzelt hört man die anderen Kinder nach Luft schnappen. Heute ist Donnerstag, unser Eis-Tag, an dem nach dem Mittagessen immer ein Eiswagen auf dem Wanderparkplatz in der Nähe des Waldschlösschen-Kindergartens Station macht. Es ist für die Kinder der Höhepunkt der Woche, wenn wir nach dem Mittagessen zu der Wendeplatte im Wald wandern, wo der weiße Lieferwagen mit der gelb-weiß gestreiften Markise bereits auf uns wartet, und der junge dunkelhaarige Mann mit der weißen Mütze laut ruft: »Vanilleschokoladeerdbeeroderzitrooooone! Wer wille eine Eis von die Beppooone?«
Auch ich freue mich immer auf den Donnerstag und zwei große Kugeln Stracciatella und Eierlikör. Manchmal lasse ich mir von Beppone heimlich noch ein Mützchen mit Sahne auf die Eiskugeln sprühen.
Mit gesenktem Kopf wendet sich Parzival an Lucy. »Entschuldigung. Machichnichmehr.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, trottet er davon, in Richtung Bällebad. Oje, das Eisverbot hat ihn wohl hart getroffen. Wahrscheinlich versucht er nun, seinen Kummer im Meer der bunten Plastikbällchen zu ertränken. Jetzt tut er mir leid, wie er so zerknirscht um die Ecke schlurft. Vielleicht stecke ich ihm nachher ein Tütchen Gummibärchen zu, wenn alle anderen Kinder ihr Eis schlecken. Aber Strafe muss sein. Ich nehme mir vor, heute auf mein heimliches Sahnehäubchen zu verzichten. Schließlich habe ich Lucy mit meinem Luftröhrenschnitt auch einen ganz schönen Schrecken versetzt. »Machichnichmehr«, flüstere ich, ehe ich in die Hände klatsche und die anderen Kinder wieder an ihre Spielsachen scheuche.
Es ist nicht das erste Mal, dass Parzival eine solche Show abzieht. Vermutlich sollte ich ein Elterngespräch einberufen, um zu klären, wieso der Junge es so irrsinnig lustig findet, Kindergarten-Praktikantinnen mit seinem vermeintlichen Ableben zu erschrecken. Aber ich kenne Parzivals Eltern. Die Aussicht auf ein Gespräch mit dem Ehepaar Becker-Stöblein ist in etwa so attraktiv wie eitrige Nagelbettentzündung. Außerdem weiß ich, dass der Kleine einen großen Bruder hat, der aus dem Bob-der-Baumeister-Alter raus ist und viel Zeit mit Computerspielen verbringt, in denen gerne mal abgetrennte Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Ich denke daher, die Ursache zu kennen. Die Sache mit dem Luftröhrenschnitt per Kugelschreiber hat Parzival gestern beim Morgenkreis mit vor Begeisterung leuchtenden Augen erzählt. Hach, pädagogisch richtig war es nicht. Aber lustig.
Ich setze mich auf eine kleine Holzbank an der Hausmauer und winke Lucy, sich zu mir zu gesellen. »Tut mir leid, dass ich dich nicht vorgewarnt hatte. Parzival übertreibt es mit seinen Streichen leider manchmal. Aber andererseits hattest du Glück. Bei seinem letzten Auftritt als Unfallopfer gab es Schaschlik zu Mittag. Du willst nicht wissen, was hier los war, als er mit der Soße in den Haaren unterm Pferd lag.«
Lucy zuckt leicht zusammen, sagt aber nichts. Ich öffne den kleinen Verbandskasten und hole einen Kirschlutscher heraus. Eigentlich habe ich ihn zur Beruhigung eines verletzten Kindes zu den Pflastern und Bandagen gepackt. Außer es handelt sich um Lilia, deren Papa ist Zahnarzt. Oder Marietta, die ist allergisch gegen Industriezucker. Ich denke, Lucy kann ein bisschen Nuckeln am Kirschzuckerbällchen jetzt nur guttun. Ich reiche ihn ihr. »Hier – das hilft.«
Ich werfe einen prüfenden Blick in die Runde. Sandkasten, Schaukel, Wellenrutsche, Baumhaus, Bällebad. Alles friedlich. Unglaublich laut, aber friedlich. Dann lehne mich zurück, schließe die Augen, schalte das 60-Dezibel-Kindergetöse auf Durchzug und genieße die Sonnenstrahlen im Gesicht. Solange kein Blut fließt, ist alles gut.
Zwei Seelen
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust … und sie haben dort reichlich Platz, bei Körbchengröße D und auch sonst geräumigem Körperbau. Die beiden treten sich also nicht auf die Füße. Grundsätzlich kommen sie recht gut miteinander aus, geraten sich nur äußerst selten in die Haare und lassen sich auch gerne mal gegenseitig den Vortritt. Sehr harmonisch, wirklich.
Also, ich habe keine multiple Persönlichkeit oder verwandle mich bei Vollmond oder ungünstiger Beleuchtung von der braven Erzieherin in ein sabberndes Untier, das die mir anvertrauten Kinder aufzufressen droht. Nein, ich beherberge lediglich zwei auf den ersten Blick völlig inkompatible Wesenszüge in meinem knuffigen Körper. Da ist zum einen die absolut bodenständige, geerdete Evelyn, die darauf besteht, für alles eine mit mittlerem Bildungsabschluss nachvollziehbare Erklärung auf naturwissenschaftlicher Basis zu erhalten. Kugeln mit der Information von Gänseblümchen gehören nicht in diese Kategorie. Zudem hat das Wort »Potenz« im Wortschatz meiner geerdeten Seele eine klar definierte Bedeutung, und diese hat nichts mit bis zur Unkenntlichkeit verdünnten Heilsubstanzen zu tun. Wobei ich mit dem homöopathischen Grundsatz »Je höher die Potenz, desto größer die Wirksamkeit« durchaus auch in dem von mir bevorzugten Kontext etwas anfangen kann.
Skeptisch bin ich auch gegenüber Wassertropfen, deren Struktur sich positiv ändert, weil sie beispielsweise einen Delfin vorbeischwimmen sahen. Ich meine, wenn man das mal zu Ende denkt: Was bedeutet das für das Trinkwasser, das aus meinem Wasserhahn sprudelt? Es hat in der jüngeren Vergangenheit sicherlich keinerlei erheiterndes Meeresgetier getroffen. Delphin, Clownfisch, Seepferdchen … nichts davon tummelt sich in den heimischen Kläranlagen. Wenn ein Delphin das Wassergedächtnis positiv beeinflusst … Welchen Effekt haben dann Fäkalien und Damenhygieneartikel? Ich befürchte, mein Leitungswasser ist extrem schlecht gelaunt.
Man kriegt diesbezüglich einiges mit als Erzieherin, weil viele Menschen, sobald sie zu Eltern werden, aus irgendwelchen Gründen der klassischen Medizin zu misstrauen beginnen und das Heil in der Schatzkammer der Natur suchen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich selbst schwöre auf Kamillentee, Spaghetti mit Bärlauch-Pesto und nicht zuletzt auf Kräuterlikör, innerlich angewendet. Ich verstehe gar nicht, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, Zuckerkügelchen in Kräuterlikör zu wälzen. Es gibt welche, die enthalten über fünfzig Kräuter. In nur einem kleinen Glas, ich mein ja nur.
Ich respektiere die Hinwendung zu natürlichen Heilmethoden also, und ich bemühe mich in Elterngesprächen daher stets, meine geerdete Hälfte im Zaum zu halten. Während dieser Teil von mir – ich nenne ihn aufgrund seiner Begeisterung für die Wissenschaft gerne Einstein – sich in Lachkrämpfen am Boden windet, höre ich aufmerksam zu, wenn mir von zum Erdkern hin geschüttelten Tränken berichtet wird. Oder von Globuli, die aus der Plazenta der Mutter gewonnen wurden. Wenn die Sprache auf dieses Thema kommt, muss ich immer kurz den Raum verlassen, denn zum einen gruselt es mich bei dem Gedanken daran, und zum anderen gerät Einstein bei dem Wort Plazenta-Globuli immer völlig außer Rand und Band. Erst wenn er sich beruhigt hat, kann ich das Gespräch fortsetzen und hingewandt und aufmerksam weiter lauschen.
Besonders ungebührlich hat Einstein sich aufgeführt, als eine Mutter von einem Besuch beim Heilpraktiker berichtete, den sie aufgrund der Schlafstörungen ihres Kindes aufgesucht hatte. Weil der Zweijährige selbst noch zu klein für eine schlüssige Untersuchung war, wurde die Diagnose durch das mehrfache Schütteln der Handgelenke der Mutter gestellt. An dem Punkt merkte ich bereits, wie Einstein um Fassung rang. Doch es kam noch besser: Die Mutter wurde angewiesen, dem Kind eine Metallschlaufe an den Körper zu halten. Diese war mit einem Kabel an einen Computer angeschlossen. Das Programm lautete: Positive Energie. Man stelle sich das vor! Unsereins verknotet sich nach Feierabend im Lotus-Sitz und ruiniert damit seine Kniegelenke, macht heimlich Atemübungen auf der Personaltoilette oder guckt uralte Al-Bundy-Folgen, um sich nach einem langen Arbeitstag mental wieder in die Spur zu kriegen. Dabei gibt es dafür Computerprogramme! Ich begreife nicht, wieso sich das nicht längst flächendeckend durchgesetzt hat. Meines Wissens ist so ein Programm nicht in der Standard-Installation von Microsoft enthalten. Wo ist Bill Gates, wenn man ihn braucht?
Bei diesem Gespräch musste ich wieder einmal etwas überstürzt den Raum verlassen, um Einstein die Gelegenheit zum Ausflippen zu geben.
Aber es gibt da ja noch meine andere Seite. Die zweite Seele in meiner Brust heißt Madame Esmeralda und glaubt fest daran, dass die Konstellation der Himmelskörper unser Schicksal beeinflusst. Zudem ist sie unfassbar abergläubisch. Niemals würde sie zulassen, dass ich morgens schlaftrunken den linken Socken zuerst anziehe oder unter einer Leiter durchgehe. Ich besitze von allen Dingen höchstens 12 oder mindestens 14 und kann aus diesem Grund niemals 13 Gäste zu einer Feier einladen. An keinem Tag würde ich das Haus verlassen, ohne mein Tageshoroskop studiert zu haben. An Silvester trage ich grundsätzlich rote Unterwäsche, und das völlig ohne erotische Hintergedanken. Auf Spaziergängen ernte ich oft irritierte Blicke, weil ich an keinem Pferdeapfel vorbeigehen kann, ohne diesen zu zertreten. Davon werden zwar die Schuhe schmutzig, es bringt aber auch Glück.
Ich weiß, es ist widersinnig. Jemand, der stets ein Päckchen Tarot-Karten bei sich trägt, sich die Haare nur bei Neumond schneiden lässt und keine Entscheidungen trifft, ohne vorher die aktuelle Sternenkonstellation geprüft zu haben, darf sich eigentlich nicht über Frauen lustig machen, die Ringelblumen-Moleküle in braunen Glasröhrchen in der Handtasche haben.
Ich bin mir der augenscheinlichen Unvereinbarkeit dieser Wesenszüge bewusst. Aber die Koexistenz des großen Zweiflers mit dem Physikbuch unter dem Arm und der Sternengläubigen mit der Kristallkugel funktioniert ganz prima. Wenn ich Horoskope lese, hat Einstein Sendepause und wird mit Schoko-Karamell-Bonbons besänftigt. Und wenn dieser sich über handgelenkschüttelnde Therapeuten aufregt, setzt sich Madame Esmeralda bescheiden in eine Ecke, stülpt Kopfhörer auf und lauscht entspannenden Walfischgesängen. Wirklich sehr harmonisch.
Lange Zeit haben Madame Esmeralda und ich mit meinem Sternzeichen gehadert. Ich wurde im Zeichen des Steinbocks geboren. Steinböcken werden zahlreiche Eigenschaften nachgesagt, die ich schlichtweg nicht besitze. Wer je mit mir in einer Cocktail-Bar war, der weiß, dass Zurückhaltung nicht zu meinen Stärken zählt. Zumindest nicht in Bezug auf bunte Getränke mit Schirmchen und unbeaufsichtigte Karaoke-Anlagen. Ich habe keinerlei Hemmungen, das Mikrofon zu kapern und dem unfreiwilligen Publikum »I will always love you« entgegenzujaulen.
Ich würde mich auch nicht als übertrieben erfolgsorientiert bezeichnen. Nichts in mir drängt mich dazu, einen Chefsessel anzustreben oder die Kreismeisterschaft im Bändertanz, oder auch nur den größten Kürbis im Landkreis zu ernten.
Ebenso kann ich die Steinbock-Attribute »ernst, düster und nachdenklich« nicht für mich beanspruchen. Dazu möchte ich gerne die Karaoke-Anlagen noch einmal erwähnen. Ich kann übrigens auch »Skandal um Rosi«, dies nur am Rande. Des Weiteren tragen disziplinierte Steinböcke normalerweise nicht Konfektionsgröße 44, weil es ihnen nicht gelingt, Buttermandelhörnchen mit Kirschfüllung, Mohnschnecken und Käsesahnetorten zu widersagen. Ich habe es aufgegeben, mich an der Backwarentheke zu kasteien. Wenn ich höre, wie mir ein fettglänzender Schoko-Donut lockend zuflüstert »Iss mich …«, dann habe ich es nicht in mir, ihn zurückzuweisen.
Kurz gesagt, mein Sternzeichen passte nicht zu mir. Ich schob es auf den Aszendenten, aber dieser – Fische – lieferte auch keine Erklärung. Fische gelten als hochromantisch, gefühlsbetont und sensibel. Ich würde sagen, ich bin in etwa so gefühlsbetont und sensibel wie ein Sattelschlepper. Ein Verehrer hat mir einmal ein Liebesgedicht gewidmet. Derlei mag so manches Frauenherz hinschmelzen lassen, ich jedoch musste mich abwenden und einen Hustenanfall vortäuschen, als er von himmlischer Ekstase schwärmte. Das reimte sich, wenn ich mich recht entsinne, auf betörende Nase.
Kerzenschein geht, weil er dem Teint schmeichelt, aber über Rosenblätter im Bett kann ich mich nicht freuen. Ich lasse es mir normalerweise nicht anmerken, finde aber Pflanzenteile zwischen den Pobacken eher störend als stimulierend. Ich weine auch ganz selten bei Filmen, im Gegensatz zu meiner Tochter Romina, die wirklich eine Bilderbuch-Heulsuse ist. Mit ihr die »Sissi«-Filmreihe zu gucken, war quasi unmöglich, ohne das Wohnzimmer unter Wasser zu setzen. Ich habe auch Jacks tragisches Ableben in »Titanic« trockenen Auges verfolgt, während Romy neben mir sich aufführte, wie eine der alten, orientalischen Frauen, die man in den Nachrichten manchmal bei einer rituellen Totenklage sieht.
Gefräßig ist kein schönes Wort, daher beschreibe ich mich gern als »von gesundem Appetit«. Das wirkt sich natürlich mit der Zeit auf den Hüftumfang aus, insbesondere wenn es zugleich an Bewegung mangelt. Manchmal packt mich das schlechte Gewissen, und dann hüpfe ich halbherzig zu einem Trainings-Video auf Youtube mit. Ich habe aber festgestellt, dass ich auf dem Gebiet der körperlichen Ertüchtigung seit meiner Grundschulzeit verbal ein wenig den Anschluss verloren habe. Als mich der Vorturner im Film anbrüllte: »Uuuuuund jetzt 20 Jaaaamping Jäcks!!«, war ich erstmal hilflos. Der junge Mann im dunkelblauen Muskelshirt hob und senkte seine schweißglänzenden Bodybuilder-Arme und hüpfte dazu mit baumstammartigen Beinen in die Grätsche. Hampelmänner. Aha. »Jumping Jack« klingt da natürlich viel cooler. Ebenso muss man sich heutzutage nicht mehr an dem sperrigen Wort »Unterarmstütz« abmühen, wenn man kurz und knackig »Plank« sagen kann. Es gibt auch noch eine Reihe von Übungen, die könnte ich auf Deutsch gar nicht benennen. »Crunches« zum Beispiel oder »Side Plank Hip Lift« oder »Squat Jump« oder »Hip Thrust«. Ach ja, Turnstunde heißt jetzt »Workout«. Ich bin zu alt für Anglizismen.
Irgendwann stolperte ich über eine Internet-Seite, die das Sternzeichen-Dilemma schlüssig auflöste. Was weder Madame Esmeralda noch ich bis dahin wussten: Die Lehre von den zwölf Sternzeichen ist völlig überholt. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Sternbilder wohl so verschoben, dass sich ein dreizehntes dazwischen drängeln konnte: der Schlangenträger. Und der hat natürlich alles komplett durcheinandergebracht. Interessiert studierten Madame Esmeralda und ich den Artikel und stellten fest: Durch dieses Gerangel am Firmament war mein Geburtsdatum in das Sternbild des Schützen gerutscht! Und hier deckt sich die Charakterisierung doch deutlich besser mit meinem Wesen: unabhängig, fröhlich, optimistisch, freiheitsliebend, spontan. Ein Abenteurer. Madame Esmeralda und ich nickten begeistert, und Madame Esmeralda fing an, ihre Sternkarten wieder aufzubügeln, die sie frustriert zusammengeknüllt hatte. Einstein konnte es nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass es doch trotz allem recht einfältig wäre, vorauszusetzen, dass allen Menschen gleichen Geburtsmonats die gleichen Charakterzüge eigen wären. Er bekam ein Schoko-Karamell-Bonbon. Dann war er ruhig, und Madame Esmeralda und ich konnten uns auf das Studium des Jahreshoroskops meines neu entdeckten Sternzeichens konzentrieren.
Sand im Popo
Zuzanna, Beate und ich haben »Die Schatztruhe des deutschen Schlagers« aufgelegt. Vor allem wegen Zuzanna. Ihr Deutsch ist im Alltag, freundlich formuliert, ausbaufähig, aber wenn sie wie jetzt »Äääär gähört zu miiir« schmettert, ist von ihrem polnischen Akzent kaum noch etwas zu merken. Beate und ich singen auch mit. Beate sitzt im Büro, ich räume die Bücherkiste in der Lese-Ecke ein, und Zuzanna die Spülmaschine in der Küche. Alle Türen sind weit geöffnet. Harmonisch klingt anders, aber wir sind ja unter uns.
Plötzlich unterbricht Zuzanna mitten im Refrain für einen deftigen polnischen Fluch. »Kurwa mac!«, entfährt es ihr, als sie die Tür zur Schmutzschleuse öffnet. »Was haben Kindär heute gämacht? Alle wie Schweine in Pfütze gäbadet?«
Ich stecke das letzte Bilderbuch in die Kiste, gehe zu ihr und gucke ihr über die Schulter. Sie hat recht. Es sieht aus, als wäre eine Rotte Wildschweine – Frischlinge in unserem Fall - nach einem Vollbad in einer Schlammpfütze durch den Raum getrampelt. Unzählige Gummistiefel von einheitlich brauner Färbung liegen in einer Ecke. Vereinzelt tropft der Schlamm noch zäh auf den Boden. Dort hat sich ein großer brauner Fleck angesammelt, der bereits zu klumpen beginnt, ebenso wie die unzähligen Schlammspritzer an den gefliesten Wänden. Die Matschhosen, die überall im Raum verteilt herumliegen, könnte man vermutlich in ungefähr einer Stunde in einer Reihe aufstellen, wenn die dicke Dreckschicht endgültig erstarrt ist.
»Ähm. Ja. Das wollte ich dir noch sagen …« Ich blicke Zuzanna entschuldigend an.
Ich war mit den Kindern nach der Parzival-Episode in den Wald hinaus gegangen. Wie der Name schon vermuten lässt, liegt unser Kindergarten »Waldschlösschen« nicht in einem Industriegebiet. Am Stadtrand von Passau gelegen, ist die Zufahrt nur über einen holprigen Waldweg möglich, weshalb der Kindergarten sehr beliebt ist bei Familien, die einen SUV fahren. Aber nachdem das Waldstück, in dem unser Schlösschen sich verbirgt, an ein Stadtviertel angrenzt, in dem beinahe in jeder Garage so eine prestigeträchtige Benzinschleuder zu finden ist (neben einem Cabrio für die Freizeit und einem Kleinwagen, falls die Haushälterin mal Besorgungen zu machen hat), hat das bislang niemanden abgeschreckt. Im Gegenteil, ein Platz bei uns im Schlösschen ist sehr begehrt. Das liegt zum einen natürlich an der wirklich wunderschönen Lage mitten im Wald. Es ist, als würde man ein Märchenland betreten, wenn man die Straßen, die Häuser und den Verkehrslärm der Stadt hinter sich lässt und stattdessen weichen Waldboden unter den Füßen spürt, den würzigen Duft der Bäume atmet und von Vogelgezwitscher umgeben ist. Also, zumindest sehr früh am Morgen. Sobald alle Kinder anwesend sind, hat kein Vögelchen mehr eine Chance, sich akustisch gegen unsere lärmenden Frischlinge durchzusetzen. Die Waldtiere scheinen sich an dem Kinderlärm jedoch nicht zu stören. Die Vögel singen unverdrossen ihre Liedlein in den Bäumen, Eichhörnchen huschen durchs Geäst, und hin und wieder wurde sogar schon ein Rehlein gesichtet, das neugierig über den Zaun lugt. Vielleicht haben wir die Tiere bereits in die Gehörlosigkeit gebrüllt.
Trotz der idyllischen Lage in der Natur sind wir kein reiner Waldkindergarten, in dem die Kinder bei Wind und Wetter draußen das Überleben in der Wildnis proben. Nein, hier mitten im Wald steht ein bezauberndes kleines Häuschen, das aufgrund von zwei kleinen Erkertürmchen und einer Veranda mit schnörkeliger Säulenbalustrade tatsächlich wie ein kleines Schlösschen anmutet. Es bietet Platz für 15 Kinder, deren Eltern sich das Naturerlebnis für ihren Nachwuchs wünschen, aber zugleich trockene Füße und ein warmes Näschen, wenn es draußen regnet oder schneit. Das wünsche ich mir auch, darum arbeite ich so gerne hier. Ich liebe es, täglich hier mitten in der Natur zu sein, jedoch mit funktionierenden sanitären Anlagen. Ich würde mich wirklich sehr ungern mehrmals täglich mit einem Schäufelchen hinter eine Tanne hocken.
Das Schlösschen wurde in den Sechzigerjahren von einer wohlhabenden Familie als Freizeithäuschen gebaut. Der Wohlstand dieser Familie stammte aus der Herstellung von Gartenzwergen, was im Nachkriegsdeutschland ein recht einträgliches Geschäft gewesen sein dürfte. Irgendwann kam dem Zipfelmützenträgerfabrikanten der vom Grundsatz her durchaus einleuchtende Gedanke, dass sich bärtige Zwerglein aus Keramik auch super in amerikanischen Vorgärten machen würden. Weil die deutsche Gartenlandschaft bereits mit ganzen Stoßtrupps von Zipfelmützen ausgestattet war, während der amerikanische Kontinent noch erhebliches Zwergen-Entwicklungspotenzial besaß – und dies bei einer deutlich höheren Anzahl an Vorgärten – siedelte der gewiefte Unternehmer seine Manufaktur nach Amerika um. Was aus ihm geworden ist, weiß ich leider nicht. Nach meinem Kenntnisstand haben die Amerikaner nie eine erwähnenswerte Leidenschaft für die kleinen Gartengesellen entwickelt, ich nehme also an, dass die Geschäftsidee nicht wirklich durchgeschlagen hat. Außerdem hätte man hierzulande sicher etwas mitbekommen von einem US-amerikanischen Gartenzwerg-Imperium.
Das Waldgrundstück inklusive Freizeithäuschen verkaufte der auswandernde Gartenzwerg an die Stadt Passau. Lange interessierte sich niemand so recht für das verlassene Häuschen im Wald, bis irgendwann in den Achtzigern eine Frau im Stadtrat saß, die gerne Strickpullis und Flechtzöpfe trug, fünf Kinder geboren und einen Zeitungsartikel über Waldpädagogik gelesen hatte. Das Prinzip als solches stieß bei den Stadtratsmitgliedern zunächst auf Skepsis – wer würde denn seine Kinder bitte schön einfach so im Wald absetzen, ohne Legobausteine, Puppenhäuser und Buntstifte! Als sich jedoch jemand an das Waldschlösschen erinnerte, begann man sich für den Gedanken einer zumindest waldnahen Pädagogik zu erwärmen. Nachdem der kindgerechte Umbau des zweifellos hübschen Häuschens im Wald das städtische Budget deutlich weniger strapazierte als der ohnehin erforderlich gewesene Anbau im städtischen Kindergarten, waren alle glücklich. Vor allem der Passauer Fußballverein, dem man von dem gesparten Geld endlich ein ordentliches Klohäuschen für die Zuschauer spendierte. Auch für Fußball-Freunde ist es nämlich nicht schön, sich für ihr Geschäft hinter eine Tanne hocken zu müssen. Zumal Männer nur selten an ein Schäufelchen denken, wenn sie zum Fußballplatz gehen.
»Nach dem Regen am Wochenende war es an manchen Stellen noch ein wenig schlammig …« Zuzanna zieht die dunklen Augenbrauen hoch.
»Du weißt doch, Pfützenspringen macht glücklich …«
Mir ist noch kein Kind untergekommen, das dem Anblick einer großen, tiefen, schlammigen Pfütze widerstehen konnte. Alle Kinder sind der Reihe nach mit Anlauf und beiden Beinen frontal in das Wasserloch gesprungen, während auf die juchzenden Umstehenden dicke Dreckspritzer herabregneten. Nepomuk, mit dreieinhalb Jahren unser kleinster Frischling, stolperte beim Absprung über seine Gummistiefel und klatschte bäuchlings in die Pfütze. Die Sauerei war unbeschreiblich, aber Nepomuk war der Held der Pfützenspringer, wurde von allen johlend abgeklatscht und strahlte über das ganze Gesicht.
Zuzanna grinst. »Solche Färkäl die Kinder sind.« Kopfschüttelnd nimmt sie den Putzeimer und geht zum Wasserhahn.
»Ich kümmere mich um die Stiefel!« Ich schnappe mir einige der dreckstarrenden Schuhe und trage sie hinaus in den Garten, um sie dort mit dem Wasserschlauch vom gröbsten Dreck zu reinigen. Danach können sie in der Sonne trocknen und stehen morgen wieder für neue Schweinereien bereit.
Zuzannas vierjährige Tochter Natalja gehört auch zu unseren Frischlingen und hat sich heute Vormittag ebenso wie ihre Artgenossen mit Wonne im Schlamm gesuhlt. Sie ist ein sehr stilles und zurückhaltendes Mädchen, das lieber zusieht, als im Rampenlicht zu stehen. Mit ihrem dunklen, langen Haar und den rabenschwarzen Knopfaugen sieht sie ihrer Mama sehr ähnlich. Für Zuzanna ist es ein Glücksfall, dass ihre Tochter einen der begehrten Plätze im Waldschlösschen erhalten hat. So muss sie sich nicht um eine Betreuungsmöglichkeit kümmern, während sie als Raumpflegerin täglich Tannennadeln, Zapfenbröseln, Mooskrümeln – oder wie heute – Schlammbrocken in unserem Kindergarten mit Eimer und Bürste zu Leibe rückt. Natalja bleibt einfach hier. Heute sitzt sie mit meiner Kollegin Beate im Büro, malt in ihrem Bauernhof-Malbuch ein Ferkel grün an (»Es hat was pfalsches gegessen.«) und lässt unsere Schlager-Performance geduldig über sich ergehen.
Als ich gerade ein paar gelbe Stiefel mit grünen Dinos an den Stiefelbaum hänge, kommt Beate heraus in den Garten. Sie ist wie ich knuffig gebaut, aber ein wenig kleiner. Mit ihrer Latzhose, den roten Bäckchen und dem ergrauten Bubikopf sieht sie ein bisschen aus wie eins der Gartenzwerg-Fräulein, die früher hier mal gewohnt haben dürften. Sie reicht mir eine Tasse Kaffee.
»Päuschen?«, fragt sie und setzt sich auf die Hausbank.
»Hach, du bist die Beste!«, freue ich mich und setze mich zu ihr.
»Wie war's beim Zahnarzt?«
»Geht schon wieder. Nur eine kleine Entzündung.«
»Wirklich schade, dass du Parzivals Auftritt heute verpasst hast.«
»Wenigstens hatte er diesmal kein Ketchup zur Hand«, kichert Beate in ihren Kaffee. »Kommt Lucy morgen nochmal?«
»Ich denke schon. Ich habe ihr einen Lutscher gegeben, danach war sie wieder ansprechbar. Und wegen der Sache mit dem Luftröhrenschnitt habe ich ihr einen Vortrag über Transaktions-Kommunikation und die Einnahme der kindlichen Ebene gehalten. Sie denkt jetzt tatsächlich, das war superpädagogisch.«
Beate schmunzelt, lehnt sich an die Hausmauer und schließt die Augen. Ich tue es ihr nach. Sonnenwärme. Kaffeeduft. Vogelgezwitscher aus den Bäumen und »Santa Maria« aus dem Gebäude. Schön.
»Du, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass keines unserer Kinder einen normalen Namen hat?«, unterbricht Beate unser Schweigen. »Was ist bitteschön aus den Peters, Wolfgangs und Martinas dieser Welt geworden?«
»Buchhalter, Bäcker und Friseurin. Die sind alle schon groß und haben ihre Ritterrüstung an den Nagel gehängt«, lache ich. »Es klingt halt einfach besser in der Tagesschau, wenn der Atomphysiker Parzival Becker-Stöblein den Nobelpreis für Physik bekommt als Herbert Müller.«
»Na ja, dann wollen wir mal hoffen, dass Parzival Becker-Stöblein irgendwann tatsächlich einmal Herausragendes leistet. Für ein Taxifahrer-Namensschild ist der Name nämlich etwas sperrig.«
Beate und ich prosten uns mit unseren Kaffeetassen zu.
»Weißt du noch, als Eric sich vorgestellt hat?«
Der Vierjährige war an seinem ersten Tag in der Frischlingsgruppe im Stuhlkreis selbstbewusst aufgestanden und hatte den Anwesenden mitgeteilt: »Ich bin der Eric - mit einem c!« Daraufhin hatte Allegra ihre blauen Kulleraugen sorgenvoll aufgerissen und gefragt: »Kannst du denn überhaupt laufen, mit nur einem Zeh?« Elliott hatte gerufen: »Krass! Das muss ich sehen!« Und Agnes, unsere kleine Professorin, hatte aufgezeigt und gefragt: »Sind wir dann jetzt ein interaktiver Kindergarten, wenn der Eric so doll behindert ist?« Sie liebt Fremdwörter, verwendet sie aber nicht immer ganz korrekt. Integrativ und interaktiv kann man schon mal verwechseln.
»Mir tut ja Penelope leid«, meint Beate. »Ich meine, wenn man aus Unterfranken kommt und damit von Natur aus nicht in der Lage ist, harte Konsonanten auszusprechen – wie komme ich da auf die Idee, mein Kind Penelope zu nennen?«
»Ich finde auch, das war nicht nett von den Pacholskis«, kichere ich. »Aber Benelobe Bacholski ist ein dodal dolles Kind«, beeile ich mich, zu betonen. »Und ihre Mama, die Dadjana, hatte es als Kind sicher auch nicht leicht …« Beates stimmt in mein albernes Gackern ein, sodass ihr üppiger Busen in der Latzhose bebt.
»Aber wer bin ich, mich über die Namenswahl anderer Leute lustig zu machen«, seufze ich. »Ich habe meine Tochter nach einer Schlagersängerin benannt!«
Als mein Kind vor nunmehr 25 Jahren geboren wurde, war ich der festen Überzeugung, dass es keine schönere Frau auf Erden gäbe als die italienische Sängerin Romina Power. Zudem fand ich den Namen Romina wunderhübsch. Finde ich heute noch, auch wenn es einmal eine etwas unschöne Phase gab, als Romina in der zweiten Klasse war. Die Kinder mussten jeweils ein kurzes Verslein über einen Klassenkameraden verfassen. Der Himmel weiß, wieso der kleinen Margit dieses Wort geläufig war, aber dem Mädchen fiel als Reim auf Romina tatsächlich nur »Domina« ein. Das brachte die Lehrerin, eine ältere Dame mit Dutt und Kragenbrosche, erheblich in Erklärungsnot, was wiederum die Kinder so lustig fanden, dass der Spitzname an meiner Tochter leider lange Zeit hängen blieb. Aber derartiges war ja zum Zeitpunkt der Namensfindung nun wirklich nicht abzusehen gewesen.
Die Tür geht auf, und Zuzanna kommt heraus. Sie hat ebenfalls eine dampfende Tasse Kaffee in der Hand und setzt sich zu uns.
»Muss ich jetztamal was sagen«, beginnt Zuzanna. »Also, Santa Maria ist Insäl, richtig?«
»Ja, so habe ich das verstanden«, nicke ich.
»San Angälo? Und Barbados? Auch?«
Beate und ich schauen uns fragend an. »Hmm … ja, denke schon. Aber frag mich bitte nicht, wo das jetzt genau liegt«, antworte ich.
»Irgendwo bei Hawaii rum? Oder mehr so Richtung … äh … Thailand?«, rätselt Beate. Sie deutet mit ihrer Kaffeetasse vage in Richtung Korbschaukel.
»Südsee«, trage ich bei. »Pazifik.« Das ist so ein großer Ozean mit vielen, vielen Inseln. Könnte richtig sein. Es klingt zumindest plausibel.
Zuzanna wedelt unseren geographischen Blindflug ungeduldig zur Seite. »Ist net so wichtig, wo sind diese Ortä genau. Jädänfalls, ich habe gemärkt, dass viele deutsche Liedär sind sääähr värsaut.« Sie lehnt sich zurück und schaut uns auffordernd an. »Warmä Sommärnacht und brännende Härzän und Gluut und fliegän zu den Sternän und weißinetwasnoch … ist nix anderäs als Färkeleiän am Strand von Insäl. Odär?«
»Nun ja …«
»Da hab ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht …«
»Stimmt wohl schon irgendwie …«
»Musstu mal zuhären«, befiehlt Zuzanna. Folgsam lauschen wir dem Gesang von der jungen Maid auf der Insel, wo auch immer diese liegen mag, das durch das geöffnete Fenster aus der Stereoanlage schmachtet. Zuzanna hat recht. Ich habe noch nie darauf geachtet, aber bei genauer Betrachtung ist der Text eindeutig nicht jugendfrei. Wenn ich mir ausmale, wie viele Omas beim Kartoffelschälen ohne rot zu werden von Sex am Strand mit einer wilden Insulanerin singen, muss ich lachen.
»Ist immär das gleichä in die Liedär«, verkündet Zuzanna kopfschüttelnd. »Freilich, ist jäder seine Sach', wenn er sich wutzält am Strand in Urlaub mit schonä Frau. Abär muss man doch nicht allä Mänschän erzählen, odär?« Zuzanna schnaubt empört. »Außärdäm ist eh bläd, Liebämachen am Strand. Bitteschän, ist doch nachhär überall Sand! Auch in Popo. Da können die singän in die Liedär noch so schän von Romantik. In ächt ist bläd.« Sie grinst.
Ich kann nichts dagegen tun, dass in meinem Gehirn Bilder von Männer-Unterhosen entstehen, aus denen im goldenen Glanz der über dem Ozean aufgehenden Sonne feiner weißer Sand rieselt.
»Zuzanna, du hast echt überhaupt keinen Sinn für Romantik«, schimpft Beate. »Außerdem kann man ja schlecht in einem Liebeslied singen: Wir ergaben uns der Leidenschaft, aber vorher legten wir noch eine Iso-Matte unter, damit wir keinen Sand in die Po-Ritze kriegten.« Sie lacht schnaubend bei der Vorstellung.
Ich pruste los. »Nein … auf Iso-Matte reimt sich echt nix!«
Auch Zuzannas Mundwinkel zucken, ehe sie in schnarrendes Gelächter ausbricht.
Natalja steckt den Kopf aus dem Büro. »Mama?«
»Komm häär, Liebeling!« Zuzanna streckt die Arme aus. »Ist alläs in Ordnung«, erklärt sie, als sich das Kind an sie schmiegt und fast zwischen den Falten der Kittelschürze verschwindet. »Habän nur lustigä Witz gehärt.« Mit großen, dunklen Augen beobachtet Natalja, wie wir uns vor Lachen die Bäuche halten und dabei allerlei seltsam Geräusche von uns geben. Schließlich verkündet sie wissend: »Ich glaube, Ihr habt was Pfalsches gegessen.«
Nestschubser
Mit einem Seufzen lehne ich mich in meinem Schwingsessel zurück und lege die Beine hoch. An der Wand mir gegenüber hängt ein großformatiger Posterdruck. Motiv: Ruderboot im Sonnenuntergang. Sehr beruhigend. Wenn ich den Blick nach rechts wende, blicke ich auf eine Regalwand in heller Birke-Nachbildung. Der niedrige Wohnzimmertisch ist aus dem gleichen Material. Beide heißen Helge. Alle meine Möbel haben Namen. Diese habe jedoch nicht ich mir ausgedacht, sondern nordische Produktdesigner mit einer mutmaßlichen Vorliebe für Knäckebrot und Fleischbällchen. Auf »Helge« steht »Ulfrik«, ein Teelichthalter aus mattem Glas. Die Kerze, die darin brennt, spendet flackernden Schein und zarten Granatapfelduft.
Duftkerzen sind eines der Dinge, bei denen sich die Gräben zwischen den Geschlechtern schier unüberwindlich auftun. Ich habe festgestellt, dass es nur sehr wenige Männer gibt, die sich für Raumbeduftung, sei es durch Kerzen, Stäbchen oder Öl in Schälchen, erwärmen können. Am Anfang einer Beziehung nehmen die meisten es noch hin, von Vanilleschwaden umwabert zu werden oder beim Toilettengang Zedernduft zu atmen. Im Rausch der ersten Verliebtheit werden in der Regel auch regenbogenfunkelnde Harmoniekristalle toleriert oder gerahmte Sinnsprüche an den Wänden, die in geschwungenen Lettern daran erinnern, den Tag zu nutzen. Nach einigen Monaten, wenn der Hormonhaushalt sich langsam wieder auf ein Normalmaß einpendelt, kann es schon mal vorkommen, dass sich das Männchen ein angewidertes Naserümpfen beim Betreten der von Rosenduft durchwölkten Höhle des Weibchens nicht verkneifen kann. Dieses Naserümpfen markiert den Wendepunkt. Wenn man bereits den Fehler gemacht hat, sich gemeinsam häuslich niederzulassen, dann sind Duft-Teelichter bald Geschichte. Die meisten Männer stehen Einrichtungsfragen zum Glück weitgehend gleichgültig gegenüber. Es darf ruhig irgendwo ein Harmoniekristall von der Decke baumeln, solange er nicht den Zugang zum Kühlschrank behindert. Es gibt aber auch Männer, die sich nicht nur an der Auswahl der Raumausstattung beteiligen, sondern auch in Dekorationsfragen ein Mitspracherecht einfordern. Gerahmte Sinnsprüche sind im Universum eines jeden Mannes ein absolutes Unding. Kein Mann, der etwas auf sich hält, möchte mit seinen Freunden ein Fußball-Spiel gucken, während ihm von der Wand die Ermunterung entgegenlächelt: »Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab«. Und Patchouli-Duft die Bieraromen verfälscht.
In meinem mittlerweile 47 Jahre währenden Leben konnte ich mich niemals dazu entschließen, in meinen vier Wänden den Duft von Bergamotte und Orangenblüten gegen den harzigen Käsegeruch von getragenen Männersocken einzutauschen. Müsste man dieses Verhalten biologisch einordnen, würde man mich wohl zur Familie der Nestschubser zählen. Mein Nest, meine Regeln. Wer es sich zu gemütlich macht, der fliegt. Das heißt nicht, dass ich Männer nicht mag, im Gegenteil. Ich mag sie nur nicht dauerhaft in meinem Habitat.
Ich finde es wunderbar, sich zu verlieben. Dieses beschwingte Gefühl, auf zartrosa Wolken durch den Tag zu schweben. Die Stromstöße, die direkt ins Innerste fahren und die Herzfasern zum Vibrieren bringen, ausgelöst durch ein Wort, ein Lächeln, das Klingeln des Telefons. Die unvergleichliche Süße, mit der Komplimente wie Zuckerperlen auf der Zunge schmelzen, als feuriges Rinnsal in die Brust fließen, ihren Weg in den Unterleib finden, und dort von innen wärmen. Leider ist es jedoch so, dass dieser rauschhafte Zustand nie mehr als ein paar Monate anhält. Das ist einerseits gut so, denn man möchte sich nicht ausmalen, was los wäre, wenn die komplette Nation Tag für Tag mit entrücktem Blick und überhitzter Libido unterwegs wäre. Ich persönlich fände es irritierend, würde die Dame an der Metzgertheke beim Absägen der Wurstscheiben glücklich lächelnd alte Flippers-Schlager trällern. Und ich möchte nicht von permanent erotisch stimulierten Politikern regiert werden. Nein, das hat die Natur schon ganz gut eingerichtet, dass dieser hormonelle Ausnahmezustand jeweils nur begrenzte Zeit anhält. Man muss halt wachsam sein und im rechten Moment die Reißleine ziehen. Ich habe gelernt, die Anzeichen zu erkennen. Das unwillkürliche Rümpfen der Nase beim Erschnuppern von Veilchenduftwolken. Der ausgeleierte Feinripp-Schlüpfer, wo bis vor kurzem noch die Wildcat-Pant lockte. Die Tasse, die aus unerfindlichen Gründen nicht ihren Weg in die Spülmaschine findet, sondern achtlos auf der Küchenanrichte geparkt wird. Beginnende emotionale Unterzuckerung durch immer spärlichere Kompliment-Perlen-Rationen. Spätestens, wenn er sich beim Samstagabend-Film auf der Wohnzimmercouch die Zehennägel schneidet, muss man sich entscheiden.
Das klingt hart, aber es ist leider nun mal Realität. Es hat schon seinen Grund, warum in den romantischen Hollywood-Schmachtfetzen die Kamera sich stets an dem Punkt abwendet, an dem die beiden Protagonisten sich glücklich in die Arme sinken. Niemand will sehen, wie Julia Roberts ihren attraktiven Geschäftsmann Richard Gere nach Abklingen des Hormontaumels ankeift, er solle sich entweder mal wieder die Füße waschen oder seine Käsetreter am anderen Ende der Couch platzieren. Oder miterleben, wie Johnny vergeblich versucht, sein Baby beim erotischen Dirty Dancing in die Hebefigur zu hieven, was ihm aufgrund zahlreicher kalorienreicher Fernsehabende nicht mehr so recht gelingen mag. Es wäre für den Zuschauer nicht schön mit anzusehen, wie die beiden rücklings auf den Boden kugeln und zappelnd versuchen, sich wieder aufzurichten. Oder Rose und Jack … ach nein, die beiden haben es ja nie auf eine gemeinsame Couch geschafft.
Ich hatte bislang nur einmal eine Beziehung, die die Bewusstseinsvernebelung der ersten Verliebtheit überdauerte. Dies war der Tatsache geschuldet, dass natürliche Verhütung ein rechter Schmarrn ist. Bernie und ich waren uns einig, dass wir das mühsame Gepfriemel mit Plastikhütchen im erotischen Überschwang als hinderlich empfanden. Ich wollte aber auch keine Hormontabletten schlucken, und so entschieden wir uns für eine im Rückblick zugegebenermaßen recht abenteuerliche Kombination aus Temperatur- und Kalenderüberwachung, die uns damals allerdings recht schlüssig schien. Wenn man zwei Faktoren gleichzeitig heranzog, konnte aus unserer Sicht nichts schiefgehen. Das ständige Messen, Zählen und Tabellenführen war leider recht lästig. Zudem waren wir beide jung, verliebt, potent und reichlich unbeherrscht. Es geschah mehr als einmal, dass in der für Vernunftentscheidungen zuständigen Abteilung in unseren Gehirnen achselzuckend die Rollläden heruntergelassen wurden, weil Bernie und ich die alarmierenden Temperaturwerte im Diagramm in meinem Nachtkästchen ignorierten. Statt uns gemeinsam an einen Tisch zu setzen und Monopoly zu spielen, wälzten wir uns höchst unzüchtig, lustvoll und glücklich in den Laken.
Romy war das Ergebnis unserer jugendlichen Disziplinlosigkeit.
Als ich feststellte, dass ich schwanger war, guckten die werdenden Eltern erstmal reichlich bedröppelt. Ich warf einen reuevollen Seitenblick in Richtung meines Nachtkästchens, das die gewissenhaft geführten, jedoch viel zu häufig unbeachteten Temperaturdiagramme beherbergte. Keiner von uns ließ sich zu der Belanglosigkeit hinreißen: »Wie konnte das nur passieren?« Wir wussten beide, wie das passieren konnte. Bernie hatte sich nach der ersten Fassungslosigkeit schnell wieder im Griff. Mit seinen treuen milchschokoladenbraunen Augen unter den beneidenswert dichten Wimpern blickte er mich fest an und machte mir den ersten und einzigen Heiratsantrag meines Lebens: »Tjaaa … dann sollten wir wohl heiraten?« Gut, es hätte romantischer sein können.
Zum Glück war ich nie ein Freund aufwendig inszenierter, tränenreicher Anträge gewesen, wie sie in diversen Samstag-Abend-Shows regelmäßig zu sehen waren. Ich konnte nie verstehen, wieso Menschen sich vor laufender Kamera und Millionen von Fernsehzuschauern von Hubschraubern abseilten oder aus Torten hüpften, um ihren Partner zu Eheschluss zu überreden. Daher war es für mich ganz in Ordnung, dass Bernie weder Sekt noch Blumen noch eine mexikanische Mariachi-Kombo auffuhr. Er sank auch nicht vor mir auf die Knie, sondern biss beherzt in sein Nuss-Nougatcreme-Brötchen. Wir saßen gerade beim Frühstück, auf dem Tisch zwischen uns der Teststreifen mit den beiden verhängnisvollen Balken. So klein, so unscheinbar, und doch so lebensverändernd. »Was meinst?«, nuschelte er mit schokoladenverschmierten Zähnen hinterher. Es wäre wirklich zu schade gewesen, hätte er ein Fernsehteam bemüht, um dem Anlass einen effektvolleren Rahmen zu verleihen. Denn ich sagte nein.
Ich war 22 und frei von blümchenumrankten Illusionen über das Eheleben. Eine Ausschließlichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen, mit dem Inhalt, dass ich in meinem ganzen Leben niemals wieder jemand anders lieben würde, schien mir komplett unsinnig. Hallo? Niemand käme schließlich auf die Idee, sich vertraglich beispielsweise auf Lebenszeit an sein Lieblingsrestaurant zu binden, und seien die Cannelloni dort noch so lecker. Oder ein lebenslanges Metzger-, Friseur- oder Zahnarzt-Abo abzuschließen. Sich mit einem Ehering an einen Menschen zu ketten, ohne eine klar definierte, überschaubare Vertragslaufzeit oder jegliches Umtauschrecht – das war in meinen Augen ausgemachter Schwachsinn. Ich hätte mich damals noch nicht einmal auf die Farbe meines Fußnagellacks über den Zeitraum von vier Wochen hinaus festlegen mögen. Geschweige denn einem Menschen die Treue zu schwören bis zum Lebensende.
Vielleicht lag es auch an meinem Poesiealbum. Irgendwer hatte mir in schnörkeliger Schrift die weisen Worte hineingeschrieben: »Liebe Evi, sei so schlau, werde niemals Ehefrau. Vor der Ehe pflückst du Rosen. In der Ehe flickst du Hosen.« Ich habs nicht so mit Rosen, aber Hosen flicken kam auf keinen Fall in Frage. Zumal Bernie und ich damals schon acht Monate zusammen waren, also in einem fortgeschrittenen Stadium der Entzauberung. Ich fing bereits an, das nächtliche Schnarchen vom Nebenkissen nicht mehr als beglückendes Geräusch wahrzunehmen, dem ich an Bernies wollige Brust gekuschelt, von Nachkopulations-Beseeltheit erfüllt, lauschte, sondern als nervtötendes Gesäge, das mich am Einschlafen hinderte. In der rosaroten Wolkendecke der Verliebtheit waren bereits zahlreiche Lücken aufgerissen, durch die die Realität kalt, grau und vollkommen unromantisch durchschimmerte.
Ich zog mein Blümchen-Nachthemd so über meine angezogenen Knie, dass ich die Zehen darin einwickeln konnte, und schüttelte den Kopf. Lächelnd streckte ich die Hand aus und wischte dem Vater meines Kindes einen Nussnougatklecks vom Mundwinkel. »Bernie, das wäre keine gute Idee. Wir kriegen das auch ohne Ringe hin.«
Bernie küsste mich haselnusscremig. Dann zog er mir das Nachthemd von den Zehen und über den Kopf. Wenn er wach war und nicht schnarchte, teilte ich ausgesprochen gerne mein Kopfkissen mit ihm. Wobei dieses in dem Moment eine eher untergeordnete Rolle spielte.
Wir waren nackt, verschwitzt, sexbeschwipst und euphorisch, als wir den Plan für unser künftiges Leben entwarfen. Ich hatte den Kopf auf Bernies Brust gebettet, die dunkelrote Satin-Bettwäsche fühlte sich angenehm kühl auf meiner Haut an. Wie sich herausstellte, war Bernie keineswegs enttäuscht, dass ich nicht von einer Zeremonie mit Tüll, Torte und Tamtam träumte. Auch ein gemeinsamer Hausstand mit mir war nicht sein innigster Wunsch.
Bernie war Landwirt. Nach dem frühen Tod seines Vaters wenige Jahre zuvor hatte er den elterlichen Hof übernommen. Kühe, Hühner und Getreide waren sein Leben. Es machte ihm nicht das Geringste aus, noch vor dem ersten Hahnenschrei aus dem Bett und in die Stallhose zu hüpfen. Er lebte auf dem Hof zusammen mit seiner sehr liebenswerten und sehr rundlichen Mama Irmi. Diese kümmerte sich um den Haushalt und regelmäßige warme Mahlzeiten, während er mit dem Trekker durch die Ländereien fuhr oder … Kuhzeug machte. Ich hatte mich ehrlich gesagt nie dafür interessiert. Kühe waren für mich nur dann von Interesse, wenn sie lila waren und in unmittelbarem Zusammenhang mit Schokoladenprodukten auftauchten. Eine Ehe mit Bernie hätte für mich unweigerlich ein geblümtes Kopftuch und Gummistiefel bedeutet. Eine Einweisung in die Bedienung der Melkmaschine und schleimige Kälbergeburten. Den Umgang mit den Fäkalien sehr großer Tiere. Einen Tagesrhythmus, der mit meinen natürlichen Bedürfnissen absolut nicht vereinbar war. Gut, es war absehbar, dass in naher Zukunft die Belange des zu erwartenden Kindes erstmal Vorrang vor meinen Bedürfnissen hatten. Ich war auch willens, mein Bett zu jeder Nachtstunde für das Gummibärchen – so der Arbeitstitel für das Baby – zu verlassen. Nicht jedoch für Rinder und Gefieder. Ebenso wenig erachtete ich es als mein Lebensziel, Bernies Stallgarderobe zu reinigen oder ihn nährstoffreich und ausgewogen zu bekochen.
Bernie war bereits aufgefallen, dass ich seinen getragenen Unterhosen – selbst den schönen Wildcat-Pants mit Leoparden-Print – den Zugang zu meinem Wäschekorb verweigerte. Auch hatte ich ihm zum Kaffee noch nie eine selbst gebackene Käsesahne, Windbeuteltorte oder Rumbombe serviert, wie es seine Mama stets tat. Bei mir kam der Kaffee im besten Fall mit einer Packung Schokokeksen auf den Tisch.
Dass ich eine große Toleranz gegenüber Wollmäusen besaß, störte Bernie nicht weiter, solange sie sich unter meinem Bett tummelten. In seiner Wohnung sorgte ja Irmi dafür, dass die Tierchen regelmäßig vom Staubsauger aufgefressen wurden. Mein Kühlschrank, in dem selbst bei genauer Suche nur Stracciatella-Joghurt, eine 300g-Tafel Schokolade Schoko+Keks, Bananen, Gurken und ein Piccolo zu finden waren, also keinerlei Fleisch- oder Wurstwaren, schien Bernie fürs Überleben bedenklich. Der heimische Kühlschrank auf dem Krämerhof beherbergte dank Irmi jederzeit eine erfreuliche Auswahl an Proteinhaltigem.
Na ja, und die Duftkerzen waren ein Problem. Seine Nase, die mehrere Stunden am Tag die Ausdünstungen von Rindern und den Duft ihrer Hinterlassenschaften einsog, konnte Pfingstrosen-Essenzen unbegreiflicherweise nichts abgewinnen.
Wir waren uns einig, die offensichtliche Inkompatibilität unserer Lebensführung nicht unnötig auf die Probe zu stellen. Folgendes war im Falle einer Eheschließung zu erwarten: Wir würden uns zusammenraufen und einige Jahre redlich bemühen. Ich würde Torten backen, Hühnereier sammeln und Kuhmist schaufeln, während ich innerlich die Messer wetzte und in den Nächten davon träumte, Bernies herzhaftem Schnarchen mit einem raschen Schnitt durch die Kehle ein Ende zu bereiten. Irgendwann würde die Fassade bröckeln, ich würde meinen Landwirtsgatten von morgens bis abends ankeifen, wegen seines Ganges, seiner Frisur, seiner Socken, seiner Existenz. Unser Kind würde seine blöde, meckernde, schlecht gelaunte Mutter hassen und später psychologische Hilfe brauchen, um das Kindheitstrauma, von einer tortenbackenden Hexe erzogen worden zu sein, aufzuarbeiten. Irgendwann würden wir dann einem Scheidungsanwalt einen Haufen Geld in den Rachen werfen, damit er uns von dem angeheirateten Übel befreit. Nein, das ging so nicht, da waren wir uns einig. Wir würden es anders machen. Gemeinsam, aber ohne Bindung. Wir würden unserem Kind Eltern sein, aber in getrennten Lebensbereichen. Wir würden es lieben und versorgen, aber unsere Unterhosen jeweils selbst waschen. Beziehungsweise Irmi. Bernie würde natürlich auf dem Hof bleiben, und ich in meiner Wohnung, die zum Glück nur einen Kälberhopser von Bernies Bauernhof entfernt lag. Nun gut, ein paar Kälberhopser, aber nahe genug, um die Strecke später mal mit kleinen Beinen oder mit dem Fahrrad zu bewältigen. Wir würden uns die Sorge für das Kind teilen, aber ohne streng fixierten, auf Monate hinaus festgelegten Zeitplan. Wir würden Entscheidungen kameradschaftlich treffen, gemeinsame Ausflüge unternehmen, uns die Kosten teilen. Auch wenn wir uns sehr wahrscheinlich nicht für immer lieben würden, waren unsere Leben fortan untrennbar verflochten. Trotzdem würden wir uns deswegen auf keinen Fall den Ehe- und Familienkäfig überstülpen. Wir wollten eine Familie sein, in der niemandem die Luft zum Atmen genommen werden sollte. Oder die Duftkerzen.
Bernie spielte mit meinen damals noch langen kastanienroten Locken. »Ist es nicht etwas egoistisch, unserem Kind das klassische Vater-Mutter-Kind-Modell vorzuenthalten?«, sinnierte er. »Ich möchte nicht schuld sein, wenn das Gummibärchen später mal beziehungsgestört wird. Stell dir vor, er oder sie endet als arbeitsloser, übergewichtiger Haustier-Messie in einer Hochhaus-Siedlung, weil wir ihm oder ihr nie ein geordnetes Familienleben mit Tagesschau und Sonntagsbraten vorgelebt haben.«
»Was ist denn bitte ein Haustier-Messie?«
»Na, die armen Menschen, die keine Partnerschaft eingehen können und sich stattdessen immer mehr Haustiere zulegen. Ich habe mal gelesen, im Durchschnitt sind es 105 Tiere.«
»Ist ja schauderhaft …« Ich schüttelte mich bei dem Gedanken. Egal, ob Fell, Gefieder oder Schuppen: Die Hinterlassenschaften von 105 Tieren mussten bestialisch stinken. Schon der Gedanke verursachte mir Würgereiz. Daran war vermutlich mein Zustand schuld. Ich angelte ein Fläschchen mit Eukalyptus-Duftöl aus dem Nachtkästchen und schnüffelte an der Öffnung. Sofort ging es mir besser.
»Erstens sind weder die Tagesschau noch der Sonntagsbraten ausgeschlossen, solange Irmi kocht. Außerdem denke ich, dass unser Gummibärchen größere Chance hat, zu einem glücklichen und ausgeglichenen Menschen heranzuwachsen, wenn es von glücklichen und ausgeglichenen Eltern erzogen wird. Es wäre sicher nicht schön für ihn oder sie, mich im Gefängnis besuchen zu müssen.«
»Gefängnis?«
»Nachdem ich dir die Kehle durchtrennt habe, damit du aufhörst zu schnarchen.«
»Du spinnst ja. Ich schnarche doch nicht!«
»Wie ein asthmatisches Walross.«
Einen Moment war Bernie sprachlos. Dann grinste er breit.
»Da hilft wohl nur eins: Möglichst lange wach bleiben«, meinte er und beugte sich über mich, um verführerisch an meinem Schlüsselbein zu knabbern. Zumindest mussten wir uns über die Verhütungstabellen im Nachtkästchen keine Gedanken mehr machen.
Schattengemahl
Ich drücke den Knopf an der golden verschnörkelten Klingel. Eine muntere Melodie erklingt, heiteres Geklimper auf Xylophon, und ich höre, wie sich die Besitzerin der fröhlichen Haustürglocke mit trippelnden Schritten nähert. Die Tür schwingt auf, das Xylophon verstummt, und ich werde von einer Wolke blumigem Parfümdufts überschwemmt.
»Liebe Evelyn, schön, dass du da bist. Komm rein, komm rein, ich habe so aufregende Neuigkeiten!«
Meine Nachbarin, Vermieterin und Freundin Olivia Morell umarmt mich herzlich. In Wirklichkeit heißt sie Heidrun Maier, doch das wissen außer mir nur sie selbst, ihre Eltern, ihr Manager, ihr Arzt und vermutlich ein paar Leute im Passauer Einwohnermeldeamt. Ich weiß es auch nur deswegen, weil Olivia / Heidrun es mir einmal unter Alkoholeinfluss kichernd erzählt hat. Danach musste ich auf die neueste Ausgabe eines Modemagazins schwören, es niemandem zu verraten.
Für einen Moment versinke ich in raschelnder, dunkelgrüner Seide und Maiglöckchenparfüm. Olivia trägt zu der Seidenbluse einen breiten, braunen Gürtel, eine enge beigefarbene Hose und High Heels. Noch nie habe ich sie in ausgeleierten Jogginghosen und Einhornpuschen – mein persönliches Couch-Outfit – angetroffen. Das liegt vermutlich daran, dass sie Schlagersängerin ist und daher von Berufs wegen immer damit rechnen muss, dass ein Fotograf im Gebüsch lauert, um ein möglichst garstiges Foto von der bildhübschen, blondgelockten jungen Frau zu ergattern. Ich stelle es mir schrecklich vor, wenn man sich sogar für den Weg zur Mülltonne vorher aufrüschen muss. Wobei Olivia eine Putzfrau hat, die den Müll rausbringt. Aber grundsätzlich. Ich möchte meine Einhornpuschen nicht missen, wobei ich auch gegen eine Putzfrau grundsätzlich nichts einzuwenden hätte. Aber man kann nicht alles haben.
Ich folge Olivia durch die Halle. Olivias Haus betritt man nicht durch einen engen Flur, in dem Mäntel, Schuhe, Handtaschen und Regenschirme auf engstem Raum ein lichtloses Dasein fristen, wie bei mir. Nein, man durchschreitet die weiße Haustür und findet sich unmittelbar in einem großen, lichtdurchfluteten Raum wieder. An der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein riesengroßes Panorama-Fenster, von dem aus man einen wunderschönen Ausblick auf die Dreiflüssestadt hat. Olivias Haus liegt an einer Anhöhe über dem rechten Ufer des Inns. Von dem großen Fenster aus blickt man auf das breite Band des Flusses und die Parade der Häuser, die sich am gegenüberliegenden Flussufer entlang der Innpromenade wie bunte Spielzeugschachteln aneinanderreihen. Auch die Ortsspitze ist zu sehen, die Landzunge, wo der Inn und die kleinere Ilz sich mit dem mächtigen Donaustrom vereinen. Über der Stadt wacht väterlich der Stephansdom mit seinen drei weißen Türmen.
Der Raum ist die perfekte Filmkulisse. Man wäre nicht überrascht, würde Cinderella die breite Freitreppe zum Obergeschoss heruntergehastet kommen, im Ballkleid natürlich und mit nur einem Schuh. Doch statt einer humpelnden Prinzessin kommt ein weißes, wuscheliges Fellknäuel die Stufen heruntergehoppelt. Laut und freudig kläffend umrundet es mich und hopst an meinen Beinen hoch. Das wollige Stummelschwänzchen rotiert freudig.
»Fou-fou!« Ich bücke mich, um den Wattebausch auf vier Beinen hinter den wuscheligen Ohren zu kraulen. »Na, Dickerchen? Heute habe ich leider kein Leckerli für dich dabei.« Prüfend beschnuppert der kleine Hund meine Handflächen, die ich ihm hinhalte. Ein leises »Pffff …« ist zu hören.
»Pfui, Fou-fou!«, schimpft Olivia. Sie blickt mich entschuldigend an. »Du kennst ihn ja. Wenn er aufgeregt ist, entfleucht ihm gerne mal ein Tönchen, haha.« Sie wedelt ein wenig mit den Händen, um den aufsteigenden Geruch zu vertreiben.
»Riechst du den Furz, ist der Abstand zu kurz«, befinde ich diplomatisch. Wir lachen beide, und Fou-fou dackelt auf kurzen Beinchen um uns herum.
»Fou-fou, mein Süßer!« Olivia nimmt den Hund hoch. »Komm mal her und lauf uns nicht immer zwischen die Beine.« Fou-fou hechelt noch immer vor Aufregung, und sie krault ihn ein wenig am Kinn, wobei sie ihren perfekt geschminkten Kirschmund spitzt und leise gurrt.
»Aber nun komm mit in den Salon, Evi, ich muss dir etwas erzählen. Und ich möchte dir jemanden vorstellen.« Sie zwinkert mir verschwörerisch zu.
Oje, auf ein Zusammentreffen mit Fremden bin ich nicht vorbereitet. Als Olivia mich eben anrief und fragte, ob kurz hochkommen könnte, bin ich nur schnell aus meinen Einhornpuschen in geringfügig tageslichttauglichere Birkenstocksandalen geschlüpft und habe eine Strickweste mit Norweger-Muster über meinen orangefarbenen Bärchen-Hoodie gezogen. Dazu trage ich eine meiner bereits erwähnten Jogginghosen. Ich nenne sie allerdings lieber »Gemütlich-Hose«, da mir nicht im Traum einfallen würde, damit tatsächlich zu joggen. Ich bin ungeschminkt, und die Haare habe ich oben am Kopf zusammengebunden wie Kohlhiesls Tochter. Die Hässliche. Insgesamt eine recht gewagte Kombi, die für den Weg von der Einliegerwohnung in Olivias Haus, in der ich lebe, die Treppe an der Rückseite des Gebäudes hoch, durchaus in Ordnung ist. Wenn Olivia mich bittet, mal kurz hochzukommen, dann bedeutet das in der Regel, dass sie ein Gurkenglas nicht aufbekommt, sich Fou-fou in irgendwas Ekliges reingesetzt hat, mit dem sie sich die frisch gemachten Nägel nicht versauen möchte, oder dass sie auf ihrer weitläufigen Terrasse zwei Gläser Wein eingeschenkt hat, von denen eines für mich bestimmt ist. Keiner dieser Anlässe würde größere Anforderungen an meine Garderobe stellen. Ich hatte auf den Wein gehofft und daher vorsorglich die Norweger-Weste übergezogen. Doch nun muss ich in meinem »Ich-schlafe-unter-der-Brücke«-Style wohl Fremden gegenübertreten. Schnell zupfe ich mir im Gehen den Zopfgummi aus den Haaren und verwuschle meine Locken. Mehr kann ich auf die Schnelle leider nicht retten.