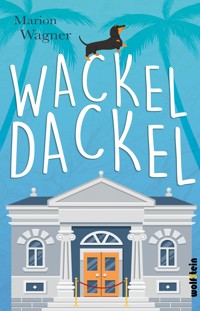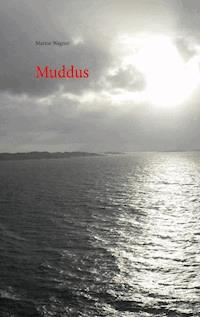Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herrlich komisch, spannend und mit einer Prise Romantik. Doro wurde gerade von ihrem Ehemann verlassen, und Gabi hadert mit dem Auszug ihrer Tochter. Beide wollen im Wellnesshotel »Oachkatzlhof« ihre Probleme für ein paar Tage vergessen. Doch dann erschüttert ein Mord die Idylle, und Gabi ist die Einzige, die mit Sicherheit weiß, dass der Hauptverdächtige unschuldig ist. Heimlich machen sich die Freundinnen auf die Suche nach dem wahren Täter und entdecken hinter der heimeligen Fassade des Hotels so manches sündige Geheimnis ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Wagner lebt mit ihrer Familie, zwei Katzen und vier Hühnern in der niederbayerischen Gemeinde Thyrnau, nahe der Dreiflüssestadt Passau. Bereits in der Grundschule prophezeite eine Lehrerin: »Das Kind wird mal ein Buch schreiben.« Sie hat recht behalten.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Chantal Cooper/Alamy/Alamy Stock Photos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Julia Lorenzer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-265-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
O Mutter, es gäbe noch so viel zu tun!Hörst du es nicht rufen, das hungernde Huhn?
Oliver und Sandra Wagner – Die neuen Leiden der Familie W.
1
»Der Poolnudel-Rudi ist ein Sadist!«
Unter theatralischem Stöhnen hievt Gabi sich auf den Barhocker neben mir. Aufgrund ihres untersetzten Körperbaus gelingt es ihr auch unter normalen Umständen nur selten, einen Barhocker mit Grazie zu erklimmen. Ihre Stunde mit dem Poolnudel-Rudi hat ihr offenbar auch noch den letzten Rest an Würde geraubt. Sie erinnert mich an ein Kängurubaby, das versucht, in den mütterlichen Beutel zu klettern, wie sie erst die Sitzfläche umklammert, einen Fuß an der Querstrebe zwischen den Stuhlbeinen abstützt, sich gleichzeitig an der Thekenplatte hochzieht und ihren Hintern schließlich auf dem Hocker einparkt. Ermattet lässt sie ihren in ein schimmerndes Paillettenoberteil verpackten Busen auf den Tresen sinken.
»Einen Bärwurz, bitte. Und einen Aperol Spritz. Viel Aperol, wenig Spritz!«, stöhnt sie in Richtung des Barkeepers Jonathan. »Der Bärwurz ist gegen die Schmerzen«, erklärt sie mir, als sie meine hochgezogenen Augenbrauen sieht. »Das ist eine Heilpflanze, wusstest du das? Geheimtipp vom Rudi.«
Jonathan ist schätzungsweise Mitte zwanzig, groß, dunkelhaarig und ein astreines Schnittchen. Wäre ich dreißig Jahre jünger, könnte ich wohl nicht umhin, mich einzureihen in die Schar der jungen Mädchen, die am anderen Ende der Theke ihre zierlichen Hinterteile mit gekonntem Hüftschwung auf den Barhockern platziert haben und nun entweder überdreht gackern oder scheinbar gelangweilt goldene Locken um ihre Finger wickeln, während sie den gut gebauten Burschen mit dem Cocktailshaker mit Blicken förmlich ausziehen.
Jonathan schenkt Gabi ein verständnisvolles Tom-Cruise-Lächeln. »Kommt sofort!«, verkündet er und holt die Flasche mit dem grellorange schimmernden Inhalt aus dem Barschrank. Ich meine, entzücktes Seufzen aus der Mädelsecke zu hören.
»Na, war es denn so schlimm?« Ich tätschele die Hand meiner Freundin, die entkräftet auf ihrem Stühlchen hockt. »Sollen wir es uns heute vielleicht lieber drüben auf den Sofas bequem machen?« Ich nicke mit dem Kopf ans andere Ende der Bar, wo einige gemütlich aussehende Loungesofas in einer Kaminecke gruppiert sind.
»Danke, Doro, aber jetzt sitze ich ja ganz gut«, winkt Gabi ab und lächelt Jonathan an, der ein bauchiges Glas mit Strohhalm und ein Stamperl mit dunkler Flüssigkeit vor ihren immer noch glitzernd auf der Tischplatte drapierten Busen stellt. Nachdem sie den Schnaps mit einem gekonnten Knick aus dem Handgelenk in einem Zug gekippt hat, saugt sie gierig an dem Strohhalm. »Boah, das hab ich jetzt gebraucht. Ich merke schon ganz deutlich, wie die Muskeln sich entspannen.«
Ich nehme auch einen Schluck von meinem Caipirinha. »Es ist ja nicht so, dass man dich nicht gewarnt hätte«, grinse ich. »Der Poolnudel-Rudi ist berüchtigt, das wusstest du vorher.«
»Jaja«, nuschelt Gabi in ihren Strohhalm. Der Pegel in ihrem Glas ist in kurzer Zeit erstaunlich tief gesunken.
Rudi Zirngibl, so sein bürgerlicher Name, hat sich in jungen Jahren einmal für die Teilnahme am Ironman auf Hawaii qualifiziert. Das geht aus mehreren gerahmten Zeitungsartikeln hervor, die im Umkleidebereich des Hallenbades zu bestaunen sind. Zudem wird der Rudi nicht müde, den Hotelgästen drastisch und wortreich von seinen Kämpfen, von Schweiß und Tränen, der schier unbezwingbaren Erschöpfung und schließlich dem triumphalen Überqueren des Zielpunktes auf einem passablen Rang siebenundfünfzig zu erzählen. Der Rudi hat einen blank rasierten Schädel, Oberschenkel aus Beton und Bauchmuskeln, wie man sie sonst nur aus der Herrenunterwäsche-Werbung kennt. Vermutlich ist der ansprechende Anblick, den der Rudi in seinen körpernahen Badeshorts am Beckenrand bietet, einer der Gründe für die Beliebtheit, derer sich die von ihm angebotenen Aquafitness-Kurse hier im Hotel erfreuen. Sie sind immer ausgebucht, obwohl er keinen Hehl daraus macht, dass bei ihm nicht gemächlich gepaddelt oder ein bisschen mit Poolnudeln geschäkert wird. Sein Aquagym-Extreme-Power-Pack heißt nicht umsonst so. Hier wird im Wasser gejoggt und gehüpft, bis das Bademützchen qualmt, und wenn man bei den Muskelkräftigungsübungen nach der achtzigsten Wiederholung das Gefühl hat, die blöde Poolnudel wiege mindestens eine Tonne, dann wird der Rudi erst richtig warm. So ein Ironman a. D. hat einfach eine andere Schmerzgrenze als eine Meute Weiber, die normalerweise niemals auf die Idee kämen, Hampelmänner im Swimmingpool zu machen – oder irgendeinen anderen Sport, ob im Wasser oder an Land. Aber für die Möglichkeit, fünfundvierzig Minuten lang ungeniert auf ein derart definiertes Sixpack gucken zu dürfen – in echt, nicht auf einem Plakat oder in einer Hochglanzzeitschrift – nimmt frau schon mal ein wenig Muskelkater in Kauf. So zumindest die Argumentation von Gabi, als sie sich in den Kurs einschrieb. Ich ließ sie gewähren.
Gabi ist seit dreiundzwanzig Jahren mit Uwe verheiratet. Uwe hat viele wunderbare Eigenschaften, aber ein Sixpack gehört nicht dazu. Gabis Mann ist eher der knuffige Typ, dem man beim Besuch im Hallenbad von körperbetonter Bademode abraten und weite Boxershorts ans Herz legen würde, mit elastischem Bund und viel Bauchfreiheit. Aber das ist nur eine hypothetische Aussage, denn das Ehepaar Sosnovski besucht meines Wissens niemals irgendwelche Bäder.
Ich persönlich kann so einem Waschbrettbauch nichts abgewinnen. Der Anblick von all diesen Buckeln auf der Bauchdecke irritiert mich eher, als dass er mich erfreut. Und praktisch betrachtet muss so ein Kerl doch furchtbar anstrengend sein. Das geht schon bei der Ernährung los. Um die Fettlosigkeit der Bauchbuckelstrecke sicherzustellen, dürfen vermutlich weder Pizza noch Pasta noch Pommes auf den Tisch. Gummibärchen und schokolierte Rosinen müsste man vermutlich auf dem Klo hinter der WC-Ente verstecken und beim Bieseln heimlich naschen, um die Gefühle des Athleten nicht zu verletzen. Außerdem stelle ich es mir schrecklich ungemütlich vor, mit so einem Berg aus stahlharter Muskelmasse ins Bett zu gehen. Das kann doch niemals kuschelig sein! Zum Anschmiegen ist ein nachgiebiges Waschbärbäuchlein einfach besser geeignet als so eine brettharte Buckelpiste. Aber das ist natürlich nur reine Spekulation. Nachdem ich in meinem Leben niemals praktische Erfahrungen mit durchtrainierten Unterwäschemodels sammeln konnte, kann ich dies alles nur vermuten. Mein Michi hatte einen Bauch, auf den man seinen Kopf wunderbar betten konnte. Nicht wabbelig, aber nachgiebig. Der perfekte Kuschelbauch. Energisch schiebe ich diesen Gedanken zur Seite.
»Hat es sich denn wenigstens gelohnt?«, will ich nun von Gabi wissen.
Diese richtet sich auf dem Barhocker ein wenig auf, streicht sich eine imaginäre Strähne ihrer grauen Pudellocken aus dem Gesicht und verkündet würdevoll: »Durchaus.«
»Was tut man nicht alles …?«, sage ich und reiche Gabi das Glas mit den Salzletten, das auf dem Tresen steht. »Da, nimm. Magnesium ist gut gegen Muskelkater, hab ich gehört.«
»Ist da Magnesium drin?«
»Bestimmt.«
»Na dann.« Gabi zupft sich einige der dünnen Stänglein aus dem Glas. »Und viel Flüssigkeit soll man auch zuführen. Jonathan, bringst du mir noch einen?«
Gabi winkt dem Barkeeper-Schnittchen mit ihrem mittlerweile leeren Aperol-Glas zu.
Versonnen ruht ihr Blick auf dem Jungen, als dieser sich umwendet, um das Gewünschte vorzubereiten.
»Guckst du dem Jonathan gerade auf den Hintern?«, zische ich Gabi zu, die mich daraufhin breit angrinst.
»Gucken darf man.«
»Sag mal, hast du so was wie eine Midlife-Crisis? Erst rennst du zum Poolnudel-Sadisten und quälst dich durch seine Folterstunde, nur für den Anblick eines nackerten Männer-Bauchs …«
»… eines unfassbar wohlgeformten nackten Männerbauches. Und der Rest war auch nicht ohne. Sein Hintern … wie zwei pralle Honigmelonen«, schwärmt Gabi.
»Und jetzt fängst du beim Anblick eines fast noch minderjährigen Hinterteils beinahe an zu sabbern. Ich bitte dich, der Junge ist doch kaum raus aus dem Kindergarten!«
Gabi beachtet mich nicht und strahlt Jonathan mit ihren großen blauen Puppenkulleraugen dankbar an, als er ihr das Getränk serviert. Offenbar immer noch sehr durstig, nimmt sie einen großen Schluck, lehnt sich auf ihrem Barhocker zurück und blickt versonnen in das orangefarbene Funkeln im Glas. Ich lasse sie schweigen.
Sie trinkt noch einmal, dann teilt sie mir mit: »Doro, Älterwerden is ein solcher Mist.« Ihre Aussprache beginnt leicht zu verschwimmen. »Wir sind beide weit über vierzich. Bei aller Liebe, aber da is das Bergfest sehr wahrscheinlich schon rum.« Ihr Mund sucht den Strohhalm und findet ihn. Nach einem weiteren tiefen Schluck, der das Glas beinahe leert, spricht sie weiter. »Du zum Beischpiel … du warst mal ein richtiger Feger, Doro. Ein richtiger Feger!« Sie unterstreicht ihre Aussage, indem sie schwankend den Zeigefinger hebt. Jonathan scheint Gabis Zubereitungshinweis getreulich umgesetzt zu haben. Viel Aperol, wenig Spritz. Und Gabi verträgt sowieso nichts.
»Mach mal langsam, Gabi …«
»Verschteh mich nich falsch, du bist immer noch eine attrak…tive Frau. Aber halt nimmer schwansig. So wie die dahinten.« Der schwankende Zeigefinger deutet in Richtung Jonathans goldgelockten Fanclub. »So jung und so knackich und so aaahnungslos …« Sie beugt sich zu mir und flüstert mir verschwörerisch zu: »Soll ich denen mal sagen, was sie erwartet?« Gabi zieht noch einmal energisch an ihrem Strohhalm. Das Glas ist leer.
»Gabi, ich glaube …«
Doch Gabi ist bereits von ihrem Barhocker gerutscht und schickt sich an, zu den Mädchen zu gehen. Ich erwische sie gerade noch am Zipfel ihres Paillettenhemdchens.
»Gabi, bleib hier.«
»Lass mich!« Sie schüttelt meine Hand ab. »Ich muss die warnen. In dreißig Jahren sind sie alt und faltich, und ihre Männer bumsen ihre Scheißsekretärinnen. Das müssen die doch wissen!«
Ich lasse die Hand sinken. Denke an meinen Michi. Und seine Scheißsekretärin. Schnell ziehe ich den blickdichten Vorhang in meinem Kopfkino wieder zu.
»Komm, Gabi, lass gut sein. Es gibt doch auch richtig tolle Männer. So wie deinen Uwe.« Ich lächle zuckersüß und reiche ihr noch eine Salzstange, um sie wieder auf den Barhocker zu locken. Aber ich fürchte, die Kombination aus Muskelschmerz und drei in Rekordzeit konsumierten alkoholischen Getränken könnte einen erneuten Aufstieg zu einem jämmerlichen Schauspiel werden lassen. Möglicherweise würde sie sich verletzen.
Entschlossen gleite ich ebenfalls von meinem Hocker, hake Gabi unter und lotse sie zu einem der Sofas. Sie lässt sich widerstandslos abführen und plumpst schwer atmend in die Kissen.
»Gar nich so übel«, befindet sie und klopft ein dickes, weiches Polster zurecht, an das sie sich nun lehnt und dabei die Augen schließt. »Aber dieses Sofa dreht sich«, murmelt sie vorwurfsvoll.
Ich muss grinsen. Alkohol und Gabi, das war schon immer eine unheilvolle Kombination. Ein Gläschen kann man problemlos mit ihr trinken, aber was darüber hinausgeht, führt unmittelbar zum Schwips. Ich kenne das. Sie wird nun einige Minuten sehr viel reden und dann sehr müde werden. Der Abend dürfte bald beendet sein. Was ich gar nicht so schlimm finde, denn auch ich habe heute in die Glitzerkiste gegriffen und trage einen schwarzen Minirock mit goldenem Metallic-Effekt. Er fühlt sich an meinen Hüften an wie eine Presswursthülle. Ich besitze diesen Rock seit fünfzehn Jahren, er ist zeitlos, sexy und zugleich elegant, betont meine langen schlanken Beine, die es mir problemlos erlauben, meinen Größe-sechsunddreißig-Popo mit Grazie auf einem Barhocker niederzulassen, und er hat immer tadellos gepasst. Ich ziehe ihn nur bei gemeinsamen Urlauben von Gabi und mir an, also einmal im Jahr. Auch in diesem Jahr habe ich das schöne Stück, ohne zu zögern, in den Koffer gelegt. Ich war sehr überrascht, dass ich den Rock heute fast nicht über die Hüften bekommen hätte und sich der Reißverschluss nur mit Gewalt und Luftanhalten schließen ließ. Die Bauchröllchen, die sich über dem güldenen Bund wölben, sind neu. Da ich in den letzten zwölf Monaten nicht zugenommen habe, müssen sich unbemerkt die Proportionen verschoben haben. Unheilvolle Dinge spielen sich ab. Gabi hat schon recht. Älterwerden ist Mist. Man bekommt Falten und Röllchen, und der Ehemann bumst die Sekretärin.
»Uuund …« Gabi hat sich auf dem schwankenden Sofa eingeschaukelt und erhebt wieder die Stimme. Ihr ist offenbar ihre Mission wieder eingefallen, der nachkommenden Frauengeneration ihre Lebenserfahrung mit auf den Weg zu geben. »Und man muss den Mädels sagen, dass …«, sie richtet sich auf, hebt erneut den Zeigefinger und überlegt, »… dass sie keine Kuchen backen sollen.«
»Gabi …«
»Doro, pass mal auf. Ich hab das grad mal ausgerechnet. Weißt du, wie viele Kuchen ich in den letzten dreiundschwansig Jahren gebacken hab? Jeden verdammten Sonntag einen. Über tausend! Tausend Kuchen! Das is doch bekloppt.« Sie lässt sich wieder in die Kissen fallen. »Das sind Mi-lli-o-nen von Kalorien! Millionen! Weißt du, wie viele Kilos ich mir angefressen hab in meiner Ehe? Ich war auch mal schlank!« Sie holt tief Luft. »Und ich hab tonnenweise Wäsche gewaschen. Tonnenweise! Gewaschen, gebügelt, in den Schrank gelegt und wieder gewaschen. Ein Teufelskreis! Von der Putzerei will ich gar nich reden. Ohne Ende Dreck hat die gemacht. Ohne Ende. Und ich hab ohne Ende geputzt. Und jetzt is sie weg. Schwups und weg.« Gabi macht eine wedelnde Bewegung mit der Hand. »Jaja, ich weiß, das muss so sein. Wär ja blöd, wenn die Kinder einem ewig am Rockzipfel hängen. Die müss’n flügge werd’n.« Sie wedelt wieder. »Aber … was soll ich denn jetzt machen?« Sie klingt weinerlich. Ermattet sinkt sie zurück und schließt wieder die Augen. Der Redeschwall scheint zu versiegen. »Magst du mir noch einen Aperol bringen, bitte?«, murmelt sie.
»Lieber nicht, Süße.« Ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, den Abend zu beenden. Im Moment hätte es keinen Sinn, Gabis Schmerz über den kürzlichen Auszug ihrer Tochter Tamara besänftigen zu wollen. Sie hat geredet, und jetzt wird es Zeit, sie ins Bett zu bringen.
»Jonathan, schreib die Drinks bitte auf mein Zimmer, ja?«, rufe ich dem jungen Mann zu, der gerade ein Glas poliert. »Zweiundvierzig!«
Ich hieve mich aus den Kissen und reiche Gabi die Hand.
»Na komm, ab ins Bettchen. Genug Aufregung für heute. Morgen machen wir eine ausgiebige Wanderung, und dann gönnen wir uns eine schöne Massage.«
»Okeeeeh …« Gabi nimmt meine Hand, und ich ziehe sie hoch.
Ein vernehmliches Ratschen ist zu hören. Na prima. Eine Metallic-Minirock-Ära geht hier und jetzt zu Ende. Zum Glück sind meine Hüften breit genug, den Rock an Ort und Stelle zu halten, während ich meine schwankende Freundin zum Aufzug führe.
»Gehst du morgen mit zum Poolnudel-Turnen?«, fragt Gabi, als wir auf den Lift warten. »Der Rudi ist wirklich ein Schnittchen. Andere Mütter ham auch schöne Söhne, weißt du?«
»Ich überleg es mir.«
2
Nun, das war ein kurzer Abend. Ächzend schäle ich mich aus den Überresten des Metallic-Rocks und lasse ihn achtlos auf den Boden fallen. Auf dem Weg ins Bad streife ich mein schwarzes Top über den Kopf und werfe auch dieses zu Boden.
Michi würde sich furchtbar darüber aufregen. Er neigt dazu, ein wenig penibel zu sein. Er kann es zum Beispiel überhaupt nicht haben, wenn in der Geschirrspülmaschine Messer und Gabeln nicht sortiert sind. Oder die alphabetische Ordnung seiner CD-Sammlung missachtet wird. Oder die Henkel der Tassen im Schrank nicht in die gleiche Richtung zeigen – bevorzugt natürlich nach rechts gerichtet, weil ergonomisch am angenehmsten. Oder eben, wenn Wäsche am Boden liegt. Aber Michi ist nicht da, um sich aufzuregen, und darum lasse ich nun auch meinen BH einmal schwungvoll um meinen Zeigefinger kreisen und schnippe ihn durchs Zimmer. Er landet auf dem großen Flachbildfernseher an der Wand.
Ist das schon die Wutphase? Nach dem Urlaub habe ich einen Termin bei Herrn Kaspar-Koppenhöfer, meinem Therapeuten. Ich werde ihn fragen.
Nackt bis auf den Slip, trete ich vor den großen Badezimmerspiegel. Kritisch betrachte ich meine Bauchregion und kneife prüfend in das Fleisch. Tatsächlich, es wabbelt. Unfassbar. Vielleicht hat Michi diese schwabbelige Wulst schon lange bemerkt und deshalb … Ärgerlich schüttele ich den Gedanken ab. Ich stemme die Hände in die Hüften und mustere mein Spiegelbild. Ohne unbescheiden sein zu wollen: Für über vierzig bin ich echt noch tipptopp in Schuss. Mein Hintern ist straff und knackig. Vorsichtshalber fühle ich nach. Ja, Substanz und Beschaffenheit unbedenklich. Der Busen genau da, wo er hingehört, und von Schwerkraft oder Gewebeerschlaffung unbeeindruckt. Jedenfalls beinahe. Ich wackele ein wenig mit den Schultern. Hm. Ich meine, mehr Wogen zu erkennen als gewöhnlich. Aber immerhin in exakt der richtigen Größe – nicht zu klein, aber auch keine Pornomelonen. Perfekte Körbchengröße C. Meine Oberschenkel sind glatt und seidig und dellenfrei. Zumindest überwiegend. Hey, und das können nun wirklich nicht viele Frauen von sich behaupten. Ich habe schon sehr viele deutlich bolligere Oberschenkel gephotoshoppt, und zwar auch bei wesentlich jüngeren Frauen. Niemand kennt die Laufstegschönheiten dieser Welt so genau wie ein Modefotograf. Ich hatte sie alle vor der Kamera, im Studio und live in Mailand und Paris. Und danach hatte ich sie auf meinem Bildschirm, wo sie dem unbarmherzigen Superzoom meiner Fotobearbeitungsprogramme gnadenlos ausgeliefert waren. Ich weiß genau, welches Model an welchen Stellen künstlich ein wenig ausgedellt werden muss, bei wem öfter mal ein paar Pickel visuell abzuschmirgeln oder Pölsterchen zu retuschieren sind.
Seufzend zupfe ich an meinen Bauchröllchen und wünschte, ich könnte mit meinem magischen Photoshop-Radierer auch hier die Konturen einfach korrigieren. Stattdessen nehme ich mein dunkelgrünes Seidennachthemd vom Haken und streife es über. Schwups, schon sind die Röllchen weg. Ich werfe einen Blick in die Minibar. Mir ist nach einem Schlummertrunk, zum Schlafen ist es noch zu früh. Gabi schnarcht in ihrem Zimmer bestimmt schon friedlich im Aperol-Delirium. Ich habe noch Kapazität.
Mit einem Glas Wein lege ich mich auf das Bett und greife nach meinem Handy. Ich nehme einen tiefen Schluck der roten Flüssigkeit und spüre, wie sie meine Kehle hinunterrinnt und sich in meinem Bauch eine wohlige Wärme ausbreitet. Zwei Klicks auf dem Display, und ich habe gefunden, was ich gesucht habe: die Fotogalerie.
Michi auf dem Golfplatz, in dem hellblauen Poloshirt, das ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Die Farbe bringt seine Augen wunderbar zum Leuchten und betont seine gebräunte Haut. Mit einem Glas Bier in der Hand prostet er in Richtung Kamera und schenkt dem Betrachter sein Wer-ist-schon-Brad-Pitt-Lächeln.
Michi in unserem Garten. Entspannt sitzt er im Liegestuhl unter dem Apfelbaum, vertieft in ein Buch. Eine Strähne seines blonden Haares fällt ihm in die Stirn. Gefärbt natürlich, was sonst? Er streitet es immer ab. Putzig. Welchem Mann über fünfzig sollte man abnehmen, dass die Natur noch ausreichend blonde Pigmente für einen sportlichen Beachboy-Look produziert?
Michi und ich auf Bali. Vor zwei Jahren war das. Ein braun gebranntes, strahlendes Paar vor einem krachblauen Himmel. Palmen. Wir halten Kokosnüsse, in denen pinkfarbene Strohhalme stecken.
Michi im Smoking, auf dem Balkon eines Luxushotels in Paris. Hinter ihm die Millionen Lichter der Großstadt, in Erwartung der Silvesternacht und des Jahreswechsels. Ich denke an den golden sprudelnden Champagner, den wir in dieser Nacht getrunken haben, die Musik und meine schweineteuren Pumps, deren Verbleib bis heute nicht geklärt ist, nachdem ich sie beim Tanzen kurzerhand in eine Ecke gekickt habe.
Ich sollte all diese Bilder löschen. Ja, das sollte ich. Aber ich bin noch nicht so weit. Herr Kaspar-Koppenhöfer meint, ich würde es merken, wenn ich loslassen kann. Hach, er ist so verständnisvoll und geduldig. Es ist mir wirklich peinlich, wie viele Boxen Kosmetiktücher ich bei ihm schon weggeschnäuzt habe, aber wenn er mich mit seinen wässrigen blauen Augen mitleiderfüllt anschaut, seine rundliche Hand auf meine legt und fragt, wie ich mich heute fühle, dann beginnt automatisch meine Unterlippe zu zittern, und meine Hand tastet nach der Box mit den Tüchern. Ich würde ja durchdrehen, müsste ich mir von morgens bis abends das Wehklagen verlassener Ehefrauen anhören. Herr Kaspar-Koppenhöfer ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Liebeskrisenbewältigung, da hat er echt einen Ruf. Was vermutlich den Vorteil hat, dass er eher selten mal einen handfesten Psychopathen auf die Couch kriegt, der davon träumt, Angela Merkel die Fußnägel zu ziehen oder sich eine Halskette aus den Ohrläppchen westfälischer Jungfrauen zu basteln. Das mit der Couch ist übrigens ein Mythos. Ich kann nur für die Praxis von Herrn Kaspar-Koppenhöfer sprechen, aber bei ihm sitzt man als Patientin aufrecht in einem bequemen Ledersessel, und man darf die Schuhe anbehalten.
Wenn ich ehrlich bin, dann erzählt Herr Kaspar-Koppenhöfer nicht viel, was ich nicht schon als Fünfzehnjährige in der Bravo gelesen hätte. Trauer, Verleugnung, Wut … Bla, bla … Nur mit dem Unterschied, dass ich damals, wie Gabi ganz richtig festgestellt hat, ein Feger war und in der Regel die Ursache für den Liebeskummer anderer. Jetzt, dreißig Jahre später, bumst mein Mann seine Scheißsekretärin, und ich sitze wöchentlich eine Stunde in einem bequemen Ledersessel und beweine mein Schicksal, während sich ein älterer Herr mit Stirnglatze dazu Notizen macht. Vermutlich schreibt er seine Einkaufsliste. Was soll er schon groß notieren, das er nicht schon mindestens tausendmal gehört hat? Meine Geschichte ist so gewöhnlich, so klischeehaft, dass es beinahe peinlich ist. Erfolgreiches Ehepaar, sie Modefotografin, er Vertriebsmanager, wohlhabend, kinderlos und ohne Haustiere, weil weder marmeladenverschmierte Kinderhände noch Hundehaare sich mit dem schweineteuren cremefarbenen Benz-Sofa vertragen. Arbeit, Reisen, Feiern. Und eines Tages die Scheißsekretärin. Linda mit den süßen Sommersprossen und den langen Beinen. Wieso wird man mit solchen Beinen Sekretärin, verdammt noch mal! Midlife-Crisis, gemeinsame Überstunden … Und die Erkenntnis, dass man sich altersbedingt mit einundfünfzig Jahren rein rechnerisch auf dem absteigenden Ast befindet. Die Lebenszeit ist endlich, und wieso sollte man da der Verlockung widerstehen, wenn die besagten langen Beine sich so bereitwillig hingeben? Erst auf dem Büroschreibtisch (ich sagte doch, Klischee), dann in diversen teuren Hotels auf Dienstreisen und nun vermutlich auf der schweineteuren Benz-Couch. Ich habe sie ihm überlassen, als ich ausgezogen bin. Ist doch super, dass außer der alternden Ehefrau keinerlei Verpflichtungen zwischen ihm und seinem Liebesrausch mit Linda stehen. Und das mit der Ehefrau hat sich recht schnell erledigt. Er war immerhin so anständig, ein paar Tränchen zu verdrücken, als er vor mir saß und erklärte, dass er nichts gegen seine Gefühle tun könne und wir die Scheidung doch sicherlich mit Anstand über die Bühne bringen würden, schließlich seien wir erwachsene Menschen mit einem Ehevertrag. Und wir hätten doch so eine tolle Zeit miteinander gehabt, auf die wir dankbar und mit Freude zurückblicken sollten, aber nun sei für ihn die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Nur weil wir bei dem Gespräch auf der schweineteuren cremefarbenen Benz-Couch saßen, habe ich ihm nicht meinen Rotwein ins Gesicht geschüttet. Heute wünschte ich, ich hätte es getan.
Oh, dieser Gedanke ist neu. Wutphase? Ich werde Herrn Kaspar-Koppenhöfer fragen.
Mein Finger schwebt über dem »Löschen«-Symbol. Soll ich? Ich horche in mich hinein. Der Gedanke, die Bilder nie wieder ansehen zu können, fühlt sich an, als würde jemand einen glutheißen Dolch in mein Herz bohren, um ein Stück abzusäbeln. Schnell lege ich das Handy zur Seite und trinke einen großen Schluck Wein. Ich nehme meine Schlafmaske vom Nachttisch und bedecke damit meine Augen. Ich bin noch nicht so weit.
3
»Na, ausgeschlafen?«
»Hm.«
Gabi ist ein wenig blass. Unter ihren Augen zeichnen sich dunkle Schatten ab. Oje, das sieht nach einem üblen Kater aus.
»Ich hol dir einen Kaffee.«
»Hm.«
Gabi blickt kaum auf, als ich die Tasse mit dem dampfenden schwarzen Getränk vor ihr auf dem Tisch abstelle. Sie bestreicht gerade eine halbe Semmel mit Nutella. Eine Tätigkeit, die offenbar ihre volle Aufmerksamkeit erfordert.
»Kopfweh?«
»Hm.«
»Dann war der zweite Aperol gestern wohl schlecht, oder?«
Endlich erscheint ein schwaches Lächeln auf Gabis Gesicht. Die Nutella-Semmel ist anscheinend zu ihrer Zufriedenheit bestrichen, und sie beißt hinein.
»Rührei? Riech mal, wie phantastisch der Speck duftet …«
Gabi gibt ein leichtes Würgen von sich. Das heißt wohl: eher nicht.
Ich stehe auf und gehe zum Büfett. Hach, Hotelbüfetts sind doch was Wunderbares! Wenn ich mit Michi unterwegs war, gab es morgens immer Unstimmigkeiten zwischen uns. Während er vollauf damit zufrieden war, eine Scheibe Vollkorntoast mit Butter mit einer Tasse schwarzem Kaffee hinunterzuspülen, schwelgte ich in den farbenfrohen Wurst-, Käse- und Obstarrangements und wollte einfach alles probieren. Eier in sämtlichen Zubereitungsvariationen, verschiedenste Müslimischungen, Marmeladen, raffinierte Aufstriche, entzückende Küchlein, frisch gepresste Fruchtsäfte, in Schokoladensoße ertränkte Windbeutelchen, knusprige Semmeln, fluffiges Weißbrot, kunstvoll verzierte Melonenscheibchen, Ananas, Mango und Apfelstückchen. An der Tiefe der Furche auf Michis Stirn konnte ich in etwa ablesen, wann es Zeit war, das Besteck zur Seite zu legen. Heute habe ich kein vorwurfsvolles Stirnrunzeln im Genick, darum nehme ich mir Zeit. Ein Scheibchen Lachs liegt bereits auf meinem Teller. Ich kleckse einen kleinen Tupfer Meerrettich daneben und dekoriere das Ganze mit einem Petersiliensträußchen.
Während ich eine Scheibe Toastbrot durch den Röster schicke, wandert mein Blick durch den Frühstücksraum. Jeder Platz scheint besetzt. Es herrscht gerade Hochbetrieb im Hotel Oachkatzlhof. Es gehört Gabis Bruder Alois, aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb Gabi und ich hier jedes Jahr ein paar Freundinnentage verbringen. Das Hotel punktet neben der Verwandtschaftsbeziehung mit einer traumhaften Lage im Bayerischen Wald, einem phantastischen Wellnessbereich und einer hervorragenden Küche. Und einen Ironman a. D. als Poolnudel-Trainer hat schließlich auch nicht jeder.
Michi und ich sind immer in Adults-only-Häusern abgestiegen. Es war ihm wichtig, seine Vollkornbrotscheibe nicht in Anwesenheit von plärrenden, herumrennenden Kindern verzehren zu müssen, die das Muffinkörbchen plünderten und sich mit Tomaten bewarfen. Und noch wichtiger: Er wollte keine Belästigung durch keifende Eltern, die ständig damit beschäftigt sind, Klein Jolanthe und Pierre-Elvis davon abzuhalten, alle vorhandenen Brötchen auszuhöhlen, weil das Innere viel besser schmeckt als die Kruste. Ich habe nichts gegen Kinder, kann aber durchaus auf den Anblick von Gurkenstiften in Nasenlöchern verzichten, weshalb ich mit dem Arrangement auch immer sehr zufrieden war. Ich habe sowieso nie verstanden, weshalb sich die Gemüter an dieser Adults-only-Diskussion stets so erhitzen. Mal ehrlich: Diejenigen Häuser, die beschließen, sich auf erwachsene Gäste zu beschränken, sind in der Regel ohnehin selten mit einem Outdoor-Funpark inklusive Superbuddelsandkiste, extralanger Wellenrutsche und XXL-Trampolin ausgestattet und bieten weder Ponyreiten noch T-Shirt-Malaktionen an. Hätte ich Kinder, würde ich vermutlich kein Hotel in Erwägung ziehen, das beim Abendbüfett Schalentiere, exotisch gewürzten Gemüsepamp, Tintenfischringe oder gar Rosenkohl auftischt anstatt einer großen Schüssel Pommes mit Ketchup. Aber »Du darfst hier nicht rein« hört wahrscheinlich niemand gern. Und schon gar nicht, wenn der Grund dafür die entzückende kleine Amelie-Rose ist, die sich stets tadellos benimmt und für ihr Leben gern Rosenkohl mit Schalentieren isst.
Hier im Frühstücksraum des Oachkatzlhofs sehe ich einige Kinder, aber soweit ich es erkennen kann, hat keines davon Gurkenstifte in der Nase. Auch fliegende Tomaten sind nicht zu sehen.
»Guten Morgen«, höre ich plötzlich eine Stimme neben mir, ungefähr in Höhe meines Ellbogens.
Ich senke den Blick. Ein Mädchen. Mangels Erfahrung tue ich mich schwer, das Alter von Kindern einzuschätzen. Fünf Jahre vielleicht? Zwei blonde Zöpfe stehen links und rechts von ihrem Kopf ab. Sie sieht sehr niedlich aus in ihrem hellblauen Kleidchen. Auf der Brust ist ein Bild aufgedruckt von der … der Blonden aus dem Disney-Film. Der, die dauernd alles einfriert und dabei singt.
»Ich weiß, wer du bist«, flüstert sie verschwörerisch.
»Echt?« Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Die Kleine wirft einen Blick über die Schulter. Dann flüstert sie: »Ja. Aber keine Sorge. Ich sag nix.«
»Okay …«
»Ich bin die Antonia. Aber du darfst Toni zu mir sagen. Hach, wenn ich das dem Papi erzähle!« Dann fällt ihr offenbar ein, dass sie mir vor zehn Sekunden noch Stillschweigen versprochen hat. Worüber auch immer. »Dem Papi darf ich doch … Ich sag meinem Papi immer alles. Aber sonst niemandem. Ich schwöre! Auch nicht der Karlotta. Die ist eh doof. Und auch nicht dem Finn-Ole. Und auch nicht der Luise …«
Ich hebe die Hand. »Schon gut.« Mein Toastbrot purzelt aus dem Röster, und ich lege es auf meinen Teller. »Nett, dich kennenzulernen, Toni. Ich bin die …«
»Pssssst!«, fällt mir das Kind ins Wort. »Mein Papi sagt, berühmte Leute sind oft ganz arme Schweine, weil die nie ihre Ruhe haben und dauernd fotografiert werden. Aber ich sag nix«, bekräftigt sie noch einmal.
Ich habe keine Ahnung, was das Mädchen von mir will. Als Modefotografin schafft man es in der Regel weder auf Kinoleinwände noch in Hochglanzzeitschriften. Das Blitzlichtgewitter findet in der Regel vor meiner Linse statt und spart mich dabei aus. Also woher glaubt das Mädchen mich zu kennen?
»Aha. Wo ist denn dein Papi?«, erkundige ich mich.
Die Kleine blickt sich suchend um. »Er wollte sich einen Obstsalat holen. Ah, da!«
Sie deutet auf einen hochgewachsenen, etwas mageren Mann im gestreiften Poloshirt. Er trägt eine silberne Brille mit runden Gläsern, die ihm von der Nase rutscht, als er versucht, den kleinen Hebel der Milchkanne umzulegen, während er in einer Hand einen Teller mit gelber Masse – ich denke, es ist Rührei – und in der anderen eine Schüssel mit Melonenstückchen und Haferflocken balanciert. Die Milch soll wohl über die Haferflocken. Ich beobachte, wie das Rührei bei der einhändigen Bedienung des Milchhebels ebenso ins Schlingern gerät wie seine Brille, und sehe eine Riesensauerei auf seine beige Leinenhose zukommen.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen!«
Mit ein paar Schritten bin ich bei dem Mann und drücke den kleinen silbernen Hebel an der Kanne. Die Milch ergießt sich freundlich über die Haferflocken. Rührei und Leinenhose sind gerettet. Nur die Brille hängt noch etwas schief auf seiner Nase.
»Darf ich?« Ich lächle freundlich und stupse das Gestell an seinen bestimmungsgemäßen Platz zurück. Bernsteinfarbene Augen blicken mich durch silberne Ränder überrascht an.
»Äh, danke. Vielen Dank. Ich war … ich bin … also, hier ist aber auch nirgendwo Platz …«, stammelt er und macht eine hilflose Geste mit seinen beiden tellerbeladenen Händen.
»Das hätte jetzt eine ziemliche Sauerei geben können«, stelle ich lachend fest. »Aber ist ja noch mal gut gegangen. Ich bin übrigens …«
»Papiii!« Toni taucht neben ihrem Papa auf und umschlingt seine Hüfte mit den Armen. »Erkennst du sie? Erkennst du sie? Ist es nicht der Wahnsinn, dass sie hier ist? Ich bin so aufgeregt!«
Tonis Papa guckt etwas ratlos. »Spätzchen, ja … ich … äh …« Es ist ihm offenbar unfassbar peinlich, eine derart berühmte Persönlichkeit wie mich nicht zu erkennen.
»Papiiii!« Tonis Zöpfe zittern vor Aufregung. Sie nimmt meine Hand und verkündet feierlich: »Papi, das ist Schneewittchen. Ich habe sie sofort erkannt, an dem Zopf und dem käsigen Gesicht. Schau!« Sie deutet auf meinen Kopf. Unwillkürlich umfasse ich den dicken Zopf, mit dem ich mein langes schwarzes Haar zusammengefasst habe. Das Kind hält mich für eine Märchenprinzessin. Ich sollte mich wohl geschmeichelt fühlen. Immerhin hätte sie auch sagen können: »Das ist Ursula, die Meerhexe.«
»Äh, weißt du …« Wie reagiert man in so einer Situation pädagogisch wertvoll? Das Kind ist außer sich vor Freude über seine Entdeckung. Es hüpft von einem Bein aufs andere und blickt erwartungsvoll zwischen seinem Papa und mir hin und her. Darf ich dem Mädchen sagen, dass ich zwar dunkelhaarig und von eher blasser Hautfarbe sein mag, jedoch keine Bekanntschaft mit Zwergen pflege? Würde die Enttäuschung die zarte Kinderseele schädigen, sodass es später das Trauma in einem bequemen Ledersessel aufarbeiten muss, während ein älterer Herr mit Stirnglatze sich Notizen macht? Andererseits, wo kommen wir denn hin, wenn man einem Kind alles erzählt, was es hören will, nur weil es einen mit großen bernsteinfarbenen Augen – übrigens exakt die gleiche Farbe wie beim Vater – anstrahlt? Echt jetzt!
»Also, ich … weißt du … da hast du mich aber jetzt erwischt. Erzähl es bitte nicht weiter, okay? Wenn ich nicht daheim bin, in … also im Wald … dann nenne ich mich Doro. Magst du mich auch so nennen?«
»Doro«, flüstert Toni sichtlich ergriffen. »Ja. Ja, das mach ich.«
»Spätzchen, schau mal, heute gibt es Muffins mit Schokostückchen. Hol dir doch rasch einen, ehe sie weg sind.« Tonis Papa deutet mit dem Rühreiteller in Richtung der Süßspeisenecke. Er hat meine Überforderung offenbar bemerkt.
»Oh! Ja, mach ich. Soll ich euch welche mitbringen?«
»Nein, danke«, winke ich ab. Möglicherweise werde ich mir später auch noch einen schnappen. Aber ich bin erst beim deftigen Gang. Vor dem Muffin kommen noch die Wurst-und-Käse-Platte, das gebratene Gemüse, Spiegelei mit Speck, und die verschiedenen Marmeladen muss ich auch probieren. Wenn man es recht bedenkt, ist es erstaunlich, dass der Metallic-Rock bis gestern noch gepasst hat.
»Bitte entschuldigen Sie. Meine Tochter ist gerade in einer schlimmen Märchenphase.« Tonis Papa lächelt schief und zuckt mit den Schultern. »Ich bin übrigens Cornelius Jablonski.«
Da er immer noch den Rühreiteller und die Müslischüssel jongliert, verzichte ich darauf, ihm die Hand zu reichen, und nicke ihm nur freundlich zu.
»Dorothea Schweighofer. Das -hofer ohne ö. Daher weder verwandt, verschwägert noch verheiratet.« Ich habe mir angewöhnt, der unweigerlichen Frage nach einer Verbindung mit dem Schauspieler zuvorzukommen. Die fehlenden Punkte über dem o halten viele für vernachlässigbar.
»Wie?« Cornelius Jablonski schaut mich ratlos an.
Das Gesicht des Mannes müsste man fotografieren. Wären wir in einem Comic, würde ihm eine Parade lustiger Fragezeichen um die Stirn tanzen. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung hat, wovon ich rede. In welchem Erdloch hat dieser Mann in den letzten zwanzig Jahren gehaust?
»Nun, spielt keine Rolle. Ich halte Sie nicht länger auf, sonst wird Ihr Rührei kalt.«
Ich nicke noch einmal freundlich, wende mich ab und marschiere in Richtung Kaffeemaschine. Er nickt ebenfalls und hebt die Hand, um zu winken. Das Rührei segelt schwungvoll vom Teller. Cornelius Jablonski ist anscheinend ein recht zerstreuter Zeitgenosse.
Als ich zu Gabi an den Tisch zurückkehre – das Hotelpersonal war sofort mit Lappen und Schäufelchen zur Stelle, um die Folgen des Rühreiabsturzes zu beseitigen, sodass ich guten Gewissens zur Kaffeemaschine weiterziehen konnte –, haben ihre Wangen wieder ein wenig Farbe.
»Na, geht’s wieder?«
Gabi nickt schweigend.
»Wie gut, dass wir für heute eine Wanderung geplant haben, Süße. Da kannst du deinen Brummschädel prima durchlüften.«
Gabi nimmt einen Schluck Kaffee. »Super. Da freu ich mich aber.«
Plötzlich steht die kleine Toni neben mir. Aber sie würdigt mich keines Blickes, sondern fixiert Gabi, die gerade in ihre Nutella-Semmel beißt. »Guten Morgen«, sagt sie höflich. »Ich weiß, wer du bist.«
Gabi nuschelt erstaunt durch die Schokocreme. »Escht?«
Toni nickt bedeutungsvoll. Dann stößt sie mich mit dem Ellbogen an und zwinkert.
»Madame Pottine, nicht wahr?«
»Wer …?«
Ich falle Gabi ins Wort. »Toni, du bist so ein schlaues Mädchen!«, rufe ich begeistert. Ich hebe die Hand, und die Kleine klatscht ab. Dann lege ich den Finger an die Lippen. »Hier im Oachkatzlhof heißt Madame Pottine aber Gabi. Okay? Und jetzt hol mir doch bitte rasch einen Schokomuffin.«
Toni nickt und flitzt mit flatternden Zöpfen davon.
»Entzückendes Kind«, befindet Gabi. »Aber wer zum Henker ist Madame Pottine?«
Ich tätschele Gabis Hand. »Eine Teekanne, meine Liebe. Eine freundliche sprechende Teekanne.«
4
Bedingt durch die Waldrandlage in einer Talsenke in der Nähe des idyllischen Örtchens Kleingumpertsbach, gibt es im Oachkatzlhof nur an wenigen Orten zuverlässig Mobilfunknetz. Anstatt Rabatz zu machen und bei den Behörden einen ordentlichen Sendemast einzufordern, hat Alois aus der Funklochnot eine Marketingtugend gemacht und setzt bei der Werbung für sein Haus stark auf den Aspekt des Rückzugs vor dem permanenten medialen Beschuss, dem wir uns alle tagtäglich ausliefern. Ausgehend von den Belegungszahlen des Hauses, ist die Sehnsucht nach einer Flucht vor den Krakenarmen von WhatsApp, Instagram und TikTok offenbar groß. Außer bei Teenagern − die würden vermutlich lieber eine Woche im Tierpark Hellabrunn Elefantenmist wegschaufeln, als im Oachkatzlhof ohne Handyempfang zu darben.
Gabi wartet im Park auf mich. Offenbar hat sie hier draußen, in der Nähe des Kinderspielplatzes, der ein wenig abseits auf einer Anhöhe liegt, ein paar Mobilfunkwellen aufgeschnappt, denn sie telefoniert.
»Natürlich, mein Schatz. Das ist überhaupt kein Problem. In ein paar Tagen … Na klar, das mach ich gern. Die grüne Bluse? Die mit den netten Rüschen an den Ärmeln? Die steht dir ganz wunderbar, meine Süße … Ja, Rüschen sind wirklich schwierig zu bügeln, das stimmt. Bring die Sachen einfach vorbei, Papa ist daheim … Nein, ich bin mit Doro weg … Was?« An diesem Punkt des Gesprächs wirft sie mir einen gehetzten Seitenblick zu. »Natürlich, ich frag sie mal … Ja, ich verstehe … Natürlich, du hast es eilig. Hab einen schönen Tag, mein Schatz, Bussi!«
Offenbar ist Gabis Groll über den treulosen Nachwuchs, der im Laufe der Jahre eintausend Kuchen verzehrt hat und dann einfach ausgezogen ist, verflogen.
»Schmutzwäsche?«
Gabi nickt.
»Und was sollst du mich fragen?«
»Sie überlegt, sich bei GNTM zu bewerben, und will wissen, ob du da nicht ein gutes Wort für sie einlegen kannst.«
Ich putze mir mit einem Papiertaschentuch die Nase, um Zeit zu gewinnen. Gabis Tochter Tamara ist ein entzückendes Mädchen. Sie hat die gleichen riesengroßen blauen Puppenaugen wie ihre Mutter und eine Lockenmähne, für die einige mir bekannte Topmodels töten würden. Leider ähnelt jedoch auch ihre Figur der ihrer Mutter. Die zwanzig Zentimeter, die ihr an Körperlänge für eine Modelkarriere fehlen, hat sie an Hüftumfang zu viel. Auch Photoshop hat seine Grenzen. Heidi Klum würde mir den Vogel zeigen.
»Nun …«
»Doro, ich bitte dich! Sieht das Kind auch nur im Entferntesten aus wie eines dieser verhungerten Salzstangerl, die du immer fotografierst? Da hat doch keine einen Arsch oder einen Busen! Das wäre ja wie … wie wenn man versuchen würde, einer Antilopenherde ein Nilpferd unterzujubeln.« Sie schnaubt entrüstet und lehnt sich zurück.
»Na, das ist aber jetzt ein harter Vergleich.«
»Du weißt, was ich meine«, kichert Gabi. »Wir erzählen ihr das natürlich nicht. Du weißt ja: What happens in the Oachkatzl, stays in the Oachkatzl.«
Ich bin ein Stadtmensch. Das liegt wohl daran, dass ich keine Kinder habe und ein Leben mit Apfelbäumen und Kräuterhochbeet damit keine unmittelbaren Vorzüge für mich hätte. Ein Garten auf dem Land, wo ich einen Sandkasten und ein Trampolin aufstellen könnte, wo die lieben Kleinen in der Natur aufwachsen, an einem Bächlein planschen, auf Bäume klettern oder was es sonst noch so an Bullerbü-Idyll gibt, war für mich nie ein Argument. Für mein Wohlbefinden sind ein großes Angebot an Geschäften, Restaurants, Kinos und Bars viel wichtiger. Ich finde es wunderbar, schon beim Frühstück die Wahl zu haben, ob ich zu meinem Premium-Blend-Fairtrade-Caffè-Latte, medium size mit Hafermilch, lieber einen American Creamy-Cheesecake essen möchte oder einen Triple-Chocolate-Chunk-Cookie. Ich kann jederzeit spontan ins Kino gehen, ein Museum besuchen oder mir in einem ägyptischen Restaurant beim Abendessen auf dem Boden die Kniescheiben ausleiern, wenn mir danach ist. Ich mag das lebendige Summen und Vibrieren, das man in der Stadt zu jeder Tages- und Nachtzeit spürt. Mich stören weder der Lärm noch die Lichter noch die Masse an Menschen. Ja, ich nehme sogar all die Irren in Kauf.
Gabi hat mich darauf hingewiesen, nachdem sie einen Artikel in einer Frauenzeitschrift gelesen hat. Ein Hirnforscher stellte darin die These auf, dass in einer Gruppe von einhundert Menschen immer mindestens einer psychisch gestört sei. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass ich mich tagtäglich in unmittelbarer Nähe von kranken menschlichen Gehirnen aufhalte − denn wie wahrscheinlich ist es im Umkehrschluss, dass in einer überfüllten U-Bahn-Station alle Anwesenden in einem psychisch unbedenklichen Zustand sind? Da muss nur mal einer, der mental etwas angeknackst ist, sich über seinen Einkommensteuerbescheid aufregen, Blähungen haben oder seinen toten Wellensittich betrauern − und schon wird er zur tickenden Zeitbombe.
Gabi und der Hirnforscher haben wahrscheinlich recht. Wenn ich mich in der Münchner Fußgängerzone so umsehe, dann meine ich des Öfteren, die eine oder andere geistige Unwucht zu erkennen. Andererseits bringt es ja nun wirklich nichts, aus Angst vor einer Katastrophe nicht mehr aus dem Haus zu gehen, zumal meiner Überzeugung nach die allermeisten Irren ohnehin harmlos sind. Aber gut, man kann nie ausschließen, dass der übergewichtige Typ, der bei Starbucks vor dir an der Kasse steht, es für eine grandiose Idee hält, alle Personen mit einem Body-Mass-Index unter dreißig per Pumpgun von der Landkarte zu tilgen. Es steigt ja schließlich niemand am Morgen aus dem Bett mit dem Gedanken: »Hach, heute mach ich mal was richtig Dämliches.« Im Universum des Irren wäre die Eliminierung aller Normalgewichtigen eine weltverbessernde Maßnahme, zwingend, folgerichtig und alternativlos. Meine Models wären alle verloren. Zum Glück konnte ich meinen Morgenkaffee bislang stets unbehelligt genießen, und ich hoffe darauf, noch viele weitere Jahre nur harmlosen Irren zu begegnen. Wenn man bedenkt, dass ich seit einigen Monaten selbst regelmäßig therapeutische Hilfe in Anspruch nehme, bin ich statistisch betrachtet vermutlich ohnehin selbst die eine Gestörte unter den hundert. Das ist ein beruhigender Gedanke. Vor mir muss ich nun wirklich keine Angst haben.
Obwohl oder gerade weil ich so eine überzeugte Großstadtpflanze bin, die auf Asphalt und unter Feinstaubeinfluss bestens gedeiht, genieße ich die Wanderung, zu der Gabi und ich uns heute nach dem Frühstück aufgemacht haben. Die Luft ist noch kühl und knabbert kribbelnd an den Ohrmuscheln. Die Sonne hat noch nicht in die Klamm gefunden. Der Weg führt neben dem Bach vorbei, der tosend über die Felsen rauscht.
»Warte mal, das muss ich fotografieren!«
Natürlich habe ich meine Kamera dabei. Ich habe einen großen Felsen entdeckt, dick mit einem Polster aus sattgrünem Moos bewachsen, auf dem einige Herbstlaubblätter liegen. Ein einzelner Sonnenstrahl stiehlt sich wie ein goldener Finger durch die Baumkronen und bringt die bunten Blätter auf dem weichen Moos mit seiner Berührung zum Glühen. »Wow, das sieht unglaublich schön aus.«
Gabi tritt neben mich. »Oh ja. Und schau mal dort.« Sie deutet auf ein Gestrüpp aus verblühten Sträuchern. Der Sonnenstrahl hat noch ein weiteres kleines Wunder zutage gebracht. Über tote schwarz starrende Dolden und nackte Blattgerippe hat jemand ein Vlies aus zarten Fäden geworfen, das im Sonnenlicht geheimnisvoll schimmert. Winzige Hängematten aus magisch glänzendem Gespinst schaukeln zwischen Astgabeln und neben hauchfeinen Perlenketten aus funkelnden Tautropfen. Für einen Moment bin ich sprachlos.
Gabi und ich sind nicht zum ersten Mal hier, und doch bin ich jedes Mal völlig überwältigt von der ursprünglichen Schönheit, die uns umgibt. Unser Weg führt über schroffe Steine und Wurzeln, und stets begleitet uns der Bach mit seinem Rauschen. An manchen Stellen liegt das Herbstlaub zentimeterdick auf dem Weg. Mit kindlicher Freude schlurfe ich durch die Blätter und freue mich über das knisternde Rascheln. Beim Betreten der Klamm stelle ich mir vor, dass sich hinter uns raschelnd ein magisches Tor schließt, die Asphalt-und-Feinstaub-Welt aussperrt und wir in einer Art Urwald gelandet sind. Ich wäre nicht überrascht, würde sich Indiana Jones mit einer Machete aus dem Dickicht kämpfen. Doch wir begegnen nur anderen unbewaffneten Wandersleuten mit Rucksäcken und bunter Goretex-Outdoor-Funktionsbekleidung, die alle freundlich grüßen. Wir Wanderer sind Gleichgesinnte und können uns gut leiden.
»Wie wäre es mit einem Päuschen? Das ist doch eine schöne Stelle hier«, schlägt Gabi vor, und sie hat recht. Die Böschung zum Bach hinunter ist flach und leicht zu bewältigen, und direkt am Ufer liegen einige umgefallene Baumstämme, die zum Hinsetzen einladen. Ich brauche zwar eigentlich keine Pause, aber Gabi scheint mir noch immer ein wenig angeschlagen, und wir haben ja keine Eile.
»Na klar, machen wir ein Päuschen.« Wir setzen beide unsere Rucksäcke ab, öffnen sie und holen die mitgebrachten Handtücher heraus. Diese breiten wir auf den Baumstämmen aus, ehe wir uns darauf niederlassen.
»Da merkt man schon, dass man älter wird«, seufzt Gabi.
»Nur vernünftiger«, erwidere ich mit einem Lachen. »Ein verkühlter Unterleib ist auch nicht schön, wenn du zwanzig bist.«
»Jaja. Wir waren schließlich auch mal jung, mutig, schlau und unbesiegbar. So jemand kriegt keine Blasenentzündung. Tamara würde sich wahrscheinlich lieber die Haare grün färben, als einen Rat von mir anzunehmen. Genauso arrogant wie wir damals.«
»Aber die Wäsche darfst du waschen.«
»Und bügeln.«
Wir setzen uns auf unsere vernünftige Blasenentzündungsprävention aus Frotteestoff und blicken auf das Wasser. Hier fließt der Bach langsamer. Sonnenstrahlen zaubern funkelnde Lichter auf die Oberfläche und lassen das Laub an den umstehenden Bäumen in feurigem Gold leuchten. Es riecht modrig und würzig. Ich atme tief ein und lasse die Natur wirken. Hier an diesem bezaubernden Ort mitten im Wald spüre ich nichts als Frieden und Zufriedenheit. Michi und seine Scheißsekretärin sind unendlich weit entfernt. Irgendwo am Rand meines Gehirns kann ich den Gedanken als Schatten wahrnehmen, aber er wird verdrängt von herrlichem Herbstgoldfrieden, der gerade all meine Sinne beansprucht und mich bis in den letzten Winkel mit wohliger Wärme erfüllt. Forest Bathing, geht es mir durch den Kopf. Heute gibt es ja für alles ein englisches Wort. Das heißt nicht, dass man in den Wald geht und sich nackig macht, um in ein Bächlein zu hüpfen. Vielmehr haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es für Körper und Seele heilsam und wohltuend ist, sich im Wald aufzuhalten. Kommt wohl aus Japan und hat eigentlich einen vielsilbigen Namen mit Bindestrich, aber so etwas kann sich ja westlich von Hokkaidō keiner merken, außer den Koreanern vielleicht. Die Japaner sind generell recht kreativ, wenn es um ausgefallene Freizeitaktivitäten geht. Ich meine, welche westliche Nation käme schon auf die Idee, winzige Flamingos aus Seidenpapier zu falten? Oder Reis – also vom Grundsatz her kleine weiße Körner – mit zwei dünnen Stäbchen zu essen? Beides ist mit Fast-Food-geformten Würstelfingern ohnehin schwierig umzusetzen. Die Japaner sind ein seltsames Volk, das elektronische Haustiere züchtet und rohen Fisch verspeist. Aber auch viel mehr über die Selbstheilungskräfte des Körpers weiß als wir. Sie haben den Waldspaziergang sicherlich nicht erfunden, aber sie haben ihn wohl als Erste für medizinisch wertvoll erklärt und mit einem schicken Label etikettiert. Ich finde Forest Bathing großartig.
»Weißt du, was ich bin?«, meldet sich Gabi neben mir zu Wort, nachdem wir eine Weile schweigend auf das glitzernde Wasser geblickt haben.
»Das haben wir doch schon geklärt. Eine freundliche Teekanne«, grinse ich. Gabi hat ihre neue Identität widerspruchslos akzeptiert. »Nun ja. Für das Schneewittchen fehlt mir wohl einfach die Taille«, waren ihre Worte. »Dann eben Teekanne.« Und dann hat sie zum ersten Mal an diesem Morgen herzhaft gelacht.
»Nein, das meine ich nicht«, sagt sie nun. »Doro, ich bin ein Empty Nester. Das stand neulich im Goldenen Blatt.«
»Da war ein Artikel über dich drin?«
»Nicht über mich. Aber über Frauen, die ihr Leben lang um ihre Brut herumgeflattert sind, so wie ich, und dann werden die Kinder flügge, und man hockt plötzlich vor dem leeren Nest und weiß nichts mehr mit seinem Leben anzufangen. So wie ich. Ich bin ein Empty Nester.«
Ich sage doch, es gibt für alles ein englisches Wort.
»Ach, Gabi …« Im Moment weiß ich nicht so recht, was ich erwidern soll.
Gabi und ich kennen uns seit unserer Kindheit. Wir waren Banknachbarinnen in der Grundschule in Großgumpertsbach, wir haben Poesiealbumbilder gesammelt und mit Barbiepuppen gespielt, und später haben wir Bravo-Hefte getauscht. Wir waren beide verliebt in Tom Cruise, jedoch ohne uns gegenseitig Konkurrenz zu machen – vielmehr verfassten wir gemeinsam schwülstige Liebesbriefe, die glücklicherweise nie ihren Weg in den Postkasten fanden, sondern im holzscheitbetriebenen Küchenherd von Gabis Oma vernichtet wurden. Wir rauchten unsere erste Zigarette zusammen hinter der Schulturnhalle und fanden es widerlich. Trotzdem taten wir es wieder, denn der Kitzbichler Herbert und seine Kumpels waren auch regelmäßig dort. Im Gegensatz zu Tom Cruise wohnte der Herbert im Dorf und konnte vor Ort durch cooles Verhalten beeindruckt werden. Glimmstängel waren dazu auf jeden Fall besser geeignet als Poesiealben.
Gabi lernte ihren Uwe bei einer Kellerparty kennen. Auf jeder dieser Partys kam es irgendwann, wenn genug Alkohol in Form von Cola-Weizen und Baileys geflossen war, zur unvermeidlichen Schieberrunde. Wir alle hatten »La Boum« gesehen und wussten, was zu tun war. Sobald die ersten Klänge von »Dreams Are My Reality« aus den Boxen kuschelten, wurde die wilde Hopserei auf der Tanzfläche eingestellt und paarweise angekoppelt, um unter der Andeutung einer Tanzbewegung in inniger Umarmung ein wenig hin- und herzuschaukeln. Danach kam meist »Careless Whisper«, und danach musste man schnell sein, wenn man einen der begehrten Plätze auf den Sofas ergattern wollte.
Uwe und Gabi waren schnell, verlagerten ihre Zärtlichkeiten aber bald an lauschigere Orte als die Partykeller anderer Leute, und vermutlich wurde vor dem Knutschen auch nicht mehr viel getanzt. Dafür traten sie recht zügig vor den Traualtar. Ihre Kuschelstunden im bausparvertragsfinanzierten Eigenheim, das die beiden in Uwes Heimatgemeinde Bodenmais errichteten, brachten eine großartige Tochter hervor.