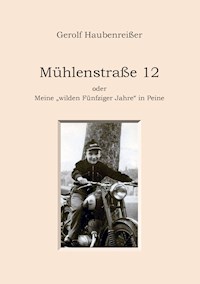Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie in seinem Erstlingswerk „Mühlenstraße 12“ nimmt Gerolf Haubenreißer den Leser humorvoll mit auf eine Zeitreise in das Wirtschaftswunder der 50er und diesmal auch 60er Jahre. Erneut erhält man einen satirischen Einblick in eine denkwürdige Epoche mit Huckepott, Tütenlampen, Elvis Presley und Konrad Adenauer. Oma und Opa sind wieder die zentralen Figuren. Die „perfekte“ Aufklärung aus dem ersten Buch kann endlich „erfolgreich“ umgesetzt werden. Ganz nebenbei beginnt eine „unglaubliche“ Fußballerlaufbahn und die Liebe…..zum Peiner Freischießen. Es beginnt aber auch der Ernst des Lebens mit der Lehre bei der Kreissparkasse und dem Wehrdienst bei der Bundeswehr, aber ganz so ernst wird es dann doch nicht…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerolf Haubenreißer
Neues aus der Mühlenstraße
Books on Demand
Über das Buch :
Die „Mühlenstraße“ zum Zweiten! Wieder hat Gerolf Haubenreißer seine Kindheit und Jugend in der „Wirtschaftswunderzeit“ aufgegriffen. Erneut erhält der Leser einen satirischen Einblick in eine denkwürdige Epoche zwischen Huckepott, Tütenlampen und Konrad Adenauer. Opa und Oma sind wieder die zentralen Figuren. Allerdings kommt diesmal die „erste Liebe“ etwas dazwischen. Die „perfekte“ Aufklärung aus Buch 1 kann endlich „erfolgreich“ umgesetzt werden. Ganz nebenbei beginnt eine „unglaubliche“ Fußballerlaufbahn und die Liebe…zum Peiner Freischießen. Es beginnt aber auch der „Ernst des Lebens“ mit der Lehre in einem Peiner Kreditinstitut und der Bundeswehr. Aber ganz so ernst wird es dann doch nicht…
Über den Autor :
Gerolf Haubenreißer, 1944 in Peine geboren, ist als "Unruheständler" freier Mitarbeiter der Peiner Allgemeinen Zeitung, wo seine Kolumne "Haubenreißers Verse" zu lokalen Ereignissen erscheint.
Weitere Untaten:
Im gleichen Verlag erschien bisher „Mühlenstraße 12 oder meine wilden Fünfziger Jahre in Peine“. Ein liebenswerter Rückblick auf eine „bewegte“ Kindheit. Zur Lektüre des vorliegenden Buches unbedingt ein Muss!
Außerdem „Gebrauchte Verse oder Verse, die keiner braucht“. Eine satirische „Lebenshilfe“ in Versen zu den kleinen Tücken des Alltags.
Inhaltsverzeichnis
Ein Vorwort
Also los, auf geht’s!
Sie hat mich wieder!
Abendbrot und Tischsitten
Bettgeschichten
Waldi und die Feuerbestattung
E-ri-ka
Onkel Gerd und ein übles Foul
Hühnerfreuden
Jungs und Mädchen
Huckepott und die Schlüpferfrage
Die Hühner picken!
Turngeräte
Gewitter
Unser Wilhelmsplatz und ein Stier aus Argentinien
Einmal Kurzschnitt bitte!
Knüppels Mühle
Adventskalender und Meister Hämmerle
Disziplin und Prügeleien
Gliesecken und Spinnenfußball
Sylvester
Else
Zeitungswesen in der Butze
Dias ohne Ende
Underberg
Thilo
Suchdienst, heile Schlagerwelt und Olympia
Spaghetti ? Gesundheit!
Adenauer
PSV 04
Weltmeister in der Mau Mau Siedlung
Feiern und Frieren in der „Mau Mau“
Marianne und Gold für Deutschland
Lesemappen und Soraya
Radio
Die Pise
Benehmen
Kennedy und alles aus Amerika ist gut!
Möbel und „Küchenhilfen“
Abschied von der Mau Mau
Das „Dauphinchen“ und andere Autos
Omas Fernseher
Heute bleibt die Küche kalt
Unsere „Pauker“
Klassenmischmasch und ein Lloyd
Der HSV beim VfB
Fußball…und kein Ende
Die hoffnungsvolle Jugend und ein Sheriff
Ilse und das Hähnchen
Die Geschichte vom Ledersessel
Die Hollandsmühle
Um Acht bei Korbmacher… und eine Verfolgungsjagd
Die Losewurstparty
Auslandserfahrungen
Freischießenfieber?
Jetzt geht`s los!
Veränderungen
Freischießen bis zum Ende
Am Kanal
Stederdorf
Willy Kipar und das Talent
Gadenstedt
Die Kreidler und andere „Unfälle“
Lieben – aber wie?
Ein freudiges Ereignis
Krumm – und sonstige Finger
Ladeschalenbodenstückverbindungsbolzen
Todendorf
Wieder mal Hühner!
Unser Spieß
Hochzeit und ein neuer Erdenbürger
Das Ende
Ein Nachwort
Ein Vorwort
Sind Sie auch schon mit dem Gefühl aus dem Supermarkt gekommen, mit Sicherheit mal wieder was vergessen zu haben? Sie wissen nur nicht genau was, aber nach und nach dämmert es. Genauso ging es mir mit meinem Buch „Mühlenstraße 12“, das seit drei Jahren die Peiner mehr oder weniger bei Laune hält.
Vieles fiel mir danach noch ein. Sehr viele Erinnerungen kamen aber auch bei Lesungen und den anschließenden Diskussionen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Denkanstöße und Anregungen ohne Ende, für die ich Ihnen sehr dankbar bin. Dazu immer wieder die Frage nach einer Fortsetzung. Es gibt sie hiermit!
Vorher muss ich aber noch ein paar Dinge aus der „Mühlenstraße 12“ korrigieren. Sie merken aber auch Alles!
So hieß der Fischladen an der Bahn damals nicht „Nordsee“ sondern „Weserländer Fischhalle“ und die berühmte Kneipe daneben hieß nicht Stadtschänke, sondern Stadtklause. Marlies Pöttke in der Mühlenstraße war nicht die Tochter, sondern die jüngere Schwester von Frau Pöttke und Frau Wiechert hieß richtig Wiegert. Die Kloake längs der Horstkippe ist nicht mein geliebter alter Bach an unserem Garten. Der lag ein Stück davor und ist inzwischen ganz einfach verschwunden. Man möge mir verzeihen!
Es gab bei den Lesungen aber auch denkwürdige Begegnungen. Frau Wiegert von → entpuppte sich als Oma von Marianne Müller, Ehefrau von Werner Müller aus dem Kollegium des VJP. Peterlein, der „schmucklose Knabe“ von → hatte sich bei einer Lesung in einen netten älteren Herren verwandelt, mit dem ich mich auf Anhieb prächtig verstand. Mit meiner Tanzstundenpartnerin vom Abschlussball schmeckte nach vielen Fußtritten vor 50 Jahren heute sogar ein Gläschen Sekt. Von meiner ersten Liebe „Tante Inge“ von → bekam ich durch eine Mitschülerin, die auch in Braunlage gewesen war, das angesprochene Bild im Bikini. Lisa, mein „erster Kuss“ auf → war die ältere Schwester unseres letzten ersten Vorsitzenden im MTV und gleichzeitig Cousine von Hans Walter Glanz, meinem alten Fußballkumpel. Nach und nach meldeten sich fast alle Personen aus dem Buch und das Schöne: Es war niemand beleidigt! Auch das hat mich zu dem vorliegenden zweiten Buch zur Mühlenstraße ermutigt.
Einiges aus dem ersten Band der Mühlenstraße musste ich zum besseren Verständnis dieses Buches kurz wiederholen oder nochmals ansprechen. Ich hoffe, das macht nichts.
Die Mühlenstraße verfolgt mich nun schon 3 Jahre. Lesungen über Lesungen. Seniorenkreise, Sportvereine, Kleinkunstbühnen, Geburtstage, Seniorenheime, Landfrauen aller Art, Heimatvereine, Sozialverbände und, und, und. Schließlich landete das Büchlein, das eigentlich für Kinder und Enkelkinder gedacht war, sogar mit Erfolg auf der Frankfurter Buchmesse. Die Mühlenstraße wurde nachträglich wieder ein Stück von mir.
Also los, auf geht’s!
Sie hat mich wieder!
So habe ich mich immer wieder dabei ertappt, mit dem Auto öfter als nötig in die Theodor Heuss Straße (so heißt das heute) zu fahren. Wie ein Kater streiche ich um das alte Haus, um Erinnerungen aufzusaugen. Die Hausnummer ist kaum noch zu lesen. Leere Fenster blicken mich an.
Hier wohnt schon lange keiner mehr, doch plötzlich meine ich zu hören, wie ganz oben im Erker ein Fenster auffliegt und die markige Stimme meiner Oma dröhnt in breitem Sächsisch durch die ganze Straße: „Gääääärolf!!!!!“
Wahrscheinlich ist der Tisch zum Abendbrot fertig! In Gedanken fliege ich die zwei Treppen rauf. Da sitzen sie alle um den alten weißen Küchentisch. Opa hat eben noch seinen Hannemann – Priem (Kautabak) in das Loch bugsiert, wo eigentlich der Auszug reingehört. Den wird er nachher wieder genussvoll weiterkauen oder vergessen, bis jemand schwarze Finger davon bekommt.
Abendbrot und Tischsitten
Omas mächtiger Busen liegt schon halb auf dem Tisch. Auf dem Kittel hat sie die Speisekarte der ganzen Woche, wie Opa immer sagt. Man sieht genau, was es die letzten Tage zu essen gab. Etwas Grüne-Bohnen-Eintopf, ein Klacks Steckrüben und eine Prise Magermilch prangen auf dem komischen Muster mit den verschlungenen Ornamenten. Eine Hausfrau ohne einen solchen Kittel war damals fast undenkbar. Majestätisch sitzt sie da am Tisch, schließlich hat sie ja hier das Sagen!
Mit dem Zeigefinger wird die Restfamilie eingewiesen: Da ist Margarine, da Käse, da ist Leberwurst, da ist der Fleischsalat von letzter Woche, der muss zuerst weg! Wie immer, bleibt der Zeigefinger kurz darin hängen und wird genüsslich abgeschleckt. Ein ganz kleiner Spritzer landet auch am Busen, direkt neben den Steckrüben.
Ich darf neben Mutti sitzen. Ich hänge sehr an ihr, mit ihrem blassen, ungeschminkten Gesicht und der schlichten Nachkriegsfrisur. Wasserwelle – was immer das war. Wasserwellen kannte ich eigentlich nur aus der Badeanstalt.
Immer wieder hatte mir Mutti erzählt, dass wir sehr dankbar sein müssten, weil Oma und Opa uns aufgenommen hatten. Bei Vati in Greiz habe es kräftig Prügel gesetzt, mein Nasenbein hat immer noch einen leichten Knick nach links.
Schräg gegenüber sitzt Werner, der jüngere Bruder meiner Mutter. Wir drei lagen alle 10 Jahre auseinander, wodurch man sich die Geburtsjahre leicht merken kann. Werners Mähne wird durch eine Haarspange gehalten. Ansonsten sieht er fast aus wie ich, auf Fotos wird man sich später streiten, wer von uns beiden da abgelichtet ist. Dunkle Haare, dunkle Augen, Oma drohte mir immer mit der Abschiebung an die Zigeuner, wenn ich was ausgefressen hatte. Am Zigeunerplatz mussten wir immer vorbei, wenn wir zu unserem Garten an der Rosenthaler Chaussee wollten.
Werner hat sich mal wieder die Hände nicht gewaschen, was ihm einen Klaps von Oma an den Hinterkopf einbringt. Laut Opa wird dadurch das Denkvermögen erhöht. Bei mir hat das aber nichts gebracht.
Ich erhielt bei solchen Gelegenheiten meist Prügel mit der Rückseite des Handfegers. Oma war die Erfinderin des heutigen Rap – Gesanges. Im gleichen Rhythmus kam: „Musst – du – eigentlich – immer – alles – kaputt - machen?!“ Zum Glück schluckte das meiste später meine Lederhose. Man gewöhnt sich an alles!
Opa hat das Brot wie immer zentimetergenau mit dem Messer geschnitten, eine Brotmaschine brauchten wir nicht, das war Opa. Von seinen Scheiben schneidet er sich die Rinde ab, weil er Probleme mit den Zähnen hat. Darauf darf ich mir etwas Margarine schmieren. Ein Genuss!!
Ich frage, nachdem ich ausgekaut habe, ob ich mir noch eine Scheibe Brot mit Leberwurst machen könne. „Aber nicht so dick, die muss noch die Woche reichen!“
Ich muss mich heute noch zurückhalten, wenn sich meine Kinder und Enkel die Wurst doppelt aufs Brot legen. Tomaten ohne Brot zu essen, bekomme ich immer noch nicht ohne schlechtes Gewissen hin. Man hat das halt so drin. Eine Scheibe Wurst ohne alles hätte ich nur in Verbindung mit dem Handfeger bekommen.
Die rechte Hand hält das Brot, die linke liegt direkt neben dem Abendbrotbrett. Andernfalls wird das Denkvermögen erhöht (Hinterkopf). Oma selbst nimmt das nicht so genau, schon tropft wieder etwas Fleischsalat Richtung Busen. Ich muss lachen, worauf sich ihre Hand bedrohlich dem Hinterkopf nähert. Nochmal Glück gehabt!
Werner kaut schon länger auf seiner Scheibe rum. Schon geht Omas Hand in die andere Richtung. „Da waren die Augen wieder größer als der Magen“, meint Opa. Werner würgt etwas und schielt dabei nach Omas Pranke. „Kau jetzt mal linksrum“, rät Opa. Das hilft tatsächlich, Omas Hand landet wieder auf dem Tisch. Bei Mutti ist sie zum Glück etwas großzügiger.
Tischgespräche gibt es nicht, bei Tisch wird nicht geredet. Einzige Ausnahme ist ab und zu Oma selbst. Schließlich sind alle fertig, eher darf keiner aufstehen, auch Mutti nicht. Das Denkvermögen wurde zum Glück nicht gefördert. Wie auf Kommando reden nun alle durcheinander, man war ja auch so lange still. Schließlich hat Oma wieder die Oberhand.
Aber Opa kontert diesmal. Ich beobachte noch wie er das Gewicht auf eine Seite legt und schon knattert es, dass die Gardinen flattern. „Williiiiiee!“ tönt Oma. Opas Gesicht wirkt entspannt „Watt mutt. dat mutt“, ist sein Kommentar.
Gemeinsam wird der Tisch abgeräumt und endlich das Fenster geöffnet. Das wurde aber auch höchste Zeit, sonst hätten die Lebensmittel gelitten. Jeder hat beim Abräumen seine feste Aufgabe und so geht das Ruckzuck.
Ich bewunderte Opa sehr. Er hatte zwar nicht viel zu melden, aber wir beide verstanden uns blind. Vielleicht war es auch die Verbundenheit der Unterdrückten.
Bettgeschichten
So war ich also damals nach einer kurzfristig gescheiterten Ehe meiner Mutter wieder in Peine gelandet, in der Wohnung, wo ich 3 Jahre zuvor auch auf der Durchreise geboren wurde. Schon komisch.
Für den Übergang, der dann aber fast ein ganzes Jahr dauern sollte, brachte man mich auf der hölzernen Ritze des Ehebetts meiner Großeltern unter, die man mit einigen Decken ausgepolstert hatte. Meist bekam ich es mit, wenn sie das Nachtlager aufsuchten. Opa pladderte dann ziemlich lange noch in einen ollen Zinkeimer, Oma setzte sich drauf und es zischte mächtig. Den Eimer durfte ich dann morgens im Plumpsklo auf dem Hof entsorgen.
Meist begannen sie noch auf dem Eimer das abendliche Gespräch. Oma setzte sich auf ihre Bettseite. Ich blinzelte und sah auf ihren mächtigen Busen, den das Nachthemd kaum in den Griff bekam.
Oma hatte schwarze Haare, die an den Enden schon etwas grau wurden. Links und rechts vom Mundwinkel sprossen Borsten. Die wuchsen als Inselchen wie winzige Tuschpinsel.
Ihren Dutt auf dem Kopf hatte sie aufgelöst und zu einem langen Indianerzopf geflochten, der fast bis zu ihren gewaltigen Hinterteil reichte. Auf dem Kopf hatte sie eine Nachthaube aus Spitze und sah irgendwie aus, wie eine Braut beim sechsten Fehlversuch.
Daneben lag auf einem Stuhl ihre Unterwäsche. Ein in sich gemusterter Hüftpanzer und oben drauf ein Stoffstück, das ich lange für eine doppelte Einkaufstasche hielt, das aber dazu diente, ihre gewaltigen Brüste zu verstauen, wie ich durch Blinzeln gesehen hatte.
Opa saß auf der anderen Seite ebenfalls in einem wallenden Nachthemd, das oben tatsächlich einen rot bestickten Kragen hatte. Das hat er mir viele Jahre später dann mal nach langem hin und her zu einer Faschingsfeier geliehen. Aber das nur nebenbei.
Opa war von hagerer Gestalt und hatte auf dem Kopf nur noch wenige Haare, die aber immer ordentlich gekämmt waren. „Opa hat keine Haare, er hat Federn“, meinte ich immer.
Ich wusste, was nun kam. Es knatterte noch mal kräftig und ich bekam einen deftigen Landgeruch in die Nase. Opa ließ seinen Blähungen stets freien Lauf.
„Williiiiee!“ kam es vorwurfsvoll von Oma.“Watt mutt, datt mutt!“ kam es zurück. Krampfhaft hielt ich die Augen geschlossen, auch wenn das jetzt sehr schwer fiel.
Nun rollte man sich wie auf Kommando in die Molle, was für mich mit einigen Erschütterungen verbunden war. Jetzt bloß nicht die Augen aufmachen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt.
Endlich war es so weit: Über mich hinweg grabschte er Oma nochmal an ihren Busen. Das Sexuelle stellten sie dann aber doch zurück, obwohl Opa da noch sehr aktiv war, wie ich sehr viel später von meiner Mutter einmal erfuhr.
Stattdessen gab es dann Krisengespräche, wobei es meist um Mutti und mich ging. Ich hörte gespannt zu. So erfuhr ich einiges über meine Mutter, was ich eigentlich nicht wissen sollte. Immerhin war von meinem Verkauf an die Zigeuner keine Rede mehr, man schien mir wirklich wohlgesonnen und ich baute die Erkenntnisse der Nacht in den nächsten Tageablauf ein. Oft wunderten sich Oma und Opa: „Woher weiß der das?!“
Waldi und die Feuerbestattung
Mein einziges Spielzeug, das die Flucht aus Greiz überstanden hatte, waren mein Teddy Brummel, meine Puppe Christel und mein Holzdackel Waldi.
Brummel war wohl mal von orangener Farbe gewesen, nun aber ziemlich abgenutzt, grau und glatt. Er brummte nur noch selten, aber ich vertraute ihm alles an. Er erzählte auch nichts weiter und war daher mein bester Kumpel.
Bei Christel war ich da schon vorsichtiger, schließlich war sie ein Mädchen. Sie war ganz aus Stoff, auch der Kopf, auf den man notdürftig ein Mondgesicht gemalt hatte. Dass sie überhaupt ein Mädchen war, konnte man nur wegen der Kleidung vermuten. Ich kannte mich da noch nicht weiter aus, was sich aber noch ändern sollte.
Waldi war nun ein absolut seltenes Stück. Der Holzdackel bestand aus drei Teilen, dem Kopf, dem Bauch und dem Schwanzstück. Die drei Holzteile waren durch Gummi verbunden. Er lief auf vier Holzrädern und hatte vorne eine lange Schnur, an der ich ihn hinter mir herziehen konnte. Durch das Gummi machte er nun schlangengleiche Bewegungen. Irgendwelche Gesichtszüge oder gar Farben waren schon längst nicht mehr zu erkennen. Nur Holz und Gummi! Er war wohl auch schon ein altes Erbstück. Ich zog ihn nun ständig auf der Straße hinter mir her, was mir bald den Namen „Der mit dem Dackel“ einbrachte (Nicht zu verwechseln mit „Der mit dem Wolf tanzt“).
Meist hatte ich dazu meine blaue Stoffhose an, die geliebte Lederhose kam erst später. Darunter trug ich tatsächlich ein Leibchen, an dem lange braune Strümpfe befestigt waren. Marlene Dietrich ließ grüßen. Ein Strumpf hing dabei meistens auf halb Acht. Zusammen mit Waldi gab das ein Bild, wie ich es später nur in Heinrich Zilles berühmten Berliner Skizzen gesehen habe.
Irgendwann meinte meine Regierung, dass ich nun schon zu alt wäre, immer mit einem Holzdackel rumzulaufen. Von den altertümlichen Strapsen sprach man nicht. „Die ganze Straße lacht schon über dich!“ Ich hing aber am Althergebrachten, eine Neigung, die ich heute noch habe. Es gab nun abends ellenlange Gespräche, die absolut keine Einigung brachten. Ich wollte meinen Waldi und schlug vor, lieber die Strapse abzuschaffen.
Schließlich nahm ihn mir Oma einfach weg und Waldi bekam trotz lautstarkem Protest eine Feuerbestattung im Küchenofen. Ich habe dazu fürchterlich geheult. So hart waren die Zeiten, von Psychologie keine Spur!
E-ri-ka
So war das pralle Leben in der Mühlenstraße! Neuerdings gehörte nach dem Essen ein melodischer Pfiff dazu, den wir draußen von der Straße hörten.
„E-ri-ka“ aus dem gleichnamigen Landserlied gerade vergangener Zeiten. „Auf der Heidi blüht ein kleines Blümelein (trapp, trapp, trapp), und das heißt (trapp, trapp, trapp) E-ri-ka“. Solche Dinge waren auch nach dem verlorenen Endsieg noch in Fleisch und Blut. Erika hieß nun auch meine Mutter.
„E-ri-ka“ pfiff es also draußen und Mutti bekam einen hochroten Kopf. Sie sah Oma unsicher an. „Nu mach schon!“ kam es mütterlich zurück und schon verschwand mein graues Mütterlein in der kleinen Küche, ein kleiner Raum mit Schräge im Anschluss an die große Küche. Darin befand sich der einzige Wasserhahn mit kaltem Wasser und tatsächlich auch ein Spiegel. Auf der Fensterbank stand immer eine Flasche 4711, die nun wohl zum Einsatz kam.
Schon sprintete sie in ihre kleine Eckkammer, die sie zusammen mit Werner bewohnte und kam in einem bunt bedruckten Kleid zurück. Bis auf die Lippen war sie völlig ungeschminkt. Sie hatte in der Richtung auch gar nichts. Dennoch bemerkte Oma: „Muss das denn sein mit den Lippen, was sollen die Leute denken?“
Schon ertönte wieder der Pfiff, nur etwas lauter und fordernder „Erika!“ Man wird jetzt fragen, warum der junge Mann, denn um einen solchen handelte es sich wohl, nicht einfach klingelte? Ganz einfach, in unserem Haus gab es unten keine Klingeln. So musste man halt pfeifen. „Erika“ wurde übrigens später unser „Familienpfiff“.
Meine Mutter kam also in voller Montur zurück, ich erkannte sie kaum wieder. „Gerolf, guck mal, ob meine Nähte gerade sitzen!“ Ich bestaunte ihre dünn bestrumpften Beine und ließ sie aus lauter Bosheit noch ein wenig an den Strümpfen zuppeln, obwohl die Nähte gerade saßen. Dünn bestrumpfte Frauenbeine haben auf mich bis heute ihren Reiz, vielleicht wurde das eben geboren.
Ich bekam nun noch einen feuchten Kuss auf die Wange, der zum Jubel der Mitbewohner einen knallroten Fleck hinterließ. Ich rubbelte verstohlen daran rum und bekam nun sogar rote Finger. So kannte ich mein Mütterlein gar nicht.
Schon rannte sie auf flinken Füßen die Treppe runter wie im Stakkato. Die alte Holztreppe schluckte auch keinerlei Ton. „Frisch gebohnert!“ brüllte Oma noch hinterher und „Nimm den Hausschlüssel mit!“ „Hab ich!“ kam`s zurück. Mit dem Riesending von Hausschlüssel war wohl Muttis kleine Tasche auch voll. Nach Neun Uhr wurde unser Haus abgeschlossen und Mutti wäre nicht mehr reingekommen. Eine Klingel gab es ja nicht.
Wer da wohl war? Natürlich ging ich nachgucken und flitzte in die gute Stube, wo man vom Fenster die ganze Straße überblicken konnte. Da stand doch tatsächlich ein fremder junger Mann mit Hut und pfiff schon ein drittes Mal „Erika!“ Durch den Hut konnte ich aber von oben nicht viel erkennen.
Schon schoss mein Mütterlein aus der Tür und sprang dem Kerl an den Hals. Dabei lag sie fast waagerecht in der Luft. Ich wusste gar nicht, dass meine Mutter turnerisch so begabt war. Vielleicht war das aber auch vom BDM übergeblieben…
Onkel Gerd und ein übles Foul
Notgedrungen stellte man mir den jungen Mann dann auch vor. Er sah fast aus wie O.W. Fischer, der berühmte Schauspieler. Mutti war richtig stolz und ich nahm mir fest vor, ihr die Freude nicht zu verderben.
Ich sollte nun „Onkel Gerd“ zu ihm sagen, was mir nur zögernd über die Lippen kam. Er hieß übrigens Gerhard Scharfe und wohnte nur ein paar Straßen weiter mit Mutter und Schwester in der Blumenstraße. In Bezug auf die Damenwelt hatte er wohl nicht den allerbesten Ruf, wie ich den Gesprächen von Oma und Mutti entnehmen konnte. Aber er sah schon toll aus!
So hatte ich nun zu meinen vielen Tanten auch einen Onkel dazubekommen. Männer waren damals durch den Krieg ziemlich rar geworden und so bemühte sich die ganze Familie sehr um Onkel Gerd. Mir wurde eingebläut, ja nett zu ihm zu sein, so eine Gelegenheit käme nie wieder. Andernfalls stellte man mir den Handfeger in Aussicht.
Zum „Beschnuppern“, wie Oma sagte, plante man eine Radtour zur Horstkippe. Man hatte mir inzwischen das alte Fahrrad meiner Mutter überlassen. An den Pedalen hatte Opa dicke Holzklötze befestigt, dennoch rieb ich mir auf dem Sattel meist den Hintern wund. Ich stand mehr darauf, als ich saß. Ich putzte nun schon vorher das Fahrrad wie ein Teufel. Man wollte sich ja nicht blamieren.
Ich bestand darauf, dass wenigstens Rolf Schwertfeger mitkommen sollte, der in der Mühlenstraße 22 wohnte und mit dem ich oft spielte, wenn mein Freund Alli nicht greifbar war. Rolf war im Besitz einer richtigen Sammlung von Wiking Autos mit einem Stadtplan und Verkehrszeichen.
An sowas war bei mir nicht zu denken. Für meine drei Blechautos hatte ich nur einen selbst aufgemalten Straßenplan auf Packpapier. Rolfs Wiking Autos waren richtige kleine Modellwagen mit durchsichtigen Fenstern, die sein Vater nach Katalog für ihn bestellte. Im Laden kosteten die Dinger bis zu einer Mark und fünfzig, für mich eine utopische Menge Geld. Wie dem auch sei, Rolf kam jedenfalls zur Unterstützung mit.
Onkel Gerd war in kurzer Hose „Modell El Alamein“, die nach den Seiten mächtig abstand, meine Mutter im zweitbesten Sommerkleid.
Rolf hatte ein richtiges neues Kinderrad und war mir technisch dadurch weit überlegen. Ich rutschte auf dem Sattel hin und her, weil ich die Pedalen kaum erreichte. „Na ja Gerolf, wir werden noch ein paar richtige Radtouren machen, dann lernst du das auch noch!“ Mir lief der Schweiß, ich nickte verkniffen. „Das konnte ja noch heiter werden“, dachte ich mir.
So ging es den Madamenweg entlang, der damals noch ein Feldweg war, am Zigeunerplatz vorbei und am Berkumer Weg zur Kippe, wo wir die Räder raufschoben und uns auf einer Decke in die Sonne legten. An der Ecke hatte die Kippe einen richtigen Treppenaufgang und daneben ein kleines Häuschen, das aussah, wie ein Kassenhäuschen. „Das hat mal dem Motosportclub in Peine gehört, die hier richtige Sandbahnrennen veranstalten wollten. Daraus wurde aber nichts.“ Ich staunte, was der alles wusste! Meine Mutter hatte nun tatsächlich eine Art Bikini aus Wolle an und kicherte albern vor sich hin. Onkel Gerd hatte eine kurze Turnhose drunter und ein Unterhemd, auf dem ich sofort nach dem Reichsadler suchte. Da war aber keiner!
Rolf und ich hatten wollene Badehosen an, an Kunstfasern wie Latex war noch nicht zu denken. Die berühmten Nylonbälle gab es auch noch nicht und so hatten wir einen schwarzen Gummiball, auf dem ein gelber Fußballer abgebildet war, wie er eben die Pille aufs Tor ballert.
Davon waren wir aber noch weit entfernt und so spielten Rolf und ich „Köppen“, wobei wir uns den Ball gegenseitig auf ein Tor gegenüber köpften. Das war damals unter den Jungs allen Alters weit verbreitet. In der Badeanstalt „köppten“ sogar die erwachsenen Fußballer vom VfB, MTV und PSV 04!
Nun ging`s aber los! Onkel Gerd wollte mitspielen und schlug ein echtes Fußballspiel vor. Mein Mütterlein wurde ins Tor gestellt, Torpfosten waren die Riesenschuhe von Onkel Gerd. Rolf und ich sollten gegen ihn spielen, wobei er mich ein ums andere mal übel foulte. Mutti protestierte! „Der Bengel muss noch etwas härter werden“, hieß es lapidar.
Meiner Mutter gefiel das gar nicht, zumal sie den ollen Gummiball irgendwann von Onkel Gerd getreten aus 2 Metern direkt auf die Zwölf bekam. Damit war das grausame Spiel beendet. Onkel Gerd küsste nun tatsächlich vor unseren Augen das Auge meiner Mutter, was aber nichts nutzte. Muttis linkes Auge begann bald allerhand verschiedene Farben anzunehmen, blau, grün und sogar etwas gelb. Toll! Vielleicht sollte Mutti auch noch „härter werden“! Onkel Gerd hatte nach eigener Rechnung gewonnen und man trat mit sehr unterschiedlichen Gefühlen den Heimweg an.
Als wir die Mühlenstraße endlich wieder erreichten, wunderte sich Oma sehr über das bunt schillernde Auge meiner Mutter: „Das fängt ja gut an!“
Hühnerfreuden
Rolf Schwerdtfeger war ein lieber Kerl, aber die meiste Zeit spielte ich mit Alfred Korth aus der Gärtnerei genau gegenüber. Alli war im Gegensatz zu mir wohlgenährt und ein prima Kumpel. Wir waren unzertrennlich, wie Oma immer sagte.
Die Gärtnerei war aber auch als Spielplatz ein Paradies, wo wir uns richtig austoben konnten. Alli`s große Schwester Rosi hatte es in der Beziehung nicht ganz so gut. Sie musste oft im Haushalt oder sogar in der Gärtnerei helfen. Mädchen hatten es damals überhaupt nicht leicht.
Oft bauten wir uns aus festgestampftem Sand Rennautos, ins Cockpit kam ein Knüppel als Gangschaltung und ein verbeulter Deckel war das Lenkrad. Unter lautem Getöse fuhren wir abenteuerliche Rennen. Man ließ der Fantasie freien Lauf, wir waren rundum zufrieden, der olle Sandhaufen war die „Playstation“ von damals!
Alli besaß sogar eine richtige Muschel aus dem Meer. Hielt man sie ans Ohr, konnte man das Meer rauschen hören. Er hielt sie mir ans Ohr, aber das Meer war mir einfach kein Begriff. Es rauschte wie bei Korths Telefon, wenn man da den Hörer heimlich mal abnahm…
Alli und ich hatten in der Gärtnerei nur eine kleine Nebentätigkeit. Wir mussten die Hühner füttern und ab und zu einen Sack Hühnerfutter von Knüppels Mühle unten an der Fuhse holen.
Womit wir bei den Hühnern wären. Die lebten fröhlich in einem alten Gewächshaus ohne Glasscheiben und erscheinen mir in der Erinnerung immer noch riesengroß. Äußerlich hatten die mit den Schmachthaken in den heutigen Legebatterien nicht viel gemeinsam. Da gab es braune, weiße und sogar ein paar grau und weiß geringelte. Dazu ein prächtiger Hahn mit bunten Schwanzfedern. Sie waren wohlgenährt und fraßen alles, was man ihnen hinwarf. Hin und wieder bekamen sie von Alli auch altes Brot.
Das wäre bei uns zu Hause undenkbar gewesen. Brot wurde bei uns immer aufgegessen, egal in welchem Zustand. Selbst Schimmel wurde nur weggeschnitten, der Rest mit den Händen in kleine Stücke gerissen und in Muckefuck Kaffee mit Milch „eingeplockt“. Eingeplocktes mit Zucker war mein Leib und Magengericht.
So hatte Alli also wieder mal Brotstücke dabei und wie von Zauberhand auch eine kleine Flasche Nusslikör. Die stammte aus dem Stubenschrank seiner Eltern. Ab und zu genehmigten sich Korth`s nach getaner Gartenarbeit einen kleinen Schluck. Wir gönnten es ihnen.
Zur Sicherheit probierten wir noch etwas aus der Pulle, wir wollten den Hühnern ja nichts Schlechtes. Ich nahm einen tüchtigen Hieb. Das schmeckte prima! „Mensch, nicht so viel, ich muss die Flasche wieder zurückstellen, die dürfen nichts merken!“
Die Brotstücke wurden nun mit dem braunen Zeugs getränkt und dem Federvieh zum Fraß hingeworfen. Denen soll es auch mal gut gehen! Es war eine Freude, wie die Hühner gierig Stück für Stück aufpickten. Sollten sie doch auch mal etwas Spaß haben!
Unsere Begeisterung steigerte sich, als sich die Hühner nun nach und nach sehr drollig verhielten, bis eine ganz neue Spezies Huhn entstand: Die Flügel hingen locker bis zur Erde und der Hahn begann sogar, tänzerisch um die eigene Achse zu rotieren. Ein heiserer Dauerton kam aus dem Hals, richtiges Krähen war nicht mehr drin. Alli, ich und die Hühner hatten einen tollen Nachmittag!
Frau Korth wunderte sich abends über das merkwürdige Verhalten des Federviehs. Sie staunte, wie leicht sie sich einfangen ließen. „Vielleicht stimmt mit dem neuen Körnerfutter was nicht“, meinte sie kopfschüttelnd.
Jungs und Mädchen
Neben den fehlenden Klingeln hatte unser Haus aber noch eine andere Besonderheit. Kam man zur Haustür rein, stand man eigentlich schon bei Familie Altendorf in der Wohnung.
Gleich vom Treppenhaus und Flur ging es rechts und links direkt in die einzelnen Zimmer. Da konnte es einem schon passieren, dass man Frau Altendorf im Nachthemd begegnete.
Die Wohnungen vom Hauswirt Schwekendiek daneben, vom Ehepaar Nedel und von Frau Wiegert im ersten Stock, waren allerdings abgeschlossen und hatten Flurtüren mit Klingel.
Bei uns oben im zweiten Stock war es dann aber wieder genauso, wie bei Altendorfs. Besucher standen bei uns aus Versehen auch schon mal direkt im Schlafzimmer.
So nahmen wir notgedrungen Anteil an Altendorfs Familienleben, weil man da ja auch immer durchmusste. Omas Verhältnis zu Frau Altendorf war hin und wieder gestört. Beide Damen hatten einen leichten Hang zu Klatsch und Tratsch und so ratschte man natürlich auch übereinander. Oma hatte da wohl den größeren Anteil.
Bei Altendorfs gab es den Sohn Hartmut, der irgendwann aufgehört hatte zu wachsen. Alle Kunst der Ärzte und das Streckbett hatten nichts genutzt, Hartmut blieb halt klein, was aber seiner Beliebtheit in der Straße keinen Abbruch tat.
Dann waren da noch seine Schwestern Maren und Helga. Helga war schon etwas älter, aber Maren war so alt wie ich und so spielten wir häufig miteinander, auch wenn Oma und Frau Altendorf wieder mal Gnatsch hatten.
Maren war ein sehr liebes Mädchen und musste zu Hause viel im Haushalt helfen. Das war in den 50ern ohnehin üblich, die Mädchen wurden auf ihren Job als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Bei Maren war das aber noch etwas mehr, als bei den anderen Mädchen. Wenn sie dann doch mal Zeit hatte, spielten wir auf dem Hof. Bei uns oben war sie aber nur sehr selten, bei Altendorfs in der Wohnung war ich eigentlich nie.
Es war schon komisch, in der Meute spielten Jungs und Mädchen problemlos durcheinander, war man aber nur zu zweit, wurde das von den Erziehungstätern misstrauisch beobachtet, man konnte ja nie wissen…
Wir Jungs gingen morgens aus dem Haus, kamen nur kurz zum Mittagessen (oder auch nicht) und waren danach wieder verschwunden. Kaum jemand fragte nach dem woher und wohin und wir kamen meist erst nach Hause, wenn es dunkel wurde. Danach waren wir oft so dreckverschmiert, dass unsere Eltern uns nur mit Mühe erkannten. Ein Gerücht besagt, dass eine Mutter damals erst einen Knaben gewaschen hat, um dann festzustellen, dass er gar nicht zur Familie gehört.
Das war aber auch nicht so tragisch, weil wir keine empfindliche Markenkleidung, sondern Klamotten trugen, die heute jede Altkleidersammlung aufwerten würden.
Vor dem Essen wurde sich aber gründlich mit kaltem Wasser in einer Emaille Waschschüssel für die ganze Familie gewaschen. Warmes Wasser gab es meist nur in eingeteilter Menge im Winter.
So hatten wir Jungen Freiheiten ohne Ende, wurden aber für verhältnismäßig geringe Vergehen drakonisch bestraft, wie mir der Handfeger mindestens jeden zweiten Tag bestätigte.
Bei den Mädels war vieles anders. Ihr Aktionsradius war sehr eingeschränkt, zudem forderte die Haushaltshilfe meist viel Zeit. Gingen sie aus dem Haus, wollte man schon genau wissen, wohin und wie lange. Wir Jungen wurden zur Hausarbeit nur sehr selten eingespannt und wenn, dann sprach man nicht drüber…
Huckepott und die Schlüpferfrage
Die meiste Zeit verbrachten wir Kinder an der frischen Luft. Zu Alli in die Gärtnerei durfte ich aber meist nur alleine, obwohl das auch ein herrlicher Spielplatz für die anderen gewesen wäre.
Ansonsten vergnügten wir uns auf der Mühlenstraße. Autos rumpelten anfangs der 50er nur wenige über das huckelige Kopfsteinpflaster, obwohl die Straße neben der Autobahn die Ost-West Verbindung Hannover /Braunschweig war.
Die gegenüberliegende Seite des Bürgersteiges war bis auf die hohe Kante nicht befestigt. Immerhin war auf der Seite die Wilhelmschule, eine Werkstatt, die Villa von Dr. Kunze, die Gärtnerei, der Hydrant und am Ende der Bauer Kielhorn.
Auf unsere Seite war der Bürgersteig sogar asphaltiert, worauf wir sehr stolz waren. Es gab zwar ein paar Risse, an einigen Stellen war der Belag ausgebessert, aber die ungewollten Linien bezogen wir oft in unsere Spiele mit ein. So war unsere Seite mit Kindern bevölkert. Man spielte mit Peitsche und Kreisel, Holzreifen und lief auf Stelzen. Für unsere Rollschuhe wurde der Bürgersteig zur gefürchteten Rennbahn.
Im Winter nutzten wir die abschüssige Fahrbahn zum Schlittenfahren. Der Schnee wurde nur sehr selten geräumt. Vor Autos warnte man sich gegenseitig immer rechtzeitig: „Achtung Auto!“
Ein beliebtes Spiel war besonders bei den Mädchen der Huckepott. Wir Jungen ließen uns erst meist dazu überreden und machten dann doch begeistert mit.