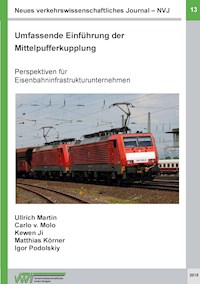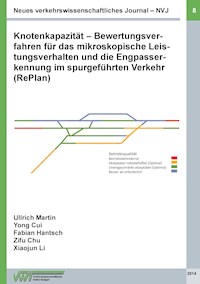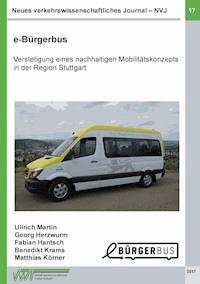
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Bürgerbusse stellen eine Form ehrenamtlicher Mobilität dar und verkehren als Ergänzung zum klassischen Öffentlichen Personennahverkehr vor allem in Gebieten, in denen weder ein herkömmlicher Linienverkehr noch flexible Bedienformen adäquate Lösungen bieten. Durch die Verknüpfung von bürgerschaftlichem Engagement und dem Einsatz der Elektromobilität entsteht mit elektrisch betriebenen Bürgerbussen ein zukunftsträchtiges Mobilitätskonzept, das den öffentlichen Nahverkehr insbesondere in ländlich geprägten Räumen nachhaltig verbessern kann. Der Forschungsbericht beinhaltet die Ergebnisse des Projekts "e-Bürgerbus", in dem ein elektrisch betriebener Bürgerbus beschafft und u. a. im realen Linien-betrieb mehrere Monate in der Region Stuttgart praktisch erprobt wurde. Der Testbetrieb wurde auf Basis einer kontinuierlichen Erfassung von Fahrtdaten evaluiert, wodurch z. B. wesentliche Einflussfaktoren auf Fahrzeugreichweite und Energieverbrauch bestimmt sowie geeignete Einsatzbedingungen für e-Fahrzeuge im Bürgerbusbetrieb abgeleitet werden konnten. Die Erkenntnisse dienen auch zur Weiterentwicklung und Verstetigung dieses Mobilitätskonzepts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Bürgerbusse sind seit nunmehr 16 Jahren auch in Baden-Württemberg eine nicht mehr wegzudenkende Ergänzung des besonders in ländlichen Räumen oftmals immer stärker ausgedünnten konventionellen ÖPNV-Angebots. Seitdem hat diese alternative Bedienungsform einen enormen Aufschwung erlebt – heute zählt Baden-Württemberg mehr als 40 Bürgerbusvereine, die durch ehrenamtliches Engagement die ÖPNV-Versorgung auch in eher schwach besiedelten Räumen sinnvoll ergänzen. Gerade vor dem Hintergrund des fortschreitenden demografischen Wandels ist auch zukünftig mit einem Anwachsen des Bedarfs nach derartigen Mobilitätsdienstleistungen zu erwarten.
Die im Bürgerbusverkehr vorliegenden verbindlich geplanten Linienverläufe und vergleichsweise kurzen Wegstrecken von etwa 100 km pro Tag bilden dabei vor dem Hintergrund der mit heutiger Technik realisierbaren Reichweiten ein attraktives Anwendungsszenario für Elektrofahrzeuge, weswegen eine Verbindung der beiden Themen Bürgerbus und Elektromobilität naheliegt. In dem hier beschriebenen Projekt „e-Bürgerbus“ konnte der erste rein elektrisch betriebene Bürgerbus mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen in Deutschland erworben, im Praxisbetrieb erfolgreich eingesetzt und unter verschiedenen Einsatzbedingungen erprobt werden. In diesem Bericht stellen wir die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Einsatzes dieses elektrisch betriebenen Bürgerbusses vor. Dabei werden neben den fahrzeugseitigen auch die für den Bürgerbusbetrieb zu berücksichtigenden Aspekte beleuchtet. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine Weiterentwicklung des Bürgerbuskonzepts mit Blick auf die künftigen Herausforderungen des Nahverkehrs in kleineren Städten und Gemeinden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Nachnutzbarkeit und Übertragbarkeit auf weitere interessierte Kommunen mit oder ohne bestehende Bürgerbusverkehre gelegt.
Ein herzlicher Dank gilt dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, welches die Durchführung dieses Forschungsprojektes durch die Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Bundesinitiative „Schaufenster Elektromobilität“ in Baden-Württemberg (LivingLab BWe mobil) im Programm NAMOREG (Nachhaltig mobile Region Stuttgart) nicht nur ermöglicht hat, sondern damit gleichzeitig auch wichtige Impulse für eine systematische Verstetigung nachhaltiger Mobilitätskonzepte im Ehrenamtsverkehr setzt. Ebenso danken wir der Landesagentur e-mobil BW für die Unterstützung in der Projektentstehung sowie der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg für die inhaltliche und organisatorische Unterstützung in der Projektarbeit. Besonderer Dank und hohe Anerkennung gilt darüber hinaus den Bürgerbusvereinen der beteiligten Anwendungskommunen Salach, Ebersbach (Fils), Uhingen und Wendlingen mit ihren ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern, die unter laufendem Betrieb in Schulungen und Praxiseinsätzen eine Erprobung unter Realbedingungen überhaupt erst möglich gemacht haben.
Als einmaliges Projekt im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität wurde abseits der viel beachteten urbanen Zentren erstmals der Einsatz eines leichten Nutzfahrzeugs für den Personentransport mit Elektroantrieb als verkehrliches Projekt in einem menschendienlichen Kontext in ländlich geprägten Räumen untersucht. Denn neben der reinen Technologieförderung gilt es, diese Technologie auch zu den Menschen zu bringen.
Stuttgart, im April 2017
Prof. Dr.-Ing. Ullrich Martin
Prof. Dr. Georg Herzwurm
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einführung
Projektziele
Vorgehensweise
Analyse Ist-Zustand in den Anwendungskommunen
4.1 Überblick Analysekriterien
4.2 Datenbeschaffung
4.3 Allgemeiner Überblick zu den vier Anwendungskommunen
4.3.1 Vergleichende Betrachtung
4.3.2 Salach
4.3.3 Ebersbach an der Fils
4.3.4 Uhingen
4.3.5 Wendlingen am Neckar
4.4 Bestehende Rahmenbedingungen
4.4.1 Vorhandenes ÖPNV-Angebot
4.4.2 Einzugsbereiche des ÖPNV
4.4.3 Konzession
4.5 Fahrzeuge
4.6 Fahrpersonal
4.7 Linienplanung
4.8 Streckencharakteristik
4.9 Fahrplanung
4.10 Fahrgastaufkommen und Fahrzeugauslastung
4.11 Finanzierung und Wirtschaftlichkeit
4.12 Optimierung der Einsatzbedingungen für den Testbetrieb
4.13 Zwischenfazit
Beschaffung eines e-Fahrzeugs
5.1 Marktanalyse zu Projektbeginn
5.2 Ausschreibung
5.3 Erprobungsfahrzeug: Plantos der German E-Cars GmbH
5.3.1 Herstellungsprozess
5.3.2 Fahrzeugspezifikationen
5.4 Ladeinfrastruktur
5.5 Laufende Marktbeobachtung und Entwicklungen
5.6 Zwischenfazit
Testbetrieb mit dem e-Fahrzeug
6.1 Vorgehen
6.1.1 Untersuchungskriterien
6.1.2 Einsatzplanung e-Fahrzeug
6.1.3 Fahrerschulungen
6.1.4 Datenerfassung
6.1.5 Datenaufbereitung
6.1.6 Datenauswertung
6.2 Ergebnisse
6.2.1 Generelle Erkenntnisse
6.2.2 Resultierende Datenbasis
6.2.3 Energieverbrauch und Reichweite des e-Fahrzeugs
6.2.4 Einfluss der mittleren Fahrgeschwindigkeit
6.2.5 Einfluss der Anzahl an Haltevorgängen
6.2.6 Einfluss der Streckentopographie
6.2.7 Einfluss der Witterung
6.2.8 Einfluss der Fahrgastanzahl
6.2.9 Gesamtbetrachtung der untersuchten Einflüsse
6.2.10 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Fazit
7.1 Geeignete Einsatzbedingungen für e-Fahrzeuge
7.2 Fahrzeugseitiger Verbesserungsbedarf
7.3 Sinnhaftigkeit des Einsatzes von e-Fahrzeugen
Ausblick
Anhang I: Datenerhebungsbogen Analyse Anwendungskommunen
Anhang II: ÖPNV-Erschließung der Anwendungskommunen
Anhang III: Verlauf der Bürgerbuslinie in den Anwendungskommunen
Anhang IV: Höhenprofile der Linien in den Anwendungskommunen
Anhang V: Lastenheft e-Bürgerbus
Anhang VI: Fotos e-Bürgerbus
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 3-1:
Detailplanung des Arbeitspakets 1 „Analyse Ist-Zustand“
Abbildung 3-2:
Detailplanung des Arbeitspakets 2 „Beschaffung e-Bürgerbus und Ladeinfrastruktur“
Abbildung 3-3:
Detailplanung des Arbeitspakets 3 „Testbetrieb“
Abbildung 3-4:
Fahrzeugbesichtigung des Ministers für Verkehr des Landes Baden-Württemberg im August 2016 (Foto: von Molo)
Abbildung 4-1:
Lage der vier Anwendungskommunen (Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 4-2:
Jahr der Vereinsgründung und Inbetriebnahme Bürgerbus
Abbildung 4-3:
ÖPNV-Erschließung (ohne Bürgerbus) Wendlingen (Stand 2015, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 4-4:
Fahrzeuge Uhingen / Salach (Stand 2015, * Anschaffungsjahr)
Abbildung 4-5:
Fahrzeuge Wendlingen / Ebersbach (Stand 2015, * Anschaffungsjahr)
Abbildung 4-6:
Linienverlauf Bürgerbus Salach (Stand 2013, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 4-7:
Höhenprofil der Bürgerbuslinie Uhingen (Stand 2013)
Abbildung 4-8:
Entwicklung des Fahrgastaufkommens der Bürgerbusverkehre in den Anwendungskommunen 2009-2013
Abbildung 4-9:
Monatliche Verteilung des Fahrgastaufkommens der Bürgerbusverkehre in den Anwendungskommunen (Bezugsjahr 2013)
Abbildung 4-10:
Verteilung des Fahrgastaufkommens der Bürgerbusverkehre in den Anwendungskommunen auf die Wochentage (Mittel 2013)
Abbildung 4-11:
Einnahmen Bürgerbusbetrieb (Bezugsjahr 2013)
Abbildung 4-12:
Ausgaben Bürgerbusbetrieb (Bezugsjahr 2013)
Abbildung 4-13:
Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben der Bürgerbusverkehre in den Anwendungskommunen 2009-2013
Abbildung 4-14:
Entwicklung von Einnahmen (inkl. weitere Einnahmen durch die Vereine) und Ausgaben der Bürgerbusverkehre 2009-2013
Abbildung 5-1:
Umgerüsteter Ford Transit der Firma Smith Electric Vehicles (Foto: Krams)
Abbildung 5-2:
Umgerüsteter Fiat Ducato der Marke ReeVOLT! (Foto: Schiefelbusch)
Abbildung 5-3:
Umgerüsteter Mercedes Benz Sprinter von German E-Cars (Foto: German E-Cars)
Abbildung 5-4:
Umgerüsteter Mercedes Benz Sprinter City 35 von EFA-S (Foto: EFA- S)
Abbildung 5-5:
e-Bürgerbus (Foto: German E-Cars GmbH)
Abbildung 5-6:
Front-, Heck- und Aufsicht des e-Bürgerbusses
Abbildung 5-7:
Mobile LIS am Fahrzeugstellplatz des Bürgerbusvereins Salach (Foto: Krams)
Abbildung 5-8:
Mobile LIS am temporären Fahrzeugstellplatz des Bürgerbusvereins Ebersbach (Foto: Maerker)
Abbildung 5-9:
FIAT Ducato-Umrüstung des Herstellers Emovum GmbH (Foto: Emovum GmbH)
Abbildung 5-10:
Volkswagen e-Crafter (Foto: Volkswagen AG)
Abbildung 5-11:
Mercedes-Benz Sprinter-Umrüstung von VDL Bus & Coach (Foto: VDL Bus & Coach)
Abbildung 5-12:
Mercedes-Benz Sprinter-Umrüstung von Kreisel Electric (Bild: team red Deutschland GmbH)
Abbildung 5-13:
Skizzen zur Umrüstung eines Nissan e-NV200 zum e-Bürgerbus (Seitenansicht und Aufsicht) (Fotos: Fibe Bus GmbH)
Abbildung 6-1:
Fahrerschulung in der Anwendungskommune Uhingen (Foto: Krams)
Abbildung 6-2:
Szene der praktischen Schulung in Ebersbach (Foto: Körner)
Abbildung 6-3:
Startbildschirm VWI-Datenlogger (Foto: Körner)
Abbildung 6-4:
Struktur der Datenauswertung
Abbildung 6-5:
Datenbasis Realbetrieb im Linienverkehr
Abbildung 6-6:
Streckenverlauf Testfahrten Stuttgart-Steinhaldenfeld (Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 6-7:
Wertespektrum Fahrzeugreichweite (Realbetrieb im Linienverkehr)
Abbildung 6-8:
Wertespektrum spezifischer Energieverbrauch (Realbetrieb im Linienverkehr)
Abbildung 6-9:
Einfluss der mittleren Fahrgeschwindigkeit auf die Reichweite am Beispiel der Route 3 in Salach
Abbildung 6-10:
Zusammenhang zwischen spezifischem Energieverbrauch und Fahrgeschwindigkeit (qualitative Darstellung für den Plantos)
Abbildung 6-11:
Einfluss der mittleren Fahrgeschwindigkeit auf den spezifischen Energieverbrauch am Beispiel der Route 1 in Ebersbach
Abbildung 6-12:
Einfluss der Anzahl an Haltevorgängen auf die Reichweite am Beispiel der Route 2 in Ebersbach
Abbildung 6-13:
Einfluss der mittleren Steigung einer Route auf die Reichweite
Abbildung 6-14:
Einfluss der Außentemperatur auf die Reichweite am Beispiel Ebersbach
Abbildung 6-15:
Einfluss der Fahrgastanzahl auf die Reichweite am Beispiel der Teststrecke Stuttgart-Steinhaldenfeld
Abbildung 6-16:
Relative Wirkung der untersuchten Einflussfaktoren auf die Fahrzeugreichweite
Abbildung 6-17:
Wirkung der untersuchten Einflussfaktoren auf die Fahrzeugreichweite
Abbildung 6-18:
Wirkung der untersuchten Einflussfaktoren auf den spezifischen Energieverbrauch
Abbildung 6-19:
Vergleich der fahrzeugabhängigen Betriebskosten je Einsatzkilometer von e- und Dieselfahrzeug
Abbildung 6-20:
Veränderung der Betriebskosten pro Jahr gegenüber Dieselfahrzeug
Abbildung 6-21:
Veränderung der Kosten pro Jahr für Betrieb und Schadstoffemissionen vor Ort gegenüber Dieselfahrzeug
Abbildung 9-1:
Datenerhebungsbogen Seite 1
Abbildung 9-2:
Datenerhebungsbogen Seite 2
Abbildung 9-3:
Datenerhebungsbogen Seite 3
Abbildung 9-4:
Datenerhebungsbogen Seite 4
Abbildung 9-5:
Datenerhebungsbogen Seite 5
Abbildung 9-6:
Datenerhebungsbogen Seite 6
Abbildung 9-7:
Datenerhebungsbogen Seite 7
Abbildung 9-8:
Datenerhebungsbogen Seite 8
Abbildung 10-1:
ÖPNV-Erschließung (ohne Bürgerbus) Ebersbach (Stand 2015, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 10-2:
ÖPNV-Erschließung (ohne Bürgerbus) Salach (Stand 2015, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 10-3:
ÖPNV-Erschließung (ohne Bürgerbus) Uhingen (Stand 2015, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 10-4:
ÖPNV-Erschließung (ohne Bürgerbus) Wendlingen (Stand 2015, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 11-1:
Linienverlauf Bürgerbus Ebersbach (Stand 2013, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 11-2:
Linienverlauf Bürgerbus Salach (Stand 2013, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 11-3:
Linienverlauf Bürgerbus Uhingen (Stand 2013, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 11-4:
Linienverlauf Bürgerbus Wendlingen (Stand 2013, Kartengrundlage: OSM)
Abbildung 12-1:
Höhenprofil der Bürgerbuslinie Ebersbach (Stand 2013)
Abbildung 12-2:
Höhenprofil der Bürgerbuslinie Salach (Stand 2013)
Abbildung 12-3:
Höhenprofil der Bürgerbuslinie Uhingen (Stand 2013)
Abbildung 12-4:
Höhenprofil der Bürgerbuslinie Wendlingen (Stand 2013)
Abbildung 14-1:
Fahrzeuginnenraum mit Einzelsitzplatzbestuhlung - Seitenansicht (Foto: Krams)
Abbildung 14-2:
Fahrzeuginnenraum mit Einzelsitzplatzbestuhlung - Heckansicht (Foto: Krams)
Abbildung 14-3:
Fahrerarbeitsplatz (Foto: Krams)
Abbildung 14-4:
Zusatzdisplay im Fahrzeuginnenraum (Foto: Krams)
Abbildung 14-5:
Motorinnenraum (Foto: Bui)
Abbildung 14-6:
e-Bürgerbus - Frontansicht (Foto: Schönhofen)
Abbildung 14-7:
Fahrzeug - Heckansicht (Foto: Krams)
Abbildung 14-8:
Seitenansicht mit Trittstufe (Foto: Krams)
Abbildung 14-9:
e-Bürgerbus und Hybridbürgerbus „ELENA“ (Foto: Krams)
Abbildung 14-10:
Laden am Betriebshof in Stuttgart (Foto: Krams)
Abbildung 14-11:
Wallbox am Betriebshof Stuttgart (Foto: Krams)
Abbildung 14-12:
Testfahrt in der Stuttgarter Innenstadt (Foto: Krams)
Abbildung 14-13:
Szene einer Fahrerschulung in Salach (Foto: Krams)
Abbildung 14-14:
Szene in der Anwendungskommune Ebersbach (Foto: Maerker)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 4-1:
Allgemeine Daten zu den Anwendungskommunen
Tabelle 4-2:
Übersicht straßengebundenes ÖPNV-Angebot der Anwendungskommunen (Stand 2015)
Tabelle 4-3:
Übersicht SPNV-Angebot der Anwendungskommunen (Stand 2015)
Tabelle 4-4:
Konzessionsinhaber in den Anwendungskommunen
Tabelle 4-5:
Charakteristik der Fahrerpools in den Anwendungskommunen
Tabelle 4-6:
Kenndaten zur Linienführung in den Anwendungskommunen (Stand 2014)
Tabelle 4-7:
Mittlere Neigung aller Steigungsabschnitte der Bürgerbuslinie in den Anwendungskommunen
Tabelle 4-8:
Kenndaten zur Fahrplanung in den Anwendungskommunen (Stand 2015)
Tabelle 4-9:
Mittlere Fahrzeugauslastung der Bürgerbusverkehre in den Anwendungskommunen
Tabelle 5-1:
Zuschlagsermittlungsverfahren
Tabelle 5-2:
Auswahl relevanter Ausstattungsmerkmale des Basisfahrzeugs Sprinter 310 CDI KB
Tabelle 5-3:
Auswahl relevanter Ausstattungsmerkmale des e-Bürgerbusses
Tabelle 6-1:
Übersicht wesentlicher Einflussfaktoren auf Reichweite und Energieverbrauch eines e-Fahrzeugs
Tabelle 6-2:
Kriterien für die Auswahl der Anwendungskommunen
Tabelle 6-3:
Einfluss der mittleren Fahrgeschwindigkeit auf Reichweite und spezifischen Energieverbrauch
Tabelle 6-4:
Einfluss der Anzahl an Haltevorgängen auf Reichweite und spezifischen Energieverbrauch
1 Einführung
Ehrenamtlich organisierte Mobilität kann einen wesentlichen Bestandteil darstellen, um in ländlich geprägten Räumen und Agglomerationen der Kernstädte das oft spärliche Mobilitätsangebot für die dort lebenden Menschen dauerhaft zu verbessern.
Bürgerbusse stellen eine Form ehrenamtlicher Mobilität dar, um Lücken im bestehenden Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu schließen.1 Dabei ist ein Bürgerbusverkehr ein „…Linienverkehr auf konzessionierten Strecken gemäß § 42 PBefG (Personenbeförderungsgesetz, Anm. d. Verf.) (…) und wird nach einem festen Fahrplan bedient. (…) Sie (die Bürgerbusverkehre, Anm. d. Verf.) fahren in Ergänzung zum klassischen ÖPNV in unterversorgten Nischen, in denen weder ein herkömmlicher Linienverkehr noch flexible Bedienformen adäquate Lösungen bieten.“ [Löcker et al. 2014] Ein wesentliches Merkmal von Bürgerbusverkehren ist darüber hinaus ein dichtes Haltestellennetz, um insbesondere mobilitätseingeschränkten Bürgern kurze Wege von und zu den Haltestellen zu ermöglichen.
Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs des Bürgerbusfahrzeugs entsteht eine in Deutschland in weiten Teilen gewünschte und politisch geförderte Form der Fortbewegung. Im Sinne eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts ist ein elektrisch betriebener Bürgerbus (e-Bürgerbus) im Spannungsfeld der Zieltrias nachhaltiger Mobilität, bestehend aus ökologischer und ökonomischer Vorteilhaftigkeit bei gleichzeitig sozialer Verträglichkeit (vgl. [Kolks/Fiedler 2003]), ein zukunftsträchtiges Mobilitätskonzept.
Eine Informationsbroschüre des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg fasst die Ziele nachhaltiger Mobilität wie folgt zusammen: „Nachhaltige Mobilität heißt, die heutigen Mobilitätsbedürfnisse in Zukunft in einer dauerhaft umweltverträglichen Weise zu gewährleisten. Dies gilt für Menschen und Wirtschaft. Zudem müssen die Mobilitätschancen benachteiligter Bevölkerungsgruppen verbessert werden.“ [MVI BW 2015b]
Bürgerbusse mit konventionellem Antrieb stellen keine Neuerung dar. Der erste Bürgerbusverein wurde im Jahr 1939 in Großbritannien gegründet.2 Der erste Bürgerbus nach heutigem Verständnis fuhr in Großbritannien im Jahr 1966. (vgl. [Löcker et al. 2014]) Nach Deutschland kam der Bürgerbus 1985 auf Basis des Vorbilds des ersten niederländischen Bürgerbusses aus dem Jahr 1977. (vgl. [Kolks/Fiedler 2003] sowie [Burmeister 2007]) Die Premiere des ersten deutschen Bürgerbusses fand am 4. März 1985 im Münsterland zwischen den Gemeinden Heek und Legden statt. (vgl. [Löcker et al. 2014], [Burmeister 2007] sowie [Schiefelbusch 2015])
2014 gab es über 260 Bürgerbusvereine im Bundesgebiet. (vgl. [Löcker et al. 2014]) Stand 2015 ist die Verbreitung mit ca. 120 Bürgerbusvereinen in Nordrhein-Westfalen am größten, gefolgt von mehr als 40 Bürgerbusvereinen in Niedersachsen und je ca. 30 Initiativen in Baden-Württemberg und Bayern. Es ist festzustellen, „…dass die Akzeptanz von Bürgerbussen für die Planung von kommunalen ÖPNV-Angeboten in den letzten Jahren stark zugenommen hat.“ [Löcker et al. 2014]
Elektrisch betriebene Bürgerbusse stellen in Deutschland eine absolute Seltenheit dar. In dem diesem Bericht zugrundeliegenden Verständnis von Bürgerbussen und den zu erfüllenden Anforderungen an das Fahrzeug gab es vor Projektbeginn noch kein realisiertes Konzept in Deutschland, weshalb es zu einer Förderung im Rahmen des Förderprogramms Schaufenster Elektromobilität kam. [Schaufenster Elektromobilität 2014] Das Projekt e-Bürgerbus war eines von ca. 40 Projekten im Schaufenster Elektromobilität Baden-Württemberg, dem so genannten LivingLab BWe mobil, das aus Landesmitteln der Initiative Nachhaltig mobile Region Stuttgart (NAMOREG) durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert wurde.
Projektpartner waren insbesondere für die wissenschaftliche Untersuchung des Testbetriebs das Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Universität Stuttgart sowie der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II des Betriebswirtschaftlichen Instituts der Universität Stuttgart. Unterstützt wurden diese vom Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart GmbH. Beratend war die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) mit der Kompetenzstelle „Innovative Angebotsformen im ÖPNV“ tätig.
Als Anwendungskommunen mit bereits existierenden Bürgerbusverkehren konnten im Landkreis Göppingen die Gemeinde Salach, die Städte Uhingen sowie Ebersbach und im Landkreis Esslingen die Stadt Wendlingen am Neckar gewonnen werden. Das Projekt hatte eine Laufzeit von Juli 2014 bis Dezember 2016 (30 Monate).
Dieser Bericht stellt im folgenden Kapitel 2 die Projektziele vor und erläutert in Kapitel 3 die Vorgehensweise im Forschungsprojekt anhand der bearbeiteten Arbeitspakete. Die Kapitel 4 bis 6 zeigen die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete. Dabei handelt es sich um die Ist-Analyse der Anwendungskommunen des Projekts (Arbeitspaket (AP) 1), in denen ein Bürgerbusverkehr bereits zu Projektbeginn bestand und in denen der beschaffte e-Bürgerbus eingesetzt wurde. AP 2 bildet die Beschaffung des e-Bürgerbusses und der Ladeinfrastruktur. Der Realeinsatz des Fahrzeugs als Feldtest im Testbetrieb wurde in AP 3 untersucht. Der Projektbericht zeigt in Kapitel 7 mit dem Fazit u. a. Handlungsempfehlungen für den Einsatz von e-Bürgerbussen auf und schließt in Kapitel 8 mit einem Ausblick.
1 Formen ehrenamtlicher Mobilität werden unter dem Begriff Gemeinschaftsverkehre subsumiert. Ein weiteres Beispiel sind Bürgerautos. Eine Übersicht mit Ausprägungen von Gemeinschaftsverkehren befindet sich in [NVBW 2017] sowie [NVBW 2015c].
2 Details hierzu sind allerdings weitestgehend unbekannt. (vgl. [Löcker et al. 2014], [Schiefelbusch 2015] sowie [Schiefelbusch 2015])
2 Projektziele
Ziel des Projektes e-Bürgerbus war die praktische Erprobung und Evaluation des Einsatzes von elektrisch betriebenen oder mit Hybridantrieb ausgestatteten Bürgerbussen in kleineren Städten und Gemeinden in der Region Stuttgart. Dabei lag ein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Bürgerbuskonzepts im Hinblick auf die künftigen verkehrlichen Herausforderungen insbesondere in ländlich geprägten Regionen unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte.