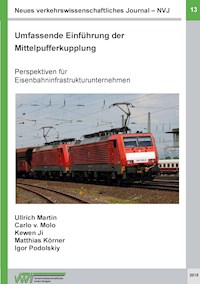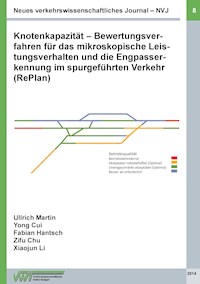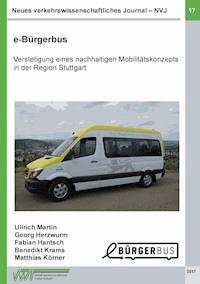Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im spurgeführten Verkehrssystem werden die Betriebsqualität und Kapazität der Infrastruktur durch Engpässe im bestehenden Netz stark beeinflusst. Engpässe entstehen dabei häufig in Infrastrukturbereichen mit komplexen Gleisstrukturen. Diese können durch ungeeignete Nutzung der Infrastruktur oder mangelhafte Dimensionierung und Gestaltung der Infrastruktur verursacht werden. Mit den in dieser Arbeit entwickelten Bewertungsansätzen wird die bisherige Beschränkung aufgrund der getrennten Bewertung von Strecken und Knoten überwunden, so dass Engpässe in einem beliebigen Untersuchungsraum unter der mikroskopischen Betrachtung hinreichend genau identifiziert werden. Der hierfür entwickelte Suchalgorithmus analysiert die auftretenden Behinderungen entlang des Fahrtverlaufs bis zu den Stellen, an denen die tatsächlichen Ursachen des Engpasses zu finden sind. Mit der ursachenbezogenen Engpassanalyse können sowohl das Phänomen als auch die Ursachen der Engpässe identifiziert werden, wodurch die gezielte Ableitung von Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen ermöglicht wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Im Jahr 2012 wurde der Antrag für eine Sachbeihilfe zu dem Thema „Entwicklung einer simulationsbasierten Methodik zur ursachenbezogenen Engpassbewertung komplexer Gleisstrukturen in spurgeführten Verkehrssystemen unter Berücksichtigung stochastischer Bedingungen“ von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt. Das Ziel des 2014 abgeschlossenen Projekts bestand in der Entwicklung eines neuen Verfahrens zur direkten Erkennung der Ursachen von Engpässen in komplexen Gleisstrukturen mit mikroskopischen Modellen zur Leistungsuntersuchung, da die tatsächlichen Ursachen der Engpässe beim gegenwärtigen Stand der Forschung in diesem Bereich aufgrund der komplexen Gleisstrukturen und Fahrtenkombinationen noch nicht trivial ermittelbar waren. Die Kenntnis der Ursachen bildet jedoch eine wichtige Voraussetzung, um geeignete Maßnahmen zur Verminderung der durch Engpässe entstehenden Wirkung ableiten zu können.
Mit den Erkenntnissen des abgeschlossenen Forschungsprojekts können Engpässe unabhängig von der Komplexität der Infrastruktur und des Betriebsprogramms bei mikroskopischer Betrachtung hinreichend genau bewertet werden. Ein im Rahmen des Projekts neu entwickeltes mikroskopisches Infrastrukturmodell bildet die Grundlade für das im Rahmen des Forschungsprojekts erarbeitete Berechnungs- und Bewertungsverfahrens zur Engpassanalyse. Basierend auf dem Infrastrukturmodell werden sowohl die wirksamen Engpässe bei einer konkreten Belastung als auch die Engpässe bei erhöhten Belastungen infrastrukturelementgenau identifiziert, so dass auch potenzielle Engpässe frühzeitig erkennbar und mit geeigneten Maßnahmen zu vermeiden sind. Die Methodik zur Ursachenfindung ermöglicht die Erkennung der tatsächlichen Ursachen der Engpässe, die durch das Zusammenspiel von sich gegenseitig behindernden Zugfahrten verursacht werden.
Die Ergebnisse aus diesem Projekt ergänzen die vorhandenen Methoden makroskopischer Leistungsuntersuchungen, so dass eine allgemeingültige Bewertung eines Untersuchungsraums innerhalb eines Bewertungsprozesses möglich ist.
Stuttgart, im März 2015
Ullrich Martin, Xiaojun Li
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Engpassanalyse bei Leistungsuntersuchungen
2.1 Überblick
2.2 Grundbegriffe
2.3 Methodik bei Leistungsuntersuchungen
2.3.1 Überblick
2.3.2 Analytische Methode
2.3.3 Simulative Methode
2.4 Zielsetzung
3 Beschreibungsmodell für komplexe Gleisstrukturen
3.1 Überblick
3.2 Vorhandene Beschreibungsmodelle
3.2.1 Fahrstraßenknoten – Gleisgruppen
3.2.2 Teilfahrstraßenknoten (TFK)
3.2.3 Mikroskopisches Infrastrukturmodell nach Radtke
3.3 Zielsetzung der Infrastrukturmodellierung bei der Engpassanalyse
3.4 Das neue Beschreibungsmodell
3.4.1 Basisstruktur - ungerichtetes Belegungselement
3.4.1.1 Definition und Abgrenzung
3.4.1.2 Vergleich mit Teilfahrstraßenknoten
3.4.1.3 Vergleich mit Fahrstraßenknoten und Gleisgruppen
3.4.2 Fahrwegkomponente – gerichtetes Belegungselement
3.4.3 Infrastrukturmodellierung auf den Ebenen der Basisstrukturen und Fahrwegkomponenten
4 Simulationsbasierter Berechnungsansatz zur Ermittlung von Bewertungskenngrößen
4.1 Überblick
4.2 Kenngrößen bei Leistungsuntersuchungen
4.2.1 Leistungsbezogene Kenngrößen
4.2.2 Infrastrukturbezogene Kenngrößen
4.2.3 Qualitätsbezogene Kenngrößen
4.3 Auswahl der Kenngrößen zur Engpassanalyse
4.4 Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Kenngrößen
4.4.1 Berechnung des Belegungsgrads
4.4.2 Berechnung des Behinderungsgrads
4.4.3 Berechnung der Engpassempfindlichkeit
4.4.4 Berechnung der Nicht erfüllbaren Belegungswünsche
4.5 Fahrplanverdichtung mit stochastischen Bedingungen
4.6 Bewertungsmaßstab - Optimaler Leistungsbereich
5 Ansätze zur ursachenbezogenen Engpassanalyse
5.1 Überblick
5.2 Algorithmus zur Lokalisierung von Engpässen
5.2.1 Konzept zur Lokalisierung von Engpässen
5.2.2 Ermittlung der Grenzwerte für die Kriterien zur Lokalisierung von Engpässen
5.2.2.1 Kriterium 1 (K1) – Engpassempfindlichkeit
5.2.2.2 Kriterium 2 (K2) – Nicht erfüllbare Belegungswünsche
5.2.2.3 Kriterium 3 (K3) – Belegungsgrad
5.2.3 Ermittlung von potenziellen Engpässen für ein grobes Betriebsprogramm
5.2.4 Erkennung von signifikanten Engpässen für eine Verdichtungsstufe
5.2.5 Ablauf zur Lokalisierung von Engpässen mit Simulationsverfahren
5.2.6 Referenzbeispiel
5.3 Algorithmus zur Lokalisierung der tatsächlichen Engpassursachen
5.3.1 Kategorisierung von Behinderungen
5.3.2 Hintergrund und Grundkonzept
5.3.3 Suchalgorithmus zur Zuordnung von Engpassursachen
5.3.4 Ablauf der Lokalisierung von Ursachen
5.4 Kategorisierung von Engpassursachen
5.4.1 Ursachen in der Infrastrukturgestaltung
5.4.2 Ursachen im Betriebsprogramm
5.5 Vorschläge für Maßnahmen zur Beseitigung der Engpässe bzw. zur Minimierung von deren Wirkung
6 Bewertungsverfahren für komplexe Gleisstrukturen
6.1 Überblick
6.2 Strukturierung einer allgemeingültigen Leistungsuntersuchung
6.3 Ablauf des Bewertungsverfahrens für komplexe Gleisstrukturen
6.4 Darstellung der Ergebnisse mit der Bewertungssoftware PULEIV
7 Zusammenfassung
Abkürzungen
Formelzeichen
Glossar
Literaturverzeichnis
Anhang I: Methoden zur Engpassanalyse bei der Infrastrukturbemessung im Schienenverkehr
Anhang II: Einfluss des Betriebsprogramms und der Infrastrukturgestaltung auf die Entstehung von Engpässen im Schienenverkehr
Anhang III: Ursachenbezogene Engpassbewertung in der Eisenbahnbetriebssimulation – DFG-Forschungsprojekt EPSUR
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 3–1: Aufteilung eines Beispielknotens in Fahrstraßenknoten und Gleisgruppe
Abbildung 3–2: Abgrenzung von TFK in einem Beispielknoten nach [Vakhtel 2002)
Abbildung 3–3: Mikroskopisches Knoten-Kanten-Modell eines Beispielbahnhofs
Abbildung 3–4: Infrastrukturmodellierung mit ungerichteten Belegungselementen – Basisstrukturen
Abbildung 3–5: Vergleich von TFK und Basisstruktur
Abbildung 3–6: Einfluss der Teilauflösung von Fahrstraßen bei der Infrastrukturmodellierung
Abbildung 3–7: Infrastrukturmodellierung mit gerichteten Belegungselementen – Fahrwegkomponenten
Abbildung 3–8: Attribute einer Fahrwegkomponente im Beispielbahnhof
Abbildung 3–9: Infrastrukturmodellierung in zwei Ebenen – Basisstrukturen und Fahrwegkomponenten
Abbildung 3–10: Schrittweise Modellierung einer Infrastruktur in zwei Ebenen – Basisstrukturen und Fahrwegkomponenten
Abbildung 4–1: Belegungszeit der Belegungselemente
Abbildung 4–2: Behinderung einer Zugfahrt auf einem Belegungselement
Abbildung 4–3: Engpassempfindlichkeit einer Fahrwegkomponente
Abbildung 4–4: Zuordnung der Fahrwegkomponenten mit Nicht erfüllbaren Belegungswünschen zu einer Basisstruktur
Abbildung 4–5: Einfluss des Behinderungsorts auf das Auftreten der behinderungsbedingten Wartezeiten (Behinderungen) – Fall A
Abbildung 4–6: Einfluss des Behinderungsorts auf das Auftreten der behinderungsbedingten Wartezeiten (Behinderungen) – Fall B
Abbildung 4–7: Verhältnis von Eingang- und Ausgangsbelastung (Quelle: [Martin et al. 2013])
Abbildung 4–8: Leistungsuntersuchung zur Ermittlung des Optimalen Leistungsbereichs (Quelle: [Chu 2014])
Abbildung 5–1: Verlauf der Engpassempfindlichkeit entlang des Fahrwegs
Abbildung 5–2: Verfahren zur Lokalisierung von Engpässen
Abbildung 5–3: Infrastruktur und Betriebsprogramm des Referenzbeispiels
Abbildung 5–4: Optimaler Leistungsbereich eines Beispielbahnhofs
Abbildung 5–5: Engpassrelevanzen und –Signifikanzen eines Beispielbahnhofs
Abbildung 5–6: Kategorisierung von Behinderungen (Quelle: eigene Darstellung in [Li & Martin 2013])
Abbildung 5–7: Behinderungen nach Häufigkeit (Quelle: Modifizierte eigene Darstellung in [Li & Martin 2013])
Abbildung 5–8: Behinderungen nach Einflussweite (Quelle: Modifizierte eigene Darstellung in [Li & Martin 2013])
Abbildung 5–9: Beispiel 1 – Ursachen befindet sich unmittelbar am Engpass (direkte Behinderung)
Abbildung 5–10: Beispiel 2 – Ursachen befindet sich unmittelbar am Engpass (indirekte Behinderung)
Abbildung 5–11: Beispiel 3 – Ursache befindet sich nicht unmittelbar an Engpässen aber verursacht die Behinderungen an Engpässen direkt
Abbildung 5–12: Beispiel 4 – Ursachen befinden sich nicht direkt an Engpässe – indirekte Behinderungen
Abbildung 5–13: Bestimmung der Art der auftretenden Behinderung
Abbildung 5–14: Bestimmung des behindernden Zugs
Zbh
für einen behinderten Zug
Zk
Abbildung 5–15: Konflikte zweier Zugfahrten mit Soll-Sperrzeitentreppen
Abbildung 5–16: Ablauf des Suchalgorithmus
Abbildung 5–17: Ablauf der Zuordnung der belegungselementverursachten Behinderungen für eine Behinderung
Abbildung 5–18:Lokalisierung der Ursachen eines Engpasses im Beispielknoten
Abbildung 5–19: Ursachen von Engpass 1
Abbildung 6–1: Engpassanalyse bei einer Leistungsuntersuchung mit Simulationswerkzeugen (Quelle: Eigene Darstellung in [Martin et al. 2012])
Abbildung 6–2: Ablauf eines allgemeingültigen Bewertungsverfahrens
Abbildung 6–3: Datenaufbereitung der Untersuchungsvariante im Simulationswerkzeug (Quelle: Eigener Screenshot RailSys)
Abbildung 6–4: Bearbeitung des Basisfahrplans in PULEIV (Quelle: Eigener Screenshot PULEIV)
Abbildung 6–5: Generierung von Fahrplänen verschiedener Verdichtungsstufen (Belastungen) (Quelle: Eigener Screenshot PULEIV)
Abbildung 6–6: Ermittlung der durchsatzbezogenen Leistungsfähigkeit und des Optimalen Leistungsbereichs in PULEIV (Quelle: Eigener Screenshot PULEIV)
Abbildung 6–7: Ermittlung der Verspätungskoeffizienten (Quelle: Eigener Screenshot PULEIV)
Abbildung 6–8: Verspätungskoeffizienten eines Fahrplans der Verdichtungsstufe 100%
Abbildung 6–9: Darstellung der Engpassrelevanzen und – Signifikanzen in PULEIV
Abbildung 6–10: Lokalisierung der Ursachen von Engpass 1
Abbildung 6–11: Vergleich der Untersuchungsvarianten - Optimaler Leistungsbereich
Abbildung 6–12: Vergleich der Engpassrelevanzen der drei Untersuchungsvarianten
Abbildung 6–13: Engpasssignifikanzen der Untersuchungsvarianten bei der Verdichtungsstufe 100%
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Einstufung von Engpässen nach den drei Kriterien K1, K2 und K3
Tabelle 2: Engpassrelevanzen und –signifikanzen des Referenzbeispiels
Tabelle 3: Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen
Tabelle 4: Gegenüberstellung der Ergebnisse der makroskopischen Bewertung der Untersuchungsvarianten
1 Einleitung
Wirtschaftswachstum und Mobilität von Menschen und Gütern werden zumeist von einer Zunahme des Verkehrs begleitet. Nach weit über hundert Jahren Entwicklung der Eisenbahn in Deutschland liegt der Schwerpunkt zurzeit nicht mehr nur auf dem Neu- und Ausbau von Strecken sondern insbesondere zunehmend auch auf der Erhöhung der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Eisenbahninfrastruktur. Hierzu ist die Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes durch Prozessoptimierung mit Hilfe von innovativen Leistungsuntersuchungen möglichst ohne größere Veränderung der Infrastruktur zu erhöhen. Zur Infrastrukturgestaltung und langfristigen Betriebsplanung in spurgeführten Verkehrssystemen gehören zwei wichtige Anforderungen. Einerseits ist die Infrastruktur so zu gestalten, dass die negativen Einflüsse auf die Betriebsdurchführung möglichst minimal sind und andererseits ist der Betrieb so zu planen, dass die Infrastruktur optimal ausgelastet wird.
Im spurgeführten Verkehrssystem werden die Betriebsqualität und Kapazität der Infrastruktur durch Engpässe im bestehenden Netz stark beeinflusst. Engpässe entstehen dabei häufig in Infrastrukturbereichen mit komplexen Gleisstrukturen. Diese können durch ungeeignete Nutzung der Infrastruktur oder mangelhafte Dimensionierung und Gestaltung der Infrastruktur verursacht werden. Zur Erhöhung der Infrastrukturkapazität und Verbesserung der Betriebsqualität sollen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Wirkung bestehender Engpässe gezielt zu entschärfen.
Die zwei Hauptaufgaben einer Engpassanalyse im Rahmen eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Leistungsuntersuchungen bestehen darin, Engpässe im Untersuchungsraum exakt zu erkennen und deren Ursachen in der Infrastruktur sowie im Betriebsprogramm zu bestimmen. Darauf aufbauend können anhand der erkannten Ursachen geeignete Maßnahmen in der Infrastrukturgestaltung oder der Betriebsplanung abgeleitet werden.
Es existiert bereits eine Reihe von Methoden bzw. Verfahren, bei denen die Wirkungen von Engpässen in Form von Warteschlangen und Wartezeiten erkennbar und auswertbar sind. Die Infrastrukturelemente an denen Warteschlangen entstehen, sind jedoch oftmals selbst nicht die Ursache des Engpasses. Während es bei einfachen Infrastrukturen vergleichsweise leicht ist, die verursachenden Infrastrukturelemente direkt zu bestimmen, ist dies bei komplexen Teilnetzen mit heterogenen Betriebsprogrammen auf überschaubare Weise bislang nicht möglich. Bei komplexen Gleisstrukturen entstehen Engpässe nämlich oftmals nicht nur aus einer einzigen Ursache sondern aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Verkehrskomponenten - Infrastruktur, Betriebsprogramm und Fahrzeuge. Aus diesem Grund ist die Bestimmung der tatsächlichen Ursachen nicht trivial.
Das Ziel des vorliegenden Forschungsprojekts besteht darin, komplexe Gleisstrukturen der Eisenbahninfrastruktur unter Berücksichtigung stochastischer Bedingungen zu bewerten, um so die eigentlichen Ursachen für Engpässe zu identifizieren. Dafür sollte ein neues Verfahren entwickelt und algorithmiert werden, um Engpässe präzise zu lokalisieren und deren Ursachen zuzuordnen.
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde ein neues Beschreibungsmodell für komplexe Gleisstrukturen entwickelt (Kapitel 3), das die ursachenbezogene Engpassanalyse mit Simulationsverfahren zielorientiert unterstützt. Darauf basierend wurden ausgewählte Kenngrößen (Kapitel4) für die nachfolgenden Bewertungsansätze berechnet. Im Rahmen der Zielsetzung des Projekts wurden neue Algorithmen zur exakten Lokalisierung von Engpässen und zur frühzeitigen Erkennung der Ursachen entwickelt (Kapitel5), um geeignete Maßnahmen Minderung der Engpasswirkung abzuleiten. Aufbauend auf diese Ergebnisse wurde das Bewertungsverfahren zur Leistungsuntersuchung weiterentwickelt (Kapitel 6), sodass eine komplexe Infrastruktur umfassend und aussagekräftig bewertet werden kann.
2 Engpassanalyse bei Leistungsuntersuchungen
2.1 Überblick
Die Engpassanalyse ist eine Teilaufgabe der eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Leistungsuntersuchung. In diesem Kapitel werden relevante Grundbegriffe (Abschnitt 2.2) im Sinne der vorliegenden Arbeit und Untersuchungsmethoden aus zwei unterschiedlichen Aspekten (Abschnitte 2.3) zusammengefasst. Die offenen Fragen bei bereits existierenden Methoden, die den Anlass zu diesem Forschungsprojekt gaben, werden in Abschnitt 2.4 beschrieben.
2.2 Grundbegriffe
Belegungselement: Der Begriff „Belegungselement“ bezieht sich in der vorliegenden Forschungsarbeit auf Teile der befahrbaren Infrastruktur. Ein Belegungselement kann gerichtet (z.B. Fahrstraße) oder ungerichtet (z.B. Strecke oder Teilstrecke) sein. In Kapitel 3.4 werden verfeinerte Begriffe („Basisstruktur“ als ungerichtetes und „Fahrwegkomponente“ als gerichtetes Belegungselement) eingeführt.
Betriebsprogramm: Im Sinne eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Leistungsuntersuchungen ist das Betriebsprogramm die umfassende Beschreibung von Betriebsvorgängen und den an diesen Vorgängen beteiligten Verkehrseinheiten, je nach erforderlichem Detaillierungsgrad und Aufgabenstellung. Die wichtigsten Merkmale eines Betriebsprogramms sind z.B.
Menge der Verkehrseinheiten
Struktur, Reihenfolge, Eigenschaften und Verhältnis der Verkehrseinheiten zueinander
zeitliche Verteilung der Verkehrseinheiten
Zugmix: Struktur des Betriebsprogramms, die die Eigenschaften der Modellzüge und das anteilige Verhältnis der Zugzahl jeder Gruppe (Zugfamilie) umfasst. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird der „Zugmix“ auch als „grobes Betriebsprogramm“ bezeichnet.
Fahrplan: In [Pachl 2011] wird der Fahrplan als „vorausschauende Festlegung des Fahrtverlaufs der Züge hinsichtlich Verkehrstage, Fahrzeiten, zulässige Geschwindigkeiten und zu benutzender Fahrwege“ definiert. Der Fahrplan kann auch als die betriebliche Realisierung des Betriebsprogramms verstanden werden.
Betriebsqualität: „Qualität des Betriebs“. Die Qualität ist im jeweiligen Einzelfall über das Zusammenwirken der unterschiedlichen Qualitätsaspekte zu beurteilen [DB Netz AG 2008].
Kenngrößen: Messbare, berechenbare oder mit Hilfe von rechnerunterstützten Tools ermittelbare Größen, mit denen eine Untersuchungsvariante bei Leistungsuntersuchungen z. B. Teilnetz oder Eisenbahnknoten, quantitativ oder qualitativ bewertet werden kann.
Leistungsverhalten: In [Pachl 2011] wird das Leistungsverhalten als die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen drei Größen: Belastung (bei gleichbleibender Struktur des Betriebsprogramms), Betriebsqualität und Bahnanlagen definiert. Aus zwei Größen als Eingangsgrößen lässt sich dabei die dritte als Ausgangsgröße ermitteln.
Belastung: Auch Leistungsanforderung genannt, ist die Anzahl der Zugfahrten pro Zeitintervall im Untersuchungsraum.
Behinderung: Behinderungen entstehen, wenn an einem Belegungselement zu einem Zeitpunkt mehr Anforderungen als Fahrmöglichkeiten vorliegen und deshalb eine Forderung nicht sofort erfüllt werden kann.
Untersuchungsraum: Ein abgegrenzter Abschnitt der Infrastruktur, für den die Leistungsuntersuchung durchgeführt wird.
Untersuchungszeitraum: Zeitraum, für den die Leistungsuntersuchung durchgeführt wird.
Engpass: Eine eindeutige Definition für den Begriff „Engpass“ ist nicht vorhanden, da die Definition meistens im Zusammenhang mit der Aufgabestellung und dem Bewertungsverfahren steht.
Definition in [DB Netz AG 2008]:
Engpass
ist „maßgebendes Netzelement für das Leistungsverhalten, dessen Nutzungsgrad
1
der Nennleistung
2
im mangelhaften Bereich der Qualität liegt“.
Definition in der vorliegenden Forschungsarbeit ([Hantsch & Li et al. 2013]): Ein Infrastrukturabschnitt (ein ungerichtetes Belegungselement oder Kombination von mehrereren benachbarten ungerichteten Belegungselementen) ist dann ein
Engpass
, wenn andere Fahrten wegen der Belegung auf diesem Infrastrukturabschnitt so stark beeinträchtigt werden, dass der Betrieb auf benachbarten Abschnitten behindert und damit die Betriebsqualität negativ beeinflusst wird, d.h. dieser Infrastrukturabschnitt wirkt betriebsbehindernd.
Eisenbahnknoten: Bahnhöfe, in denen mindestens zwei Strecken oder Abzweigstellen miteinander verknüpft sind. Eisenbahnknoten werden in der eisenbahnbetrieblichen Fachwelt oftmals vereinfacht als „Knoten“ bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Eisenbahnknoten“ zur Unterscheidung vom Begriff „Knoten“ bei der Infrastrukturmodellierung verwendet.
2.3 Methodik bei Leistungsuntersuchungen
2.3.1 Überblick
Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Leistungsuntersuchungen können sowohl für die Infrastrukturgestaltung und –bemessung als auch für die Betriebsplanung während aller zeitlichen Planungsphasen angewandt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben von Leistungsuntersuchungen ist die Ermittlung des Leistungsverhaltens einer Infrastruktur bei einem gegebenen Betriebsprogramm. Ziel der Leistungsuntersuchungen ist u.a. die Verbesserung des Leistungsverhaltens durch Optimierung der