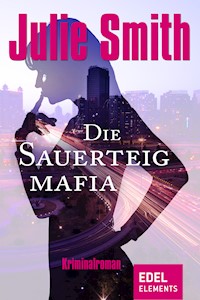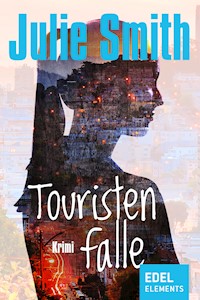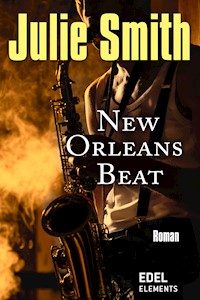
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Skip Langdon
- Sprache: Deutsch
Skip Langdon, die junge Polizistin vom Morddezernat in New Orleans, soll den Tod eines Computerfreaks aufklären und dringt dabei in eine bizarre Schattenwelt ein – einen Chatclub namens TOWN, dessen Teilnehmer ihre intimsten Geheimnisse Menschen anvertrauen, die sie noch nie gesehen haben. Einer von ihnen war Geoff, und schon bald wird Skip klar, daß Geoffs Sturz von der Leiter kein Unfall war, sondern Mord der widerwärtigsten Art, und daß sein Mörder jeden bedroht, der der Wahrheit zu nahe kommt... Spannend, witzig, kultig: ein Krimi aus Julie Smiths preisgekrönter New-Orleans-Serie um die unkonventionelle junge Polizistin Skip Langdon!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Skip Langdon, die junge Polizistin vom Morddezernat in New Orleans, soll den Tod eines Computerfreaks aufklären und dringt dabei in eine bizarre Schattenwelt ein – einen Chatclub namens TOWN, dessen Teilnehmer ihre intimsten Geheimnisse Menschen anvertrauen, die sie noch nie gesehen haben. Einer von ihnen war Geoff, und schon bald wird Skip klar, daß Geoffs Sturz von der Leiter kein Unfall war, sondern Mord der widerwärtigsten Art, und daß sein Mörder jeden bedroht, der der Wahrheit zu nahe kommt...
Spannend, witzig, kultig: ein Krimi aus Julie Smiths preisgekrönter New-Orleans-Serie um die unkonventionelle junge Polizistin Skip Langdon!
Julie Smith
New Orleans Beat
Edel ElementsEin Verlag der Edel Germany GmbH
© 2014 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 1994 by Julie Smith
First published in Germany under the title New Orleans Beat by S. Fischer Verlag (1995)
Original title: Death turns a trick
Ins Deutsche übertragen von Bettina Thienhaus
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-614-4
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
1
Es war der zehnte November, der erste wirklich kalte Tag, und Skip erwachte bibbernd vor Kälte. Sie hatte die Wohnung gerade erst bezogen, noch keinen Winter darin verbracht – in dem alten Sklavenquartier hinter jenem Haus, in dem sie früher gewohnt hatte und das ihr Vermieter, Jimmy Dee Scoggin, wieder zu einem Einfamilienhaus umgebaut und dann selbst bezogen hatte, zusammen mit den beiden Kindern, die ihm nach dem Tod seiner Schwester zugefallen waren.
Jimmy Dee hatte das Sklavenquartier entkernen und es zu einem der schicksten Domizile im Quarter umbauen lassen, als er noch selbst dort wohnte. Aber jetzt nannten sie das Gebäude nicht mehr beim alten Namen. Jimmy Dees Adoptivkinder stammten aus Minneapolis und waren nicht vertraut mit der brutalen Geschichte der Stadt. Ihr Onkel war entschlossen, auf ihre Unschuld Rücksicht zu nehmen, und bestand darauf, das Hinterhaus als garçonnière zu bezeichnen. »Früher«, erzählte er den Kindern, »gab es besondere Häuser, nur für die Jungs«, was den elfjährigen Kenny dazu veranlaßte zu fragen, wieso nicht er anstelle der Tante die Wohnung bekommen könne.
»Weil jetzt, nachdem ich erst mal drin bin, ein Erdbeben nötig ist, um mich wieder rauszukriegen«, antwortete Skip.
Sie hatte viermal soviel Platz wie in ihrer alten Einzimmerwohnung, zehnmal soviel Luxus – und etwa zwanzigmal soviel leere Flächen, weil ihre drei oder vier Möbelstücke kaum ins Gewicht fielen. Sie kam sich vor wie in einem Schloß und war so glücklich wie selten in ihrem Leben. Aber was sie hier nicht hatte – wie ihr gerade auffiel –, war eine Zentralheizung.
Sie rief Jimmy Dee an.
»Mach ein Feuerchen, Schatz, ein Feuerchen. Das ist doch so romantisch!«
»Dee-Dee, es ist halb acht, und gleich gehe ich arbeiten.«
»Wo liegt dann das Problem? Entschuldige, ich habe Haferschleim auf dem Herd.« Im Hintergrund konnte sie »Iiih, Haferschleim!«-Geschrei hören. Das Vatersein schien schwieriger, als Jimmy Dee es sich vorgestellt. hatte.
Skip zog schließlich einen schwarzen Wollrock und einen hellbraunen Pullover an und hoffte, es würde nicht wieder wärmer werden. Irgendwo hatte sie auch noch einen braunen Blazer, der ihrer Kleidung »den letzten Schliff« geben würde, wie ihre Freundin Alison es immer ausdrückte. So ganz verstand Skip das nicht, aber sie mußte zugeben, daß es besser aussah als ihre selbst zusammengestellten Ensembles – sie hätte vermutlich etwas Rotes genommen, vollkommen unangemessen für eine Beamtin der Mordkommission.
Sie saß gerade am Schreibtisch und trank die zweite Tasse Kaffee, als ihre Vorgesetzte, Sergeant Sylvia Cappello, ihr einen Bericht des amtlichen Leichenbeschauers reichte, zusammen mit einem Autopsiebericht.
»Sieh dir das mal an. Ich habe gerade mit dem Coroner darüber gesprochen.«
Es ging um einen »nicht klassifizierten« beziehungsweise verdächtigen Todesfall. Ein einunddreißigjähriger gesunder Weißer war – offenbar nach einem Sturz von einer Leiter – tot aufgefunden worden.
Sylvia sagte: »Fällt dir auf, daß er sich das Fußgelenk gebrochen und den Schädel eingeschlagen hat? Ziemlich unwahrscheinlich, oder? Man landet doch entweder auf den Füßen oder auf dem Kopf.«
»Genau.«
»Aber wenn du mit den Füßen aufkommst und dir den Knöchel brichst und dich nicht mehr bewegen kannst, könnte dir jemand ganz einfach auf dem Betonboden den Schädel einschlagen.«
»Jemand von der Mordkommision hat sich doch sicher schon darum gekümmert?«
»Lasko und Drumm. Aber zunächst sah es wie ein Unfall aus, und so haben sie den Fall auch behandelt.« Sie reichte Skip den knappen Bericht der Kollegen. »Und jetzt stecken sie bis zum Hals in der Arbeit wegen dieses dreifachen Mordes in der Magnolia-Siedlung.«
»Das ist ja schon letzten Donnerstag passiert«, seufzte Skip, »und heute ist Montag. Ich darf gar nicht dran denken, in welchem Zustand der Tatort inzwischen ist.«
»Ach, was soll’s – schließlich hast du ja nichts Besseres zu tun.«
Ein makaberer Witz, der Skip nur ein Schnauben entlockte. Die Mordrate der Stadt war bereits gewaltig, und sie stieg immer noch weiter.
»Einunddreißig ist wirklich zu jung zum Sterben.«
»Aber zu alt, um noch bei den Eltern zu wohnen.«
Genau das hatte Geoffrey Kavanagh, das Opfer, jedoch getan, in einem großen alten Haus in der Octavia Street. Die Kinder in der Nachbarschaft bezeichneten das Gebäude bestimmt als ›das Spukhaus‹ – der Hof war zugewuchert, der Verputz seit Jahrzehnten nicht erneuert worden. Die Bewohner waren offenbar nicht besonders gesellig, wenn sie sich hinter einem solchen Dschungel versteckten. Skip näherte sich unsicher.
Drinnen im Haus bellte ein Hund. Mit was für Leuten hatte sie hier zu rechnen? Mit ungeselligen Menschen, vermutlich mit leicht Verrückten, Verwahrlosten.
Mit Depressiven.
Alkoholikern.
Aber als sie den Dschungel betrat, fiel ihr auf, daß es so etwas wie ein Muster in der Wildnis gab, daß jemand hier bewußt die ursprüngliche Dramatik gefördert hatte. Es gab Pfade, Unterholz war weggeschafft, Blätter waren weggerecht worden – der ganze Dschungel entpuppte sich als Täuschung, nur ein vorgeschobenes Durcheinander an der Straßenfront von Hof und Garten. Dahinter befanden sich ein ordentlich gemähter Rasen und gepflegte Beete. Drei oder vier Katzen räkelten sich an Stellen, an denen Sonne durch die Blätter drang. Nein, die Bewohner dieses Hauses ließen nichts verwahrlosen, auch wenn der Putz bröckelte.
Gerade als Skip zu diesem Schluß gekommen war, öffnete eine Frau die Tür, die solche Überlegungen Lügen strafte. Sie trug einen ausgebeulten, verwaschenen Jogginganzug. Ihr Gesicht sah verhärmt aus, ohne Make-up, ihre Wangen eingesunken, die Tränensäcke violett. Das stumpfe, schlaffe Haar hatte sie zu einem Zopf zurückgebunden. Dem Aussehen nach hätte sie sechzig sein können, aber ihr Haar war schwarz – noch hatte sie nicht völlig aufgegeben.
»Mrs. Kavanagh?«
»Terry. Marguerite Terry.«
Skip stellte sich vor. »Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Sohn stellen?«
Sofort traten ihr Tränen in die Augen. »Mein Sohn? Aber er ist doch ... Das verstehe ich nicht.«
»Über seinen Tod.«
Sie wirkte erleichtert. »Entschuldigen Sie. Ich fürchte, ich bin noch nicht ganz wach; ich habe so viel geschlafen ...«
Skip nickte nur und schwieg, weil sie hoffte, Marguerite Terry werde sich an ihre gute Erziehung erinnern, aber die Frau sah sie nur erwartungsvoll an. Neben ihr wedelte ein weißer Hund mit braunen Ohren ein wenig zögernd mit dem Schwanz. »Dürfte ich wohl reinkommen?«
»Oh. Aber natürlich.« Sie warf dem Hund einen Blick zu. »Okay, Toots?« Wieder wedelte der Hund zögernd, aber er war offenbar zufrieden.
Skip betrat ein Zimmer, dessen düstere Atmosphäre einem Trauerhaus angemessen war. Die Vorhänge waren zugezogen und ließen den Raum wie eine Höhle wirken. Auf dem Boden stapelten sich Zeitungen, als wäre es zu anstrengend, sie wegzuwerfen. Auf dem Tisch standen ein oder zwei Gläser, auf der Couch lag eine Decke; ansonsten wirkte das Zimmer verstaubt und selten benutzt. Der Teppich war fadenscheinig, die Versiegelung der Bodendielen längst abgewetzt, ebenso wie die Bezüge der Sitzgarnitur. Niemand hatte sich je die Mühe gemacht, die uralte Tapete zu ersetzen.
Trotzdem, das mußte einmal anders gewesen sein; die Möbel waren im Prinzip von guter Qualität, es sah aus, als hätten sich die Lebensbedingungen der Bewohner rapide verschlechtert – eine Armut, der es nicht an Eleganz mangelte, hätte sich nur jemand zum Staubwischen und -saugen aufraffen können. Also doch verwahrlost, schloß Skip.
Offensichtlich verlegen, zog Marguerite die schweren, staubigen Vorhänge zurück. Sie sahen aus, als hätte man sie vor vierzig Jahren ausgesucht und seitdem nicht mehr berührt, als hätten sie seitdem Staub gesammelt, die Moden beinahe eines halben Jahrhunderts überstanden und einen Mantel von Düsternis über alles gebreitet.
Im Licht machte das Zimmer schon einen besseren Eindruck.
»Wir halten uns hier nicht oft auf«, sagte Marguerite. »Wir haben alle soviel zu tun ...«
»Alle?«
»Mein Mann, Coleman, ist Computerfachmann – Autodidakt und autonom, wie er das immer ausdrückt. Er hat sein Büro hier, aber heute ist er weg, zu einer Besprechung. Und Neetsie, unsere Tochter – sie ist vor ein paar Monaten ausgezogen. Sie hat ein eigenes Apartment, stellen Sie sich vor! Mit achtzehn. Und Geoff« – ihre Stimme brach –, »ich hatte mich so an ihn gewöhnt. Sie wissen sicher, wie man sich an jemanden gewöhnen kann?«
Eine sonderbare Bemerkung, wenn es den eigenen Sohn betraf.
»Wie an einen Hund oder so. Ich weiß nicht. Setzen Sie sich doch.
»Ich würde eigentlich gern sehen, wo der Unfall passiert ist, wenn ich darf.«
»Sie wollen sehen –?« Sie starrte Skip an, als versuche sie, diese Äußerung zu verstehen.
»Wo Sie ihn gefunden haben«, beendete Skip den Satz für sie. »Es tut mir leid. Ich weiß, es muß schwer für Sie sein.«
»Oh«, sagte Marguerite. Das bezog sich wohl weniger auf Skips letzte Äußerung; Marguerite hatte nur endlich begriffen, was die Polizistin von ihr wollte. »Kommen Sie hier durch.«
Den Hund bei Fuß, führte sie Skip durch ein Eßzimmer, das ebenso schäbig war wie das Wohnzimmer, ebenso dunkel und verstaubt, aber deutlich mehr benutzt wurde – wenn auch nur als Stauraum. Auf dem Tisch stapelte sich die Post, alte Zeitungen, Zeitschriften, alltäglicher Abfall, der sich in jedem Haus ansammelt und den andere alle paar Tage wegwarfen. Das hier sah eher nach Monaten aus. Sie kamen in eine Küche, die einen bewohnteren Eindruck machte, auch ziemlich durcheinander, aber gemütlicher, und schließlich in eine Abstellkammer. Drei Stufen führten in einen gepflasterten Hof. »Hier oben«, sagte Marguerite. »Da ist Mosey gewesen.«
»Wie bitte?«
»Sie wissen gar nicht, wie es passiert ist?«
»Ich weiß nur, daß Ihr Sohn von einer Leiter gefallen ist.«
»Also, ich bin gegen zehn aufgewacht, und als ich in die Küche kam, hörte ich ein ganz jämmerliches Miauen. Also bin ich rausgegangen, und da lag Geoff, mitten im Hof, und die Leiter lag auf ihm. Mosey, unsere kleine graue Katze, war aufs Dach geklettert, und Geoff hatte wohl versucht, ihn da runterzuholen, und war dabei gestürzt.« Sie hielt inne, erinnerte sich, und ihre Züge wurden starr, als sie um Fassung rang. »Ich wußte gleich, was passiert war.«
»Was hatte er an?«
»Ein T-Shirt und eine alte Jogginghose, als sei er gerade aufgestanden und habe nur was übergezogen, um rauszugehen. Keine Schuhe. Seine Füße –«
»Was?«
Sie sah elend aus. »Er hat bestimmt kalte Füße gehabt.«
Auch Skip wollte daran lieber nicht denken. »Was haben Sie getan?«
»Ich weiß nicht. Ich hab wohl geschrien oder so.«
»Und dann?«
»Ich hab die Leiter runtergezerrt und seinen Kopf auf meinen Schoß gezogen und ihn gestreichelt. Aber er fühlte sich irgendwie seltsam an.«
»Wie denn?«
Sie zog eine gequälte Grimasse. »Seltsam. Weich.«
»War sonst noch jemand im Haus?«
»Nein. Cole war in Baton Rouge. Ich mußte selbst den Notruf wählen. Ich wußte, daß er tot war. Ich war vollkommen hysterisch.«
»Woher wußten Sie, daß er tot war?«
»Er war so kalt. Und sein Kopf.«
»Wie lange haben Sie so dagesessen, mit seinem Kopf in Ihrem Schoß?«
»Vielleicht ein paar Sekunden. Nicht lange.«
»Als Sie wieder aufgestanden sind, haben Sie da seinen Kopf auf das Pflaster fallen lassen?«
»Er war mein Sohn!«
Skip wartete.
»Ich hab ihn ganz sanft abgelegt.«
Skip sah zum Dach hinauf. »Ist Mosey schon öfter da raufgeklettert?«
»Ach, Mosey. Der klettert überallhin.«
»Aber aufs Dach?«
»Keine Ahnung. Nicht daß ich wüBte.«
»Ich überlege gerade – haben Sie gehört, wie die Leiter umgestürzt ist? Oder einen Schrei von Geoff oder so was?«
»Nein, mein Zimmer ist auf der anderen Hausseite. Und ich würde selbst einen Wirbelsturm verschlafen. Ich nehme Schlaftabletten, und die werfen mich so um, daß neben mir auch eine Bombe einschlagen könnte, und ich würde es nicht merken.«
Skip dachte, das erklärte vielleicht, wieso sie so betäubt wirkte. »Haben Sie heute auch eine genommen?«
»Gestern abend, aber ich bin mit Cole aufgestanden und habe mich dann wieder hingelegt. Wir können ruhig reden, kein Problem. Sollen wir wieder reingehen? Vielleicht sollte ich einen Kaffee machen.«
Skip gefiel es draußen besser, und sie wollte auch keinen Kaffee. Aber sie sagte: »Das wäre schön«, weil sie annahm, Marguerite wolle selbst welchen trinken. Sie kam ihr so abgestumpft und apathisch vor, ihre Stimme war so ausdruckslos, vielleicht würde Koffein ja ein bißchen helfen. In der Küche sagte sie: »Lassen Sie mich den Kaffee machen.«
»Schon gut, ich schaffe das schon.« Marguerite sah in ihrem ausgebeulten Jogginganzug sehr dünn aus, jämmerlich und einsam, als sie da in ihrer chaotischen Küche stand. Skip fand es merkwürdig, daß sie so bald nach dem Tod ihres Sohnes hier allein war, daß das Haus so unberührt wirkte, als seien keine Besucher dagewesen. Als Marguerite den Kühlschrank öffnete, sah Skip, daß er beinahe leer war, nicht vollgepfropft, wie man es hätte erwarten können – mit Eintöpfen und Schinken, Kuchen und Pasteten, die Freunde und Verwandte vorbeigebracht hatten.
»Halten Sie es für gut, daß Sie hier so allein sind?« fragte sie. »Soll ich jemanden holen, der bei Ihnen bleibt?«
Marguerite sagte: »Wir sind immer allein.« Sie starrte ins Leere. »Neetsies Freunde sind hin und wieder vorbeigekommen. Ich weiß nicht – ich glaube, Cole und ich sind einfach nicht besonders gesellig. Wir ... wir gehören keiner Kirche an und keinem Verein oder so. Und wir arbeiten beide nicht außer Haus.«
Sie klang, als frage sie sich gerade, wie es zu dieser Vereinsamung gekommen war.
»Haben Sie Verwandte?«
»Cole nicht. Mein Dad ist schon lange tot. Und meine Ma ist in einem Pflegeheim. Aber trotzdem...« Wieder starrte sie geradeaus. »Die Trauerfeier ist bald. Vielleicht kommen hinterher noch Leute mit – ist das nicht immer so?«
Skip schüttelte den Kopf – ihre Arbeit bei der Mordkommission hatte sie nicht zu einer Spezialistin für Bestattungen gemacht.
Marguerite sah verängstigt aus. Zwei Katzen, eine schildpattfarbene und eine schwarzweiße, schmiegten sich an ihre Knöchel. »Ich müßte wohl mal saubermachen.«
Um diese Arbeit beneidete Skip sie nicht.
»Na ihr Hübschen? Soll Mommy euch füttern? Mommy ist wirklich böse. So eine böse Mommy, die nicht mal ihre Kätzchen füttert.« Sie löffelte ein wenig Katzenfutter in ein Schälchen. Das Geräusch lockte eine weitere Katze herein, eine schwarze. Skip hatte jetzt schon ein halbes Dutzend Katzen gesehen, Mosey nicht eingeschlossen, und einen Hund.
»Bellt der Hund, wenn Fremde aufs Grundstück kommen?«
»Manchmal – sie hat Sie angebellt. Aber manchmal auch nicht. Als Wachhund taugt sie nicht viel. Wieso?«
»Ich dachte an den Tag, an dem Geoff umgekommen ist. Haben Sie sie bellen gehört?«
Sie runzelte die Stirn. »Ich glaube nicht. Aber die Schlaftabletten – sie hätte einen halben Meter von mir entfernt bellen können, und ich hätte es nicht gehört.«
Marguerite fragte, wie Skip ihren Kaffee wolle, reichte ihr einen dampfenden Becher und nahm sich selbst einen. »Sollen wir wieder ins Wohnzimmer gehen?«
Dort war es wenigstens ein bißchen sonniger.
»Ich habe nicht viel Zeit zum Saubermachen«, sagte Marguerite. »Ich habe soviel zu tun.«
»Kümmern Sie sich selbst um den Garten?« Skip schaute aus dem Fenster auf das Grün hinaus, das sie jetzt, nachdem sie das Innere das Hauses kannte, noch mehr zu schätzen wußte.
»Ja. Gefällt er Ihnen?«
»Sehr.«
»Mit kreativen Arbeiten kann ich umgehen, nur mit dem alltäglichen Kram komme ich nicht zurecht. Und Neetsie ist genauso.«
»Ich weiß, was Sie meinen.« Skip fiel auf, daß Marguerite gelächelt hatte, als sie von Neetsie sprach. Beinahe zum erstenmal. Sie ging darauf ein. »Was macht Neetsie denn?«
»Sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Jedenfalls wird sie mal gut sein. Ich glaube, sie wird es wirklich schaffen. Sie geht auf die Uni, aber sie hat nur wenige Seminare belegt und hält sich mit kleinen Jobs über Wasser.« Wieder lächelte sie, ganz die stolze Mutter.
»Sie muß sehr begabt sein.«
»O ja, das ist sie.«
»Und Geoff?«
»Geoff?«
Skip lächelte, versuchte, sowenig bedrohlich wie möglich auszusehen. »Was hat er gemacht?«
»Er hatte es mit Computern. Wie sein Vater.«
»Sein Vater? Aber Sie haben einen anderen Namen.«
»Sein Stiefvater. Sie standen einander sehr nahe. Cole hat ihm alles über Computer beigebracht, und Geoff ist richtig aufgeblüht dabei, er ist ein ganz anderer Mensch geworden.«
Skip dachte, ein Einunddreißigjähriger, der noch bei seinen Eltern wohnte, könne kaum besonders weit aufgeblüht sein. »Er hat als Computerspezialist gearbeitet?«
Ein Schatten flog über Marguerites Gesicht. »Nein. Geoff war ein sehr, sehr intelligenter junger Mann. Ganz außerordentlich. Aber wir konnten uns keine guten Schulen leisten – wir mußten ihn selbst unterrichten. Er ist mit anderen nicht besonders gut ausgekommen. Er konnte nicht mit Menschen umgehen.«
Skip nickte und lächelte. Sie hatte keine Ahnung, was Marguerite eigentlich meinte.
»Er war brillant, wirklich. Aber er hat als Junge immer Comics gelesen. Sie wissen ja, viele Kinder machen das. Und es sah so aus, als wollte er da nie rauswachsen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Aus dieser Mentalität. Er war ein sehr ruhiger, sehr introvertierter Junge. Aber er hatte eine Freundin. Es wurde langsam besser. Ich glaube, sie war seine erste Freundin.«
»Und was ist mit anderen Freunden?«
»Na ja, einen Freund hatte er auch noch.« Sie zog die Nase kraus, als röche dieser Freund schlecht. »Layne Soundso, glaube ich.
»Vielleicht können wir in Geoffs Adreßbuch nachsehen? Sagten Sie nicht, er habe einen Job gehabt?« Skip wußte genau, Marguerite hatte das nie erwähnt.
»Ja. Er – äh – hat in einer Videothek gearbeitet. Mondo Video, unten an der Riverbend.«
Skip fragte sich, ob es eine Pornovideothek war – nach Marguerites Verlegenheit zu schließen, war das durchaus möglich. Einem Impuls folgend, fragte sie: »Haben Sie ein Foto von Geoff?«
»Wieso?«
»Ich versuche nur, ihn mir vorzustellen.«
»Darf ich fragen warum?«
»Ich bin neugierig, das ist alles.«
»Sie haben mir auch noch gar nicht erklärt, wieso Sie eigentlich hier sind.«
»Es hat sich etwas ergeben, was wir näher untersuchen müssen; nur der Ordnung halber.« Wieder lächelte sie, benutzte das Lächeln als Schild: Keine Fragen mehr, Mrs. Terry, ja?
Marguerite schaute unbehaglich drein. »Ich weiß wirklich nicht, wo die alten Fotos sind.«
»Schon gut, es war nur so ein Gedanke. Dürfte ich mir Geoffs Zimmer mal anschauen?«
Marguerite warf ihr einen seltsamen Blick zu. »Selbstverständlich.«
Geoffs Zimmer lag rechts von der Abstellkammer, das Fenster direkt unter dem Dach, auf das die Katze angeblich geklettert war. »Entschuldigen Sie die Unordnung«, sagte Marguerite. Das hätte Skip erheiternd finden können angesichts des Zustands, in dem sich das restliche Haus befand, wäre es nicht so deprimierend gewesen, sich all die kleinen Dinge anzusehen, die jemand geschätzt hatte, den es nicht mehr gab, und aus diesen Einzelstücken eine Geschichte zusammenzufügen.
Diese Geschichte selbst war ebenfalls traurig, dachte Skip, sie paßte zu dem bröckelnden Putz, dem eisigen Winterschlaf, in den das ganze Haus gesunken war. Eine graue Katze, vielleicht Mosey, schlief auf dem Bett, dort, wo sich die Matratze gesenkt hatte und anzeigte, daß Geoff übergewichtig gewesen war oder niemand je die Matratze gewendet hatte oder beides. Skip überlegte einen Augenblick lang, ob sie einander nahegestanden hatten, der Mann und die Katze, oder ob das Tier auf seine kätzische Weise spürte, daß Geoff bei seiner Rettung umgekommen war, oder ob es gar in einer Art von Einklang mit dem Geist des Verstorbenen stand.
Skip glaubte nicht an Geister, oder jedenfalls neigte sie im allgemeinen nicht dazu, länger über so etwas nachzudenken.
Es liegt an diesem Haus, dachte sie. Es macht mich ganz kribbelig.
Aber von der geisterhaften Katze und dem durchhängenden Bett einmal abgesehen, war das Zimmer vollkommen normal. Es war allerdings das Zimmer eines Jungen, nicht das eines Mannes – ganz eindeutig das Zimmer eines Jungen, der noch bei den Eltern wohnte. Roh zusammengezimmerte Bücherregale an den Wänden. Ein Schreibtisch aus einem Türblatt, mit kompliziert aussehender Computerhardware. Es gab auch einen Fernseher, ein Videogerät und Videos auf den Regalen neben den Büchern. Viele Science-fiction-Filme, und auch die meisten Bücher gehörten diesem Genre an. Aber es gab auch eine Menge Sachbücher – Computerfachliteratur, populärwissenschaftliche und auch einige wissenschaftliche Werke über Naturwissenschaft, dazu Geschichtsbücher; alles streng sachlich, außer zwei oder drei Bänden über Selbsthypnose.
Die Bücher faszinierten sie. Nur die Bücher und die Katze fielen aus dem Klischee heraus, dem der Rest des Zimmers so offensichtlich entsprach: die Katze, weil sie ein warmes, lebendes Wesen war, die Bücher, weil sie Themen behandelten, die nicht alle streng rational waren. Geoff mochte – so stellte sie sich das jedenfalls vor – zwar in einer Phantasiewelt gelebt haben, einer Welt der Zeitreisen und fremden Galaxien, aber solche Leute hatten im allgemeinen nicht das Bedürfnis, sich ihrem Inneren zuzuwenden. Sie waren eigentlich nur damit beschäftigt, Fakten über die rationale Welt zu verschlingen, oder sie versuchten, ihr zu entkommen.
Sie hatte das Gefühl, Geoff ziemlich gut beschreiben zu können. Er hatte bestimmt Übergewicht gehabt, Rettungsringe um den Bauch, aber diese Tatsache nie akzeptiert oder so wenig Gefühl für sich selbst gehabt, daß er immer T-Shirts getragen hatte, die eine Nummer zu klein waren, T-Shirts, die über seinem weißen und haarigen Bauch klafften und mit Schädeln oder Skeletten und den Namen von Death-Metal-Bands bedruckt waren – Napalm Death vielleicht oder Controlled Bleeding – und mit seltsamen, grausigen Symbolen und Worten, die so gar nicht zu diesem sanften, ungepflegten Mann passen wollten, der sie trug. Er hatte einen kurzen, rund geschnittenen Bart und dünnes braunes Haar, das immer nach einer Wäsche schrie. Und eine Brille. Er trug Joggingschuhe. Jeans, die tief saßen und die Ritze seines Hinterns enthüllten – eines flachen Hinterns. Früher einmal hatte er Fantasy-Rollenspiele gespielt, und vielleicht tat er das immer noch. Er war der fleischgewordene verschrobene Außenseiter, ein intelligenter junger Mann, der sich ganz in sich zurückgezogen hatte, kaum angepaßt, dem sein eigener Planet so wenig vertraut war, daß er lieber diejenigen bereiste, die seine Lieblingsautoren erfunden hatten, und der sich lieber in Cyberspace aufhielt, jenem geheimen, verträumten Ort, an den sein Computer ihn führte – an einem aufregenden Ort, der ihm wirklicher vorkam als sein eigenes Leben, in einem Land, das er erobern konnte, anders als jenes schäbige Teenagerzimmer im Haus seiner Eltern.
Skip wußte, daß ihre Phantasie sich überschlug, aber das Bild, das sie vor Augen hatte, war so lebhaft, daß sie erschrak. »Er muß ein sehr netter junger Mann gewesen sein«, sagte sie zu Marguerite. »Haben Sie was dagegen, wenn ich mir mal seine Papiere anschaue?«
Skip sah ihr an, daß es ihr nicht recht war, aber schließlich konnte sie schlecht ablehnen. »Nein«, sagte sie. »Machen Sie nur.«
Skip setzte sich an den Schreibtisch. Vor allem wollte sie sich Geoffs Dateien anschauen, die im Computer, aber vorläufig gab sie sich damit zufrieden, die Sachen auf seinem Schreibtisch durchzusehen; langsam, ganz langsam. Sie wollte, daß Marguerite das Zimmer verließ. Und das tat sie dann schließlich auch.
Schnell griff Skip unter die Matratze – sie erwartete zumindest ein paar Ausgaben des Playboy, fand aber nichts. Sie wühlte in den Schubladen und bemerkte, daß sie sich geirrt hatte, was die Death-Metal-T-Shirts anging; er hatte gebatikte getragen.
Dann wandte sie sich wieder dem Computer zu. Es gab Unmengen Dateien; sie wußte gar nicht, wo sie anfangen sollte. Sie fand auch eine Schachtel mit Disketten – Sicherheitskopien –, vielleicht würde Marguerite sie die mitnehmen lassen.
»Mrs. Terry?« Skip ging zurück ins Wohnzimmer, wo ihre Gastgeberin auf dem Sofa lag, mit der verknitterten Decke zugedeckt, und ins Nichts starrte, den weißen Hund zu ihren Füßen. Sie fragte, ob sie die Disketten mitnehmen dürfe, und erhielt die Erlaubnis; Marguerite war jetzt nur noch gleichgültig, offenbar völlig in Depressionen versunken.
»Nur noch eins, dann lasse ich Sie in Ruhe. Könnten Sie mir sagen, wie Geoffs Freundin hieß? Und sein Freund – Layne?« Sie hatte kein Adreßbuch und keine Kartei gefunden.
»Selbstverständlich. Lenore Marquer. Sie ist ein- oder zweimal vorbeigekommen. Layne auch, aber ich hab seinen Nachnamen nie richtig verstanden.«
»Wissen Sie, wo Lenore wohnt? Oder haben Sie ihre Telefonnummer?«
Marguerite schüttelte den Kopf. Skip bedankte sich und ging; draußen holte sie tief Luft, dankbar für den kühlen Herbsttag, und erst jetzt wurde ihr klar, wie dumpf und verbraucht die Luft im Haus gewesen war, säuerlich und abgestanden. Sie spürte, wie ihre Schritte beschwingter wurden, wie eine Last von ihren Schultern abfiel. War das für Geoffrey Kavanagh auch so gewesen? War ihm das Haus auch wie ein Mausoleum vorgekommen?
Und Marguerite Terry? Sie war die Herrin dieses Hauses, hatte es zu dem gemacht, was es war. Wie empfand sie es selbst?
Geoff mußte fest auf den Boden aufgeschlagen sein, aber nachdem Skip seine Mutter kennengelernt hatte, konnte sie sich gut vorstellen, daß Marguerite auch das verschlafen hatte; sie war ja selbst mit offenen Augen kaum wach.
Aber es gab doch bestimmt jemanden, der etwas gehört hatte?
Sie klopfte an den Türen.
Die nächste Nachbarin hatte den Aufprall nicht gehört, aber das Miauen der Katze; sie war kurz vor sieben davon geweckt worden und hatte aus dem Fenster gesehen, aber nichts entdeckt – nur eine Leiter, die an das Haus gelehnt war. Sie hatte sich gefragt, wieso die Katze nicht einfach die Leiter herunterkletterte. Sie hatte keinen Aufprall gehört, aber sie war auch eine halbe Stunde lang außer Haus gewesen, zwischen acht und halb neun, als sie ihren Mann zur Arbeit gefahren hatte.
Die Nachbarin auf der anderen Seite hatte ein dumpfes Geräusch und ein Klappern gehört, sich aber nichts dabei gedacht. Erst später war ihr klargeworden, daß das Geoffs Sturz und die Leiter gewesen sein mußten, aber beim ersten Hören war ihr nichts daran unheimlich vorgekommen – einfach ein Geräusch in der Nachbarschaft. Sie glaube, es sei kurz nach acht passiert.
Leider hatten weder diese Nachbarinnen noch sonst jemand in der Nähe jemanden am Haus gesehen, schon erst recht keine Fremden.
Niemand kannte Geoff oder die Terrys.
Skip fuhr zum Mondo Video.
Falls sie den Mondo-Freak erwartet hatte, in Übereinstimmung mit ihrem Bild von Geoff, dann hatte sie sich getäuscht. Der Geschäftsführer hatte Sommersprossen und beinahe militärisch kurz geschnittenes Haar. Er war breitschultrig, trug ein Button-down-Hemd, hatte einen klaren Blick und wirkte, als hätte er am liebsten einen dunkelblauen Blazer getragen und nur darauf verzichtet, weil er wußte, das so etwas in einer Videothek fehl am Platze war. Er war etwa eins dreiundsiebzig groß und gab Skip, die mit ihren eins achtzig eigentlich an kleinere Männer gewöhnt war, das Gefühl, als müsse sie sich bücken, um mit ihm reden zu können. Er hatte den festen Händedruck eines Jungen, der so etwas auf einer guten Schule gelernt hat, und den Namen einer Familiendynastie. »Knowles Kennedy«, sagte er, als er den Händedruck anwandte.
Skip quetschte zurück, stellte sich vor und erklärte, was sie wollte.
»Geoff«, meinte Knowles, »einer unserer besten Leute. Wirklich klug und kenntnisreich. Aber nicht besonders ehrgeizig.«
Skip hielt ihn für etwa vierundzwanzig, und er hatte es schon weiter gebracht als Geoff.
»Aber mit Science-fiction kannte er sich aus?«
»Das war sein Gebiet. Woher wissen Sie das?«
»Ich hatte einfach so ein Gefühl.«
»Was für ein Gedächtnis! Der Bursche konnte einem jede einzelne Szene aus Der Tag, an dem die Erde stillstand erzählen oder aus – was war das noch für ein Ding, wo sie Kopien von Menschen machen?«
»Die Körperfresser kommen.«
»Genau. Beide Fassungen. Aber er kannte auch all das obskure Zeug genau. Und alle neuen Videos. Auch anderes – ich meine, außer Science-fiction. Er konnte die Titelsongs sämtlicher James-Bond-Filme singen.«
»Er muß bei den Kunden sehr beliebt gewesen sein.«
Knowles’ Miene verdüsterte sich. »Nicht unbedingt. Ich denke, er war schüchtern. Er konnte mit Leuten über Filme reden, aber es wäre ihm nie eingefallen zu fragen, wie es einem geht. Nicht besonders kommunikativ, würde ich sagen. Er hat ganz in seiner eigenen Welt gelebt, in seinem Kopf. Als wäre das die wirkliche Welt und alles, was hier draußen passierte, für ihn nur eine Ablenkung.«
Skip grinste. »Abgedreht?«
»So hätte man es ausdrücken können. Ich meine, er hat schon funktioniert, er ist hier großartig zurechtgekommen; aber der Bursche war brillant – ehrlich, und der Job hier hat ihn unterfordert.«
»Wie kommen Sie darauf, daß er brillant war?«
»Na ja, aus der Art, wie er geredet hat. Er hatte alles abgespeichert, wie ich schon sagte, er hat sich an jedes Detail aus jedem Film erinnert, den er je gesehen hat, und er kannte auch Unmengen anderer Fakten. Vor allem naturwissenschaftliche. Ich glaube nicht mal, daß er auf dem College war – jedenfalls nicht sehr lange. Er hatte sich alles selbst beigebracht, und es gab nicht viel, worüber er nichts wußte. Wenn Sie es wirklich wissen wollen: Er konnte ein ziemlicher Klugscheißer sein.«
»Hörte er sich gerne reden?«
Knowles zögerte. »Nein, ich glaube, das war es eigentlich nicht. Dazu hatte er nicht genug – wie heißt das – Selbstvertrauen. Ich glaube, es ist ihm einfach nicht aufgefallen, wenn er anfing zu dozieren. Es war die einzige Art von Kommunikation, die er beherrschte. Wissen Sie, er konnte einem all dieses Zeug über die Rosenkriege oder das Heilige Römische Reich erzählen, aber er hat nie mitgekriegt, wenn er einen fast zu Tode langweilte, weil er nichts von Menschen verstand, um die Reaktionen von anderen deuten zu können. Er konnte einen nicht mal richtig ansehen – hat immer nur vor sich hingestarrt oder so, vor sich hingeschwafelt und geglaubt, man wäre fasziniert. Ein einfaches: ›Na, wie geht’s?‹ wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Er war schüchtern, verdammt schüchtern. Aber nett. Er hat es wirklich gut gemeint.«
»Ja?«
»Ehrlich. Er wollte, daß alle so viel Spaß an seinen Lieblingsthemen hatten wie er selbst. Er konnte sich nicht an die Gesichter oder Namen der Kunden erinnern, aber wenn er sah, was für Filme sie zurückbrachten, hat er sie gefragt, wie sie ihnen gefallen haben – und dann hat er sich die Beine ausgerissen, um was Neues zu finden, was ihrem Geschmack entspricht.«
Das bestätigte mehr und mehr die Vermutungen, die Skip schon in Geoffs Zimmer beschlichen hatten. Spontan fragte sie: »Wie hat er denn ausgesehen?«
»Wie er ausgesehen hat? War denn sein Gesicht –«
»Nein, nein. Ich bin nur neugierig.«
»Ich glaube, ich habe noch ein Foto von einer Geburtstagsfeier.« Er verschwand und kam wieder zurück. »Da. Der in dem komischen T-Shirt.«
Sie hatte fast total schiefgelegen und doch auch wieder irgendwie richtig: Der Mann auf dem Bild war der typische beste Freund des Mannes, den sie sich vorgestellt hatte. Er war dünn, nicht dick, von mittlerer Größe und glatt rasiert. Aber ein Bart wäre keine schlechte Idee gewesen; er hatte ein fliehendes Kinn. Drei Dinge hatte sie vollkommen richtig getroffen: Er hatte tatsächlich eine Brille getragen, sein Haar war dünn und fettig gewesen, und er war ein Ausbund an Verschrobenheit.
Was war nur mit diesen Typen los? Wieso entsprachen alle so perfekt dem Stereotyp – genial, introvertiert, verschroben und begeistert von Computern und Science-fiction? Sie wußte die Antwort, oder sie glaubte sie zumindest zu wissen. Sie kamen mit der wirklichen Welt nicht zurecht, hatten zuwenig Selbstvertrauen (wie Knowles Kennedy, der mehr als genug davon besaß, schon beobachtet hatte) und suchten sich alternative Welten.
Also gut, so waren sie im allgemeinen, aber was hatte darüber hinaus Geoff Kavanagh ausgemacht? War er noch mehr gewesen als die Idealbesetzung für einen Außenseiter? Worin hatte denn nun seine ganz persönliche Variante des Außenseitertums bestanden? So konnte sie die Frage selbstverständlich nicht stellen. »Was war ungewöhnlich an ihm?« fragte sie schließlich.
»Ungewöhnlich?« Knowles war verwirrt. »Na ja, er war... so klug und so. Ich weiß nicht – ansonsten war er der übliche –«
»Verschrobene Spinner.«
»Genau.«
»Hatte er Feinde?«
»Was? Glauben Sie etwa, er sei ermordet worden?«
Skip zuckte die Schultern. »Ich muß diese Frage stellen.«
»Ob er Feinde hatte? Er hatte nicht mal Freunde.«
»Woher wissen Sie das?«
Knowles schien verlegen. »Eigentlich weiß ich es gar nicht. Es ist nur, daß er nie von Freunden gesprochen hat. Er hat nie über irgendwas anderes als über Dinge geredet, über Ereignisse, Sachen, die man in Büchern nachschlagen konnte. Nie über das Leben. Er hat kaum je private Anrufe bekommen. Er konnte immer Überstunden machen oder für andere einspringen. Ich glaube sogar, er hat noch bei seinen Eltern gewohnt.«
»Hat ihn irgend jemand hier besser gekannt als Sie?«
»Na ja, vielleicht Jody. Sie hat viel mit ihm zusammengearbeitet. Hey, Jo!«
Eine rundliche junge Frau trat zu ihnen, eine Schwarze in Kleidern, die ein paar Nummern zu klein für sie waren – aber ihrem wiegenden Gang nach zu urteilen, war sie sehr zufrieden mit ihrem Äußeren. »Jody, das hier ist Officer Langdon. Sie ermittelt wegen Geoffs Tod.«
»Er war ein guter Junge. Alle hatten Geoff gern.«
»Sie auch?«
»Aber sicher. Mit Geoff zu reden war wie aufs College zu gehen.«
»Hat er je über sein Privatleben gesprochen?«
»Angeblich hatte er eine Freundin.«
»Hat er ihren Namen mal erwähnt?«
»Lenore. O ja, sicher hatte er eine Freundin. Die Welt ist schließlich voll mit Frauen, die Lenore heißen. Er hat den Namen wahrscheinlich aus einem Buch. Wissen Sie, ich hab über Sachen geredet, Läden, Kneipen, gleich hier um die Ecke, und er wußte nicht mal, was ich meine. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, daß er viel rausgekommen ist. Hat mit seinem Computer zu Hause gehockt. Jede Nacht hat er in dieser komischen Stadt festgesessen, das war seine Welt. Kennen Sie die TOWN?«
Skip schluckte. Knowles sah so verstört aus, wie sie sich fühlte.
»Die TOWN. So eine Computergeschichte. Warten Sie mal, er hat’s mir mal genauer erzählt... mal sehen, ob es mir wieder einfällt.« Sie legte die Hand an die Stirn und schloß die Augen. »The Original Worldwide Network.«
»Ah. Die TOWN. Eine Mailbox oder so was?»
Sie zuckte die Achseln. »Mehr eine Religion. Oder eine richtige Stadt. Wissen Sie, er hat von den Sachen, die in der TOWN passieren, immer gesprochen, als wäre das die Wirklichkeit.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich dachte immer, er braucht ’ne Freundin. Ich wollte ihn verkuppeln, aber dann hat er gesagt, er hätte schon eine. Aber das war bestimmt gelogen. Wissen Sie was? Er war wirklich ’n komischer Kerl.«
»Was war denn nun so komisch an ihm? Was war anders als bei anderen?«
»Er hat richtig durch einen durchgesehen, hat einen nicht mal bemerkt.«
»Er war schüchtern«, warf Knowles ein.
»Quatsch. Der war nicht schüchtern. Der war kaum am Leben.«
2
Vielleicht, dachte Skip, kann ja die Freundin ein wenig Licht in die Sache bringen. Marguerite Terry hatte ihr eine Telefonnummer gegeben, unter der die folgende Nachricht abgespielt wurde: »Wenn es gerade Tag ist, bin ich in der Perlmuschel. Wenn es Nacht ist, fragt lieber nicht – besonders bei Vollmond.« Dem folgte ein so teuflisches Gackern, wie man es sonst nur noch bei Macbeth-Aufführungen zu hören bekam. Gut, daß es noch Tag war, aber was zum Teufel war die Perlmuschel?
Dem Telefonbuch zufolge befand sie sich in der Magazine Street. Wahrscheinlich ein Laden.
Dort angekommen, war Skip nicht mehr so sicher. Es war ein Laden, aber war es auch ein Geschäft? Das mußte wohl so sein, falls der Handel mit Kunstperlen nicht als Vorwand für eine Geldwaschanlage diente – denn Perlen waren alles, was es hier gab. Winzig kleine, große, Glasperlen, Kristallperlen, Bernsteinperlen, Jettperlen, geschnitzte Perlen, bunt gemusterte und solche mit Farben in erstaunlicher Klarheit, genug, um damit einen Schuhkarton zu füllen, wenn man den gesamten Bestand zusammengeworfen hätte. Aber so könnte man sie natürlich nie verkaufen. Sie wurden in Hunderten kleiner Plastikkästchen präsentiert und kosteten zehn Cent pro Stück und mehr. Aber trotzdem. Wie konnte man davon leben, Perlen zu verkaufen? Wer kaufte so was?
Es war nur eine Person im Laden, eine nicht besonders große Frau, um die Dreißig, mit dunklem, glattem Haar, einem Strich roten Lippenstifts und einem kurzen schwarzen Kleid, das als Folie für ein halbes Dutzend zweifellos selbstgemachter Halsketten diente. Sie hatte ein kleines, zartes Gesicht, herzförmig, ein Jungengesicht mit einem fliehenden Kinn, das Skip an Geoffs Kinn erinnerte. Wenn das hier Lenore war, dann hatten die beiden zusammengepaßt wie Mick und Bianca. Mit ihrer Zierlichkeit und ihren verhuschten Bewegungen hatte sie etwas von einem Rehkitz, aber sie war nicht hübsch und vermutlich auch nicht unschuldig – sie sah einfach nur aus, als sei sie leicht zu erschrecken.
Als Skip näher kam, sah sie, daß die Frau einen Leberfleck nahe dem Mundwinkel hatte, einen kleinen Schönheitsfehler, der ihrem Gesicht Persönlichkeit verlieh. Sie hatte das Gefühl, ein Gespräch mit ihr würde dem Versuch ähneln, Wasser mit der Hand aufzufangen.
»Lenore Marquer?«
Der Mund der Frau begann zu zittern. »Ja. Ist mit Caitlin alles in Ordnung?«
»Caitlin?«
»Meine Tochter. Sie sind nicht wegen ihr hier?«
»Nein.«
Lenore seufzte erleichtert. »Gott sei Dank. Sie ist bei einer Tagesmutter – ich lebe in ständiger Angst.«
Skip lächelte; froh, sie beruhigen zu können. »Nein, darum geht es überhaupt nicht. Ich bin Skip Langdon von der hiesigen Polizei –«
»O Gott, es ist wegen Geoff! Mist! Ich hab’s doch gewußt. Ich wußte es einfach. Ich hab’s denen auch gesagt. Scheiße! Er ist umgebracht worden, stimmt’s? Wir haben das alle gewußt. Es war nur eine Frage der Zeit...«
»Langsam, langsam. Sie wissen offenbar mehr als ich.«
»Geht es denn nicht um Geoff?«
»Doch, doch.«
»Der Autopsiebericht. Deshalb ermitteln Sie jetzt, nicht wahr? Endlich. Wir dachten schon, es würde gar nichts passieren. Mein Gott, wir haben uns solche Sorgen gemacht, aber wenn es jetzt wirklich losgeht, so kalt, so real ...« Sie preßte sich die Hände auf den Mund, offensichtlich, um ein Schluchzen zu unterdrücken, das nicht zu unterdrücken war. Ihre Tränen flossen wie warmer Regen, und sofort nahm ihr Gesicht ein fleckiges Rot an, beinahe Rotbraun. Sie brach völlig zusammen, und Skip mußte sich daran erinnern, daß Geoff erst fünf Tage tot war – die Wunde war immer noch offen, immer noch entzündet und gefährlich.
»Lenore, vielleicht setzen Sie sich lieber hin.« Skip sah sich nach einem Stuhl um, aber nicht einmal ein Hocker war zu finden.
Lenores Schultern zuckten immer noch unkontrolliert. Da sie sich nicht hinsetzen konnte, kam sie hinter der Theke vor, zog die Tür auf und holte demonstrativ tief Luft. Sie hatte eine Tätowierung am Fußknöchel, eine sehr hübsche zusammengerollte Schlange.
Skip stand Höllenqualen aus. Es war nur zu deutlich, daß Lenore nicht reden konnte – sie konnte ja kaum atmen –, aber es brachte sie fast um, nicht gleich ihre Fragen abfeuern zu können.
Zwei Frauen, die gerade an dem Laden hatten vorbeigehen wollen, wurden offenbar von dem Gesicht in der Tür angezogen. »Sieh mal«, sagte eine. »Gehen wir mal rein und schauen uns um.«
Lenore trat zur Seite.
»Was ist denn das – ein Perlenladen? Sie verkaufen hier Perlen?«
Lenore rang sich ein Lächeln ab. »Und ein paar Ketten, die wir selbst herstellen.«
»Geht es Ihnen nicht gut?«
»Doch – bestens – äh, es ist eine Allergie. Kann ich etwas für Sie tun?«
Die Frau wandte sich ihrer Freundin zu. »Steff, das könnte die Lösung sein.« Und zu Lenore sagte sie: »Ich habe ein Kostüm in einem ganz bestimmten Ockerton, und ich kann einfach nichts finden, was dazu paßt.«
»Dann sehen wir mal. Welche Farbe hat denn die Bluse, die Sie üblicherweise dazu tragen?«
Skip zog in Erwägung, auf die kleinen Vitrinen einzuschlagen. Oder noch besser auf Steff und ihre Freundin. Aber sie konnte nichts anderes tun als warten. Zehn Minuten später warf Lenore ihr einen hilflosen Blick zu und sagte zu ihren Kundinnen: »Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen?«
Sie trat zu Skip. »Tut mir leid, aber ich bin hier nur angestellt, der Laden gehört mir nicht. Ich kann es mir einfach nicht leisten, diesen Job zu verlieren.«
Irgendwie gelang es ihr, aus allem eine Tragödie zu machen; Skip hatte wirklich nicht vorgehabt, sie um ihre Stelle zu bringen. Aber bevor sie antworten konnte, sagte Lenore: »Hören Sie, ich weiß sowieso nichts. Wieso sprechen Sie nicht mit Layne? Er ist Geoffs bester Freund, und er arbeitet zu Hause. Er hat Zeit.«
»Layne wer?«
»Bilderback. Er wohnt im Quarter.«
Das paßte wunderbar, denn Skip wohnte auch dort. Auf diese Weise konnte sie sich ein Sandwich mit nach Hause nehmen und zwischen zwei Befragungen kurz die Füße hochlegen.
Ich könnte sogar meditieren.
Als sie wieder im Wagen saß, mußte sie lachen. Damit nahm sie sich immer selbst auf den Arm: sie würde ja meditieren, wenn sie nur könnte – sie konnte bloß nicht stillsitzen. Vor allem war sie nicht dazu in der Lage, wenn Adrenalin durch ihren Kreislauf rauschte wie jedesmal, wenn sie so fasziniert von einem Fall war wie von diesem. Selbst die Füße hochzulegen wäre schon anstrengend. Zum Teufel damit. Sie aß ihr Sandwich im Stehen, in der Küche, schaute dabei ihre Post durch und fragte sich, wieso Lenore Marquer vor ihr von dem Autopsiebericht erfahren hatte.
Sie aß schnell und wußte, daß ihr das in ein paar Minuten leid tun würde, aber sie war einfach nicht in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, war in Gedanken schon bei Layne Bilderback.
Er wohnte am Rand des Quarter, auf der Downtown-Seite der Esplanade, nahe der Dumaine. Nicht die beste Gegend, hätten einige bemängelt, aber wunderschön; atemberaubend schön. Wenn man den baumbestandenen Mittelstreifen (in New Orleans hieß so etwas »Neutrale Fläche«) und die geschmackvollen alten Häuser sah – Häuser, die beinahe lebendig schienen, die so freundlich aussahen, als beugten sie sich vor, um einen zu begrüßen –, konnte man kaum glauben, daß hinter diesen Fassaden der Drogenhandel florierte, aber genau das passierte hier und so manches mehr; wie Skip nur allzu gut wußte, denn sie hatte im VCD gearbeitet, dem Vieux Carre District, jetzt prosaisch ›achter Bezirk‹ genannt.
Auf den Stufen des Hauses, in dem Layne wohnte, saß ein Schwarzer. »Wie geht’s?« sagte er, so freundlich, als hätte man die Uhr fünfzig Jahre zurückgedreht.
Skip blieb stehen, um diesen Augenblick zu genießen. »Gut, danke. Aber ziemlich kalt.« Sie schauderte ein wenig.
»Ja. Meine Frau läßt mich drin nicht rauchen – ihr ist es lieber, wenn ich mich hier totfriere.«
»Wenigstens läßt Sie sie danach wieder heim.« Nicht besonders komisch, aber sie und der Mann lachten trotzdem, und für einen Augenblick waren sie Freunde. Solche Augenblicke erlebte man nicht in jeder Stadt, dachte sie immer, wenn sie New Orleans gerade mochte – was in diesem Moment der Fall war.
Ich bin ja richtig glücklich, dachte sie überrascht, und dann erinnerte sie sich voller Schuldgefühle daran, daß sie in einem Mordfall ermittelte.
»Wohnt Layne Bilderback hier?«
»Oben.«
Sie klingelte, und einen Augenblick später trat ein junger Weißer auf den Balkon hinaus. »Ja?«
»Ich heiße Skip Langdon – hat Lenore Marquer angerufen und gesagt, daß ich vorbeikomme?« Sie wollte vermeiden, auf der Straße das P-Wort auszusprechen.
»Nein. Hätte sie das tun sollen?«
»Ich bin Polizistin. Darf ich reinkommen?«
»Zeigen Sie mal Ihre Marke.«
Der Raucher war bereits verschwunden, entweder weil er verschreckt war oder weil er sich nicht einmischen wollte. Skip zeigte ihre Marke.
»Worum geht es überhaupt?«
»Ich glaube, das wissen Sie.«
»Es wurde ja auch Zeit«, sagte er und ließ sie herein.
Er war – nach Skips Maßstäben – ziemlich klein, hatte etwa Knowles Kennedys Größe. Obwohl er ein Sweatshirt und Jeans trug, konnte sie sehen, wie muskulös er war, wie schlank seine Taille; bestimmt trainierte er regelmäßig. Er war blaß, hatte kaum Haare und trug eine Brille. Das ist kein so verschrobener Spinner wie Geoff, dachte sie, aber vielleicht ein Intellektueller. Dies schloß sie aus der Umgebung und aus Bilderbacks Äußerem. Das Zimmer war das übliche Quarter-Juwel mit hoher Decke und Balkontüren, aber die Wände waren von einem schmutzigen Beige, als seien dem Bewohner Farben gleichgültig, die Möbel bestenfalls funktional – mehr oder weniger Sperrmüll. Allein auf dem Boden stapelten sich mehr Bücher und Zeitschriften, als manche Kleinstadtbibliothek vorzuweisen hatte. Es gab auch Regale, aber die waren nur zur Hälfte voller Bücher, die andere Hälfte des Platzes nahmen Pappkartons ein, offensichtlich Brettspiele, aber viel mehr, als Skip je für wahrscheinlich gehalten hätte.
»Kommen Sie von der Mordkommission?« Er zeigte auf eine durchgesessene Couch mit einer gefälschten Navaho-Decke darauf, die vermutlich die Risse im Bezug und Flecken verbergen sollte.
Sie setzte sich. »Ja. Und wissen Sie, wieso ich hier bin?«
»Wegen Geoff Kavanagh. Darf ich Ihnen etwas anbieten?«
Ungeduldig schüttelte sie den Kopf. Sie hoffte, er würde weitersprechen, und sie wurde nicht enttäuscht.
»Endlich reagiert also jemand auf den Autopsiebericht. Wir haben uns schon gefragt, ob wir das Polizeipräsidium stürmen sollen oder so.« Er setzte sich auf einen schäbigen Rattanstuhl.
»Könnten Sie mir vielleicht sagen, was hier eigentlich los ist? Und wer ist ›wir‹?«
»Die ganze TOWN spricht davon, Officer.«
»Detective«, fauchte sie. Normalerweise waren ihr Ränge vollkommen gleich, aber dieser Bursche machte sie wütend. »Sie meinen, das Computernetzwerk?«
»Ach, Sie wissen von der TOWN?«
»Offensichtlich längst nicht genug.«
»Kommen Sie, ich zeig’s Ihnen.«
»Lassen Sie uns erst noch einen Moment reden.« Sie hatte das Bedürfnis, wieder Herrin der Lage zu werden. Die ganze Sache glitt ihr langsam aus der Hand. »In welcher Beziehung standen Sie zu Geoff Kavanagh?«
Er wurde rot. »Wir hatten nichts miteinander, wenn Sie das meinen.«
»Das meinte ich nicht.«
»Na ja – er war mein bester Freund, und ich bin so offen schwul, wie man nur sein kann.«
Sie mußte sich zusammennehmen, nicht auf die Uhr zu sehen. Wir kennen uns gerade – wie lange, zwei Minuten vielleicht? dachte sie, und schon weiß ich eines über dich. Das.
»Wo haben Sie einander kennengelernt?«
»Online.«
»Wie bitte?«
»In der TOWN. Wir sind beide in der Südstaaten-Konferenz und fanden heraus, daß wir beide in New Orleans wohnen. Also haben wir uns getroffen; wir hatten viele gemeinsame Interessen.«
»Zum Beispiel?«
»Ach, Computer. Virtuelle Realität. Virtuelle Gemeinschaften. Virtueller Sex.«
»Virtueller was?«
»Den Sex habe ich nur erwähnt, um Sie wachzurütteln. So etwas ist noch nicht entwickelt worden, aber alle sitzen schon in den Startlöchern. Virtuelle Gemeinschaften gibt es allerdings schon. Die TOWN ist eine davon. Wir kennen uns und kümmern uns umeinander, obwohl die meisten einander nie gesehen oder gehört haben und es auch nie tun werden. Die Zentrale ist irgendwo in Kalifornien, und dort wohnen auch die meisten User. Aber ich kenne Darlis und Busy von der Westküste ebensogut wie Leute hier in New Orleans.«
»Layne, Sie sollten öfter ausgehen.«
»Genau das kann ich aber nicht. Ich arbeite zu Hause, und am liebsten bleibe ich auch hier.«
»Einen Moment, was tun Sie eigentlich?«
»Sie meinen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Ich konstruiere Rätsel.«
»Sie konstruieren Rätsel?«
»Ja. Wie Kreuzworträtsel und Logeleien. Meist für Rätselblätter und eine oder zwei der größeren Zeitschriften.«
»Na ja, irgendwo müssen die ja auch herkommen.«
»Glauben Sie nicht, daß es auch Spaß macht?«
»Doch, doch. Ich bin nur ganz platt über diese Begegnung. Ich glaube, ich habe noch nie einen Rätselmacher getroffen.«
»Und dabei wollten Sie das doch immer.« Er schenkte ihr ein gewinnendes Lächeln, und seine blauen Augen blitzten derart, daß sie geschworen hätte, er versuche zu flirten – was er vermutlich auch tat. Ihr war aufgefallen, daß Schwule oft mit ihr flirteten, und das gefiel ihr – man war so wunderbar sicher vor Mißverständnissen.
»Wahrscheinlich.« Sie hatte ihren Zorn beinahe vergessen. Aber das änderte sich, als ihr auffiel, was Laynes Aussage über seinen Beruf bedeutete. »Und Geoffs Tod betrachten Sie ebenfalls als Rätsel, das es zu lösen gilt.«
Er zuckte die Achseln. »Wenn einem der beste Freund stirbt, tut man einfach das, was man kann. Ich habe einen Freund, der drüben in Kalifornien für eine Zeitschrift arbeitet. Jedesmal, wenn wieder ein Schwuler an Aids gestorben ist, versucht er, den Auftrag für den Nachruf zu bekommen. Das ist seine Art, damit umzugehen.«
»War Geoff schwul?« Skip wußte, das führte nur vom Thema weg, aber das Gespräch entwickelte sich ohnehin ausgesprochen chaotisch.
»Nicht daß ich wüßte. Und, wie ich schon sagte, er war mein bester Freund.« Unter seiner Schlaumeierei lag eine Offenheit, eine Direktheit des Ausdrucks, die Skip gefiel, und sie fragte sich, ob sie ihm trauen konnte.
»Also gut. Wie haben Sie erfahren, daß Geoff tot ist?«
»Lenore hat es mir erzählt. Sie hatte ihn in der Videothek angerufen, und er war dort nicht aufgetaucht. Dann hat sie es bei ihm zu Hause versucht, und seine Mutter hat es ihr gesagt. Ich war ganz aufgeregt und habe eine Meldung losgelassen. Und dann haben alle es aufgegriffen, im ganzen Land. Es gibt regelrechte Konferenzen darüber – wir glauben, er ist ermordet worden.«
»Langsam, ich hab längst den Faden verloren. Ich kann ja verstehen, daß Sie Geoffs Tod als Rätsel betrachten, weil Sie Rätselmacher sind, ich kann sogar verstehen, wenn man versucht, den Schmerz um den Tod eines Freundes durch intellektuelle Aktivitäten zu verdrängen...«
Er zuckte zusammen; vermutlich war es ihm höchst unangenehm, Gefühle auch nur erwähnt zu wissen.
»... aber ich verstehe nicht, wie Sie zu dem Schluß gekommen sind, Ihr Freund sei ermordet worden, nur weil er durch einen Unfall umgekommen ist.«
»Oh. Ich nehme an, Sie wissen nichts von den Rückblenden?«
»Ist das wieder ein Computerfachausdruck, den ich nicht kenne?«
»Sie haben wirklich keine Ahnung, wie?«
»Ahnung wovon, verdammt noch mal?« Sie merkte, wie sehr es ihr gegen den Strich ging, die Situation nicht selbst in der Hand zu haben.
»Also gut, wenn ich es richtig verstehe, sind Sie nur wegen des Autopsieberichtes hier. Sie wissen bisher nur, daß Geoffs Tod als ›verdächtig‹ betrachtet wird?«
»Überlassen Sie die Fragen gefälligst mir.«
Layne lehnte sich zurück. »Schießen Sie los.«
»Erzählen Sie mir von diesen Rückblenden.«
»Das wollte ich gerade tun. Ich wollte mich nur überzeugen, wieviel Sie schon wissen, damit wir nicht unnötig Zeit verschwenden.«
Sie blieb ruhig, auch wenn sie vor Anstrengung mit den Zähnen knirschte.
Aber Layne konnte sich nicht bremsen: »Ist das jetzt unser erster Krach?«
Sie war wütend auf sich selbst, weil sie zugelassen hatte, daß er sah, wie sehr sie sich ärgerte, und sie fragte sich, wie sie aus dieser Situation wieder herauskommen sollte. Sie versuchte es mit einem Lächeln, von dem sie nur hoffte, daß es nicht wie das starre Grinsen einer Leiche wirkte. »Rückblenden.«
»Na gut, wir können ja später darüber reden. Also, es war in der Beichte –«
»Wie bitte?«
»›Beichte‹. Das ist der Name der Konferenz.«
»Und was ist eine Konferenz?«
»Ein Ort, an dem man über ein bestimmtes Thema reden kann – ein virtueller Ort natürlich. Manchmal geht man zur ›Beichte‹, und es gibt ein neues Thema, sagen wir mal Sex, und Leute steuern bloß Dinge bei wie: ›Ich hatte seit zwei Monaten keinen mehr. Wie sieht’s bei euch aus?‹ Das hängt von der Tagesform ab, vom Glück, wissen Sie? Manchmal ist es ziemlich langweilig, und manchmal kommen die Leute wirklich zur Sache.«
»Also kam das Thema Rückblenden auf?«
»O nein, es ging um ›Mord in der Nachbarschaft‹ oder so was Ähnliches. Ich weiß nicht genau. Jemand ist auf die Idee gekommen, was zu schreiben über dieses Phänomen, daß nach der Festnahme eines Serienkillers stets jedermann verkündet, was für ein netter, ruhiger Mensch er doch gewesen sei. Und er wollte wissen, ob die Leute jemanden kannten, den sie für einen Mörder hielten. Man braucht wohl nicht zu betonen, daß es dann sehr interessant wurde, und schließlich änderte sich das Thema ein wenig, in Richtung ›Mord zu Hause‹, nur, daß solche Sachen immer anders genannt werden.«
»Jetzt blicke ich schon wieder nicht mehr durch.«
»Keine Sorge, ich setze Sie schon ins Bild. Wenn bei Leuten zu Hause ein Mord passiert, nennt man es nie so, jedenfalls nicht, wenn keiner verhaftet wird. Wie der Bursche, dessen Oma aus dem Fenster fiel, während Opa im Zimmer war. Hat er sie nun geschubst oder nicht? Es ging etwa eine Woche lang so weiter, und Geoff hat behauptet, er glaube, tatsächlich einmal Zeuge eines Mordes geworden zu sein.«
»Was?« Skip fuhr auf, konnte kaum mehr stillsitzen.
»Es ging um den Mord an seinem Vater.«
Sie sank wieder zurück. »Weiter.«
»Er sagte, er habe einen komischen Traum gehabt, als das Thema zum erstenmal erwähnt wurde, über Schreie in der Nacht und jemanden, der versuchte einzubrechen; eine Art Alptraum. Er hat ihn aufgeschrieben und versucht, die Bedeutung rauszufinden, und dann glaubte er, sich tatsächlich an ähnliche Szenen erinnern zu können. Jedenfalls an das Gefühl, wirklich Angst zu haben.
Und was er tatsächlich wußte, ist folgendes: Als er vier Jahre alt war, sind er und seine Mutter abends nach Hause gekommen und haben seinen Vater tot auf dem Schlafzimmerboden gefunden. Mit seinem eigenen Revolver erschossen – er war ein Cop.«
»Ein Cop!«
»Ein Kollege. Geoff glaubte, sich daran erinnern zu können, wie er nach Hause kam – mit seiner Mutter zusammen die Treppe raufging und dann ins Schlafzimmer, wo sie die Leiche fanden. Aber er hat sie mal gefragt, und sie behauptete, es sei ganz anders gewesen. Sie sagte, Geoff sei die Treppe raufgerannt und ins Bad gegangen; und inzwischen sei Marguerite – also seine Mutter – ins Schlafzimmer gegangen und habe dort das Licht angemacht. Sie hat sich ungeheuer beherrscht, nicht zu schreien, denn sie wollte nicht, daß der kleine Geoffrey erfuhr, was geschehen war, also hat sie das Licht wieder aus- und die Tür zugemacht, ist runtergegangen und hat die Bullen angerufen.«
»Verdammt cool.«
»Ach, wer weiß, was wirklich passiert ist? Das hat sie bloß Geoff erzählt. Es hat aber dazu geführt, daß er glaubte, seine eigenen Erinnerungen seien falsch – oder könnten es jedenfalls sein. Und nach diesem Traum hatte er immer wieder seltsame Rückblenden, wenn man es so nennen kann, wie Inzestopfer sie haben sollen – so was wie Bruchstücke von Erinnerungen. Im Bett zu liegen und einen Streit zu hören. Den Flur entlangzurennen. Das Gesicht seiner Mutter. Sein Dad auf dem Boden... eigentlich hatte er so was immer schon gehabt, schon bevor seine Mutter ihm erzählte, daß er seinen Vater nie dort gesehen hat. Verstehen Sie, was ich damit sagen will?«
»Und er hat diese Sachen im Netzwerk veröffentlicht?«
»Ja.«
»Unter seinem eigenen Namen?«
»Man kann in der TOWN seine Identität nicht verbergen – man hat eine User-ID, aber jeder kann in etwa zwei Sekunden rausfinden, wer dahintersteckt. Geoff war Vidkid.«
»Wenn das also stimmt, wenn er wirklich Zeuge dieses Mordes gewesen ist oder sogar vor dem Mord im Haus war, hat er es dann die ganze Welt wissen lassen. Meinten Sie das?«
»Zu diesem Schluß sind wir gekommen, ja. Nachdem wir das mit dem ›Unfall‹ rausgefunden hatten.«
Jetzt sah Skip ein, wieso die ganze TOWN um dieses Thema gekreist war. »Also gut, jeder in der TOWN konnte rausfinden, wer Geoff war. Konnte er seinerseits irgendwie feststellen, wer seine Meldungen las?«
Layne schüttelte den Kopf. »Vergessen Sie’s. Die TOWN hat beinahe zehntausend Teilnehmer, über die ganze Welt verstreut. Es ist durchaus möglich, daß jemand in Marrakesch die Meldungen gesehen hat und nach New Orleans gekommen ist, nur um Geoff aus dem Weg zu schaffen, bevor seine Erinnerungen klarer wurden.«
Oder vielleicht hatte Geoff sich ja bereits erinnert und versucht, den Mörder zu stellen. Es mußte überhaupt niemand sein, der mit der TOWN zu tun hatte – sondern nur jemand, den er kannte.
»Was hat er sich bloß dabei gedacht?« jammerte sie.
»Alles zu veröffentlichen? Na ja, das gehört sozusagen zu den Traditionen der TOWN. Wenn man etwas Schlimmes durchmacht – und das hat er wirklich –, wendet man sich um Hilfe und Trost an seine Kumpel.«
»Er hat diese Leute ja nicht mal gekannt.«
»Hat er doch.«
»Entschuldigen Sie mal – zehntausend?«
Layne schaute verlegen drein.
»Mein Gott!« fuhr sie fort. »Für so was gibt es Therapeuten!«
»Die TOWN ist erheblich zugänglicher – und billiger.«
»Nicht in diesem Fall.«
Jetzt sah er ziemlich jämmerlich aus. »Es hätte einer von uns sein können. Das wissen wir.«
»Und wie war das mit dem Autopsiebericht?«
»Lenore hat ihn sich irgendwie verschafft – fragen Sie mich nicht, wie. Sie hat ihn ins Netz eingegeben, und PX, der in Portland wohnt, Med aus Pensacola und Sayah aus Savannah haben ihr fachliches Urteil als Mediziner abgegeben. Heute ging es vor allem darum, ob wir die Polizei benachrichtigen sollen oder nicht.«
Skip seufzte. »Jetzt zeigen Sie mir am besten mal, wie dieses Ungetüm aussieht.«
Layne grinste wie ein kleiner Junge. »Ich habe gehofft, daß Sie das sagen.«
Sein Computerraum sah aus wie die Kommandobrücke des Raumschiffs Enterprise. Hier hatte er sehr viel mehr Sorgfalt verwendet als beim Rest der Wohnung. Skip ließ sich vor dem Farbmonitor nieder.
»Also, jetzt logge ich mich ein. Sehen Sie? Ich benutze meine User-ID, mein Benutzerkennwort – Teaser. Und jetzt wird nach meinem Password gefragt.« Er bediente die Tasten, aber auf dem Bildschirm erschien nichts. Dann tauchte eine Zeile auf: »Willkommen in der TOWN!
»Wer kennt Ihr Password?«
»Ich und der Sysop. Sonst niemand.«
»Noch mal.«
»Der Systemoperator.«
Sie nickte.
»Sollen wir gleich mit der ›Beichte‹ anfangen?«
»Unbedingt.«
Er gab ein paar Befehle ein, und bald tauchte auf dem Bildschirm die Rubrik ›Mord zu Hause‹ auf oder genauer gesagt: ›Welche Mörder kennt ihr persönlich?‹
»Es wird lange dauern, alles zu lesen. Unter diesem Thema sind vierhundertelf Beiträge eingegangen. Wir gehen am besten wieder raus, und ich zeige Ihnen die Diskussionen über Geoff.«
Die erste Meldung stammte von Layne selbst: »Geoff Kavanagh (Vidkid) ist heute früh tot aufgefunden worden, angeblich Opfer eines Unfalls. Kann das jemand glauben?«
Der nächste Eintrag besagte: »Die Rückblenden! Jemand hat gelesen, was er eingeschickt hat!«
Geoffs Leiche war am Donnerstag um zehn Uhr morgens entdeckt worden – diese Meldung stammte von halb eins, zweieinhalb Stunden danach und etwa dreiundneunzig Stunden vor dem offiziellen Beginn der polizeilichen Ermittlungen.
Ich erfahre erst jetzt davon, dachte Skip, und dieser Cyberpunk wußte es schon vor drei Tagen.
Die zugehörige User-ID lautete Gorilla. »Wer zum Teufel ist das?« knurrte sie.
»Sie heißt Nancy, glaube ich, und sie wohnt in Boise oder so. Soll ich nachsehen?«
»Nein. Bleiben wir beim Thema.«
»Na ja, danach geht es noch einige Zeit so weiter. Alle kommen zu dem offensichtlichen Schluß. Dann hat jemand – ich glaube, es war Med –« er blätterte weiter – »die Idee gehabt, wir sollten uns den Autopsiebericht verschaffen, und Lenore ist das tatsächlich gelungen. Sie hat ihn veröffentlicht, und dann ging es erst richtig los – sämtliche Ärzte meinten, die Untersuchungsergebnisse paßten nicht zu dieser Art Unfall, und alle gaben ihren Senf dazu.«
»Ist jemand beschuldigt worden?«
»Nicht öffentlich.« Layne sah beunruhigt aus.
»Aber jemand könnte einen anderen direkt per Internet ansprechen. Wenn die beiden etwas wußten, was sie nicht mit den anderen teilen wollten.«
»Ja. Das ist mir auch schon eingefallen. Sie denken an Erpressung, nicht wahr?«
»Daran oder einfach Protzerei.«
Er nickte; er verstand offenbar genau, was sie meinte. »Haben Sie je eines dieser Rätselwochenenden mitgemacht?«
»Nein, wieso?«
»Na ja, ich hab ein paar davon organisiert.« Bescheiden breitete er die Arme aus. »Ich erfinde auch Spiele. Und bei solchen Gelegenheiten passiert mit den Leuten etwas Merkwürdiges. Sie bilden sich alle ein, sie wären Sam Spade, und tun Dinge, die sie normalerweise nie tun würden. Sie brechen in Zimmer von anderen ein, klauen Telefonnotizen, beschatten Leute – wenn man es zum erstenmal miterlebt, bringt es einen ziemlich durcheinander.«
»Scheiße, das hier ist aber kein Spiel.«
»Wenn man erst mal in der TOWN ist, wird man von einer merkwürdigen Art von Realität vereinnahmt. Ähnlich, wie wenn man Auto fährt und Leute anschreit, mit denen man das unter normalen Umständen nie machen würde. Kennen Sie dieses Gefühl, unbesiegbar zu sein?«
Skip war ganz elend zumute. »Die Leute glauben, weil sie denjenigen, mit dem sie sprechen, nicht wirklich sehen können, sprechen sie auch eigentlich nicht mit ihm?«