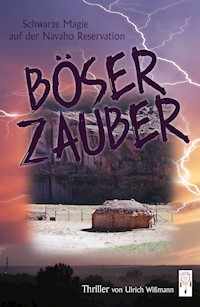Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Fünf Freunde spielen zusammen mit mäßigem Erfolg in einer Rockband. Bis sie auf die Idee kommen, sich als Band aus den USA auszugeben. Tatsächlich haben sie als vermeintlich amerikanische Musiker bald viel mehr Auftritte. Auch ein Management tritt an sie heran. Sie machen eine CD, haben immer mehr Erfolg. Um beim Publikum anzukommen, müssen sie aber immer mehr Kompromisse machen. Schließlich steigen zwei der Bandmitglieder aus und werden durch Profis ersetzt. Aber die Situation wird immer angespannter, bis es zu Prügeleien auf der Bühne kommt. Die Freunde müssen sich entscheiden zwischen Erfolg und Geld oder Freundschaft und der Musik, die sie eigentlich machen wollten. Der Autor weiß, wovon er schreibt: Er ist selbst Profimusiker. Nicht schön aber laut ist eine Tour durch Rockszene, Musikbusiness, über kleine und große Bühnen, durch Backstage Areas, Hotelbars, Festivals und ganz viel Musik, mal brüllend komisch, dann wieder tiefsinnig und nachdenklich. Ein Muss nicht nur für Rockfans!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Ulrich Wißmann weiß, wovon er schreibt: Er ist Profigitarrist und Lehrer für E-Gitarre. Nach dem Studium an der Musikhochschule Hamburg spielt er in verschiedensten Ensembles Jazz, Blues und Rock, reiste und musizierte auf allen fünf Kontinenten. Als Dozent arbeitete er auf etlichen Jazz- und Rock-Workshops.Seine Rocksinfonie „Hymn of the Earth - an Electric Symphony“ wurde 2017 uraufgeführt.
Neben unzähligen Live-Gigs spielte er in Radio und Fernsehen, über einhundert Kompositionen von ihm wurden bisher auf elf CDs veröffentlicht.
Die Songs Fear, Mr. President, der Minusmann und Fall of the World, die im Text vorkommen, sind auf CDs erschienen und über den Autor erhältlich.
Fear, Mr. President ist auf der CD American Dream, American Drama von Uli Wißmann erschienen. Die CD ist bei amazon erhältlich, die Titel sind auch über spotify oder andere Streaming-Dienste herunterzuladen.
Ulrich Wißmann
Nicht schön, aber laut
Ein Rockmusik-Roman
© 2021 Ulrich Wißmann
Verlag: tredition GmbH
ISBN:
978-3-347-42461-6 (Paperback)
978-3-347-42462-3 (Hardcover)
978-3-347-42463-0 (e-Book)
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
CRISIS? WHAT CRISIS? (SUPERTRAMP)
Soundcheck
Aftershow
die Idee
Festhalle Boppensen
SEX AND DRUGS AND ROCK & ROLL (IAN DURY)
Rock&Roll (Led Zeppelin)
Krisengespräch
Umsonst und draußen
Die Band
Sex and Drugs and Rock&Roll
WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS (Beatles)
Tom
Olli
Frank
Ecki
Phil
MONEY (Pink Floyd)
Allerlei Kulturinitiativen
Der Agent
Musik
Management
Technik
CD
Tournee
Hit
SUPPER´S READY (Genesis)
Strange beautiful music (Joe Satriani)
Old school
Open air
Fans
Umbesetzung
Aftershow-Party
THE ROAD (Danny O´Keefe)
Musikerleben
Show
Driving Home for Christmas (Chris Rea)
Andere Formationen
Kneipengigs
Jazz
Routine
THE END (The Doors)
Bad Vibrations
Close to the edge (Yes)
This is the End, my only Friend
Zugabe
Crisis? What Crisis? (Supertramp)
Soundcheck
GRAAAANG….
Tom hatte nur die oberen Saiten seiner Stratocaster angeschlagen. Die Wände der Halle bebten. Vereinzelt hielten sich die Leute vor der Bühne die Ohren zu. Nochmal.
GRAAAAAAAANNG!!!
Ja, geiler Sound! Diesmal hatte er alle Saiten angeschlagen, schööön!
GASCH!
Tom zuckte zusammen und drehte sich um. Phil hatte auf seine Snare geschlagen. Tom war versucht, sich auch die Ohren zuzuhalten.
GASCH; GASCH; GASCH!!!
Der Drummer schlug jetzt mit aller Wucht auf sein Set ein. Von der hinteren Wand der Halle wogte ein Echo zurück, nicht ganz so laut wie das Originalsignal.
Jetzt war auch Ecki auf der Bühne, nestelte an seinem Precision Bass herum. Oh Gott, das würde laut werden!
KRRRRRAAAK.
Ecki versuchte, das Kabel in den Eingang des Instrumentes zu stecken, während der Kanal offensichtlich schon voll hochgedreht war.
KRRRRRAAAK; KRRRRRAAAAAKKKKK
Jetzt hatte er es geschafft.
BAUUUUUMMM!
Die Bühnenbretter bebten deutlich unter Toms Füssen. Satter Sound, musste man Ecki lassen. Auch Olli an den Keyboards wurstelte jetzt an seinem Instrument herum. Ein Streichersound erklang, Klavier, dann Orgel.
NIIIIIEEEET.
Aha, ein Synthi-Solosound. Und ein ziemlich hässlicher dazu.
Tom schlug wieder die Gitarre an.
GRRRAAAANG.
Zu leise! Tom ging zu seinem Amp zurück, aber der 100-Watt-Marshall stand schon auf voller Lautstärke. Englische Einstellung, wie man sagte, alle Regler auf 10.
Tom brüllte in sein Mikro, konnte sich aber nicht hören. Die Kollegen dengelten, quietschten und ballerten alle auf ihren Instrumenten herum, als ob das Höllenfeuer ausgebrochen wäre.
Tom deutete auf die Monitorbox, dann auf seine Ohren und dann mit dem Zeigefinger nach oben: „Hör mich nicht! Muss lauter“, sollte das heißen.
„Hör mich nicht! Muss viel lauter!“, schrie er ins Mikrophon.
Niemand schien Notiz von ihm zu nehmen. Resigniert beobachtete Tom, wie ihr Sänger, Frank, in sein Mikro brüllte. Den hörte man gut!
„HEY, JA, EINS, EINS, EINS, JA, HEY, AHAHAHAHAU, YEHIYEHIYEAH, MUSS LAUTER!“
Die Leute vor der Bühne hatten sich inzwischen verzogen, warteten den Soundcheck lieber im Vorraum ab. Nur ein paar bierselige Freak-Eltern standen noch am Biertresen, wo es wohl schon Getränke gab, während ihre kleinen Kinder in der Halle spielten, und brüllten sich wie die Geisteskranken gegenseitig an. Ein Kind fing an zu weinen, nicht beachtet von seiner Mutter am Tresen. Man konnte es auch nicht hören.
Ein offensichtlich total tauber Hund mit buntem Halstuch stand bedächtig wedelnd vor der Bühne und sah versonnen zu den Musikern hoch.
Tom schlug nochmal an:
GRRRAAAAAAAAAAANNGGG!
Schon besser! Seine 4 mal 10er Box vibrierte sichtbar und aus dem Monitor hörte er jetzt auch was. Mehr! Lauter! Tom zeigte wieder auf die Box, dann nach oben, in der Hoffnung, dass irgendwer am Mischpult ihn beachten würde.
„So, jetzt mal nur Schlagzeug“, ließ sich die Stimme des Mischers vernehmen. „Bass Drum!“
BUMMMPF; BUMMMPF; BUMMMMPF…
Hölle, war das laut!
Der Mischer nestelte eine Weile an seinem Pult rum, dann sagte er in sein Mikro: „Okay, jetzt Snare!“
GASCH; GASCH; GASCH….
„Ok, die Toms….„
GASCH; GASCH; GASCH….
„Tooohoms…“
GASCH; GASCH….
Hallo?… HALLO!!! Gib mir mal die Trommeln, ja?“, brüllte der Mann am Mischpult ins Mikro.
Jetzt hatte Phil ihn gehört und hörte auf, auf die Snare einzudreschen. Stattdessen ballerte er jetzt auf Hängetoms und Standtom ein.
DAT; DOT; DUMPF; DAT; DOT; DUMPF….
„Okay. OKAY! HALLO! IS GUT JETZT!“ Man hörte den Mischer genervt ausatmen. „Jetzt mal Overheads!“
Phil dengelte auf den Becken herum:
ZISCH; ZISCH; ZISCH; ZISCH; ZISCH…
„Und nochma Hihat, ja?“
„ZIP; ZIP ;ZIP; ZIP…
„DAHAAANKE! Ganzes Set bitte!“
DRADAT DADAT DADAT DADAT GUMPF GASCH GAGUMPFGUMPF GASCH GUM…
„Okay, reicht, Danke!“
Phil hörte nix, spielte weiter.
GUMPFGASCH GAGUMPFGUMPF GASCH…
„REICHT, DANKE!“
Keine Reaktion.
„EEEEIIYYY! HÖR AUF! IS GUT JETZT!“
…GUMPF GASCH GAGUMPFGUMPF GASCH DATA GUMPF…
„AUUUSS!!!“
„Was is?“ fragte Phil.
Frank war inzwischen zu Phil gegangen und bedeutete ihm, aufzuhören.
„Boah, eyh“, sagte der Mischer. „Bass“.
BAAAAAUUUUUUUUUUMMMM
„Wow, ja, okay, das reicht schon! Danke. Keyboard.“
PIIIEEEP; SCHWWWWWWW; QUIIIIIETSCHH; KLING KLING…
Alle möglichen mehr oder weniger geschmackvollen Klänge waren zu hören.
„Jau, okay auch gut! Dann jetzt bitte mal Gitarre“
GRRRAAAAAAANNNGG; GRAAAAAAAANNNGGGGG;
Der Mischer schraubte wieder eine Weile an seinen Knöpfen. „Okay!“
„Ich hab da noch Solosounds, die ich gern mal checken würde“, meinte Tom.
BRAAAAT; BRAAAAT; HIDELDI HIDELDI HIDELDI…..
„Ja, ja. Ne, is okay. Gesang bitte“, meinte der Mann an der Mische. „Wer singt alles?“
„Ich Lead, Tom und Ecki Satzgesang.“ Frank deutete auf seine Kollegen an Bass und Gitarre.
„Okay, erstmal Leadgesang. Du bist auf der eins, ne?“
„Äh, keine Ahnung“, meinte Frank.
„Was steht denn auf Deinem Mikro, häh?“, fragte der Mischer geduldig.
„Äh, eins“, meinte Frank, nachdem er die auf einem Klebestreifen am Stecker des Mikrokabels angebrachte Zahl gelesen hatte.
„Siehste.“
„Äh, YEHIYEAHIYEAHH; HUHUHU…“
„Moment“, meinte der Mischer und schraubte hier und da an seinem Pult etwas.
„Nochmal bitte!“
„YEAHEAHEAH, EINS, EINS, EINS, YEAH…“
„Danke. Alles klar. Die zwei bitte.“
Tom hatte inzwischen herausgefunden, dass das sein Mikro war:
„EINS; ZWEI; DREI; HAAAALLLOO“
„Kannste ma was singen?“
„ÄH, JA, ÄH. THERE MUST BE SOME KIND OF WAY OUT OF HERE SAID THE JOKER TO THE THIEF THERE MUST BE SOME KIND OF CONFUSISCHOHON I CAN GET NO RELIEF…“
„Danke reicht!“
Ecki fuhr fort:
„BUSINESSMEN THEY DRINK MY WINE PLOWMEN DIG MY EARTH…“
„Reicht!“
„NONE WILL LEVEL ON THE LINE…“
„JAAHHAA! Ruhe jetzt!“
„Kann ich nochmal wegen meinem Solosound…“, hob Tom an.
„So, jetzt mal alle zusammen“, unterbrach ihn der Mann am Mischpult.
„Was spielen wir denn?“, fragte Tom, aber das ging schon im Lärm unter:
DADATDADATDATDUMPFGASCHQUIIITSCHBAUUUUMMMBRAAAT TTTYEHIYEEAAH….
„OKAY SUPER! JAHAA!“, rief der Mann von der Mische herüber und gestikulierte mit den Armen, bis sie auf ihn aufmerksam wurden und aufhörten zu spielen. „Alles klar dann. In zehn Minuten geht’s los!“
„Äh, ich müsste nochmal wegen meinem Solosound…“, sagte Tom ins Mikro. Keine Antwort. „Hallo?“ Er schirmte seine Augen gegen die jetzt voll aufgedrehten Scheinwerfer ab, um das Mischpult sehen zu können, aber da war niemand mehr.
Aftershow
„Geil gespielt, Alter!“
„Du aber auch, Mann!“
Sie saßen in der Garderobe, falls man das so nennen konnte. Hauptsächlich schien der Veranstalter hier alte Sachen zu lagern: Ausrangierte Boxen, eine alte Kühltruhe und große Pappkartons, in denen wahrscheinlich irgendein Müll vor sich hin gammelte, stapelten sich neben etlichen Wasserkisten und Kartons mit Billigsäften. Natürlich keine Bierkästen, da hätten die zahllosen Rockmusiker, die hier auf ihren Auftritt warteten, sich ja ungehindert bedienen können.
Sie saßen an einem versifften Tisch auf altersschwachen Campingstühlen und tranken aus dem Kasten Bier, der ihnen zur Verfügung gestellt war, auf den Gig.
„Super Solo bei der Zugabe, Tom“, meinte Frank.
„Danke! Hast aber auch super gesungen“, gab Tom zurück.
Eigentlich waren sie aus der Phase „Wir sind die Größten“ heraus. Aber nach einem mäßig besuchten Auftritt tat es gut, sich gegenseitig zu beweihräuchern.
Hier wird es Zeit für eine Anmerkung: Apropos Zeit: Bei einem Auftritt konnte man prima merken, dass Zeit nicht immer gleichmäßig verläuft: War eine Band eingespielt und harmonierte auf der Bühne und das Publikum ging mit, ging der Gig wie im Flug vorbei: Man kam auf die Bühne, spielte wie im Zeitraffer, wie im Rausch und SSCHWWWWUUUUUAAAP war man wieder runter von der Bühne und fragte sich, was geschehen war. Wenn eine Band nicht so gut zusammenspielte und ständig irgendwas nicht klappte oder immer irgendwer nicht wusste, wo man war, oder die Leute vor der Bühne gähnten und das Publikum sich lieber an den Tresen am hintersten Ende des Raumes und am weitesten von der Bühne entfernt zurückzog oder die Leute vor der Bühne sich die Ohren zuhielten (alles schon dagewesen), konnte so ein Gig sich endlos hinziehen.
Aber jetzt zur Anmerkung: Jede Band macht fünf Phasen durch:
1. Phase: Wo kriegen wir einen Bassisten/Keyboarder/Sänger/Schlagzeuger her? (die Frage nach einem Gitarristen taucht in dieser Phase eigentlich nie auf, weil a) jeder Penner Gitarre spielt und es b) bei der Bandgründung drei oder vier Gitarristen gab)
2. Phase: Wie werden wir den schlechten Gitarristen los und werden trotzdem noch von ihm auf Partys eingeladen?
3. Phase: Was spielen wir?
4. Phase: Wo spielen wir? Ein Proberaum muss gefunden und erst mal mit Millionen Eierpappen als Schallschutz verkleidet werden.
5. Phase: Probephase: Man stellt fest, dass das doch alles gar nicht so einfach ist.
6. Phase: a) Ein Chef kristallisiert sich raus, entweder der Sänger (weil das Publikum sowieso nur den sehen will) oder jemand, der etwas von Musik versteht und daher das Ganze leiten kann (selten) oder
b) die Band beschließt, demokratisch die Entschlüsse alle gemeinsam zu fassen und löst sich auf. (Sollte die Band sich an dieser Stelle nicht auflösen, sollte darauf geachtet werden, dass es eine ungerade Anzahl von Bandmitgliedern gibt, damit Mehrheitsentscheidungen leichter zu Stande kommen können, dringend zu empfehlen ist ein Trio, weil es dann immer eine 2:1 Mehrheit gibt.
7. Phase: Erster Auftritt. WIR SIND DIE GRÖßTEN!
8. Phase: Wir sind doch nicht die Größten. Erste Umbesetzungen (weil der Sänger gut aussieht, aber eben doch nicht singen kann, der Bassist nichts spielen kann, was mehr als einen Finger erfordert, der Keyboarder zwar ein Keyboard besitzt aber ÜBERHAUPT nicht spielen kann, der Gitarrist zwar echt spielen kann, aber mit seinen endlosen Soli alles zumüllt, der Drummer nur rumrumpelt und als Einziger das Timing nicht halten kann).
In dieser Phase sind Bands richtig gut geworden: Als Pete Best bei den Beatles durch Ringo Starr ersetzt wurde und Paul McCartney von Stuart Sutcliffe (der selbst aussteigen wollte) den Bass übernahm, nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Die Band Yes holte konsequent die besten Rockmusiker ihrer Zeit in die Gruppe, um dann etliche Jahre in Folge immer zur besten Band der Welt gewählt zu werden.
9. Phase: Arbeitsphase, auch genannt die Ochsentour: Man tingelt durch unzählige Clubs und Kneipen, tritt auf jedem Stadtfest und Festival auf, kurz, man spielt an jeder Milchkanne um sich einen Namen zu machen.
10. Phase: a) Die Band löst sich auf oder b) wird schweineberühmt (na gut oder verdient wenigstens Geld)
Okay, dann halt zehn Phasen…
Sie saßen um den Tisch, auf dem sich leere Bierflaschen und halbleere Platten mit lieblos belegten Broten stapelten.
„Es kommen einfach zu wenig Leute“, meinte Phil.
Er war Profimusiker und verdiente sein Geld mit mehr oder weniger erträglichen Tanzbands. Er stand zwar auf ihre Band, The Tribe, aber es ärgerte ihn, dass er immer wieder lukrative Tanzgigs sausen lassen musste, um mit einer Rockband durch die Lande zu tingeln, die oft nicht mehr als die Fahrtkosten einspielte.
„Wenigstens hatten wir ne Garantie“, meinte Ecki.
„Die 300 Euro decken ja mal gerade die Fahrtkosten“, gab Phil zurück.
Sie hatten eine Garantiegage ausgehandelt, einen Betrag, den sie in jedem Fall bekamen. Erst wenn die Kasse diesen Betrag überstieg, wurde der Gewinn zu siebzig Prozent an sie ausgezahlt, dreißig Prozent erhielt der Veranstalter.
„Haben wir morgen in dem Laden ne Garantie?“
„Ne, das hätten die nicht gemacht. Aber wo wir sowieso in der Gegend sind…“
„Ich finde, wir sollten nur spielen, wenns ne Festgage gibt!“
„Dann können wir den Laden auch gleich zumachen“, antwortete Tom.
„Oder wenigstens ne Garantie…“, beharrte Phil.
„Es gibt halt genug Bands, die froh sind, wenn sie überhaupt irgendwo spielen dürfen. Die spielen auch umsonst oder auf Kasse.“
„Das ist die Scheiße…“, pflichtete Frank bei.
„Wer ne gute Band sehen will, muss dafür auch was bezahlen“, sagte Olli. „Sonst hat ja auch keiner mehr Achtung vor der Leistung der Musiker. Das ist auch eine Frage des Wertes von Musik.“
„Was für ein Wert von Musik?“, fragte Ecki etwas angetrunken.
„Genau: Musik hat doch heute keinen Wert mehr“, meinte Tom. Er war in Sachen Alkohol auch nicht mehr ganz allein.
„Die meisten Leute merken ja gar nicht, ob eine Band gut ist oder nicht“, nahm Phil den Faden wieder auf.
„Oder es ist ihnen egal. Lieber ne schlechte Amateurband für umme als ne gute Band gegen Kohle“, sagte Tom.
„Eben: Viele Leute drehen ja schon um, wenn ein Konzert Eintritt kostet und gehen lieber woanders hin, wo sie mit dem Geld ein Bier mehr trinken können!“
„Und leider sind ja gar nicht alle Bands, die umsonst spielen, schlecht. Es gibt ja auch gute Bands, die halt unbedingt spielen wollen und es auch zu allen Konditionen machen.“
„Genau: Gerade die Ami-Bands, die in Deutschland auf Tour sind, spielen ja oft für ganz kleine Gagen oder sogar für den Hut!“
Sie waren bei ihrem Lieblingsthema: Die Welt war schlecht. Und ungerecht. Und die Welt war schlecht zu ihnen.
„Die haben ja oft keine Wahl: Wenn die Agentur sagt „Ihr spielt da und da“, müssen sie das machen. Und gerade Montag, Dienstag, wenn sie keinen lukrativen Gig haben, schickt die Agentur sie halt in die Provinz. Besser die spielen da und sind im Hotel untergebracht, dann hat die Agentur keine Kosten.“
„Das is der Mist: Da können die Leute richtig gute Bands für umsonst sehen, warum sollen sie da Geld ausgeben, um uns zu sehen?“, meinte Ecki.
„Na ja und sie können halt überall grottenschlechte Bands sehen, die ihnen vielleicht besser gefallen als wir und das auch umsonst.“
„Die Welt ist schlecht“, sagte Olli.
Die Idee
Tom stand in seiner Stammkneipe. Einen Sitzplatz gab es nicht. Es spielte eine Band. Wie oft am Anfang der Woche, wenn die Bands aus dem Ausland, die in Deutschland auf Tour waren, hier auftraten. Die Bands hatten an den off-days ihrer Tournee nichts anderes zu tun, als in den kleinen Clubs zu spielen, die sich auf diese Konzerte spezialisiert hatten. Tom hatte schon oft angefragt, ob seine Band nicht hier spielen könnte. Konnte sie aber nicht. Hier spielten nur Amis. Na, oder jedenfalls Ausländer. Das fanden die Leute interessanter.
Man kannte ihn hier und wusste, dass er Musiker war. Manche Leute, die sich etwas mit Musik auskannten, wussten wohl auch, dass er besser spielte als viele der hier auftretenden Musiker. Die meisten dachten aber wohl eher, er sei halt ganz gut, könne aber mit diesen Koryphäen aus Amerika, Kanada oder Australien nicht mithalten. Er hatte auch zweimal hier gespielt. Mit Amis.
Ab und zu wurde er angeheuert, eine Tour mit ausländischen Musikern zu spielen. Da verdiente er dann deutlich besser als mit seiner eigenen Band The Tribe und spielte auch in den Läden, die The Tribe immer ablehnten (beziehungsweise sich auf e-mails nie zurückmeldeten und wenn man anrief immer gerade keine Zeit hatten und sagten: „schick mir doch mal ne e-mail“).
Heute spielte die Jeff Snipes Band. Nach dem Namen zu urteilen aus einem englischsprachigen Land. Nach dem Gesang zu urteilen vom Balkan. „Gat a black maczac waman…“ brüllte der Typ gerade ins Mikrophon. Er war einer englischen Aussprache offensichtlich nicht fähig. Tom würgte. Die Leute fandens toll. Gitarre spielen konnte er auch nicht. Er hatte zwar gelernt, wie man Töne auf dem Ding erzeugte und das sogar in halsbrecherischem Tempo. Aber was er spielte war völlig unzusammenhängendes, sinnloses Zeug, bestenfalls von anderen Gitarristen abgeguckte Licks, die gar nicht zu dem Stück passten.
Tom verglich Gitarristen gerne mit Revolverhelden aus dem Wilden Westen: Die meisten meinten offenbar, ihr Überleben hinge von ihrer Schnelligkeit ab. Selbst viele bekannte Gitarristen gaben ständig mehr oder weniger geschmackvolle, halsbrecherische Läufe von sich, die mit Musik nicht viel zu tun hatten, dafür aber von ihren Fans gefeiert wurden. Bei vielen Hobbygitarristen führte das dazu, dass sie wie die Hammerkranken vor sich hin pfuschten, ohne noch in irgendeinem Zusammenhang mit dem Rhythmus zu stehen. Das schätzten Toms Kollegen an ihm, dass jeder Ton, egal ob schnell oder langsam, immer genau auf dem Groove aufbaute. Natürlich brauchte man eine gute Technik, um alles spielen und damit alles ausdrücken zu können. Aber die wahren Könner erkannte man eben daran, dass sie ihre Technik in den Dienst der Musik stellten und nicht nur möglichst viele Tönen in möglichst kurzer Zeit spielten.
Obwohl Tom den meisten Gitarristen gepflegt den Arsch abspielen konnte, bemühte er sich, seine Technik nie zum Selbstzweck werden zu lassen. Er nahm sich Zeit für lange ausdrucksstarke Töne und musste nicht immer beweisen, was er konnte.
Na ja, die Leute amüsierten sich, wie Tom feststellte. Die Band war auch gruselig: Alle dengelten so vor sich hin, jeder für sich, es groovte nicht für fünf Pfennig. Dafür war es erschreckend laut. Tom beschloss erstmal draußen eine zu rauchen. Im Hof trafen sich Raucher und frustrierte Musiker. Dort war es nicht so laut, aber man hörte trotzdem alles. Schade!
„Na, was macht das Profimusiker-Leben?“, wurde er gleich angequatscht.
„Bin noch nicht verhungert.“
„Hähähäh!“
Tom wand sich weiter durch die Umstehenden. Da kam Pete, der Chef von dem Laden auf in zu, ein monströses Sparschwein in den Händen. Er sammelte für die Band oder um die eigenen Kosten etwas zu decken.
„Na, wie findest du die Band?“, sprach er Tom freudig an und hielt ihm das Schwein hin.
„Scheiße“, meinte Tom und ließ der Aussage zum Trotz ein paar Münzen in das Porzellanschwein klimpern.
Pete entglitt das Gesicht kurz, aber er fing sich sofort wieder: „Nicht so geil, was?“
„Ne, die sind echt furchtbar! Spielen überhaupt nicht zusammen!“
„Aber der Gitarrist ist geil“, versuchte Pete es nochmal.
„Oh, ne! Der spielt zwar schnell, aber überhaupt nicht dem Stück angemessen. Daddelt nur seine Phrasen runter und sagt gar nichts! Ätzend!“
Das Gespräch verlief nicht so wie Pete es erwartet hatte. Er sah sich um, ob auch niemand diese geschäftsschädigenden Aussagen mithörte. Glücklicher Weise standen die Leute nicht gerade Schlange, wenn er mit dem Schwein durchs Publikum lief. Viele hatten dann plötzlich irgendwas ganz Wichtiges zu erledigen oder mussten dringend aufs Klo. Wenn er eine hübsche weibliche Bedienung mit dem Schwein losschickte, erhöhte das die Freiwilligenquote ein kleines bisschen.
„Wo kommt die Band eigentlich her?“, fragte Tom.
„Aus Serbien oder Kroatien, weiß nicht genau“, antwortete Pete und hatte gleich das Gefühl, dass Tom das nicht freuen würde.
Tom verdrehte die Augen. Dann heißt Jeff Heart wohl eigentlich Woidzlaw Tschnitichik, he?“
Darauf ging Pete gar nicht ein. „Letzte Woche war Soundso soundso da. Das hättest Du sehen müssen! Echt der Hammer! Der Gitarrist ist auf den Tresen gesprungen und hat da ein Solo gespielt! Und hinterm Rücken hat er gespielt!
Und mit den Zähnen! Der Hammer!“
Tom verdrehte wieder die Augen. Er hatte Pete schon oft zu erklären versucht, was er an Musik toll fand: Musik! Nicht irgendwelche Artistik oder Showeinlagen! Aber immer wieder erzählte Pete ihm davon, dass Musiker mit Zähnen, Füssen oder sonst welchen Körperteilen spielten und was weiß ich für Kunststückchen vorführten und schien das für das Ausschlaggebende für eine überzeugende Band zu halten.
Von ihm aus konnten die auch mit ihrem Pullermatz spielen oder sonst wo drauf springen, das machte keinen guten Song und auch kein gutes Solo aus!
„Von mir aus können die auch mit ihrem Pullermatz spielen, das hat doch mit Musik nichts zu tun“, sagte Tom.
Pete entglitt das Gesicht wieder etwas. Dann lachte er, klopfte Tom auf die Schulter und drängelte sich durch die Menge davon. Offensichtlich hatte er neue Opfer für sein Schwein entdeckt.
Tom kannte viele Clubs, die ganz klar sagten: „Bei uns spielen nur Amerikaner“. Oder sogar: „Hier spielen nur Schwarze“. Ein umgekehrter Rassismus, wie Tom fand, der den Schwarzen aber zu gönnen war: Jahrzehntelang hatten schwarze Musiker im Blues und Jazz ja alle wichtigen Neuerungen geschaffen und weiße Musiker, die ihnen meistens nicht das Wasser reichen konnten, hatten es ihnen dann nachgemacht und waren im Gegensatz zu den Innovatoren zu Reichtum und Anerkennung gekommen. Oft hatten die schwarzen Musiker in den Konzertsälen, wo ihre Musik berühmt wurde (oder ein Abklatsch davon) ja selbst gar nicht auftreten dürfen. Und immer wieder hatten Schwarze auf diesen Diebstahl ihres geistigen Eigentums reagiert, indem sie wieder etwas Neues erschufen, was die Weißen zunächst nicht spielen konnten, so dass sie es zumindest für eine Weile für sich hatten.
Aber es war schon komisch, dass ein Land gar nicht seine eigenen Musiker und Bands unterstützte (außer halt beim deutschen Schlager), sondern die Kultur lieber importierte. Als Deutscher hatte man doppelt verloren: In Deutschland fand das Publikum Ausländer interessanter (am besten englischsprachig aber sonst halt auch alle). Auf der anderen Seite bekamen aber nur sehr wenige deutsche Bands die Gelegenheit, zum Beispiel in den USA zu spielen. Die Amerikaner gingen davon aus, dass die „Krauts“ gar keinen Rock oder Jazz spielen konnten. Außerdem wachte die amerikanische Musikergewerkschaft darüber, dass die Ausländer ihren Landsleuten nicht die Jobs wegnahmen, während man in Deutschland jede ausländische Band überschwänglich und mit offenen Armen empfing. Das war zwar sehr nett, dachte Tom, aber diese Ungleichbehandlung nervte ihn. Vor einiger Zeit war ihm ein Job bei einer Big Band angeboten worden, die eine Tournee durch die USA spielen sollte. Daraufhin intervenierte die amerikanische Gewerkschaft und setzte durch, dass nur eine Grundbesetzung von vier oder fünf Musikern in die USA reiste. Das Gros der benötigten Instrumente musste mit amerikanischen Musikern besetzt werden und Tom war den Job los. Wenn eine amerikanische Big Band in Deutschland spielte (was viel öfter vorkam), konnte sie natürlich problemlos in ihrer gewünschten Besetzung auftreten.
Selbst als in Deutschland eine Quote eingeführt wurde, die im Radio den Anteil der einheimischen Musik gegenüber den ausländischen Produktionen gewährleisten sollte (was es in anderen Ländern schon lange gab), ging das nach hinten los: Es wurde nämlich deutschsprachige Musik gefördert, so dass der deutsche Schlager und ähnliches wieder einmal profitierten, aber ernsthafte Rock-Künstler, deren Texte oft auf Englisch waren, guckten wieder in die Röhre. Für sie wurde es jetzt sogar noch schwieriger als vorher, weil sie ja auch unter die Quote der englischsprachigen Musik fielen.
Die Band fing wieder an zu spielen. Ein Klassiker von den Stones:
„Sho`s o hoooohohohohoooonko tonk womon, dätdedä, so gommo, gommo, gommo, so honkotonk bloos…“
Tom hatte eine Idee: Warum gaben sie sich nicht einen anderen Namen? Wenn Woitilla Tschiniktschek sich Jeff Snipes nennen konnte, konnten sie das doch auch! Seiner Erfahrung nach waren diese englischen Namen mit -Band dahinter ein Garant für Publikumszuspruch.
Tom war ganz enthusiastisch. Er nahm noch einen Schluck Bier. Er sprach ziemlich gut Englisch. Sogar mit amerikanischem Akzent. Schließlich war er lange in Amerika gewesen. Fürs deutsche Publikum würde es allemal reichen. Durfte nur kein anderer was sagen. Dann hieße die Band nach ihm. Tom Stanton Band. Oder gar nix mit Tom? John Hinsley Band. Derek McSonstwas Band. Toll! Er war ganz begeistert. Würden die anderen die Notwendigkeit einer Namensänderung verstehen? Die Chance darin erkennen? Sie hätten einen englischen Namen. Sie würden nur noch Englisch reden. Mit Ami-Slang. Die Pausen würden schwer werden. Egal. Dann waren halt ein paar Bandmitglieder doch Deutsche. Völkerverständigung. Er würde nur noch Englisch reden. Er hatte das schon mal gemacht. Als er aus den USA zurückkam, war er durch Deutschland getrampt und hatte sich als Amerikaner ausgegeben. Was waren die Leute nett zu ihm gewesen! In den USA waren die Leute super nett zu ihm gewesen. Nachdem er zurückkam, hatte er rauskriegen wollen, ob das in Deutschland auch ging. Und tatsächlich, er war eingeladen worden, Leute machten Umwege wegen ihm, um ihm etwas von der Gegend zu zeigen und waren überhaupt super freundlich. Klar gab es in Deutschland eine Menge ausländerfeindliche Leute, aber denen war er beim Trampen nicht begegnet. Wahrscheinlich nahmen solche Leute auch keinen Tramper mit. Aber hey, wie viel ausländerfeindliche oder rassistische Leute gab es in den USA und er hatte dort nur sehr nette Leute getroffen. Na okay, fast.
Wenn jemand bemerkte, dass er doch einen Akzent hatte oder nicht alles so flüssig auf Englisch ausdrücken konnte, sagte er, er wäre in einer finnischen Einwandererfamilie aufgewachsen, wo zu Hause finnisch gesprochen worden war und daher sei sein Englisch eben auch nicht perfekt (was es ja in Einwanderungsländern wie Amerika wirklich oft gab). Und das jemand Finnisch sprach war echt unwahrscheinlich.
Er musste den anderen von seiner Idee erzählen.
Festhalle Boppensen
Phil sah hinunter ins Publikum. Die Tanzfläche war nicht mehr so voll wie in den letzten Stunden. Und die Pärchen, die sich dort unten eng umschlungen zu der Schnulze wiegten, die die Band gerade spielte, waren alkoholtechnisch inzwischen weit vorne.
Sie spielten in Boppensen, irgendeinem kleinen Kaff in der Lüneburger Heide, es war Schützenfest. Um achtzehn Uhr hatten sie aufgebaut, um zwanzig Uhr angefangen zu spielen, jetzt war es kurz nach drei. Noch eine Stunde vielleicht, dann war das hier zu Ende. Dann noch abbauen und zwei, drei Stunden Fahrt, dann war er mit etwas Glück um sieben Uhr morgens zu Hause. Sie spielten immer circa zwanzig Minuten, machten zwanzig Minuten Pause. In diesem Rhythmus hatten sie dann etwa acht Stunden gespielt. Gab sechshundertvierzig Euro pro Musiker. Naja, der Bandchef sackte mehr ein. Er machte die Auftritte klar und stellte die Anlage. Phil sehnte sich nach seiner Rockband. Mit den Jungs machte das Spielen richtig Spaß. Und es war richtige Musik. Dafür gab es aber extrem wenig Geld. Und man musste ja auch von etwas leben. Phil seufzte.
Der Chef war jetzt in seinem Element: „Ganz in weiiiiiiiß mit einem Blumenstrauuuuuss, so siehst Duuuuu in meinen Träumen auuuusss…“
Deutsche Schlager brachte er mit dem dazu passenden widerlich schleimigen Timbre dar. Wenn er Englisch sang, hatte er einen grauenerregenden Akzent. Dazu spielte er mehr schlecht als recht Keyboard. Mehr als dreistimmige Akkorde kannte er nicht und selbst mit denen hatte er seine liebe Not. Aber er war der Chef der Band.
Der Gitarrist war gar nicht so schlecht und sang auch, ebenso wie Phil (wobei der sich weigerte, deutsche Schlager zu singen). Einen Bassisten hatten sie nicht: Bass, Bläsersätze und auch zusätzliche Keyboard- und Gitarrenstimmen kamen vom Midi-File. Deshalb musste Phil mit Kopfhörern spielen. Er hatte den Klick auf dem Ohr und musste dafür sorgen, dass die Band halbwegs mit dem Sequenzer zusammenspielte. Meistens musste er sich höllisch anstrengen, die anderen davon abzuhalten, immer schneller zu werden. Natürlich musste er auch mit angezogener Handbremse spielen, er war mehr Taktgeber als richtiger Schlagzeuger. Interessante Fills oder rhythmische Überlagerungen, wie jeder gute Schlagzeuger sie gerne spielte, waren hier nicht erlaubt. Wenn es genug Geld gab, gingen sie auch mit einer zusätzlichen Sängerin los, aber das war selten. Noch vor zehn Jahren hatte Phil auf solchen Veranstaltungen mit großen Bands gespielt: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard, Saxofon und Sängerin. Damals war er auch mit Tom und den anderen auf Hochzeiten, Geburtstagen und Betriebsfesten aufgetreten. Sie hatten keine Schlager oder deutsche Volksmusik gespielt, aber wenn der Veranstalter internationale Popmusik, Soul, Funk und ähnliches hatte hören wollen, dann hatten sie das gerne gemacht. Inzwischen fragte jeder, der eine Band suchte, ob es denn wirklich nötig sei, mit fünf oder sechs Musikern zu kommen. Und da alle Tanzbands inzwischen mit Midi-Files arbeiteten und so mit wenig Musikern auskamen, musste man das selber auch machen, sonst war man zu teuer. Das sklavische Festhalten am Tempo, die Unmöglichkeit, die Form des Stückes zu verändern, die Files (die zwar erstaunlich gut klangen, aber eben nicht wie eine echte Band) und die Begrenztheit musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten hatten mit Musik natürlich nicht mehr viel zu tun.
Das Stück war erfreulicher Weise zu Ende, der Chef bedankte sich schleimig beim Publikum und kündigte eine weitere Pause an. Ein paar Leute auf der Tanzfläche klatschten freudlos und die Band spielte ihren Jingle, der Anfang und Ende jedes Sets anzeigte.
Sie gingen von der Bühne. Chef und Gitarrist gingen lachend und schulterklopfend zu ihrem Tisch. Phil schlenderte zum Tresen und holte sich ein Wasser. Er hielt sich meistens abseits von den anderen. Mit ihrem aufgesetzten Tanzmusiker-Humor und ihren ständigen blöden Sprüchen gingen sie ihm auf die Nerven. Sie hatten auch kein gemeinsames Gesprächsthema. Die beiden anderen machten entweder schlüpfrige Bemerkungen über die anwesenden Damen, über die sie sich dann vor Lachen ausschütteten oder sie fachsimpelten über Sequenzer, Drumcomputer, Effektgeräte und ähnliches, was Phil als endlos aneinandergereihte Kette von Gerätebezeichnungen wie AX-1214, ZBS5b, KT11XT und so weiter grenzenlos langweilte.
Die anderen mochten ihn auch nicht sonderlich, da war Phil sicher. Er meinte auch, sie suchten schon hinter seinem Rücken nach einem anderen Drummer. Er passte ja auch nicht zu ihnen. Mit seinem ernsthaften Interesse für Musik und seinen instrumentalen Fähigkeiten war er ihnen ein Dorn im Auge. Sie brauchten eigentlich nur einen Drummer, der geradeaus spielte. Außerdem war Phil mit seinen fast fünfzig Jahren deutlich älter als die beiden. Und sie suchten sicher einen jüngeren, vermeintlich cooleren Kollegen. Beide hatten so ein Ziegenbärtchen und kurze Haare, waren sehr gestylt, während Phil eher leger rumlief (außer auf der Bühne, da trugen sie alle die Banduniform, schwarze Hose, weißes Hemd, Fliege und die unvermeidliche Glitzerweste).
Ein Typ, der neben Phil am Tresen lehnte, sprach ihn an: „He, hast Du auch mal was anständiges gelernt?“
Phil hätte dem Mann am liebsten eine reingehauen, aber das konnte er sich nicht leisten. Und ihm zu erzählen, dass er auch mal Musik studiert hatte, wäre vergeudete Liebesmüh gewesen.
„Is ja gute Musik, aber spielt ihr auch was von Helene Fischer?“ ließ die Dumpfbacke sich wieder hören.
„Na, ja, wir haben ja keine Sängerin dabei…“
„Na, wie heißt das noch? Kennste auch“, fuhr der Mann ungeachtet des Einwands fort.
„Ich fürchte, das kenne ich nicht…“
„Doch, doch, das kennste! Hier: Lalalalala... Kennste doch!“
„Ne, das kenne ich nicht!“
„Doch, klar kennste das! Lalalalalalalalalala…“
„Ne, das kenne ich wirklich nicht! Ich bin auch nicht so der Helene Fischer-Fan…“, versuchte es Phil.
„Hähähä, klar. Aber das kennste doch: Lalalalalala…“
„Ne wirklich nicht!“
„Sieht aber gut aus, wa? Und ist bestimmt angenehm auf der Haut, hähähäh…“, versuchte Phils Gesprächspartner das Thema zu erweitern und knuffte ihn verschwörerisch in den Bauch.
Phil bekam sein Wasser und versuchte dem Mann zu entgehen, aber der hielt ihn am Arm fest: „Aber das kennste doch: Laölaölalaöö…“
„Nein, wirklich nicht“, meinte Phil.
„Doooch, das kennste: Laölaölalaöölalalaöööö“
„Ich glaub ich muss dann mal“, meinte Phil und machte sich von dem Mann los.
„Blödmann“, nuschelte der Mann hinter ihm her.
Eine ältere Frau stellte sich ihm in den Weg und sprach ihn an: „Hey Süßer, bist Du nicht von der Band?“
„Ja, aber ich glaube, ich muss wieder auf die Bühne.“
„Bist du nicht der Trommelspieler?“, fuhr die Frau ohne seine Antwort ernst zu nehmen fort. Sie war sicher sechzig oder älter und war bereits etwas derangiert.
Reste verschütteter Getränke bildeten sich auf ihrer Kleidung ab. Ihre Bluse war weit über die Schulter herunter gerutscht und gab unerfreuliche Ausblicke frei.
„Ich muss jetzt echt zur Bühne“, versuchte Phil es nochmal.
„Ne, ne, du bleibst jetzt schön hier“, mischte sich eine andere Dame ein, die sich bereits in einem ähnlichen Zustand befand und hakte ihren Arm bei ihm ein.
„Könnt Ihr auch was von Howard Carpendale?“, fragte die erste Dame jetzt. „Bestimmt, ich frage mal die anderen“, sagte Phil und versuchte sich loszumachen.
„Genau, was von Howi. Bäbädudädä…“, fing sie an zu singen und die andere stimmte sofort mit ein: „Bäbädudädädädädädubäbä…“
Phil machte sich sanft, aber mit Nachdruck los und floh.
„Kannst wohl nix von Howi!“
„Ne, kann er nicht!“
„Blödmann!“
„Hau doch ab!“
„Genau! Wixer!“
Er hörte die Damen hinter sich lachen.
Phil hasste das. Früher war man als Musiker angesehen gewesen und gefeiert worden. Heute war man sozial noch unter den Kellnern angesiedelt. Die Leute meinten, man müsste alles tun, was sie von einem wollten und sie müssten den Musikern keinerlei Respekt entgegen bringen. Der Chef stellte sich ihm in den Weg. „Hör mal: Du musst mit den Leuten netter umgehen! Das sind unsere Kunden! Wir leben von denen! Also reiß Dich zusammen!“
„Ja, gut, mach ich!
„Okay! Los, geht weiter, auf die Bühne!“
„Bäbädudädädädädädubäbä…“ schall es hinter ihm.
Phil bahnte sich gerade seinen Weg zur Bühne, als er einen Schrei hörte: „Draußen wird geschossen!“
„Was ist los?“ fragte Phil entgeistert den Chef, der ebenfalls in Richtung Bühne strebte.
„Geh halt nicht raus! Hier drin passiert schon nichts“, riet ihm der Chef, der weiter erklärte, dass einer der anwesenden Schützen wohl durchgedreht sei und jetzt draußen rumballere. Ein anderer Mann habe wohl mit der Frau des Schützen auf der Toilette eine Nummer geschoben, führte der Chef grinsend aus und jetzt sei der Gehörnte mit seiner Flinte hinter ihm her.
„Der will ja nix von Dir! Außerdem scheint er ziemlich besoffen zu sein. Bis jetzt hat er jedenfalls nicht getroffen“, meinte der Chef.
„Wie beruhigend“, dachte Phil.
In das „Bäbädudädädädädädubäbä…“, das inzwischen von einem gemischten Chor in seinem Rücken mehr schlecht als recht intoniert wurde, mischte sich jetzt gelegentlich das Krachen eines Schusses.