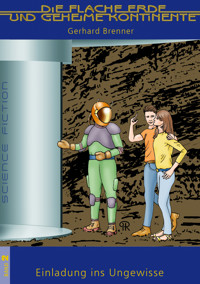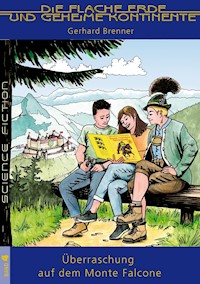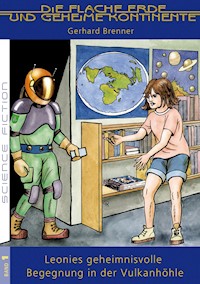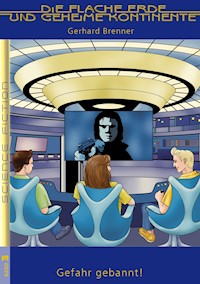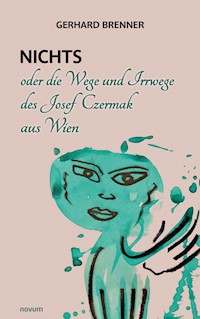
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerhard Brenner (* 1930; † 1993) wuchs im von Hunger und Armut geprägten Wien der Zwischen- und Nachkriegszeit auf. Schon früh zeigte sich seine Vorliebe für originelle Scherze und skurrile Gedankengebäude. Die fruchtbare Zusammenarbeit mit seinen Mitschülern, wie Schauspieler und Regisseur Otto Schenk, brachte eine Reihe von Theatersketches und Kurzszenen hervor. Als Privatsekretär der Schauspielerin Annemarie Düringer, als Sekretär von Otto Schulmeister bei der Presse und später beim ORF tauchte er in die Welt des Films und Journalismus ein. Sein Roman "Nichts" begleitete ihn sein ganzes Leben und blieb unvollendet. Vielleicht, weil das Leben als Angestellter einer Bank – sein Brotberuf – keinen Raum für ein geeignetes Ende der fantastischen Welt seiner Hauptfigur Josef Czermak ließ. Oder weil das "Nichts" an sich kein Ende kennt. Seinem Andenken gewidmet von seinen Kindern Susanne Wixforth und Franz Brenner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-577-3
ISBN e-book: 978-3-99131-578-0
Lektorat: Bernhard Breitenschläger
Umschlagfoto: Franz Schwarzinger
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Inhaltsangabe
Josef Czermak, unscheinbarer, still in sich aufbegehrender Erzähler und Spielzeugreparateur in Bern mit Wurzeln in Wien lässt die Leser im teils autografischen Episodenroman „Nichts“ die Zeit der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in einer Sprache voller Wortwitz und ganz eigener Melodie erleben.
Ein Kaleidoskop von Wiener Originalen und ein Mikrokosmos an Persönlichkeiten des Alltags tritt reihum auf, wird teils vermenschlicht, teils romantisierend dargestellt. Die biedermannhaften strengen Düttlingers aus Bern leiten die liebevolle Beschreibung wunderlicher Charaktere ein und stellen doch den Josef Czermak vor existentielle Fragen: „Sagen Sie, Czermak, warum sind Sie eigentlich in der Schweiz? Ist es Ihnen in Wien nicht gut gegangen? Sie waren dort Bankbeamter. Wer hat sie überhaupt auf diese blöde Idee gebracht mit dem Spielzeugreparieren?“
„Könnte ich einen Roman schreiben,
würde ich ihn genauso geschrieben haben.“
Otto Schenk
Nichts oder die Wege und Irrwege des Josef Czermak aus Wien
Die Wichtigkeit jeder einzelnen Ameise im Haufen
Josef Czermak war, wie immer, verzweifelt auf der Suche nach dem kleinen Haus. Irgendwo in dem großen Haus war das kleine Haus, das er so gut kannte. Immer wieder in den Dachsparren oben eingenistet wie ein Nest in blätterlosem Wintergezweig oder, nicht weit, im Freien. Denn es konnte auch außerhalb des großen Hauses sein, auf dem Hügel, zwischen Kirschenbäumen, Blumen, Gebüschen. Und von irgendwem bewohnt – oder auch leerstehend. Josef Czermak wusste es ganz genau.
Es dürfte aus Holz sein. Obwohl, so präzise es festzustellen, weder nötig noch möglich ist. Jedenfalls gestrichene Fensterstöcke, bunt, manchmal rot, manchmal Rosenstöcke. Unwichtig, wie gesagt. Unwichtig eigentlich auch, wo es war, ob nestartig im Dachstock des großen Hauses oder draußen. Es musste einfach wo sein, wo auch immer, denn Josef Czermak war verzweifelt auf der Suche nach ihm. Es verursachte ihm jedes Mal tiefstes Unbehagen, wenn er es suchen musste. Mit tiefstem Unglücksempfinden in der Seele war er in dem großen Haus und suchte das kleine Haus. Suchen.
Er ging durch den bekannten Gang im Tiefparterre, es war dunkel, ruhig und hallig, und er fuhr mit dem Paternoster, dessen Zellen viel zu schnell kreisten, hinauf zur Menschenmenge. Aber nein!
Er hatte sich geirrt, er wusste erst, dass er hinauffahren werde und müsse. Doch die erste Kabine raste vorbei, und er hatte den Sprung nicht gewagt. Die nächste Kabine, und die Furcht war nur noch größer geworden. Einen Ausweg über die Stiegen gab es nicht. Und dabei musste er schnellstens hinauf. Alles drängte ihn, denn sonst war alles versäumt und verloren. Die Menschen drängten. Welch Scham! Er musste weiter. Zitternd ließ er sich vornüberfallen – es war gelungen; unerklärlich, dass es nicht schwieriger gewesen war, sich den hierarchisch aufsteigenden Kabinen zu überantworten. Er rumpelte aufwärts, voll Angst im Herzen, denn es hieß ja gleich aussteigen, und schon raste es wieder. Da! … vorbei … Noch ein Stock, noch ein Stock. Zu spät. Zurückfahren. Czermak in seiner Zelle wurde oben um das große Rad herumgerumpelt, wo es ein wenig muffig riecht, ölig, staubig, einsam, wie in einem leeren Panoptikum. Und hinunter sauste er. Die Menschen starrten ihn schon unwillig an. Er warf sich vornüber. Es war wieder gelungen, war wieder nicht so schwierig gewesen, und kein Mensch hatte dem einsamen Verzweiflungsbeginnen zugeschaut. Oh, diese Angst im Herzen, diese Angst im Herzen, diese Angst vor Sturz, Missgeschick, Bloßstellung, Wehtun! Diese Angst, im Pyjama durch die Menschenmenge zur betreffenden Abteilung sich hindrängen zu müssen! Oh, dieses Unglücksempfinden in der Seele! Und plötzlich war er unter den hastenden Leuten. Im Pyjama.
Er wusste es ganz genau. Irgendwo im großen Haus – oder auch nicht im großen Haus – war das kleine Haus, von irgendwem bewohnt, oder auch unbewohnt. Er musste hin, um seines Lebens willen musste er schnell hin, bevor alles hin war.
Die Trauer war schon ganz groß, ganz tief. Er ging durch den Keller. Windet sich durch enge Gänge mit heißen Heizungsrohren. Kommt gar in einen Hauptkanal mit hoher Wölbung, von der es ekelhaft trieft, Seitenkanäle, Schmutzwasseraufstauungen, die er über schlitzige Treppen überwinden muss, halbverschüttete Stellen mit Bergen von Zitronen- und Orangenschalen.
Also wieder höher in dem Labyrinth. Es stinkt und ist ekelhaft, bis die Kachelung beginnt, den eigentlichen Bädercharakter des Kanalsystems endlich deutlichmachend, und Czermak in den Kleidern durch die Dampfschwaden ein Becken mit Warmwasser watend quert. Im Gehen zieht er sich aus. An einer seichten Stelle liegt im Wasser dieses Weib, das er so oft trifft und dessen Namen er nicht kennt, ja nicht einmal dessen Gesicht, obgleich es dem der Venus von Willendorf ungemein ähnlich ist. Im Wasser liegt es nackt und zieht ihn an sich, wie er hinschmilzt vor der inneren Hitze, und drückt ihn an sich, sie ist warm und weich, sie ist hart und weich, wie ein Pilz, wie Pilzfleisch, und sie erregt ihn unsagbar, erregt ihn mit ihrem Körper, ihren Händen aufs Höchste, streicht ihm mit dem Busen über Empfindliches, aber es kommt nichts, denn es sind Leute da, was sehr peinlich ist und sehr schade. Und er muss weiter. Rennt durch den großen Saal, in dem er seinerzeit ein paar Jahre gearbeitet hatte, und ist entsetzt über diese widerwärtige Wiederkunft, und er findet aber keinen bekannten Kollegen mehr an der Registrierkasse sitzen, nicht einen an einer von all den Hunderten von Registrierkassen. Sie grüßen ihn alle wieder, heißen ihn wieder willkommen in den Reihen der Ihren und schauen ihn fremd an. Selbst der Direktor ist nicht hier, um ihn zur Rede zu stellen – aber das bringt wenig Erleichterung. Und Czermak benützt den Lastenaufzug. Kommt durch die Schwingtür mit dem gummigefassten Fenster in den Packraum, auch die nackten Packerinnen kennt er nicht mehr, lauter unbekannte Brüste, er streicht an der Zitzenmenge vorbei und packt seine alte Bekannte, auch jetzt sie noch nicht erkennend, und sie greift ihn an der empfindlichen Stelle an in dem weichen Gewoge runder Gesäße. Er möchte das Weib in eine Nische ziehen, und so findet er sich allein in einem Nebenraum, der keine weitere Tür mehr hat, er geht nur durch einen engen Schlauch oder Schliefgang weiter, durch den er mit sperriger Erregung sich zwängen muss. Und dabei hat er vor nichts mehr Angst, als einmal in der mundartigen Verengung dieses Schlauches hilflos steckenzubleiben, vor Erstickungsnot nicht rufen zu können und von allen Leuten ertappt zu werden. Es würde ihn ohnedies niemand hören in dieser Gruft. Und er ist schon bei diesem von allen Höhlenforschern gefürchteten und auch tatsächlich gefährlichen Knick, und umkehren kann der Captivus nicht. Schweißnass windet er sich durch und sieht endlich, noch immer schmerzlich im Gang steckend, im Gebälk, wie ein freihängendes Nest im blätterlosen Winterwald der Dachsparren, das kleine Haus. Draufzu drängt es ihn, und er wirft sich in ein fremd dünkendes Auto, und er fährt, immer im Kampf mit der nicht vertrauten Gangschaltung, immer den falschen Gang erwischend, durch Laubwölbungen des Waldes, durch Wald, durch Wald, durch Wald. Und er macht einen Gang durch den Wald. Geht über schlammige Wiesen, über Berge, in Serpentinen, an Tümpeln vorbei, in denen es eklig zu baden ist; so badet er schnell. Und Wirtshäuser stehen am Weg, die zu sind, schwarzgewittert stecken Bänke und Tische im festgestampften Boden, und seltsame Straßenbahnen, die schon längst aufgelassen sind, fahren an der Kaffeehausterrasse vorbei. Czermak steht in jener Straßenbahn, die sich durch so allerengste Kurven zwängt, dass alle Ängste sie nicht für möglich halten. An gewissen Stellen hören die Schienen auf, der Wagen rattert eisern über die Pflastersteine zu der entsprechenden Stelle hinüber, an der die Schienen wieder beginnen. Czermak zittert: Die Straßenbahn möchte die richtige Stelle nicht treffen. Für einen Menschen mit technischem Verständnis ist so etwas sehr unbehaglich, und er wundert sich über die Unzweckmäßigkeit, ja technische Unverfrorenheit einer solchen Konzeption, und er wundert sich immer wieder, dass bei dem enormen Gewicht des vollbesetzten Triebwagens – fünf Sitzplätze, 184 Stehplätze – die Spurkränze nicht zuschanden gehen. Der Motorführer, mit dem während der Fahrt nicht gesprochen werden darf, beruhigt ihn und sagt ihm, er selbst habe diese Linie auch nicht gern, es verursache doch einen Nervenkitzel, wenn auch ziemlich abzuschätzen wäre, welche Geschwindigkeit der Wagen benötige, richtig hinüberzukommen. Auch die engen Gassen haben einen gewissen Würgegriff. Czermak muss die Straßenbahn hindurchsteuern, und dann steht er am Rande des großen, jetzt aufgegrabenen Platzes und sieht Eisenbahnen fahren. Die alte Schmalspur-Dampfbahn, die er für im Krieg vernichtet gehalten hat, und schließlich eine richtige Eisenbahn. Aus dem Torbogen eines Hauses herauskommend und über die Piazza dei Cinquecento dampfend, in Einschichten, die sich durch die Stadt ziehen, über riesige Viadukte, und sie braust am allermeisten durch die unheimlichen Röhren, in denen man nie weiß, an welcher Station man angelangt ist, da man kaum je einen der bleichen, schweigsamen Schalterbeamten sieht. Durch die Dämmerung und Nacht fahren die Züge, oft auf stillgelegten Strecken, wo nur mehr Schwellen ohne Schienen liegen, wo man dann, von Verbrechern gejagt, Verbrecher jagt. Sogar auf einem Schiff fährt ein Zug ab, den Czermak allerdings nicht mehr erreicht, denn er muss durch die Schneewehen und Schneehaufen Ski fahren, und er stapft und versinkt und watet und muss weiter, immer weiter, zu dem kleinen Haus mit den bunten Fensterstöcken, ja, und das Dach ist auch recht bunt, ein rechtes Lebzeltendach, ein rechtes Knusperhaus.
In Täler sieht er hinab, auf Berge sieht er hinauf, manchmal sogar auf die Schlackenflanke des Vesuvs, und eilige Männer werfen Leinen los, und eine eisige Strömung reißt einen Lastenkahn mit sich, wobei mehrere der Männer, wie vorausgesehen – ersehnt –, erwünscht, ins Wasser stürzen und verschwinden, wobei er mit atemloser Angst zusieht. Aber das macht nichts. Czermak springt im letzten Moment auf den Kahn, aus der Erde raucht es schon. Es ist alles ungeheuer gefährlich, obwohl das Observatorium einen Ausbruch genau voraussagen könnte. Lastende, ungreifbare Gefahr. Ob er jetzt geruhig an einem Lokomotivfriedhof vorbeizieht, auf dem sich der ganze rostige Dreck der Eisenbahn sinnlos stapelt –, schöne Rauchfänge, schöne Radpaare, schöne Kessel, Führerhäuser, Dampfdome, Tender, und alles gehört wem –, ob er auf Fluss-Abzweigungen zutreibt, wo die Stromschnellen über eine schiefe Betonfläche nur so hinunterbrausen, alles ist so ungeheuer gefährlich und macht Angst im Herzen, Angst in jeder Zelle von Körper und Bewusstsein. Czermak rennt weiter, klettert die Steilwand hinauf, wo oben die Burg aus zinnoberroten Steinen steht, wirft einen Blick hinab auf das sich windende Band des Stromes, stillfriedlich vertäut schaukelt am Ufer in London die HMS Discovery. Sehnsucht zieht ihm das Herz zusammen. Er kann aber nicht mehr im Hafenviertel bleiben, er muss einen anderen Weg nehmen, weil der Herweg inzwischen überschwemmt worden ist, und die ganze Uferstraße ist aufgerissen und wird neu gebaut, und in den Stationen der Hochbahn, die ihren Betrieb eingestellt hat, stauen sich die Leute wie Schmutz im Kanal, und viele sind verzweifelt, weil sogar der berühmte Flusstunnel mit dem Turm am Eingang zugesperrt ist. Durch die menschenleeren Straßen rennt er in der entmenschten Menge weiter, immer weiter, bis er endlich – über Wald und Tal und Berg und Schlucht – in dem kleinen Haus sein Zimmer kriegt. Es steht, endlich, auf einem Flachdach, mitten in einem Dachgarten, in einem Dachpark, in einem Dachwald, in einer Dachlandschaft, ziemlich auf der Spitze eines Hügels, von knorrigen Bäumen und zartblühenden Kirschbäumen umgeben, von unsichtbaren, aber bekannten Bauern bewohnt. Es ist ein Blockhaus mit vielen Ritzen, durch die jedermann spähen kann, es ist Winter, es zieht, er hat nichts zum Anziehen, nichts zum Zudecken, die Zimmertür ist überhaupt nur ein Lattengerüst, und davor hat man ihm die Missgeburt eines Lammes gelegt, ein Fellfetzen eigentlich nur, kopflos, gliedlos, ein blutendes Herz außen. Es ist ihm unbehaglich, es ist ihm unheimlich, er ist totunglücklich, hat nicht zu schildernde Angst, fürchtet sich vor Schluchten, weint der Kindheit nach –, wobei er niemals an den Tod des Großvaters glaubt, dessen Hinscheiden sich im Nachhinein immer wieder als Irrtum herausstellt und den er umso inniger lieb hat, an dem er viel Versäumtes nachholt, wenn er von den Totgeglaubten wiederkommt –, hat vergebliche Erlösungssehnsucht, wünscht sich Sommerwiesen, ist von Kälte und Nässe gepeinigt, entsetzt sich bei dem Gedanken ans Hinscheiden. Und durch die Ritzen der dürftigen Wand sieht er im Dämmer ein Kind ihm vor die Tür hinscheißen.
„Na servus“, denkt sich Josef Czermak, wie ihn der Wecker aufläutet, denn er war trotz jahrelangen Aufenthaltes im Ausland Wiener geblieben, außen und erst recht innen, „na servus.“
Es ist vielleicht ordinär und ein wenig entwürdigend, eine Geschichte, die, wie sich ergeben wird, in höchste Höhen, tiefste Tiefen, fernste Fernen führt, mit einer so nahezu mundartlichen Äußerung der Erlebenshauptperson zu beginnen. Dennoch sei, wenn auch mit Zögern, insbesondere ob des trivialen Traumfinales, um der Historie genau zu genügen, dieses Wort registriert, das eine gewisse fatale Auflehnung, einen gewissen resignierten Protest ausdrückt. Mit dem man sich den Schweiß von der Stirn wischt nach getanem Traum.
Denn wo sonst ansetzen? Wo eine Erzählung an sich, die ja letzten Endes nur ein Mikroskopieren des Gleichgültigen, eine Bestimmung des Ewigschwindenden bleibt, nun wirklich einhaken soll, ist, wenngleich auch nicht so wichtig – oder gerade deshalb –, recht schwierig. Bieten sich doch allzu viele Hebel literarischer Maschinerie zum Angriff an, eine Schilderung von Begebnissen ins Geleise zu wuchten, einzugleisen, aufzugleisen. Etwa jener alte Dichter, dessen Name wohl nach einigem Umfragen noch zu eruieren wäre – was aber die Mühe sicher nicht lohnte.
Alt war er an die sechzig, als er in Czermaks Leben trat oder, vielmehr, an ihm vorbeistreifte, um sich nahezu sofort wieder zu verlieren. Wie etwa ein Meteor in die äußerste Lufthülle streicht, wohl selbst aufglüht, verglüht, bestenfalls sprühend explodiert, ohne aber durch seinen kalorischen Untergang der Umgebung Wärme von merklicher Dauer mitzuteilen, und sein Zeichen bloß als einen kurzen Lichtstrick von nichts zu nichts ins Vergessen wischt, der umso gespenstischer anmutet, wie er in völliger Lautlosigkeit verfährt und wie dann schließlich wieder, wo nichts war, nichts mehr ist. Junge Liebesleute, bezeichnenderweise, nehmen sie diese zur Zeit der Leoniden und Perseiden nicht seltene Verzischung wahr, tun einen Blick einander in die Augen, wünschen sich was im Herzen.
Wir könnten nun etwa dieses wohl geringste aller Dinge, eines Meteors Verpuffen im Äther, zum Ausgangspunkt nehmen, es schadet nämlich nicht, leisem Anlass zu huldigen und die Feststellungen, indem wir sie setzen, auch gleichzeitig, und sicher nicht nur mutwillig, aufzuheben. Ewig sind die Dinge ja in Schwebe, mögen wir sie, mögen sie uns niederdrücken. Man halte also zugute, dass Feststellungen und Aufhebungen nicht um einer Künstelei willen geschehen oder aus Ziererei, sondern aus unendlicher Bescheidung. Nennt man etwas, so klingt es; deshalb muss man’s dämpfen, denn nichts ist was. Benennungen löst auf.
Dieser Dichter nun, seine äußere Erscheinung zu feiern, ging an einem Stock, weil sein rechtes Bein etwas kürzer als das linke gelungen war; und weil er meinte, bares Hinken sei doch allzu nichtssagend, schmückte oder umbrämte er’s mit dem Gebrauch dieses Stockes. Beide, Dichter und Stock, hatten viel Knorriges, kaum Ausgeschnitztes; Bauernkunst. Der Mann hatte einen leichten Buckel, aber obgleich dieser auch nur angedeutet war, wie bei einem Menschen, der ihn sich durch lebenslanges Verbeugen vor Akten anerzogen hat, wusste man, undefinierbar überzeugt, doch, dass dieser Buckel natürlicher Provenienz sei. Die Kleidung wirkte durch eine fast unmerkliche Verschmutzung oder Verspeckung an den Rändern; im Übrigen hielt sie sich an Beamtenmäßiges: Hose mit elegantem Zweireiher, braun. Von Eigenart der Kopf samt Gesicht: Hier trat das Grobgeschnitzte, naiv Krippenhafte am kantig-sichtlichsten zutage. Das Kinn lang und vorstoßend, darüber der Mund, infolge Zahnmangels und Prothesenlosigkeit zitronenartig verbrämt, breit, dünnlippig, und er wäre ausdruckslos erschienen, hätte ihm nicht eine langjährige Muskelzugsübung eine gewisse Verkniffenheit geprägt, die ein ewiges Lächeln offenbaren wollte. Der Mann war zu jedem freundlich. Die Nase, in Entsprechung zum unheimlichen Kinn groß, wuchs kaum merklich schief übers Gesicht. Unter der hohen und runden Stirn, die wiederum unter den langen, blassbraun-fettigen Haaren lag, stachen die Augen ein wenig, stachen, weil sie, wie der Mund, verkniffen blickten – vom Lächelnsollen – und tief in die Höhlen zurückgewichen waren, ein wenig, weil sie blassbraun waren, triefig und kraftlos. Im Ganzen war das Gesicht länglich, kürbissen-, nicht gurkenhager und nicht melonenvoll. Man ahnte, er müsse, bevor die Alterung seines äußeren Wesens geraspelt und herausgehauen und das Alter schließlich vor so unbewältigbarer Aufgabe das Werkzeug hingelegt hatte, ein hoffnungslos hässliches Kind gewesen sein. Eines jener Kinder, die von anderen geschlagen werden, weil ihr Haar klebrig ist, die angespuckt werden, weil ihre Stimme nasal klingt, die gezwickt werden, weil sie nur schief zu schauen vermögen, die auf alle Fälle abfällig betitelt werden, und sollten sie aus einem Erzgeschlecht der Wikinger stammen. Von den Händen ist zu sagen, dass sie nicht waschbar schienen, wenn sich wahrhafter Schmutz auch nur in den tiefsten Rillen fand und in den Fingernägeln, so er die Letzteren nicht gerade fransig abgebissen hatte.
Czermak hatte diesen Dichter in einem kleinen Theater kennengelernt, hinter der Bühne in den Garderoben. Der hatte ihn mit einem unappetitlichen Lächeln begrüßt, wobei es aussah, als ob ihm Mundschleim über die eingeschluckten Lippen herausränne; das Kinn war feucht. Czermak hatte einige Zeit nicht gewusst, was mit der Hand, die dieser ihm hingedrückt hatte, anfangen, dann hatte er eine Wasserleitung gefunden, sich heimlich zu waschen. Ärgerlich das nach dem Abtrocknen nasse Taschentuch. Irgendwer hatte ihm gesagt, dass dieser so freundliche alte Herr ein Dichter sei, der hier zwischen Schauspielern Künstlerisches atmen wolle und der den Schauspielern zwischendurch Blumengedichte zu lesen gäbe.
Dann, nach etlichen Monaten, hatte er den Dichter an zwei kurz aufeinander folgenden Tagen vor einer öffentlichen Küche stehen sehen. Hier pflegte er anscheinend seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und nach deren Einverleibung draußen ein paar Augenblicke zu meditieren, scheinbar völlig abgeschlossen von dem vielfältigen grässlichen Getriebe der modernen Großstadt. Ein Blumengedicht inmitten des Verkehrsgewirres. Einer jener von erfindungsreichen Stadtvätern zur Verfreundlichung auf einer Schutzinsel aufgestellter Beton-Blumenkübel. Allmählich belebte sich sein Blick, wie ein nach Regen sich erfangendes Feuerchen. Der Erdäpfelsalat (laut Speisekarte Kartoffelsalat) war geschluckt. Die Augen begannen wieder zu wandern, streiften erkennend übers erzherzogliche Reiterdenkmal in der Platzmitte, erfassten die vorbeifahrenden Straßenbahnen der Friedhofslinie. Und zuletzt schritt er an seinem billigen Stock davon. Wahrlich, ein Schreiten im Humpeln. Er hatte den Reim. Ein Sieger. – Vielleicht ging gerade wegen dieses gedankenverlorenen Stehens das Gerücht um, er sei ein Buddhist – man weiß ja niemals Ursachen und Quellen; vielleicht wurde dieses Gerücht gerade dadurch noch begünstigt, dass niemand wusste, wohin er entschritt. (Kann so einer überhaupt wohnen? – aber das fragte sich niemand). Wahrlich entschritt, nicht enthumpelte.
Freunde hatte der Dichter keine, sein einziger Umgang geschah in dem kleinen Theater, das sich vor dem Desinteresse der modernen Großstadt in einen Keller vergraben hatte, und von dem er sich als Künstler und auch aus Gründen der Fronde gegen das Desinteresse der modernen Großstadt angezogen fühlte (Viele hielten ihn oft, was immer auch gespielt wurde – mit Ausnahme natürlich von Shakespeare, Grillparzer und dergleichen –, für den Autor). Wo er dann von Mal zu Mal erschien, an den Wänden der engen Gänge hinter der Bühne herumstand, bitterlich lächelte und zu jedermann freundlich war, alle grüßte, zumal Leute, die er nicht kannte, wie diese zwangsläufig in der Mehrzahl waren. Er bat nie, etwas von ihm zu lesen oder gar zu rezitieren, frug auch nie um (positives) Urteil, ja bezeichnete sich nicht einmal als Dichter. Am Anfang hatte man gar nicht gewusst, dass er einer sei, später wusste man nicht, woher man es wusste, es dachte auch niemand nach, man wusste plötzlich schlechthin, er sei einer. Schließlich, nachdem er Zeit gelassen hatte, seines Dichtertums gewohnt zu werden, legte er mit stummem, aber großem Lächeln voll Bedeutung den Mädchen der Truppe handgeschriebene Gedichte auf die Schminktische (Bretter, über Kisten gelegt). Aber keinesfalls war man dadurch auf die Tatsache des Dichtertums gelenkt worden, dass er so stumm und freundlich den Mädchen des Personals und späterhin auch den Burschen so ein Gedicht über irgendwelche Blumen oder Hälmer oder Gräser auftischte; in Kurrentschrift.
So ist es natürlich schwer, sechzig Jahre zu vollbringen, wenn es auch hernach nicht viel leichter ist, sechzig Jahre zu haben. Allein, es war ihm gelungen, und das so überzeugend, dass niemand ihn sich, wie gesagt, kindlich und knabenhaft hätte vorstellen können. Außer als erschreckend greisenhafter Gnom; aber nimmermehr spielend, lärmend, weinend, raufend, eine Mutter habend, schicksaleinspringend. Und plötzlich dann, mit etwa sechzig, bekam er einen Preis, man wusste nicht welchen, man war zufällig einmal vor einer Auslage stehen geblieben, Bücher anzusehen, hatte dann mit Staunen, es erst nicht glaubend, seinen Namen (den man damals noch gewusst hatte) gelesen, darüber ein Pappendeckelschild: Der diesjährige Träger des Soundsopreises. Ein staatlicher Preis. Ein diesjähriger. (Somit gleichzeitig Lüftung des Konfessionsgeheimnisses: Kein Buddhist – ein Katholik; leise Enttäuschung – der Mensch sehnt sich nach Exotischem – weht durchs Herz). Blumengedichte. Wahrscheinlich Blumengedichte, denn der Einband (wer erinnert sich schon?) dürfte ein paar Blumen unter dem Titel gezeigt haben, Dürers meisterliches Wiesenstück etwa (wer wagte schon, an Dürer zu zweifeln?), Hälmer und Gräser. Die Sprache sicherlich edel (wer hat es schon gelesen?), die Verse reimten sich wahrscheinlich jeweils, stehen doch die Blumen der Manier moderner Dichter entgegen, die demnach auch den Reim wie die Pest meiden. Die Worte hatten sicherlich sogar einen Sinn, einen wirklichen, realen, eingängigen, fassbaren, gefügten, logischen Sinn, teils in Versen, teils in regelmäßigen, teils in unregelmäßigen Rhythmen. Worte, die die Beschaulichkeit priesen, den inneren Wert von Blume und Mensch über die äußeren Werte unseres technisierten Zeitalters stellten. Seht doch die Blume im Mittag (nach dem Erdäpfelsalat, inmitten des Verkehrsgewirrs?), sie steht in einfacher Schöne und atmet; was habt ihr draus gemacht (die Stadtväter mit den Betonkübeln?), was trabt ihr trottenden Dingen nach und hetzet nach Anschein, anstatt zu sein, zu atmen …
Czermak kannte niemanden im ganzen Kreis, der diese Gedichte, vom Kultur- oder Unterrichtsministerium oder wie es heißt (dessen Haupt, der katholische Minister Doktor Soundso, Volkstümlichkeit keineswegs scheute und fortschrittlicher Weise einmal sogar selbst zum Gaudium von Bevölkerung und interner Beamtenschaft den Ankick eines Fußballmatches vorgenommen hatte) auserkoren und preisgekrönt, gedruckt und gefördert, schließlich gar gelesen oder auch nur durchgeblättert hätte. Aber dem Dichter, nunmehr poeta laureatus seitens des kulturellen Ankickers, war dieses aus schier unfruchtbarem Boden überraschend hervorgebrochene Bändchen endlicher Ausgleich, der sich ihm unter den kürzeren Fuß legte: Er schritt unhumpelnder. Es strich ihm lind über den leichten Buckel, krümmte ihn vergeistigter. Ohne dass er jenes nun solchermaßen bewährte und bestätigte Opus erwähnt hätte, hatte sich, so fand Czermak, der ihm noch zwei, drei Male begegnete, ein ärmeres Stolzlächeln in die ausdruckskarge Verkniffenheit seines Mundes gemischt, ein Stolzlächeln, das dieser Dichter früher nur beim Verkehr mit Menschen – und auch dann wie etwas Eingenommenes – in sich gekehrt hatte, das sich indessen jetzt unbemerkt noch bis ins verlorenste katholisch-buddhistische Meditieren vor der Ausspeise erhielt – und nach außen gekehrt. Ein im Tode friedliches Antlitz. Geld hat er sicher nicht erhalten, der Mann, solche Staatspreise für solche Dichter sind nicht zur Bereicherung bestimmt, und die Auflage wird nicht groß gewesen sein, den schleppenden Abverkauf gewärtigend, haben doch heutzutage nicht einmal die hochgelobten Zeitdichterfürsten eine bedeutende Auflage, wenn ihr Verlag sie aus Markt- oder Renommeegründen zur Schöpfung von Lyrik veranlasst. Aber wie auch immer, er hatte einen neuen Anzug, die Verspeckung an den Rändern war frisch, und die Hände schienen waschbarer. Sein Tod war gerettet.
Dann war er weg, der Dichter, weg auf immer, Czermak hat ihn nie mehr gesehen, hat nie mehr von ihm gehört, obwohl er ihm solcherart samt dieser Ausschnitts-Biographie gerade am Lebenswendepunkt aufgefallen war, er ihm aus Erinnernsvakuolen mitunter noch an möglichen und unmöglichen Orten ins Gedächtnis stieß. – Das wäre etwa ein Ansatzpunkt, richtungsweisend, vielleicht ein wenig würdiger als ein „Na servus“, und dabei im Grunde noch dasselbe. Samt End-Trivialität.
Ebenso könnte man allerdings wesentlich machen, wo die eigentliche Geschichte anfing. Etwa dass es seltsam ist, wie die kleine Stadt sich aufbaut. Unten, am Fluss, ist das ganz Alte. Gut, man hat’s saniert. Das große Waschhaus gibt es nicht mehr, das so viel kaltes und nasses Elend, beispielsweise lediger Mütter, gesehen hat, an dessen Rückfront die Frauen, beispielsweise uralte Gemeindepfründnerinnen, mit der Wäsche die Steine peitschten, im Sommer wie im Winter. Bei Sonnenblumen wie bei Eisblumen. Es pfeift keine Ratte mehr unter den losen Uferbefestigungen, es läuft kein Schab mehr die Wand hinauf und wieder hinunter, es beißt keinen mehr die Wanze. Alles saniert, kanalisiert, desinfiziert. Und doch sprechen die in der Unterstadt, in der Matte, noch immer eine Sprache, eine wirkliche Sprache, die denen in der Oberstadt unverständlich ist, wohingegen sie selbst des Dialektes der Oberen mühelos zusätzlich mächtig ist. Als hätte das Neue das Alte zurückgelassen, und dieses ist dadurch um eben jenen Fortschritt gescheiter geworden.
Der Fluss, tief eingegraben, umschlingt einen Hügel, und auf diesen ist die Stadt sichtlich hinaufgewuchert, Höhenschicht um Höhenschicht, wie man am Uferabhang sieht. Eozoikum, Paläozoikum, Mesozoikum, Kanäozoikum, säuberlich abgeschichtet. Alles ist wie aus der Spielzeugschachtel eines Mädchens mit Hängelocken, sauber und nett. Jeden Abend wird jedes Haus gewaschen und an seine rechte Stelle gerückt, sollte es sich untertags verunordentlicht haben. Die Hausnummer wird kontrolliert, ob sie noch stimmt, der Gassenname wird buchstabiert, die Hausbewohner werden abgestrichen, ob jeder in dem Seinigen sei. Und dann schnappen die Türen zu. Und Schlaf, Schlaf, Schlaf. So etwas. Nett und sauber. Verordentlicht. Nett und sauber auch die Figürchen mit ihrer etwas pretiosen Sprechweise, ganz vorn und mit spitzen Mündchen, die alles verzierlichen, was sie sagen. Sogar die schweren Geschäftsleute, die mit Staatsbürgerschaften arbeiten, niedlich noch. Es ist ja auch nett der Laubengang, der sich dahinzieht vom Anfang der Stadt bis hinauf zum Bahnhof, abschnittsweise Nydeggasse, Gerechtigkeitsgasse, Kramgasse, Marktgasse, Spitalgasse genannt. In seiner Achse sind Brunnen aufgereiht, mit Wappen und Männchen (eins davon der berühmte Kindlifresser). Weiter oben muss sogar die Straßenbahn ihnen ausweichen, ungeachtet deren Spur ohnedies schmal ist.
Das, um nur einige Details zu nennen. Es gäbe ja so viel zu sagen. Und eigentlich gibt es auch nichts mehr zu sagen, vielleicht. Vielleicht, bis auf die Brücken.
Denn man hat Brücken gebaut. Brücken, die spielenden Rückens die Verkehrslast von einem Ufer des nahezu schluchtigen Flussbettes hinüber zum anderen befördern. Schönausteg, Monbijoubrücke, Dalmazibrücke, Kirchenfeldbrücke, Nydeggbrücke (richtig, das ist ganz unten, beim Laubengangbeginn, wo er heißt Nydeggasse), Untertorbrücke, Altenbergsteg, Kornhausbrücke, Lorrainebrücke, und zu all diesen geschichtsinhaltenden Namsungen noch eine ungetaufte Eisenbahnbrücke, heidnisch; die Technik ketzert gern. Brücken. Eine fleißige Stadt. Eine Brücke nach der anderen. Man vergisst, berauscht vom Zwecke einer Brücke, vom edlen Zwecke: Zu überbrücken, was da durch Ungunst getrennt ist, so leicht, dass sie nicht nur eine glatte Fahrbahn hat, von mächtigen Bögen frei getragen, sondern dass man zugleich und notgedrungen einen Raum schafft, sei es auch nur einen schmalsten Streifen Wegs oder Ufers zwischen Wasser und nischigen Fundamenten der Widerlager – einen Raum, dass man schafft, ist wichtig zu bemerken, geräumig für alle Dinge des Dunklen, Dämmrigen, unterschwellig oder auch nur, in der Sprache der Mondänen, ordinär – für alle Dinge des Lichtscheuenden, so viel wie nur im menschlichen Gehirn Platz haben; und noch mehr, eine Reserve an Undenkbarem – aber das übersteigt die Grenzen des Ausdenkens. – Die Dinge der Finsternis.
Wenn sie erzählen könnten, solche Nischen. Nicht einmal: Wenn sie nur lange genug nachhallen könnten – um Artikulation wird ja nicht viel zu fragen sein. Wer hat noch nicht ein Paar verlegen heraustreten sehen, das keinesfalls unmittelbar zuvor auf der anderen Seite beim Hineingehen zu beobachten gewesen wäre. Sie waren eine Zeit drinnen. Sie taten was. Ein finsteres Ding. (Der feldstecherbewehrte Herr in der Nische am anderen Ufer könnte es bezeugen). Oder zwei Burschen, deren erhitzte Gesichter sich um eine Miene bemühten, vom Tageslicht verhalten, eine solche wieder zu gewinnen (und auch den Latz zumachten). Und ferner wird das alles ins Symbolische gehoben durch die Frage: Wer, von allen Tausenden Staatsbürgern, wäre nicht das eine oder andere Mal in diesen Raum getreten? In diesen unmoralischen Raum, unmoralisch, weil er eines konstruktiven Sinns eigentlich entbehrt. Oder auch nur, weil ein Raum ursprünglichem Zweck entfremdet wird durch eben ein Betreten mit anderer Absicht. Wer ist noch nicht in eine Küche, in der eine dralle Köchin bestallt war, eingetreten und hätte plötzlich anderes im Kopf oder sonstwo als das Essen? Etc., was ähnliche Schweinereien anlangt. Sind denn diese Nischen und Überwölbungen nicht nur notgedrungen entstanden, weil eine Fahrbahn überbrücken musste, was getrennt war, weil Bogen gespannt werden mussten, das Auseinanderliegende zusammenbringen, den Verkehr von einer Seite auf die andere fortzupflanzen? Und das ganze Bogen-, Pfeiler-, Streben- und Nischenwerk treibt unter der Oberfläche sein Wesen, umraumt den Menschen mit Chtonischem, mit schummriger Freiheit zu wildester, sinnlosester, inbrünstiger Ausgelassenheit, die hier in Szene setzen kann, was keiner Beleuchtung standhielte. Heimlichkeiten. Es sind ja nicht nur Brücken und deren Unterzeug: Es sind ja auch Keller, Bodenräume, Heuschober, selbst gewisse Zimmer mit Tapetentüren, alles, wo Licht nicht selbstverständlich ist und Alleinsein möglich, Abstellkammern, Doppeltüren, Bauhütten, die der fiebernde Jüngling für seine erglühte Jünglingin aufbricht, Rohbaue, Wassertürme, Schilderhäuschen, Werkzeugschuppen, Totengräberhütten, Hundekoben, Gartenlauben, natürliche und künstliche Grotten, Taubenschläge, leere Büros, der Gebirge wundersame Tropfsteinhöhlen an ihren trockenen Stellen, Umkleidekabinen in Bädern, Kabinenkreuzer, ja Taucherglocken, Bahnhofstoiletten auf Vizinalstrecken, Flurwächterhäuschen, Anstände, abgelegene Telefonzellen, alte Dampfer auf Schiffsfriedhöfen, Waggons auf Abstellgleisen, das Innere von begehbaren Litfaßsäulen im Stadtzentrum und an der Peripherie, Kanaleinstiege, einsame Aussichtstürme und Ruinen (Palas, Gaden, Dirmitz, Bergfrit, Kemenate): Räume, Räume. In jedem von ihnen ist einmal Unheimliches geschehen, Wildes, Unüberlegtes, Unsittliches.
Man könnte sagen: Das also wird aus mehr oder weniger holdem Filigranspielzeug im Lichte betrachtet. Und das wäre so phrasenhaft wie einen Gedanken einzuleiten mit: Wenn sie sprechen könnten, die Dinge. – Das alles hat schon so und so oft beispringen müssen, diese stumme Zeugenschaft der Dinge, man hat’s gelesen, das war einmal wahr, ist’s aber wahrscheinlich gar nicht mehr, weil abgegriffen, jeder hütet sich, es wahr sein zu lassen.
Das also ist nicht der Weg, eine Stadt zu beschreiben und gleichzeitig ins Unheimliche vorzustoßen. Ein Konterfei zu geben, wäre abgebraucht. Ihren Charakter zu destillieren, wäre abgebraucht. Phrasen, Phrasen, denn auch die Unkenntlichmachung einer Phrase durch kunstreiche Umschreibungen wäre abgebraucht. Es scheint, als hätte das Material mit dem Griffigwerden des Werkzeugs seine Konterfeifähigkeit verloren. Vorerst erkennt man vielleicht nur an kleinen Wendungen: Die Lichterkette der Straßenbeleuchtung. Oder: In der Ferne wird das Häusermeer vom Dom überragt. Überhaupt: Häusermeer. Oder, modernistischer: Im Stadtschritt stampft sich der Dom aus den Furchen dürrer Straßen – besonderer Rhythmikathlet (und das nach Gefälligkeit auch in Kleinschreibe). Und schon verwischen sich die Gesichter der Städte selbst. Es gibt neue Viertel, die das Kind noch nicht gesehen hat, weil sie damals noch nicht bestanden, und die der Erwachsene nicht mehr wahrnimmt, weil er sie niemals, sich einlebend, wahrnehmen lernen musste. Sie sind da, abgelagerte Bau-Moränen, eine Überschwemmungskatastrophe aus Betonmischmaschinen, Bulldozern, Kränen, Lastwagen hat sie nach Verrinnen ihrer wirbelnden Massen als Absetzung zurückgelassen, Ordnungschaos aus Geplantem, Nützlichem, Schönem, Regelmäßigem. Es geschieht so schnell, man ist’s gewohnt, ehe man sich’s bewusst macht. Es gibt keine Räume, keine Nischen, Winkel, Ecken. Geheimnislos, ohne Anhaltspunkte für verbrecherische Phantasie, geht man hier nur nachhause, nur der kennt sich aus, der sich nach Nummern zu orientieren vermag. Wo soll der arme Knab’ in seiner Not sich selbst befriedigen? Die Öffentlichkeit hat ihm die Gonaden einbetoniert. Vineta, über der Meeresoberfläche versunken. Im Glanz der Sonne breitet sich flimmernd das Dächermeer, und so wird die Phrase wieder Wahrheit.
Das alles, wie gesagt, ist nichts.
Man nehme also eine Staffelei, streife sich ein Samtbarett über, stelle sich auf den Berg (jede Stadt, die auf sich hält, hat ihren Berg, was keinen Berg hat, hat von Anfang an versagt) und male mit flächiger Technik zerlaufene Landschaft, Licht und Farbe, kein Detail. Denn es wäre unvorsichtig, angesichts einer Stadt die Einzelheiten schon an die Landschaft zu verschwenden. Eine Lichtflut. Grün, Hügel, das silberne Band des Flusses, bis zum Horizont gewischt, Wolkenschatten, Luftreflexe usw. Und nun, in den leeren Fleck hinein, die ersten Häuser. Aber seltsam, sie verschmieren sich wie von selbst, plötzlich hat man auch für die Stadt keine Details mehr, nirgends Konturen, nirgends Feststellbares, also auch verwischt alles, oszillierend, unbestimmbar, ineinander verspielend, flächig, Dächer, Türme, Gasometer, Straßen, Rauchfänge. Und, wie geahnt, nur Schleim in allem, ein grauer Belag. Ein Sarkast bezeichnete ihn vielleicht an manchen Stellen mit einem Krönlein, Sternlein oder Rufzeichen. Das ist der besonders wichtige Belag.
Erlebt man vielleicht eine Stadt?
Huschend jagt’s über das Weichbild. Fahrige Dunkelheit jagt über Hausdächer: Wolkenschatten. Es wird fröstelig, der Erleber schaut besorgt empor, eine bleiche Sonne sieht er hinter Vorhängen, die über die Hügel herschleifen, und der Wald wird dunkel. Der Erleber drückt den Rock zusammen, macht sich schmäler in den Schultern, stellt sich unter einen Überhang. Die Stadt wird eingeregnet. Leise, kleine Schwebetropfen, fast mehr Nebel als Regen. Und die Tropfen, klein, mischen sich mit den Rauchschwaden, die plötzlich sichtbar werden. Das Kraftwerk, fern, schiebt eine Riesenwolke in die Höhe, man riecht sie förmlich heranstinken. Dumpfe Geräusche dringen her, Hupen, gleich wieder abgebrochen nach kurzem klagendem Aufheulen, verirrte Schafe, verirrt blökende Kälber. Fetzen irgendwelchen Lebens, losgerissen von da unten und jetzt schleichlings ins Nichts verschwebend, ohne Sinn und Bezug durch die Luft fleddernd, ein Rauch, ein Hall, ein plötzlich heraus-fokussierter Anblick von irgendwas Undefinierbarem. Ein unüberblickbarer Riesenleib, die Stadt, gleichsam unter auflösendem Säureregen. Verfließende Ausläufer, wo die Häuser sich aussprenkeln, poröse Industrien. Nichtausgewachsene Gliedmaßen, Finger gärender Sozietät, die krüpplig in die Landschaft greifen, ein Häusermus, aus unermesslicher Höhe herab herabgeplatzt von irgendwoher im Himmel, aufgeplatzt, oder aus der Erde herausgeschwärt, verfließend, verfaulend, veraasend, ein Aas, die Stadt, gärend unterm Regen. Schwaden ausdunstend, gelb, rot, Blaken vom Blitz eines zischenden Straßenbahnbügels fernweg. Aufbrechen von Blasen, Ahnung von winzigem Gewimmel, das miteinander im Aas ums Aas kämpft. Dämpfe steigen auf, die Streifen legen sich über die vom Fremdleben regsam Leiche, ein einziger Kampf in dem Weichen da unten, Übereinanderrinnen, Ineinandervermischen, jeder will was haben. Die Stadt. Die Stadt im Regen. Im befruchtenden Regen. Pilze schießen auf, wo nichts war, bleich, fahl, nächtig, hartfleischig, ausgegoren im Moos des Häuservielerleis, die Sporen schlafen überall, warten, schlafen, warten. Und endlich der Regen. Gestanksbänke ziehen aus dem Dachrinnenschlamm, aus den staubgedüngten Steinen, aus den Straßenbahnen mit ungewaschenen Leuten, unter denen die Giftblume der Animosität voreinander erwächst, im einen vorm Gestank des anderen. Schwarzfleckiger Salat in den Abfallkörben, modernde Lumpen in Häuserecken, Hundekot auf den Randsteinen. Und Menschen. Menschen.
Gestank ohne Grenzen. Da schwellt der Zorn in der Stadt. Das ist vom Regen entzündet. Der Hass. Der Hass, dass sie einen nicht liebt. Der Hass, dass der Nachbar Nachbar ist. Hass, weil er sie betrügt, Hass, weil sie nicht zum anderen kann, weil der Freund Freund ist, weil das Weib Weib ist und der Mann Mann oder das Weib Mann und der Mann Weib. Hass. Er schnellt durch die Luft, reitet auf dem lauten Liebesliederschall des Radios zum Fenster herein und quält sich ins Ohr, tanzt in der Wohnung oberhalb, hämmert in der Wohnung links, kocht unten aus Zwiebeldünsten. Hass befördert die Autos durch die Straßen, Hass verbeißt sich in Vorrang, der Fußgänger hat seinen Adel und der Fahrer hat ihn. Es schwelt der Dampf und dünstet, das Gärende vom Regen entzündet in der drückenden Enge. Da schwelt der Hass, oh der Hass.
Wenn er die Welt aufreißt und dann sein Bett findet und dann gelenkt wirken kann. Wenn er sich nicht aufreibt in heimlichem, kleinlichem Zusammenstoß dieser Moleküle da drunten untereinander. Wenn er ein Ziel kriegt. Das mag dann die Stadt aufreißen bis ins innerste Gedärm. Den Leichnam zerreißen und das Aasgewürm auswerfen samt Titel und Orden, durcheinanderschmeißen, dass auch das Ungeziefer in Leichen im Leichnam liegt. Ein einziger Gestank nurmehr, und diesmal wirklich leblos. Leblos, dunstend, stinken, brodelnd in barer chemischer Auflösung. Bis die Landschaft alles eingesaugt hat und verschmerzt hat. Den ganzen Dreck da unten aus Stein und Holz und Eisen und Leib. Nichts mehr. Die Landschaft; und irgendwo eine einzelne Flöte, als ob niemand sie spielte und niemand sie hörte.
Zögernd dreht der Erleber sich um und schaut nochmals besorgt empor.
Die Ruine. Wie eine Zackenkrone ruht sie über der Stadt. Ihr Insignum, ihr Wahrzeichen. Es bröckelt. Hier haben Menschen gehaust. Herren, Knechte. Schufte.
Vorm schwefligen Himmel steht man in der Stadt und blickt man empor, bebt sich die Ruine noch ein Stück vom Bergrücken ins Wolkenverhangene. Ein ausgebleichter Unterkiefer, zahnlückig, hässlich, tot, tot. Und der Turm des Fernsehsenders. –
Aber eine Heimatstadt, oh, man müsste sich, so hart es ankäme, wirklich an die Einzelheiten halten, mit der Liebe zum Detail, wenn’s auch ein Leben dauerte. Kein Erleber könnte maßgerecht in den Hymnus ausbrechen, die Bejubelung dessen, was einen gebildet hat, Sprache, Sitte, Eigenart; Ansingung des Mütterlichen, Verehrung des Väterlichen, Halleluja der Kindheit. Licht, Farbe und Stimmung sind nicht so wichtig wie Aufbau und Stil. Die Landschaft wird sekundär, man wird sich aufs Stadtzentrum konzentrieren. Jede Häuserkante muss für sich sichtbar sein, ja ein künstlerischer Trick müsste die Schichtung der Dachziegel auf den mikroskopisch kleinen Dächern vorzaubern, jeder Laternenpfahl müsste am maßstäblich richtigen Platz wurzeln, das Kuppelhaus in Kupfer glänzen, in Patina grünen, der Dom, so klein er auch sei, bis zu den Figürchen der gotischen Darstellung des Jüngsten Gerichts am Tympanon ziseliert sein, und durch das steinerne Spitzenwerk des Turms, durch die Rosetten, etwa einen halben Daumen unterm Kreuz, müsste man, schon wieder am äußeren Festungswall, gerade das Fensterchen der Leondine sehen, vielleicht sie selbst mit ihrem hausbackenen Antlitz, die schwarzhaarige, schwarzäugige und trägblickige Stadtschnalle. Die kleinen Leuchten, welche die Straßen beleben, modisch gekleidet, die halbwüchsigen mit Röhrenhosen, die Damen mit ihren entzückenden Rauhreifen von Hüten. Da geht auch schon der Zentraltheaterdirektor, elastisch, wie er ist: samt seinem beißenden Witz ein halber Millimeter, sein (durch die Zeitungen anekdotisch-wohlwollend bekanntgemachtes) frischgewachsenes Oberlippenbärtchen: neunzehn Mikron. Da geht ein bedeutender Mann des Funks zu seinem Auto mit dreistelliger Zahl auf dem Kennzeichenschild (was in dieser Stadt einem Adelspatent gleichzusetzen ist, da freigewordene niedrigstellige Nummern vom Polizeipräsidenten persönlich in seiner Schreibtischlade verwahrt und nur wieder Honoratioren, Günstlingen, Bühnenstars, politischen Funktionären, Millionären und Ähnlichem verliehen werden; se non è vero è ben trovato): ebenfalls ein halber Millimeter, über dem feisten Siebzigmikronantlitz die Rundglatze mit sechsundzwanzig Mikron Durchmesser, das Fontanellenzentrum als Mittelpunkt des Zirkeleinhiebs genommen. Filmregisseur und Produzent: ein halber Millimeter (wie überhaupt bei solchem Maßstabe ein jeder Halbmillimetermann nivelliert wird), sein (durch die Zeitungen anekdotisch-wohlwollend vieldiskutierter) Schamteil (allerdings in der Hose verborgen, allerdings durch Blasenspannung in erectio): ungeschmeichelte neunzehn Mikron – ziemlich genaues Oberlippenbärtchenpendant. Die Journalistin: Ein halber Millimeter, dreiundzwanzig Mikron Hängebrust, von den Zitzen aus gelotet, ferner könnte man den von ihr ausströmenden Odor – sie wäscht sich nicht gern (wie hält das ihr Mann aus?) – durch etwa einen Millimeter Abstand zwischen ihr und allen sie umschwärmenden Personen darstellen. Ein Kulturpapst: achtundneunzig Mikron Kopf lugen, auf einen Verkehrsteilnehmer schimpfend, aus dem Seitenfenster eines Einskommadreimillimeterautos mit niedrigestelligem Kennzeichen. Ein Kulturgegenpapst: die gleichen Abmessungen. Kulturnachfolge- oder Drittpapst: die gleichen Abmessungen. Und schließlich der Kulturgott, dem die Stadt ungeteilt zu Füßen liegt, der den Weibern die zuckenden Herzen aus den Brüsten reißt: Ein drahtiges Halbmillimeterstäbchen im Fond eines Einskommaneunundfünfzigmillimeterautos mit ausländischem Kennzeichen – heut lächelt er den Huldigenden gnädig zu mit seinem Elfmikronmündchen.
Und so weiter. So könnte man auch seinen Spaß an der Heimatstadt haben, die Hymne in der Grundtonart der Satire hinübermodulierend, und an manchem, im öffentlichen Interesse Stehenden, sein Mütchen kühlen, ohne dass er einen prozessuarisch belangen könnte, der Sauarsch, das Arschloch, der Scheißsack, der Hurenbock, der Schleimscheißer. Man könnte die verdienstvollen Leutchen halbmillimeterweise in verpissten Ecken aufmarschieren lassen und sie dort mikronweis zerreißen auf lauter Fliegenschiss. Aber immer noch nicht hätte man die Stadt gegeben, ihr Wesen, ihr Unwesen, ihr Wesentliches, ihr Unwesentliches … Quadratkilometer … Bezirke (Anzahl, Namen) … Wahlsprengel … Einwohner (nach dem Stand der letzten Volkszählung vom Jahre …), darunter etwa … Spitzen der Gesellschaft, teils adlig (von früher her), teils wohlhabend (von früher her), teils emporgekommen, teils politisch, teils geschäftlich, teils nur gesellschaftlich. Soundso wenig Glanz, unterlegt von soundso viel Stumpfheit. Davon … Unternehmer … Kleingewerbetreibende … Handelstreibende … Handwerker … Angestellte … Öffentliche Bauten, Nutzflächen, Wohnbauten, Zinsburgen, Straßen, Plätze, Gassen, Gässchen, Wege, Verkehrsflächen – wie eine Stadt eben ist: Ein Konglomerat, eine Brekzie. Und unter dem Haufen: Lichtleitungen, den halben Äquator umspannend; Gas- und Wasserrohre, von Gibraltar bis zum Nordkap reichend; Telefonkabel, von der Erde zum Mond reichend; aber auch: Kanäle.
Wäre etwa so die Stelle erreicht, wo man, einige Anfangsschwierigkeiten überwindend, einen Ausgangspunkt willkürlich applizieren könnte? Wie man die Daten der geometrischen Darstellung auf der egal weißen Papierfläche ausdrückbar macht durch Festlegung des Achskreuzes, errichtet auf dem Nullpunkt am Schnitt von Ordinate und Abszisse irgendwo. Da lässt sich’s gleich lustig an mit Ellipse, Parabeln, Hyperbeln, die ein mathematischer Pfiffikus seit Évariste Galois mühelos rotieren lassen kann, ohne ein Zerreißen durch Fliehkraft befürchten zu müssen, weil es ja zuletzt doch nur auf dem Papier steht. Ein gedachtes Messer sticht keine wirkliche Sau ab.
Anstatt all dessen hätte man nun freilich auch kurz und dürr sagen können: Josef Czermak ist ein Wiener, und die Geschichte fängt in Bern an. – Aber hätte das, so, mehr Sinn gehabt?
Ob so oder so, Josef Czermak lag in Bern im Bett, und mitten aus einem seiner oftigen und ihm auch im Traum selbst schon bekannten Albträume wurde er vom täglichen Wecker herausgeläutet. Ohne recht erleichtert zu sein, denn ihm bedeutete das Wachwerden letzten Endes nur den Wechsel von Albtraum zu Albwachen. Jedenfalls hatte er, gleich nach dem Gewecktwerden wach und, wie immer, sofort im Vollbewusstsein seiner selbst und seiner Situation (was allein ihn schon misslich touchierte), gesagt: „Na servus.“
Kurzes Dem-Traume-Nachsinnen. Rascher Überschlag vom Traum zur Wirklichkeit. Und schon war sein Gehirn durchzuckt von einer unfasslichen Vielfalt von Gedanken, Erinnerungen, Theorien, Flüchen, Betrachtungen Überlegungen, Wünschen, Flüchen, Sentenzen, Phantasien, Flüchen, Plänen, Erwägungen, Flüchen, Bildern, Analysen, Flüchen, Kalkulationen, Flüchen, Flüchen, Flüchen. Saftiges Beginnen eines trockenen Tages.
Ein Tag wäre zu schildern: aufwachen, aufspringen (weil äußerster Termin, sonst auch vielleicht wieder einschlafen), Zigaretten anzünden, urinieren gehen. Dann, ineinanderverschränkt: rasieren, Zähne putzen, duschen (dabei nochmaliges Freispülen des Mundes vom Zahnpastageschmack), abtrocknen, salben, Haare bürsten, anziehen, Stuhl verrichten, wieder anziehen (sakra, warum geht’s nie gleich!), Begrüßung der Mitbewohner, Frühstück mit Konversation, weggehen. Anfahrt (dösend). Neun Stunden in der Arbeit, eine halbe Stunde Mittagspause mit inbegriffen. Dann der Abend, irgendwie.
Heut’ aber lag er nach dem Weckerläuten im Bett und rührte sich nicht. Er dachte. Unterließ das Aufspringen durch willkürliche Muskelerschlaffung und sprengte so quasi die Kette der Wiedergeburten. Er unterließ, er dachte. Fast Nirwana. Oder Tao. Je nachdem. Halblaut sagte er manchmal vor sich hin: „Je suis malade! Je suis malade!“ Das hatte er in einem französischen Film gehört. (Zwerg erschießt Liebhaber der jungen Frau seines angetrauten Herrn und stellt sich aus Alibigründen bettlägerig). Seinerzeit, als er noch Wachträume gehabt hatte, als er noch daheimgewesen war, als er noch jung gewesen war, als er noch ins Kino gegangen war, um die Madeleine Sologne zu bewundern, als er noch beeindruckbar gewesen war, hatte er einen kurzen Aufsatz aufgesetzt gehabt: Der Meister des magischen Kellers:
Grausig treibt es mich manchmal von der Welt fort, und zu diesen Zeiten besuchte ich voll Verzweiflung meine Experimentierstube im innersten Keller. Die große Halle ist der allgemeine Mittelpunkt, und in ihre Wände münden Röhren, eine neben der anderen. Da heraus schreit es, stöhnt es, lacht und singt es im Wahnsinn, denn es ist alles so heiß, so drückend, so vernichtend. Ich stelle die erprobten Anlagen bereit, lasse Dämpfe wallen, Gifte zischen. Plötzlich springe ich zu einer der Röhren, drehe den Hahn auf, lasse das Öl ein wenig tropfen. Ein Ohweh läuft durch die Reihe. Ich ziehe ein Gestell heraus, und es steckt da was am Spieße. Ich tu ihm nichts, ich lasse es nur ein wenig jammern, in beißende Erinnerung getaucht. Dann drehe ich alle Hähne weit auf, damit das heiße Öl verstärkt sprudle zur Speisung aller Qualen. Schrill zischt das Fleisch, und Rauch steigt auf in kleinen Wölkchen. In den gewundenen Glasgeräten glüht es leuchtend, ein grünlicher Schein dehnt sich langsam aus den Geißlerröhren heraus. Ich mische Flüssigkeiten in einem Becher, bis es schäumt, bis mir die Tränen in die Augen steigen, und ich lasse mir den Trank mit furchtbarem Behagen schmecken. Gesichte überfallen mich. Wieder mische ich Pulver grauenhaftester Zusammensetzung, halte Flammen daran, bis die Verbindung krachend zustandekommt. Es ist ein Gift geworden. Quietschend öffnen sich eiserne Türen und fahren wieder zu, Blitze zucken auf, und zornig packe ich mit bloßer Hand ein Stück weißglühendes Eisen und schmiede es mit meiner Faust allein. Und die Nebel werden fahler und fahler und lassen mich in Nüchternheit zurück, und kaltes Licht senkt sich herab, der Blick schweift suchend in den Himmel, verliert sich in Träumereien. Wie ausgestorben ist das Land, so öde, schwer verhängt ist stets das Firmament, Bleiernes kriecht über die Berge … kein Leben dringt mehr ins Ohr … nur jährlich einmal macht es in der alten Knochenmühle „klack“ …
Josef Czermak hatte also auch seine Anwandlungen und Anfechtungen gehabt. Und er hatte sich ein Gilles de Rais gedünkt, als er den kleinen Aufsatz aufgesetzt und in der Hand gehalten hatte. Aber er konnte nichts damit anfangen, wusste er doch nicht einmal zu diagnostizieren, was es war, das da am Spieße steckte und so arg gepeinigt wurde. Und so beschloss er, sich halt die Madeleine Sologne noch einmal anzuschauen. Aber immerhin war’s peinlich, so Unnennbares handhaben zu müssen, und er konnte es nicht vergessen. Ja, ein Buch müsste man schreiben. Überhaupt. Über all das. Über alles. Ein Buch vom Fressen und vom Scheißen, vom Furzen und Farzen, vom Wasserlassen und von den Hämorrhoiden, von den Kotsteinen und Darmzotten, vom Leibschwellen und In-die-Hosen-Machen, vom Rotzen und Trenzen, Ohrschmalzfluss, Zehenschweiß, von allen Sekretionen. Und vom Purgieren, Klistieren. Ah, vom Abführmittel, Suppositorium, vom Katheterisieren, Magenausheben, Irrigieren und von wochenlangem Brechdurchfall. Von den Kanälen, Kloaken, Latrinen, Abortröhren und Jauchengruben. Vom Stuhlgang auf einer Wiese, vom Rasengrün und Blumenblühen, vom Blütenmeer und Büschebauschen, vom Waldesrand und Vogelsang und Wieselrennen, Grillensägen, vom Stieglitz und vom Wiedehopf, und nachts vom Käuzchen und winters vom Kreuzschnabel. Von den Sternen, Spiralnebeln, Sonnensystemen, vom Rotieren der Planeten, von der Erde Majestät, von Tag und Nacht und Wahn und Nüchternheit und Glück und Herz und himmelwärts, oh ein Buch von der ewigen Liebe, vom gewaltigen Rotieren der ewigen Liebe: rota tu volubilis!
Wo, in all dem, anfangen? Was ist nötig, den Einzelnen aufzureißen oder ist es rätlich, die Vielen querzuschneiden? Das Große oder Kleine? Mikroskop oder Fernrohr? Soll verschlüsselt oder offen untersucht werden? Soll man das Kind beim Namen nennen? Wo sind wir überhaupt? Wer sind wir? Wer ist der und wer ist jener? Was ist’s, das sie treibt? Sind sie überhaupt als solche anzusprechen? Ist es wichtig, gewichtig?
Ein Buch.
Über was?
Muri.
In einer Villa in der Belpstraße zu Muri bei Bern, einem kleinen Vorort, hatte Josef Czermak ein Untermietszimmer zu günstigen Bedingungen gefunden. Muri ist ein bemerkenswerter Ort: Gering an Einwohnerzahl, beheimatet er doch gegen fünfundzwanzig Millionäre; Millionäre in sfrs. In einem Millionärshaus, solch angenehme Idylle weiterzuspinnen, war nun durch Wegheiraten sämtlicher Kinder gar zu viel Platz freigeworden, sodass das alte Millionärsehepaar sich entschlossen hatte, zumindest eins, das kleinste der brachliegenden Zimmer zu vermieten. Nicht nur von Überlegungen ökonomischen Ertragsmomentes und der Haus-Amortisation ausgehend, sondern auch – und, in Wahrheit, vor allem – von den menschlichen, dass es vielleicht – vorausgesetzt, man hätte mittels Menschenkenntnis ein wenig Glück im Aussondern der Bewerber – ganz gut sei, eine Gesellschaft im Haus zu haben. Man kam überein, ein Zimmer auszuschreiben, mit Zentralheizung sowie Badbenützung, Frühstück und Mahlzeiten an den Wochenenden. Das Inserat, als es erschienen war, wurde viel diskutiert in der Nachbarschaft, ja schier als Zumutung angeprangert, Mutmaßungen wurden angestellt, teils war man geschockt, teils belächelte man spöttisch. Der Krämer im Kramladen begann mit dem Inseratenerscheinungstag einen überschlagsweisen Diurnalsaldo, ob sich der Plafond der Lebensmittelrechnungen – und wenn, um welche Differenz und auf Grund welcher Produkte oder gar Spezereien – höbe, der Drogist gegenüber, die Meistzeit der Spätsommertage auf seinem Stühlchen extra muros verweilend, gleichsam auf Kunden-Anstand, beobachtete schärfstens alle Vorgänge, hier nun allerdings Nicht-Vorgänge (denn weiterhin nahm die Ruhe ihren Lauf). Und nicht nur diese beiden hatten Posto gefasst. Die ganze Belpstraße war von einem Prokrustes der Neugier ins allzu lange Bett gespannt, voll Tension knirschte sie in der Hitze, deren Schläfrigkeit nicht schläferte, sondern lastete, Wasser kurz vorm Sieden, wo erst noch die Oberfläche leis erzittert. Kein kleinstes Fensterlein konnte hörbar aufgehen, ohne dass es sämtliche Nachbarschaftsfensterleins mitgerissen hätte, als ob sie alle an der straffen Saite der Hochspannung aufgefädelt gewesen wären. Auch lautloses Fensterleinaufgehen rief alles à l’arme, wurde durch optische Spähungen sofort ausgemacht und verzugslos in Massengaffungen versteckter oder weniger versteckter Art umgesetzt. Von ereignislosem Tag zu ereignislosem Tag zu ereignislosem Tag spannte sich die Saite, und der Langeweileteufel murkste die Knebel um und um, dass sich das Schmerzschrillen der Nerven höher und höher schraubte, ins unausstehlich Ultrasonische hinauf, und ein geringster Anlass in häuslichem Kreise genügte, die Murimenschen aufeinander losfahren zu lassen. Spätsommertage, Tage der Reife, der Ruhe, der Ernte. Spätsommertage, an denen von der Sonne keine Strahlen herabdrangen, sondern Ballen herabfielen, Sonnenballen, Hitzeballen, die aufs Pflaster prallten, gleich platzreifen Früchten des Glutkugelgewächses am Himmel krepierten und mit lautlosem Feuerhauch aufgingen. Hitze-Seifenblasen, weitverlangsamend mit freiwerdenden Licht- und Wärmefluten, alles wie in Aspik einkochend. Die Tiere, die Menschen wateten durch die körperhafte Grelle, ja noch die botanische Welt – Gartenblumen, Gartenbüsche, Gartenbäume – und die mineralische – vertreten durch Randsteine und Gemäuer –, das Regloseste noch schien mit größerer Beschwer reglos zu sein auf dem Grund dieses kalorischen, luziden Spätsommermeeres, und durch die gallertigen Glastmassen spannte sich die quälende Saite, quer über den kleinen Platz, den die Häuser dort an der Kreuzung mit der Elfenaustraße ließen in Muri bei Bern, dem kleinen Vorort. Blumen, Gebüsche, Bäume, grün, grün, Grünes und Buntes und Sattes, strotzend wie dieses Landes Bankkonten, dass man schier hätte Zinsen zahlen müssen, hätte man noch Grünes dort unterbringen wollen. Und alles unter der Idyllenglocke des Vorortes, und etwas entfernt hörte man, die Stille dick unterstreichend, das Autosausen von der Thunerstraße herab, manchmal von einem Zweitaktfrechling ungehörig interpunktiert. Ach, die Idyllenglocke! Seit dem aufwühlenden Tag des Inserates war sie einer grässlichen Transsubstantiation unterwunden worden, bis sie – weiland aus gesundem, gutem, derbem Pressglas – nunmehr aus einem jener nervösen, jederzeit zum Zerklirren bereiten Glasmaterialien sich wölbte, dessen sich mitunter die Gläserzersinger bedienen; als ob ein windiger Bologneser unter der Hand den soliden Quargelsturz mit fragwürdigem Kunstwerk vertauscht hätte. So viel vermögen ein paar harmlose Zeilen in harmloser Zeitung. Nicht mehr wie in allen gewohnten Zeiten war das Zittern in der Luft allein durch Hitze bewirkt; was eine einfache Beobachtung beweist: Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge, die ganze Welt verflirrte unruhig oder verschwamm langsam in Schlieren … nur die Millionärsvilla ragte gleich einem Zauberschloss aus seiner à l’armierten – und dennoch gebremsten – Umwelt heraus, ein Eisberg im Tropengewitter oder das Auge des Zyklons. Unberührt vom umbrandenden Wirbel der Spannung, als wolle es die Inseratsproklamation vorm Tribunal der Nachbarschaft bekräftigen: Hier steh ich, kann nicht anders. Kontur behielt es, Gemessenheit, Kühle, ja Harmlosigkeit; sein Material hatte keine Resonanz für die Spannungsschwingungen, und die beiden Dornröschens drinnen verschlummerten die Tage, für sie war alles so, wie es wirklich war, und kein Tüttelchen mehr: Frühmorgens die Gebäck-, Brot- und Milchlieferer auf ihren Velos, dann die einkaufenden Frauen (die beiden bemerkten nicht Blicke, Ohrenspitzungen, Tuscheltuschel, aber auch nicht das Verstummen; als hätten sie in diesem Marianengraben an Neugier drucksichere Skapander an – man könnte auch schlicht sagen, sie hatten eine dicke Haut). Dann die Straßenkehrer, die die Straßen kehrten. Dann die Postausträger, die die Post austrugen. Alles tuschelig in Wort und Blick. Mittags die Autos, eines von jedem Haus, die die arbeitenden Familienväter aus ihren Büros herbeikarrten (in diesen Tagen schien’s schneller und etwas früher – Er, nämlich der große, durch die Annonce wortmagisch heraufbeschworene Unbekannte, hätte ja schon eingelangt sein können, seinen finsteren Schatten werfen können, dieser Laster-auf-allem, dieser Würgengel, Belial, schrecklicher Utilisator bisher ökonomisch nicht genutzten Wohnraums; und wohin würde das führen, wenn dieses Beispiel Nachahmer, Nachäffer fände: Lauter Untermieter in Muri!). Dann die Kinder aus den Schulen (die Lernleistungen in diesen Tagen merklich zurückgegangen; kein Wunder). Dann, nach einer Zeit jetzt mühsam ertrotzten Mittagsschläfchens – man hatte Wachen eingeteilt, dass einige wenigstens zur Ruhe kämen –, die hohl aufrumpelnden Garagentore, die zögernd-bedauernd davon brummenden Autos, die die genährten, leicht erholten Familienväter wieder in die Büros zurückkarrten. (Wo sie ein wenig unruhig den Arbeitstagsrest zubrachten – denn der An-die-Wand-Gemalte könnte ja inzwischen schon heraufgestiegen sein, der Finsterfürst aus Hadesland, aus Feuerkratern und mit Blitz und hypsibemetischem Donner und murizerstörerischem Schwefelregen). Dann ein wenig Gespräch von Frau zu Frau (Angstblicke werfend, flüsternd), bevor die Garagentore wieder hohl herabrumpelten. Und war zwischen all diesen Geschehnissen nichts geschehen, so geschah ab nun rein gar nichts mehr in diese Spannung hinein, um diese hindurchgezogene Saite herum, alles blieb in unerträglicher Weise sich selbst überlassen, und verschämtes Staubsaugergeheule in einem Villeninnern wurde zur Quartierbelästigung. Et in terra pax, und jeder wird hundert Jahre – wovon jetzt allerdings durch den Einschlagschock der Annonce mindestens eins wird subtrahiert werden müssen.
Denn es war tödlich. Mancher Haushalt überlegte schon, eine Gegenmine springen zu lassen und ebenfalls ein Zimmerchen auszuschreiben; aber aus Gründen der Delikatesse ward davon wieder Abstand genommen, man wollte doch erst abwarten. Und so blieb, was voreinst Ruhe gewesen war, auch innen, nunmehr außen und innen herzumkrampfende Spannung. Man kann mit Fug sagen, dass in diese hiesige Paradiesewigkeit der Tod Einzug gehalten hatte, ja dass die Vertreibung aus dem Paradiese auch schon stattgehabt hatte mit den schrecklichen Inseratsworten, es sei hier ein Zimmer mit Frühstück und Bad zu vermieten. Noch in die niedersten Bevölkerungsschichten hinab (Schuldiener, Ladenschwengel, Aushäusler, Botengänger) reichte das Entsetzen. Ein Millionärsort hat seinen Stempel und drückt ihn erbarmungslos jedermann in ihm drinnen auf, noch der streunenden Katze und dem pissenden Hündlein, und den Mann von der Mistabfuhr dünken seine Zinkkübel hier (hier!) Goldamphoren voll Geschmeid, der Mann ist hier verpflichteter, stolzer, er zelebriert die Abfuhr, Hierodule im Müllheiligtum, sein Gewand ist Livree, seine Profession Stand.
Mit dem Tageverrinnen wurde die Nervenstrapaze unmenschlich. Nicht selten erregte ein Unglücksrabe den Unmut der ganzen Straße, indem er – trapp, trapp, ein Elefant auf dem Siedehäutchen – durch die ein wenig abschüssige Belpstraße schritt, womöglich – der Teufel schläft nicht – ein Köfferchen in der Hand trug, aufs Gatter des Zauberschlosses zuschritt – ah! … und weiterging. Die Zuschauermenge tobte vor Entrüstung. Kinder, wenn sie lärmten, wurden strenge zur Ruhe vermahnt. Man hätte ihn überhören können. Ihn. Den unerbittlichen Tyrannen.
Die zwei Millionäre indessen, Millionärsfrau und Millionärsmann, Herr und Frau Düttlinger (nennen wir ungescheut beim Namen, was Namen hat, es kann ja nichts für ihn), (für die alles wirklich so war, wie es war, kein – erinnern wir uns dies Ausdrucks und erkennen wir ihn jetzt als glänzendes divinatorisches Wortspiel – Tüttelchen mehr), die zwei also indessen hatten nach manchem Wartenstage ein wenig besorgt Wert und Unwert eines Inserates zu diskutieren begonnen. Die Pendule in ihrem dunklen Holzkasten schlug hin und her mit ihrem reichlich langen Pendel, zwischen Links und Rechts, mutete es an, hätten schier Pyramiden zerbröckeln können. Die beiden waren verwundert, was das für Zeiten seien. Was das für eine Zeit sei, sagte die Frau beim Servieren des Milch-Kaffees, in der niemand mehr auf ein wohlfeiles Zimmer reflektiere. Seien halt alles Vagabunden, die Schweizer seien ein einzig Volk von Autostoppern und Stromern geworden, setzte sie gleich fort, als ihr Mann den kalten Braten aufschnitt und austeilte. Es sei wirklich seltsam, wand sie ihren Faden gleichsam um die Sauciere beim Reichen dieser, früher hätte es so was nicht gegeben (und vergaß sichtlich, dass es früher eine Zimmer-Ausschreibung auch nicht gegeben hätte, dass sie also ein Unrecht gesetzt hatte und ihr daher jetzt auch eines widerfuhr). Und als sie ihm (sie kannte ihn und ging trotz langjähriger Ehe auf seine Eigenheiten ein; sie hatte etwas sehr Mütterliches, Fürsorgliches, ihr Scharfrichterhaftes war nicht mehr als Schweizer Landestracht) noch Geröstetes nachreichte, fügte sie dem hinzu, dass es nicht dafürgestanden sei, das Geld für das Inserat aufzuwenden, und ob er noch Salat möge. Aber wer hätte das gedacht, meinte sie nach dem Abservieren und beim Pfefferminztee, dass überhaupt niemand komme, nicht einmal anschauen (lugen). Als sich der Mann nach der zweiten Tasse die Zigarre angezündet, die Zeitung genommen und in den Ohrenfauteuil hinübergesetzt hatte, als er die Stehlampe aufgedreht und den Aschenbecher neben sich auf das Rauchtischchen gestellt hatte, als er sich das Fußschemelchen mit der Grospointstickerei zurechtgerückt und den Polster zwischen Schulterblätter und Lehne geklemmt hatte, entgegnete er ihr beim Auseinanderfalten des Blattes, dass er sich wundere, was das für Zeiten seien.
Worauf es, ohne auch nur eine Zehntelsekunde Verschnaufpause zu lassen, direkt in den auslautenden Konsonanten („… Zeiten sind“) hinein läutete. Schnell, schrill, wie die Klingel war, und extrem kurz. Grad so viel wie nötig, um als Nervenschlag eines Bosheitsteufelchens, Flaschenteufelchens, Springteufelchens zur Geltung zu kommen und registriert zu werden. Mit kleinen Pausbäckchen und einem rundlichen Rubenspopsch, fast schon wieder Amorette, und es zwickt, das Teufelchen, verstohlen und plötzlich von hinten anspringend, ins Ohr und stößt mit seinen zwei Hörnlein ins Trommelfell. Es tut nicht weh, aber es beißt. Man ist à l’armiert. Auch hier nun. Aus war’s mit dem Dornröschenschlaf inmitten von Stürmen.
Wer das sein könne. – Er wisse es nicht, beantwortete er die Frage und blätterte beunruhigt in der Zeitung hin und her, die Devisenkurse suchend. Ob’s eins von den Kindern sei, forschte sie weiter. Aber, meinte sie gleich dazu, die hätten ja vorher angerufen. Ob’s ein Nachbar sei. Auf das zuckte er die Achseln; und wer ihn kannte, der sah diesem Achselzucken eine gewisse Anamnese an, es war nicht sein gesundes Achselzucken. Das Beste sei, schlug sie vor, nachzusehen (lugen). Zu diesem Vorschlag sagte er, dass es das Beste sei, nachzusehen (lugen). Die Pendeluhr schlug nun acht, und ihr Pendelhinundher im Kasten drinnen, langsam (das zwischendurch immer Zeit hatte für ein paar Pyramidenzerbröckelungen, dieser Pendelschwung trat ein wenig hervor aus dem Alkoven, drapiert als unheimlicher Kindlifresser).
Es läutete. Man könnte sagen: Es läutete ein aber Mal. Doch so getragen war es nicht. Es war wieder das Bosheitsteufelchen, nun schon ein wenig größer und fetter durch Wiederholung (Oder war’s ein zweites, ein aberes? Gibt es mehr als ein Bosheitsteufelchen? Wie viele Bosheitsteufelchen haben auf einer Nadelspitze Platz? Stieß aus dem Pyramidenbröckeln hervor mit seinen Hörnlein ins Trommelfell).
Wer das wohl wirklich sein könne, es läutete jetzt schon zum zweiten Mal. Nun ernstlich beunruhigt, sog Herr Düttlinger an seiner Zigarre und gab zu bedenken, dass das zweite Läuten auch so seltsam, so kurz, gewesen sei. Und um die Zeit, direkt unheimlich (man bedenke doch: Baron Frankenstein ist immerhin Schweizer gewesen, aus Belrive am Genfer See). (Der Kindlifresser im Alkoven fletschte die Zähne, machte sich groß und hob drohend die Arme, um im geeigneten Momente hervorstürzen zu können).
Besuch könne es nicht sein.
Ein Wind wischte mächtig durch Baum und Strauch.
Sie werde nun doch aufmachen gehen. Aber es könne vielleicht auch nur irgendeine Frau sein, warf ihr Mann, skeptisch, wie Männer sind, und stets neue Hypothesen ventilierend, ein. Man könne sich ja überzeugen, schloss sie, stand auf, ging in die Diele und schaute durch das kopfgroße Fenster der Haustür.
Ein anhaltender Windstoß warf die Büsche durcheinander. Am Gartengitter stand ein Mensch (was auch sonst?). Ein jüngerer Mann, soweit ersichtlich. Sie überlegte, ob sie ihn kenne, und sie kam nach einem Sondieren der Silhouette und einiger im Dämmer spärlich zu erfassender Antlitzens- und Figurmerkmale darauf, dass sie ihn nicht kenne, warf über ihre Schulter in den Salon zurück, dass ein Mann draußen stehe, den sie nicht kenne, und ihr Gemahl, der ein kleinwenig harthörig war, frug wieder, ob sie ihn nicht kenne. (Zwei, drei Pyramiden waren inzwischen wieder zerbröckelt, eh’ man sich’s versehen hatte.)
Und ein gewaltiger Windstoß fuhr auf und bauschte das Haus, der Kindlifresser hatte schon zum Sprung angesetzt, als er zurückzuckte, erschreckt durch einen im ersten Stock zuschlagenden Fensterladen.
Sie stieß die Tür gegen die hereinplusternde Sturmflut ein wenig auf und rief hinaus, dass sie gleich komme. Eilte in den Stock hinauf und verriegelte den Laden und rief bei der Gelegenheit hinunter, dass sie gleich komme.
Und dann kam sie. Ein erster Blitz beleuchtete die Szene.