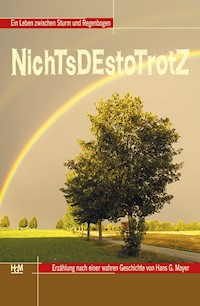
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leider - oder vielleicht gottseidank - verläuft unser Leben nicht immer nach unseren Wünschen oder Erwartungen. Doch wir müssen unvorhersehbare negative Ereignisse als Herausforderungen betrachten. Die romanartige Erzählung beruht auf einer wahren, provokanten Geschichte, die lehren soll, dankbar zu sein. Freude, Zufriedenheit, Erfolg und glücklich zu sein, hängen nicht von Äußerlichkeiten wie einer körperlichen Behinderung oder einem unversehrten und intakten Körper ab. Oft sieht ein Ereignis zunächst wie eine Katastrophe aus, bietet in Wirklichkeit aber die Chance, herauszufinden, was wirklich wichtig ist im Leben. Die Lektüre soll als Mut-Macher für benachteiligte Menschen dienen. Sie soll für all jene sein, die nach Schicksalsschlägen hadern und zum positiven Denken angeregt werden wollen. Das Werk führt vor Augen, was der Glaube an Gott bewirken kann, zeigt aber auch die vielfältige Scheinheiligkeit in der Kirche auf. Mit dem Buch wird versucht, ein Tabu zu brechen: Es ist ein ehrlich geschriebenes Werk, in welchem dem Leser unkonventionell der Spiegel des Nachdenkens vorgehalten wird und gesellschaftskritisch Botschaften transportiert werden wollen, die zum Widerspruch auffordern. Kategorie: Gesundheit, Familie, Lebenshilfe, Biografien, Erinnerungen, Erzählungen, Geschenkbücher, Zeitzeugen, Heimatgeschichte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Hans G. Mayer
Ein Leben zwischen Sturm und Regenbogen
www.tredition.de
Impressum
© 2015 Hans G. Mayer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7323-6701-6
Hardcover:
978-3-7323-6702-3
e-Book:
978-3-7323-6703-0
Buchtitelgestaltung:
Strauss-Grafik, 72537 Mehrstetten
Buchtitelfotografie:
Gerhard Mayer, 72537 Mehrstetten
Rechteinhaber:
HGM-Verlag, Hanna Mayer, Ulmer Straße 37 72537 Mehrstetten
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Hans G. Mayer
Romanartige Erzählung nach einer wahren Geschichte
Ein Leben zwischen Sturm und Regenbogen
Vita
Hans G. Mayer wurde 1950 in Mehrstetten auf der Schwäbischen Alb geboren. Weil seine Eltern ihn unter sechs Geschwistern zum Hofnachfolger erwählten, verweigerten sie ihm den Besuch einer höheren Bildungseinrichtung. Ein verhängnisvoller Unfall verhinderte dann den von seinen Eltern vorgezeichneten beruflichen Weg.
Von Jugend an galt seine Leidenschaft dem Schreiben. Im Jahre 2001 brachte er ein heimatgeschichtliches Buch heraus, das sich als lokaler Bestseller entpuppte. Überaus erfolgreich war er mit seinem zweiten Werk, „Mehr als landschaftliche Reize“ das sich mit der schwäbischen Mundart befasst. Für dieses volkstümlich gehaltene Sprachwerk das auch im SWR vorgestellt wurde, ist 2015 eine weitere Auflage geplant.
Obwohl er seit 30 Jahren an der parkinsonschen Krankheit leidet, hat er nach wie vor große Freude am Schreiben.
Mayer ist seit 40 Jahren verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Mehrstetten auf der Schwäbischen Alb.
Inhalt:
Impressum
Vita
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1
Eine wegweisende Entscheidung
2
Plötzlich einsam und allein
3
Autoritäre Erziehung
4
In der Rolle des Knechts
5
Hausaufgaben sind unwichtig
6
Mit Herzblut im Sport dabei
7
„Gott sei Dank bist du da“
8
Auf der Erfolgsleiter oben
9
Der verhängnisvolle Unfall
10
Eine unwirklich erscheinende Welt
11
Tiefes, dunkles Tal: Heimweh
12
Freunde verloren
13
Es droht Verjährung
14
Kaltschnäuzige Unverschämtheit
15
Das schlechte Gewissen
16
Der Mann an der Spitze ist unredlich Seite
17
Beamte: Schreibtisch voll beladen
18
Veränderung
19
Versuchungen
20
Die Frau fürs Leben
21
Mentalitätsunterschiede
22
Das Lügengeständnis
23
Die Hochzeit
24
Zwei Generationen, drei entfernt
25
Nicht alle Tassen im Schrank
26
Tod und Geburt
27
Der „Dämon der Tattrigen“
28
Kann nicht mal die Reifen wechseln
29
Die Körpersprache bei Parkinson
30
Auch nur einen Hosenknopf spenden Seite
31
Das Denken Pferden überlassen
32
Nachwort
Vorwort
Leider – oder vielleicht gottseidank – verläuft unser Leben nicht immer nach unseren Wünschen oder Erwartungen. Doch wir müssen unerwartete, negative Ereignisse als Herausforderungen betrachten.
Die in dieser Erzählung geschilderten Ereignisse beruhen auf einer wahren Geschichte. Die meisten der Namen der genannten Personen des Geschehens wurden anonymisiert. Bei dem Dorf Scheulenfeld und der Stadt Sirgenstein handelt es sich um fiktive Ortschaften. Etwaige Übereinstimmungen wären rein zufällig. Die Dialoge und Äußerungen Dritter sind teilweise zitiert, teilweise ihrem Inhalt nach wiedergegeben.
1
Eine richtungsweisende Entscheidung
Einundzwanzigster Mai 1959:
Er ahnte nicht, dass dieser Tag, was seine Zukunft betraf, einen gewaltigen Einschnitt in seinem Leben bringen würde.
Es nieselte. Leichter, warmer Maienregen begleitete Franz Schöpfel an seinem neunten Geburtstag, als er sich auf dem Nachhauseweg von der Volksschule in Scheulenfeld befand.
Franz freute sich schon aufs Mittagessen. Sicherlich hatte seine Mutter sein Lieblingsgericht, Fleischküchle mit Schwäbischem Kartoffelsalat und Spätzle mit Soße zubereitet. Immer wenn eines der vier Kinder der Familie Schöpfel Geburtstag feierte, erfüllte die Mutter dem Kind den Wunsch nach seiner Leibspeise und bereitete ihm sein Lieblingsessen. Deshalb war er frohgestimmt unterwegs. Sein Weg führte ihn von der Frauenstraße den schmalen Pfad zwischen hohen Lattenzäunen hindurch in die Fuchsgasse, in dem sich sein Elternhaus befand.
Die Vorfreude auf sein Lieblingsessen war schon der zweite erquickliche Anlass an diesem Tag, denn in der Schule war es für ihn wieder wünschenswert gut gelaufen. Der aufgeweckte Kerl mit seinen Sommersprossen im Gesicht und seinen etwas rötlichen Haaren war, wenn nicht der Beste unter den 32 Buben und Mädchen seiner Klasse, so doch einer der Begabtesten seines Schuljahrgangs. Lediglich noch zwei oder drei Mädchen und ein weiterer Junge konnten ihm das Wasser reichen, was die Zeugnisnoten anbelangte. Heute war er wieder bei denjenigen dabei, welche in der Klassenarbeit im Diktat fehlerlos geblieben waren.
Der Weg nach Hause führte ihn an alten Bauernhäusern vorbei. Die Schule, welche sich bisher beengt in der Ortsmitte befunden hatte, war durch einen Neubau am Ortsrand ersetzt worden. Die Wohnhäuser, Ställe und Scheunen der Bauern aber befanden sich in teilweise schlechtem Zustand. Der Ort aber, der auf der dünnbesiedelten Hochfläche der Schwäbischen Alb noch zu den volkreichsten in der strukturschwachen Region gehörte, war vergleichsweise groß.
Scheulenfeld war mit einem Gürtel aus Streuobstwiesen mit hohen Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Zwetschgenbäumen umzogen. In den Gärten standen vielfach kleine Schuppen und Bretterhütten, die dem Nachwuchs, der reichlich vorhanden war, zahlreiche geheimnisvolle, verwunschene Plätzchen zum Spielen boten. Die meisten Familien hatten drei oder noch mehr Kinder.
Franz Schöpfel stieg, nachdem er den Flur des Hauses seiner Eltern betreten hatte, schon der Duft seiner Leibspeise in die Nase. Im Hausflur hatten sich die angenehmen Essensdüfte noch mit dem penetranten Geruch des nur durch eine Stalltür getrennten angrenzenden Kuhstalles vermischt, aber als er die Küche betrat, entfalteten sich nur noch die Essensdüfte.
Die Geschwister von Franz, der um drei Jahre ältere Karlheinz und Roswitha, die fast auf den Tag ein Jahr vor ihm geboren wurde, saßen bereits auf ihren Plätzen auf der Eckbank. Sein dreijährige Bruder, Gerald, strahlte Franz an, „Du hast heute Geburtstag, es gibt dein Lieblingsessen“, brachte er freudestrahlend hervor.
Da war auch noch die „Stübles-Ahne“, die Mutter seines Vaters, die bereits das achtzigste Lebensjahr überschritten hatte und in ihrem Stübchen im ersten Stock des elterlichen Hauses wohnte, aber das Mittagessen zusammen mit den übrigen Hausbewohnern einnahm. Sie schien gedanklich abwesend zu sein.
Während Mutter Schöpfel noch am Herd hantierte, deckte Vater Hermann schon einmal den Tisch. Normalerweise ging es im Hause Schöpfel immer sehr lebhaft zu. Die Kinder berichteten von ihren Erlebnissen in der Schule und die Eltern erörterten die allgemeinen Dinge des täglichen Geschehens. Vater Hermann war heute ungewöhnlich ruhig und wortkarg, es schien als ob ihn etwas bedrücke. „Franz“, stieß er dann fast lautlos hervor, „nachher kommt dein Großvater; wir müssen etwas besprechen“.
Franz sah ihn an. „Wieso?“
„Lass dich halt überraschen. Ich denke, du wirst dich freuen“, mischte sich die Mutter ein.
Jetzt aber war Franz gespannt, was wohl Besonderes auf ihn wartete. Die großen Geschwister von Franz, Karlheinz und Roswitha schienen in die Angelegenheit eingeweiht zu sein, denn wie aus einem Mund tönten sie, „du wirst schon sehen“. Familienvater Hermann machte den Eindruck, als sei ihm bei der bevorstehenden Angelegenheit unwohl. Er runzelte die Stirn und wirkte mit seinen strahlend blauen Augen, im Gegensatz zu sonst, auf Franz irgendwie bedrückt.
Nun aber wollte das Geburtstagskind wissen, was da vor sich ging. „Sagt doch endlich was los ist, habt ihr ein besonderes Geburtstagsgeschenk oder wieso seid ihr so komisch?“
Die beiden älteren Geschwister kniffen die Augen zusammen und grinsten geheimnisvoll, während sich der Vater räusperte.
Dann hörten die um den Tisch versammelten Familienmitglieder, wie die Haustür geöffnet wurde. Schnellen Schrittes kam da jemand Richtung Küche und klopfte einen Augenblick später herzhaft an die Küchentür. Das konnte nur der überaus rüstige und energische Großvater, der Vater von Mutter Schöpfel sein.
Tatsächlich: der Großvater. „Grüß Gott miteinander“, begrüßte er die um den Küchentisch Sitzenden. „Da ist ja die ganze Familie versammelt“, sagte er forsch, während der neunjährige Franz ebenso erwartungsvoll wie auch gespannt zum Großvater aufblickte.
Der Alte, der wie immer, wenn er im Dorf zu Fuß unterwegs war, seine blaue Bauernschürze umgebunden hatte, kam vorsichtig zur Sache. „Franz“, stieß er zunächst noch zögerlich heraus. Seine Unsicherheit war ihm förmlich anzusehen. Seine Stimme klang gepresst, so als würde er gerade einen steilen Berg besteigen.
Der Vater, erhob sich von seinem Stuhl, drehte sich von den fragend zum Großvater Aufblickenden weg und schaute in Gedanken versunken zum Fenster hinaus. Er schien besorgt zu sein. Franz“, wiederholte der Großvater, „ich könnte einen tüchtigen Buben wie dich gut gebrauchen. Willst du nicht zu mir und Großmutter ziehen und bei uns wohnen. Du würdest dann, wie es früher bei Knechten und Mägden üblich war, immer zu Martini einen guten Lohn ausbezahlt bekommen.“ Damit hatte Franz nicht gerechnet. Ihm stockte der Atem.
Franz wusste zwar nicht, wie hart sich früher Knechte und Mägde auf den Bauernhöfen auf der rauen Alb ihren Lohn verdienen mussten, die in Aussicht gestellte Entlohnung aber war ihm willkommen. Er dachte daran, dass er seit jeher die Kleidung und Schuhe seiner älteren Geschwister abtragen musste und stellte sich vor, sich künftig auch eigene Spielsachen leisten zu können. Bei seinen Eltern saß das Geld alles andere als locker. Die drei großen Kinder mussten mit einem Taschengeld, das es jeden Sonntag als Sonntagsgeld gab, im Sommer mit 50, im Winter mit 30 Pfennig auskommen. Dafür durften sie dann im Gemischtwaren-Laden von Konditor Schmauder, der jeden Sonntag für eine Stunde geöffnet hatte, Süßigkeiten kaufen.
Franz ahnte nicht, dass er buchstäblich als Knecht bei den Großeltern angeheuert werden würde.
Scheulenfeld, ein ansehnlicher Ort mit knapp tausend Einwohnern, war Franz Schöpfel ans Herz gewachsen. Hier war die Welt in Ordnung.
Das Dorf war in allen Richtungen, trotz der rauen Lage, umgrenzt von fruchtbaren Feldern und Wiesen. Die Äcker waren immer wieder von Steinriegeln durchzogen, die mit Hecken bewachsen waren.
Die Gemarkungsgrenzen säumten vorwiegend hochgewachsene Buchenwälder, umgrenzt von drei Trockentälern mit Wacholderheiden.
Geteert war nur die Hauptstraße, welche mitten durch den Ort führte.
Die Nebenstraßen waren Kalkwege. Bei Regenwetter musste man durch zentimeterhohen Straßendreck gehen. Schwalben gab es im Dorf unzählige, sie fanden genügend Baumaterial. In einer Trockenperiode entstanden regelrechte Staubwolken, wenn man die Wege mit einem Fahrzeug befuhr.
Sämtliche Straßen des Dorfes waren eng bebaut, vorwiegend mit Bauernhäusern.
Zwar gab es einige Handwerker wie Küfer, Schreiner, Zimmererleute, Wagner und ein paar Kleingewerbetreibende sowie vier kleine Lebensmittel- und Kolonialwarenläden, aber außer fünf Gastwirten lebten die meisten von ihren Einkommen als Bauern.
Die Großeltern wohnten auch in Scheulenfeld, am östlichen Ortsende. Sie betrieben selbst noch eine Landwirtschaft, jedoch ohne Milchkühe. Die Großmutter hatte durch einen Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gefährt an der rechten Hand eine Verletzung erlitten, durch die es ihr nicht mehr möglich war, die Finger zur Faust zu schließen, sie konnte deshalb mit dieser Hand nicht mehr melken. Melken aber war traditionell Frauensache, weshalb die beiden Alten gezwungen waren, die Milchviehhaltung aufzugeben. Das Jungvieh, das sie nun heranzogen, erstand der Großvater auf meist auswärtigen Höfen im Umkreis von bis zu 20 Kilometern oder auf Viehmärkten feilschend. Der 65-jährige besaß keine landwirtschaftliche Zugmaschine, jedoch ein Pferd.
Zwei der drei Söhne der Großeltern waren im Krieg in Russland vermisst geblieben. So hatten die beiden gehofft, dass ihr ältester Sohn, Gregor, ihre Landwirtschaft und den Hof übernehmen würde. Doch dieser zog es dann vor, vom Wunsch des autoritären Vaters und seiner Mutter mit ihrer selbstherrlichen Art, Hofnachfolger zu werden, Abstand zu nehmen. Auch das bestimmende Naturell seiner Eltern veranlasste ihn dann, in den kleinen landwirtschaftlichen Betrieb seiner Frau einzuheiraten. Johann und Luise Schweizer waren immer der Ansicht gewesen, dass die Schwiegertochter Barbara für ihren Gregor nicht passend sei, weil diese eine verschlossene und sonderliche Eigenheit an sich habe. Außerdem hielten sie den Hof der Schwiegertochter für etwas beengt und auch nicht groß genug.
Franz fühlte sich geschmeichelt, vom Großvater eine fürstliche Entlohnung in Aussicht gestellt zu bekommen.
Sein Vater beeilte sich zu sagen: „Franz, wenn du aber nicht zu den Großeltern ziehen willst, brauchst du auch nicht. Du darfst selbst entscheiden.“ Die Mutter fiel ihm ins Wort. „Franz überleg mal, wenn du bei den Großeltern wohnst, hast du dein eigenes großes Zimmer, brauchst es nicht mit Karl-Heinz und Roswitha teilen. Und überhaupt, alles was du bekommst, gehört dir allein. Du brauchst niemand anderem etwas davon überlassen. Jeden Abend kannst du heimkommen und den täglichen Liter Frischmilch für die Großeltern abholen, so kannst du auch mit uns weiterhin verkehren.“
Seit Jahren, seit der Großvater nur noch Jungvieh mästete, war es so, dass immer eines der drei großen Kinder den Großeltern abends ihre Milch bringen musste.
Sie fuhr fort: „Sonntagnachmittags kannst du auch immer nach Hause kommen, in der Schule triffst du auch täglich deine Geschwister.“
Franz war sich nicht so recht im Klaren darüber, was er von Mutters Drängen, dem Großvater gleich zuzusagen, halten sollte.
Franz dachte darüber nach, wie der Großvater, wenn er zu Fuß unterwegs war, stets eilenden Schrittes und mit schwingenden Armen mehr lief als ging. So schneidig gehend kannte jeder im Dorf Johann Schweizer.
Damit, dass der Großvater ihn für tüchtig hielt und ihm manches zutraute, schmierte er Franz Honig um den Bart.
Sein Vater betonte noch einmal: „Franz wenn du lieber dableiben willst, du musst nicht gehen, du darfst selbst bestimmen, was dir lieber ist.“ Irgendwie lag etwas Wehmut in seinem Tonfall.
Erneut schaltete sich die Mutter ein: „Auch im Kleinallmending gibt es Kinder, mit denen du spielen und den Weg zur Schule und wieder nach Hause zusammen gehen kannst.“ „Kleinallmending“ so nannte man in Scheulenfeld den letzten Teil des östlichen Dorfendes, an der Durchfahrtstrasse, dort wo die Großeltern wohnten. Zwischen dem zusammenhängend bebauten Ort und Kleinallmending war auf der einen Seite der Straße eine unbebaute Lücke und auf der anderen befand sich der Dorffriedhof, so dass sich hier ein etwas abgeschiedenes Dorfteil gebildet hatte.
Von ihrer Angst vor ihrem autoritären Vater, Johann Schweizer, die sie zeitlebens gehabt hatte, sagte die Mutter nichts.
Nur die Tatsache, dass Hedwig Schöpfel schwanger wurde, führte zur Heirat mit Hermann Schöpfel. Denn nach dem Willen und den Vorstellungen ihres Vaters hätte sie Matthias Engelhardt, den wohlhabenden Bertelbauern, heiraten sollen. Auch der reiche Jakob Fritsch war ein Heiratskandidat gewesen, den sich ihr Vater für sie auserkoren hatte. Beide jedoch verschmähte sie und interessierte sich nie für sie.
Johann Schweizer war darauf bedacht, dass seine Tochter sich nicht mit dem weniger betuchten Hermann Schöpfel einlassen würde. Er musste mitbekommen haben, dass sich nach dem Krieg zwischen seiner 26jährigen Tochter und dem um sechs Jahre älteren Hermann Schöpfel etwas anbahnte.
Hermann Schöpfel galt zwar als grundanständiger Mensch, besaß aber nicht so viele Güter und Reichtümer wie sie sich Schweizer von seinem künftigen Schwiegersohn erwartete. Schöpfels Vater betrieb, was in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb eine absolute Seltenheit war, eine Gärtnerei und stellte im Winter für andere Gärtnereien zum Abdecken von Pflanzen und Beeten Strohmatten her. Das Rohmaterial, ein besonders kräftiges Haferstroh, importierte er aus Holland. In seinem Produktionsbetrieb fanden zahlreiche Bauern des Dorfes im Winterhalbjahr willkommene Arbeit. In Gewächshäusern zog er Salat und Gemüse heran, um sie in der naheliegenden Garnisonsstadt an den Mann zu bringen. Dann verstarb der Gärtner unerwartet und Hermann Schöpfel mit seinen elf Jahren war natürlich noch zu jung, um den Betrieb zu übernehmen. Die Strohmattenfabrikation wurde aufgegeben. So mühte sich Hermann Schöpfel nach absolvierter Schulzeit mit seiner kleinen Landwirtschaft ab und fand ein Zusatzeinkommen als Molker in der Milchsammelstelle mit Entrahmungsstation im Dorf. Hierzu musste er morgens und abends jeweils etwa zwei Stunden Zeit aufwenden.
Die Molke diente vor allem abends als Treffpunkt für die Jugend des Ortes zur Kommunikation und um Neuigkeiten zu erfahren. Molker Hermann Schöpfel wurde von allen, die Milch anlieferten, sehr geschätzt und respektiert.
Noch immer stellte sich Johann Schweizer einen Sohn von einem der reichen Bauern im Dorf als Schwiegersohn vor, dieses Ziel versuchte er nach wie vor zu verfolgen.
Die Tragödie, die sich kaum zwanzig Jahre früher in Scheulenfeld zutrug, verdrängte der „Schweizerhans“, wie man ihn im Dorf nannte, anscheinend ganz.
Damals verliebte sich Lena, eine der drei Töchter des Schimmelbauern, der zu den größten Bauern im Ort gehörte, in den jungen Zimmermann Clemens. Dessen Mutter wurde sehr bald nach seiner Geburt Witwe und brachte sich und ihren Sohn nur mit Mühe durch. Clemens aber war fleißig und tüchtig und schmiedete mit seiner Freundin Zukunftspläne.
Da die reichen Eltern von Lena eine Heirat der Verliebten mit allen Mitteln zu verhindern versuchten, wurden die beiden Liebenden in den Selbstmord getrieben. Im Wald fand man die beiden, die sich mit einer Pistole erschossen hatten. Selbst ihrem im Abschiedsbrief geäußerten Wunsch, man möge sie in einem gemeinsamen Grab beerdigen, waren die stolzen Schimmelbauern nicht nachgekommen.
Hedwig Schweizer war dieses Drama noch gut im Gedächtnis. Sie verfolgte damals, 8-jährig, wie man die toten jungen Leute mit einem Pferdefuhrwerk ins Dorf brachte. Sie erinnerte sich noch lebhaft an den liebenswürdigen jungen Zimmermann Clemens. Er war ihr immer behilflich gewesen, wenn sie, vor allem im Winter, mit dem Schlitten, der mit vollen Milchkannen beladen war, den Anger hinauf zur Molkerei musste.
Johann Schweizer jedenfalls war dieses unglückselige Ereignis offenbar nicht mehr im Gedächtnis. Er versuchte mit aller seiner Macht die Verbindung seiner Tochter mit Hermann Schöpfel zu verhindern.
Hedwig Schweizer scherte mit einigen Freundinnen zusammen schon jahrelang immer vom 1. Mai an bei verschiedenen Schäfern an wechselnden Orten Schafe. Meistens kamen die jungen Frauen erst am späten Samstagabend mit ihren Fahrrädern bei Dunkelheit von ihrer anstrengenden Arbeit nach Hause und mussten montags in der Frühe schon um halb fünf Uhr wieder aufbrechen.
Trotzdem verlangte Johann Schweizer von seinen Kindern, dass sie sonntags in der Frühe und auch am Sonntagabend bei der Stallarbeit mithalfen.
Einmal nutzte die 26-Jährige das bisschen Freizeit nach dem gemeinsamen Mittagessen der Schweizers um sich mit Hermann Schöpfel und ihren Freundinnen beim Sommerfest in einem Nachbardorf zu treffen. Dies musste heimlich geschehen, weil Schweizer mit seiner ganzen Autorität die Verbindung seiner Tochter mit Hermann Schöpfel zu verhindern versuchte. Hermann Schöpfel und seine Hedwig genossen die Zweisamkeit länger als geplant, so dass die junge Frau später als mit ihrem autoritären Vater vereinbart, den Rückweg antrat.
Hermann Schöpfel begleitete seine Freundin bis etwa zwei Kilometer vor dem Dorf, ging dann einen anderen Weg, damit ihn der Vater von Hedwig nicht mit ihr sehen würde.
Wie befürchtet, kam Johann Schweizer eilenden Schrittes Hedwig entgegen. Sie wusste von zahlreichen anderen Vorkommnissen, was ihr jetzt blühte. „Wo treibst du dich rum?“, war seine erste Frage. Ohne ihre Antwort abzuwarten, schlug er ihr heftig ins Gesicht. „Dein Kerl hat sich wohl versteckt, was?“ Sie wusste, dass jedes Wort zu ihrer Rechtfertigung ihn noch erboster und gewalttätiger machen würde. Eigentlich hätte sie jetzt vorgebracht, dass alle ihre Freundinnen, die mit ihr das Sommerfest im Nachbardorf besucht haben, noch dort verweilen und nicht zum Viehfüttern nach Hause müssten. Diese würden sich von der anstrengenden Arbeit die Woche über, im Gegensatz zu ihr, wenigstens am Sonntag, erholen dürfen. Wie besessen schlug Schweizer auf seine Tochter ein. Schweizer scherte sich nicht darum, dass seine Tochter bereits volljährig war und selbst wissen musste, was sie für richtig hielt.
Als Folge der Schläge war die junge Frau tagelang auf einem Ohr taub.
Für Hermann Schöpfel stand nach diesem Ereignis fest, dass er seine Freundin zukünftig nie mehr ohne sie zu begleiten, der Gewalt ihres Vaters ausgesetzt sein lassen würde. Für ihn stand auch außer Zweifel, dass Hedwig so schnell wie möglich aus ihrem Elternhaus und damit dem Zwang und der Herrschaft ihres Vaters herausgeholt werden musste.
So kam die Schwangerschaft von Hedwig gerade recht.
Auch Hermann Schöpfel selbst war nach der Hochzeit stets unwohl zu Mute, wenn sein Schwiegervater Johann Schweizer nur auftauchte. Dann musste er immer befürchten, dass die Arbeit, die er und seine Frau verrichteten, nicht gut genug, nicht schnell genug getan wurde. Ein Gehetze, wie es der Schwiegervater betrieb, ging Hermann Schöpfel gegen den Strich.
Hermann Schöpfel bekam von seinen Schwiegereltern nie das „du“ angeboten. Er redete sie, wie es in früheren Zeiten gang und gäbe war, und wie es verlangt wurde, respektvoll zeitlebens mit „Ihr“ an.
Hermann und Hedwig aber führten eine glückliche und friedvolle Ehe. Die beiden waren erfüllt von der Tatsache, dass ihre Kinder wohlgeraten waren, sie hatten an ihnen viel Freude.
Der Großvater wandte sich noch einmal an den neunjährigen Franz: „Franz, du darfst bei uns alle Aufgaben, die normalerweise erwachsene Knechte machen, übernehmen. Dazu gehört auch, dass du mit meinem Pferd und dem Fuhrwerk selbstständig fahren darfst. Auch das Reiten auf meinem Pferd werde ich dir beibringen.“
Reiten war des Großvaters große Leidenschaft. Im I. Weltkrieg gehörte er einem Dragonerregiment an. Beide seiner jüngeren Söhne absolvierten, bevor sie in den Krieg ziehen mussten, eine Gestütswärterausbildung, der eine im 20 Kilometer von Scheulenfeld entfernten Haupt- und Landgestüt, der andere in einem anderen, 25 Kilometer entfernten, Gestüt. Auch sie zwang er stets, wenn sie am Wochenende von ihrem Ausbildungsort mit dem Fahrrad nach Hause kamen, ihm in seiner Landwirtschaft tatkräftig zur Hand zu gehen. Auch sie bekamen die rigorose Autorität ihres Vaters leibhaftig zu spüren. Dann verhungerten, erfroren oder krepierten sie im Alter von 19 und 20 Jahren in Stalingrad.
Johann Schweizer fuhr, an den kleinen Franz gewandt, fort: „Ich will dir beibringen, wie man mit der Sense umgeht, dir alles zeigen, was dich zu einem guten und tüchtigen Bauern macht. Auch brauche ich einen flotten und sportlichen Jungen wie dich, der mich begleiten kann, wenn ich irgendwo Jungvieh gekauft habe, um dieses anzutreiben, wenn ich mit ihm zu Fuß nach Hause gehe.“
Schon mehrere Male in der Vergangenheit engagierte er Franz als Viehtreiber, als er Jungvieh in Nachbarorten erstand und dieses per pedes heimwärts brachte.
„Du wärst der ideale Viehtreiber. Ich weiß, dass du solch weite Wege mitgehen kannst. Weil ich dich für tüchtig und fleißig halte, wäre ich froh, du würdest mir gleich zusagen.“
Erneut fühlte sich Franz geschmeichelt. Er wusste nichts von dem ursprünglichen Vorhaben seiner Eltern, den älteren Bruder Karlheinz zu den Großeltern zu geben. Auch war Franz nicht darüber im Bilde, dass seine Mutter mit ihrem fünften Kind im fünften Monat schwanger war. Die beengten Wohnverhältnisse in ihrem kleinen Bauernhaus bewogen sie zu dem Schritt, ein Kind wegzugeben.
Franz wusste auch nichts von der Tatsache, dass der Großvater nicht Karlheinz zu sich und Großmutter nehmen wollte, sondern sich für dessen kleineren Bruder Franz entschieden hatte. Deshalb warb er nun um ihn.
Franz machte bisher nur positive Erfahrungen mit seinen Großeltern. Immer wenn er oder seine Geschwister zu den Großeltern kamen, gab es freundliche Worte und die Großmutter ging in ihre Kammer mit den Worten: „Dann will ich mal sehen, was ich für Euch habe“, und regelmäßig kam sie mit einem Stück Schokolade oder anderen Leckereien zurück. Auch gab es immer eine reichliche Belohnung, wenn man den Alten einen Gefallen getan oder sich irgendwie hilfreich Ihnen gegenüber zeigte.
So sagte der kleine Franz spontan zu, das Angebot des Großvaters anzunehmen und ab dem nächsten Monatsersten, wie es früher bei Knechten und Mägden der Fall war, zu den Großeltern zu ziehen.
Hedwig Schöpfel war erleichtert, während ihr Ehemann nicht so recht wusste, ob er sich freuen oder grämen sollte.
2
Plötzlich einsam und allein
Am 1. Juni erfolgte der Umzug von Franz ins Kleinallmending zu den Großeltern. Die wenigen Sachen, die Franz Schöpfel mitnahm, waren schnell zusammen gekramt. Es waren nur ein paar Kleidungsstücke und die Schulsachen. Alles andere wurde von den Großeltern gestellt.
In seinem neuen Zuhause, seiner Kammer im ersten Stock des Bauernhauses der Großeltern, wohnte zuletzt Magdalene Wernauer. Magdalene nahmen Johann und Anna Schweizer im Mai 1944 im Zuge der Kinderlandverschickung bei sich auf. Als Neunjährige kam sie in bombenbedrohter Zeit vom Ruhrgebiet auf die Alb. Eineinhalb Jahre später holte man sie wieder ab. Weil es in Duisburg zu Hause wenig zu essen gab und weil die Schweizers ihr schrieben, sie solle doch wieder kommen, zog sie ein Jahr später erneut und endgültig zu Johann und Luise Schweizer. Hier wuchs sie auf, und Johann Schweizer erzog sie genau so streng, wie seine eigenen Kinder. Sie musste stets in Haus und Hof mithelfen, und für Schularbeiten bekam sie wenig Freiraum, bestenfalls am Sonntag durfte sie sich Zeit nehmen, für die Schule zu lernen.
1958 heiratete Magdalene im Ort einen Einheimischen und zog bei Schweizers aus. Lange meinte Franz, dass Magdalene die Schwester seiner Mutter sei, doch wunderte er sich immer, dass sie seinen Großvater mit Onkel und die Großmutter mit Tante ansprach.
Er erinnerte sich noch, dass er als kleiner Bub mit vielleicht fünf oder sechs Jahren in ihrem ehemaligen Zimmer gespielt und dabei versehentlich ihren Puppenwagen, der noch aus ihrer Kindheit herumstand, beschädigte. Als sie mit ihm ein Hühnchen rupfen wollte, nahm er damals Reißaus. Weil er schon als kleiner Knirps schnell laufen konnte, gelang es ihm, bis in die Dorfmitte zu flüchten, wo ihn dann die damals Zwanzigjährige einholte und wieder zurückschleppte.
Dies rief er sich ins Gedächtnis, als er am Abend in seiner Kammer alleine war. Er kam sich einsam und verlassen vor. Die schlichte und einfache Einrichtung mit einer Kommode, einem Schrank, in dem es nach Mottenkugeln roch, und seinem Bett trug im Übrigen dazu bei, dass ihm erste Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung, zu den Großeltern zu ziehen, kamen.
Sein Bett war als Matratze mit einem Strohsack ausgestattet. Franz konnte nicht einschlafen; sein bisheriges Leben zog in Gedanken an ihm vorbei.
Wie er vom Erzählen seiner Eltern wusste, begann sein Leben bereits aufregend für alle Beteiligten: An einem schönen Sonntagmorgen im Mai setzten bei Hedwig Schöpfel die Wehen ein. Da ihr Mann bereits in die Molkerei gegangen war, bat sie einen Nachbarn, die Hebamme zu benachrichtigen. Diese war jedoch bereits auf dem Weg zum drei Kilometer entfernten Bahnhof, weil Sie eine Wöchnerin in einem Nachbardorf besuchen wollte. Die Schwangere bat ihren Nachbarn, er möge im Bahnhof anrufen, um Hebamme Assenheimer am Einstieg in den Zug zu hindern. Ein eigenes Telefon besaßen die wenigsten, auch Schöpfels nicht. Doch es war schon zu spät, der Zug war mit der Hebamme abgefahren. Währenddessen wurden die Wehen der Gebärenden immer heftiger. Eine Nachbarin, die bereits etwas älter war und selbst schon fünf Kinder geboren hatte, erschien am Fenster von Hedwigs Schlafzimmer und Hedwig bat die Nachbarin, sie möge doch hereinkommen und ihr in ihrer Not beistehen. Diese fühlte sich jedoch dazu nicht in der Lage. Stattdessen forderte die Nachbarin





























