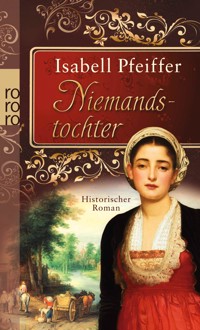
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Welt in Aufruhr. Eine Frau kämpft sich zurück ins Leben. Schwaben zur Zeit des Bauernkriegs 1525. Die Heirat mit dem jähzornigen, aber wohlhabenden Andres Breitwieser scheint für Barbara der Beginn einer besseren Zukunft. Aber der Bauernkrieg nimmt ihr Mann und Zuhause; die junge Frau gerät in die Kriegswirren und wird auf der Flucht durch geplünderte und niedergebrannte Dörfer von marodierenden Landsknechten vergewaltigt. Aus Glatt verbannt, ist das Hurenhaus in Rottenburg der einzige Platz, wo sie ihr Kind zur Welt bringen kann. Ihr Weg erscheint vorgezeichnet … «Ein tadelloser, spannender Roman». (Main-Echo) «Wirklich lesenswert!» (Histo-Couch.de)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Isabell Pfeiffer
Niemandstochter
Roman
Teil I · 1515
1
«Komm jetzt, Barbara!» Energisch griff Gertrud Spaichin nach der Hand des Mädchens, aber das Kind riss sich los und lauschte: Sie hatten schon angefangen.
«…ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo…» Der Singsang der Schüler drang an ihr Ohr, vertraut, so vertraut wie ein Wiegenlied. Sie würde ihre schäbige Wachstafel nehmen, wie an jedem Tag, leise die Tür zum Schulsaal öffnen und sich in ihrer Ecke zusammenkauern, sich unsichtbar machen wie eine Maus, während vorn der Magister die Bücher zurechtrückte und mit seiner tiefen Stimme sprach, die sie umfing wie eine warme Decke. Er würde durch die Reihen gehen und dem einen das Haar raufen, den anderen zurechtweisen, um sie dann schließlich doch zu finden und überrascht zu rufen: Da ist ja meine Barbara! Noch einmal, noch einmal jetzt und immer wieder…
«Lass das, Kind. Wir haben doch darüber gesprochen. Hier, du kannst den Beutel nehmen.» Hastig hängte die Mutter Barbara ein Leinensäckchen um und griff dann selbst nach der großen Kiepe. Das Gestell war schwer; es dauerte eine Weile, ehe sie es auf den Rücken gewuchtet und festgeschnallt hatte. Schließlich packte sie den Gehstock und wandte sich zur Tür. Barbaras Unterlippe begann zu zittern.
«Wollen – wollen wir nicht auf Wiedersehen sagen? Und Gottes Segen?» Sie sah die Mutter mit großen Augen an, in denen schon die Tränen schimmerten. Gertrud kniff die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. «Nein», sagte sie barscher als beabsichtigt.
Sie öffnete die Tür und machte sich daran, die steile Stiege hinabzuklettern. «Ich will hierbleiben», flüsterte das Kind. Aber da waren sie schon auf dem Weg zum Stadttor hinaus und durch die Gärten, am Fluss entlang, wo das Tal enger wurde und die Weinberge steiler, vorbei an überschwemmten Wiesen und kleinen Weilern bis ans Ende der Welt.
Das Dorf lag in der Talaue des Flüsschens Glatt, das westlich von Dornstetten im Schwarzwald entsprang und sich zunächst an Neuneck, Leinstetten und Hopfau vorbeischlängelte, um schließlich keine halbe Meile entfernt von hier zwischen Horb und Sulz in den Neckar zu münden. Zwei Tage hatten sie gebraucht, um von Rottenburg neckaraufwärts herzugelangen, und schon von weitem hatten sie den klobigen, viereckigen Bau der Wasserburg gesehen, die mit ihrem großen Wehrturm das Bild beherrschte.
«Das ist Glatt», erklärte Gertrud und blieb für einen Augenblick auf der schmalen Holzbrücke stehen, die sie von Norden her über den Fluss führte, wo die Hänge dicht mit Weinreben bewachsen waren. «Hier in diesem Dorf bin ich geboren und aufgewachsen.» Barbara folgte mit den Augen der ausgestreckten Hand: Eine bescheidene Ansammlung von Höfen drängte sich zwischen Kirchlein und Burg wie Gänse zwischen den Stecken der Hütekinder. Wo noch Platz war neben Strohdächern, Schuppen und Fachwerk, lagen kleine Gärten eingestreut, in denen sich schon das erste Grün des Frühlings regte. Ein mannshoher Flechtzaun umschloss das ganze Dorf. Dahinter erstreckte sich ein Streifen Grünland, bevor das Gelände an der gegenüberliegenden Talseite wieder steil zu den bewaldeten Höhen anstieg. Schafe und Kühe weideten dort träge in der Abendsonne.
«Schau mal, da drüben am Ufer haben wir als Kinder immer gespielt. Jetzt ist natürlich viel zu viel Wasser da, weil im Schwarzwald oben der Schnee schmilzt, aber im Sommer kann man sogar durch den Fluss waten. Und wenn du ein Stöckchen hineinwirfst, dann schwimmt es mit der Glatt zum Neckar und kommt in ein paar Tagen in Rottenburg vorbei.» Gertrud versuchte ihrer Stimme einen heiteren Klang zu geben.
Sie waren mittlerweile am Ende der Brücke angekommen. Irgendwo kläffte ein Hund, es roch nach Mist und verbranntem Holz. Die Mutter nahm Barbara fest an die Hand, wich den Schweinen aus, die mit ihren Schnauzen den weichen Boden des Dorfplatzes nach Schnecken und Würmern durchwühlten, und machte vor einem niedrigen Bauernhaus halt. Die Sonne stand schon tief im Westen. Barbara kniff ihre Augen zusammen und blinzelte.
«So, Barbara. Jetzt sei schön brav und sprich nur, wenn du gefragt wirst, verstanden?» Das Kind nickte, während Gertrud auf ihren Rockzipfel spuckte und ihm damit über das Gesicht wischte. «Wie siehst du nur wieder aus… So.» Sie hob die Hand und klopfte. Stimmen waren von innen zu hören, dann kräftige Schritte. Schließlich öffnete sich die Tür. Ein Mann stand ihnen gegenüber und musterte sie von oben bis unten.
«Gertrud?» Er war vielleicht Mitte dreißig, mit wirrem Haar und einem stoppeligen Bart und Wangen, die von staubgrauen Furchen zerklüftet wurden. «Was machst du hier? Wir haben dich nicht erwartet.» Er sprach nur mit den Lippen, ohne den Kiefer dabei zu bewegen. Aber die Augen wanderten unruhig hin und her und streiften immer wieder Barbaras Gesicht.
«Ich weiß.» Die Mutter nickte. «Ich habe erst vor ein paar Tagen beschlossen, wieder zurückzukommen. Das hier ist Barbara, meine Tochter. Sie ist neun.» Der Mann beugte sich hinunter, legte Barbara die Hand unter das Kinn und hob es hoch. Sie spürte die kratzigen Schwielen an seinen Fingerkuppen, die abgebrochenen Fingernägel.
«Barbara also. Sieht aus wie du, als du klein warst.» Er richtete sich wieder zu seiner vollen Größe auf. «Zurückzukommen? Wie meinst du das?», fragte er dann. Der Griff um Barbaras Hand wurde fester.
«Balthes, ich – es war besser so.» Die Finger der Mutter waren nass geworden, sie pressten Barbaras kleine Hand so fest zusammen, dass es wehtat.
«Haben sie dich rausgeworfen? Oder was?», fragte der Mann. Barbara versuchte, an ihm vorbei ins Hausinnere zu spähen. Irgendwo hinten hörte sie jemanden mit Kesseln und Töpfen hantieren – vielleicht jemand, der diesen kantigen Mann einfach wegschicken und sie hereinbitten würde zu einer heißen Suppe und einem Stück Brot? Sie war so schrecklich müde nach diesem langen Weg.
«Oder was?» Die Augen des Mannes hatten sich verengt, seine Stimme war jetzt schneidend. Er schien noch viel fragen zu wollen, aber in diesem Augenblick wurde er zur Seite geschoben, und eine hagere Frau erschien an seiner Seite. Sie beugte sich zur Mutter hinüber und küsste sie auf die Wange.
«Willkommen, Gertrud. Wie schön, dich nach all der Zeit wiederzusehen! Und? Willst du deine Schwester nicht hereinlassen?» Langsam und unwillig löste sich Balthes von den Türpfosten und gab den Eingang frei.
Barbara saß auf der schmalen Bank neben ihrer Mutter und löffelte dankbar die dünne Suppe, die Tante Mia aufgetischt hatte. Unter gesenkten Lidern betrachtete sie die Familienmitglieder. Balthes Spaich duckte sich über seinen Teller, als müsste er ihn verteidigen. Er war kräftig und braun gebrannt von der Arbeit im Freien, und doch ging von seinen trüben Augen, seinen gespannten Zügen etwas Ungesundes aus. Feine rote Äderchen liefen von seiner Nase über beide Wangen, und die Lippen waren so schmal, als würde er sie beständig nach innen ziehen. Er aß wie jemand, der noch nie im Leben wirklich satt geworden war: hastig, gierig, ohne ein Wort. Obwohl seine Augen seinen Teller keinen Moment losließen, hätte Barbara geschworen, dass er genau zählte, wie viele Löffel Brei jeder andere am Tisch zu sich nahm. Tante Mia mit den strähnigen Haaren und den wässrigen Augen, die jeden Moment überzulaufen schienen, wagte in seiner Gegenwart kaum hochzuschauen, und ihre Bewegungen waren fahrig und schuldbewusst. Jeden Augenblick schien sie kurz davor, etwas zu verschütten oder umzukippen, und murmelte eine Entschuldigung vor sich hin, während sie Liesbeth, der Jüngsten, den Brei mit dem Löffelchen in den Mund schob. Die Kleine brabbelte vor sich hin; Brei hing an ihrem Mündchen, Brei klebte an ihren Händen und sogar in ihrem Haar, und die Fliegen hatten es darauf abgesehen. Das Mädchen mit den langen braunen Zöpfen, der kecken Nase und den Zahnlücken, das ihr gelegentlich einen Blick zuwarf und verhalten lächelte, hieß Gunda. Sie war wohl nur wenig älter als Barbara selbst, während Hans, der ihr gegenübersaß, vielleicht drei, vier Jahre jünger war. Er war ein gedrungener kleiner Kerl und schnaufte beim Essen, als müsste er schwere Arbeit verrichten. In zwei fetten grünen Bändern lief ihm der Rotz aus der Nase, obwohl er ihn sich immer wieder mit dem Ärmel abwischte.
«Los, raus mit euch. Wir haben zu reden, da können wir euch nicht gebrauchen. Und sperrt die Hühner in den Stall!» Balthes Spaich war aufgestanden und gab seinem Sohn einen leichten Klaps. «Marsch jetzt.» Gunda warf einen fragenden Blick zu ihrer Mutter, die kaum merklich nickte, packte Liesbeth am Ärmel und lief zur Tür. Zögernd rutschte Barbara von der Bank herunter und folgte ihr.
Auf dem Dorfplatz war schon eine ganze Schar Kinder versammelt. Nur noch wenige Schritte, und alle würden sich zu ihr umdrehen, würden zu ihr herübersehen, neugierig, abschätzig, würden anfangen, zu tuscheln und zu kichern, und Gesten machen, deren Sinn sie nicht verstand. Ihr Herz schlug schneller. Sie stolperte und starrte auf den Boden.
«Hierher, los. Setz dich hin.» Staubige Füße traten zur Seite, verschlissener Stoff schabte über ihren Arm. Aber niemand schien auf sie zu achten, schien überhaupt zu bemerken, dass eine Fremde unter ihnen war. Die Aufmerksamkeit der Dorfkinder ruhte auf einem hoch aufgeschossenen blonden Jungen in ihrer Mitte.
«Lass ihn springen, Simon, noch einmal! Bitte, lass ihn springen!» Der blonde Junge lachte und warf seine wilden Haare zurück. Um die Stirn hatte er sich ein buntes Tuch gebunden, was ihm ein verwegenes Aussehen verlieh, und in der Hand hielt er eine lange Haselrute, mit der er einen scheckigen kleinen Hund hin und her dirigierte. Der Hund stand auf den Hinterpfoten und hüpfte, sobald der Junge die Stockspitze hob, als hinge er an einem unsichtbaren Faden.
«Brav, Fex, braver Hund. Bist ein ganz Braver.» Der Junge ließ den Stock sinken und fuhr dem Tier mit seinen langen Fingern durch das Fell. Dann zog er einen Happen aus der Tasche; das Tier schnappte glücklich danach und ließ sich den Bauch kraulen.
«Weiter! Was soll er weiter tun?» Fragend blickte er in die Runde und richtete sich auf.
«Springen! Simon, er soll über den brennenden Stock springen, wie letztes Mal!» Simon runzelte die Stirn und setzte eine bedenkliche Miene auf.
«Über den brennenden Stock… das ist schwierig. Sehr schwierig! Was meinst du, Fex?» Er schnippte mit den Fingern. Der Hund sprang auf, leckte kurz die ausgestreckte Hand des Jungen und schlug dann einen Purzelbaum. Die Kinder lachten, Barbara saß wie verzaubert. «Einer muss das Feuer holen.» Er streckte den Stock aus; gleich rannten zwei Kleine zu ihm hin und prügelten sich fast um die Ehre, die Haselrute am Kochfeuer eines Herdes anzünden zu dürfen. «Und jetzt… wer hält den Stock, während ich ihn anlocke?», fragte er lächelnd.
«Ich, Simon, ich! Nimm mich!» Alle schrien gleichzeitig los, rissen die Hände in die Höhe, schubsten, knufften. Hohheitsvoll betrachtete der Blonde sein Publikum und ließ den Blick über die aufgeregten Köpfe schweifen.
«Nein, du nicht… und Georg, du bist so ein Schisser, du lässt nur den Stock fallen… Martin war’s schon das letzte Mal…» Wie sie sich aufplusterten, während er an ihnen vorbeischritt, wie die Gesichter rot anliefen und die Hälse immer länger wurden! Plötzlich blieb er vor Barbara stehen.
«Du.» Er nahm ihre Hand und zog sie auf die Füße. «Wie heißt du?»
«Ich… Barbara.»
«Barbara, du machst es.» Wie eine Puppe ließ sie sich hinter ihm herziehen, die brennende Haselrute in die Hand drücken und in die richtige Position bringen. Die Dorfkinder sahen sie neidisch an. Die Rute zitterte in ihrer Hand.
«So.» Simon setzte den Hund ein paar Schritte von Barbara entfernt auf die Erde. «Da bleibst du sitzen, bis ich pfeife, verstanden?» Der Hund sah ihn mit großen Augen an und wedelte mit dem Schwanz, und dann tänzelte Simon an ihm vorbei auf die andere Seite.
«Jetzt!» Er hob die Hand, hielt ein kleines Stück Fleisch hoch und pfiff. Der Hund rannte und sprang, aber Barbara sah, dass er zu kurz springen würde. Er hatte Angst, das konnte sie spüren, die Angst lähmte ihm die Beine, er war hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu seinem Herrn und der Angst und würde sich das Fell verbrennen. Im letzten Augenblick ließ sie den Stock fallen.
Die Dorfkinder schrien auf vor Enttäuschung. Barbara hörte sie böse zischen, spürte die wütenden Blicke auf ihrem Gesicht und zog den Kopf ein. Jetzt, jetzt würden sie sich auf sie stürzen und sie in den Dreck werfen, würden sie verprügeln, weil sie ihr Spiel verdorben hatte… Schon fasste eine Hand nach ihrer Schulter, und sie zuckte zusammen.
«Du hast ihn gerettet», sagte Simon feierlich. Er zog sich das Tuch vom Kopf, verbeugte sich feierlich und überreichte es ihr. Das feindselige Gemurmel verstummte augenblicklich.
«Er war einfach schon zu müde. Wenn du nicht aufgepasst hättest, hätte er sich verbrannt.» Es war inzwischen fast schon dunkel geworden, und sie konnte nicht erkennen, ob es nur der Schalk war, der aus Simons Augen blitzte. Bevor sie noch etwas sagen konnte, hob er den kleinen Hund auf und hielt ihn hoch.
«Wollt ihr nicht klatschen für den besten Hund der Welt?» Gehorsam klatschten die Dorfkinder, und Simon nickte zufrieden. In diesem Augenblick drängte sich ein Halbwüchsiger nach vorn und blieb knapp vor Simon stehen. Er war ein kräftiger Bursche, fast schon ein Mann, und der verbissene Ernst in seinem Gesicht stand in merkwürdigem Gegensatz zu den weichen, dunklen Locken, die ihm ungebändigt in die Stirn fielen.
«Schluss mit den Faxen, Simon», sagte er scharf. «Du kommst sofort nach Hause, verstanden? Vater ist fuchsteufelswild, weil du das Holz nicht klein gemacht hast.» Verblüfft schaute Barbara von einem zum anderen: So unterschiedlich sie waren, es gab doch eine Ähnlichkeit. Und natürlich, wenn man es wusste, war es nicht zu übersehen, auch wenn Simon blond, der andere aber dunkelhaarig war: dieselbe kräftige Gestalt, bei Simon etwas mehr in die Länge gezogen, dieselben eindringlichen, weit auseinanderliegenden Augen, dieselben kantigen Gesichtszüge mit der vorspringenden Kinnpartie. Sie mussten Brüder sein. Simon schien ein bisschen geschrumpft zu sein, seit sein Bruder die Bildfläche betreten hatte. Er setzte den kleinen Hund vorsichtig wieder auf die Erde, zuckte mit den Schultern und murmelte eine Entschuldigung. Die Dorfkinder standen langsam auf und machten sich davon. Heute würde es nichts mehr zu sehen geben. Barbara beeilte sich, hinter Gunda herzulaufen, die mit der kleinen Liesbeth auf dem Arm schon ungeduldig auf sie wartete.
Barbara lag in der winzigen Nebenkammer auf ihrem Strohsack und konnte nicht einschlafen. Die drei Kinder des Onkels neben ihr waren schon lange ruhig, wenn man von Ruhe sprechen konnte: Der kleine Hans schnarchte zum Gotterbarmen und warf sich hin und her, weil er durch seine verrotzte Nase nicht genug Luft zum Atmen bekam. Die Stimmen der Erwachsenen aus der Stube wurden lauter; Barbara zog sich die Decke über die Ohren, aber sie konnte trotzdem jedes Wort verstehen.
«…lässt dir noch ein Hurenkind machen und bringst es in mein Haus, damit ich es durchfüttern soll! Als ob das eine Balg nicht genug gewesen wäre…»
«Bitte, Balthes! Sie ist doch deine Schwester.» Das war die Tante.
«Ach, halt’s Maul! Meine Schwester! Eine gottverdammte Pfaffenhure ist sie, die nicht schnell genug zu diesem Tintenpisser unter die Decke kriechen konnte! Soll sie doch sehen, wie sie zurechtkommt mit ihren Bastarden!»
«Balthes, um Gottes Barmherzigkeit…! Wo soll ich denn sonst hin? Du kannst uns doch nicht vor die Tür setzen», sagte ihre Mutter flehend. Barbara biss in ihre Decke; Sandkörnchen knirschten zwischen ihren Zähnen. Mutter wollte, dass sie hierbleiben sollten, für immer hierbleiben; für immer bei diesem übellaunigen Mann, vor dem sie jetzt schon Angst hatte und der nach Alkohol roch. Mach, dass wir morgen wieder zurückgehen, lieber Gott, betete sie. Ich will auch immer zur Frühmesse gehen und alle Gebote halten und mein ganzes Geld den Armen spenden, aber lass uns nicht hierbleiben, hier unter diesem Dach.
«Ich kann dir hier auf dem Hof helfen, Balthes, bestimmt, so wie früher… weißt du nicht mehr, dass ich die beste Milchmagd im ganzen Dorf war? Weißt du’s nicht?» Der Onkel knurrte irgendetwas; es schepperte, und eine Frauenstimme jammerte schrill auf.
«Balthes, nicht! Balthes! Lass!»
«Im Kuhstall hast du’s getrieben, das weiß ich noch! Und wie ich das weiß! Das werd ich wohl nie vergessen!…» Barbara steckte sich die Zeigefinger so fest in die Ohren, dass sie nichts mehr hörte als das Pulsen ihres eigenen Blutes.
In der Dunkelheit der Stube lehnte Gertrud sich gegen die Wand. Auf der anderen Seite lag der Küchenherd, und die Steine gaben eine tröstliche Wärme ab. Sie schob sich die Hände unter ihren Rock und streichelte sanft über ihren Leib, dem man noch nicht ansah, dass ein Kind darin wuchs. Sie konnte seine Bewegungen noch nicht fühlen, aber sie wusste ja, dass es da war. In einem halben Jahr würde es zur Welt kommen, hier, in diesem Haus, in dem sie selbst aufgewachsen, aber jetzt nur noch geduldet war.
«Was hätte ich denn tun sollen?», flüsterte sie der Dunkelheit zu. «Ich konnte doch nicht länger dableiben.» Wie dumm war sie gewesen, wie dumm! Natürlich konnte der Magister keine schwangere Magd in seinem Haus dulden: Nicht den Hauch eines Zweifels hatte er daran gelassen. Wollte er nicht Rektor der Lateinschule werden? Da durfte es keine verdächtigen Punkte in seinem Lebenswandel geben. Sie hatte ihm gestanden, dass sie guter Hoffnung war, als sie miteinander im Bett lagen. Kaum wieder angezogen, war er zu seiner Truhe gegangen, hatte sie aufgeschlossen und dreißig Gulden in ein Holzkästchen abgezählt. Das sollte wohl reichen, nicht wahr, bis sie etwas Passendes gefunden hätte? Und Gottes Segen, auch für das Kind! Und dass sie es gottesfürchtig erziehen sollte.
Gertrud lächelte böse. Der Gedanke an den Magister hatte sie wenigstens abgelenkt von ihrer schmerzenden Lippe, die inzwischen deutlich angeschwollen war. Sie leckte mit der Zunge darüber. Dreißig Gulden. Es war nicht gut, das Geld hier im Haus ihres Bruders aufzubewahren. Früher oder später würde er es finden und nicht mehr herausgeben. Sie musste es in Sicherheit bringen. Plötzlich hatte sie wieder Barbara vor Augen. Wie verängstigt hatte das Kind ausgesehen, als Balthes es ins Bett geschickt hatte! Barbara hatte den Magister gemocht. Sicher vermisste sie ihn und den Unterricht, an dem er sie augenzwinkernd hatte teilnehmen lassen. Für Barbara würde es eine große Umstellung sein: als kleinste und jüngste Magd auf einem Hof, der vermutlich gerade genug abwarf, dass seine Bewohner nicht verhungern mussten. Sie würde mit dem zufrieden sein müssen, was die anderen übrig ließen. Gertrud ballte die Fäuste. Dreißig Gulden. Das war nicht genug, um ihnen anderswo ein sorgloses Leben zu ermöglichen.
Missmutig wies der Onkel ihnen einen Verschlag neben dem Hühnerstall zum Schlafen zu. Darin bewahrte er alte Gerätschaften und allerlei Gerümpel auf. Sie räumten den Kram zur Seite, so gut es ging, legten ein paar Bretter auf dem Boden aus und machten sich mit ihren Decken und Strohsäcken ein Bett zurecht. In den ersten Nächten träumte Barbara regelmäßig, wie sie wieder nach Hause zurückgingen. Immer war es in ihren Träumen Winter. Sie wanderten unter kahlen Bäumen und zwischen abgeernteten Feldern entlang, bis sie endlich die Stadt erreichten, das vertraute Haus, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatte. Voller Freude machte sie sich daran, die Stufen hinaufzusteigen. Aber die Treppe war entsetzlich hoch, viel höher, als sie früher jemals gewesen war. Es kostete Barbara all ihre Kraft, zumal die Stufen nach oben hin immer steiler wurden und der Gepäcksack auf ihrem Rücken immer schwerer. Endlich hatte sie es geschafft: Da war die Diele, da die Tür zur Schulstube. Mit letzter Kraft schleppte sie sich über die Schwelle. Vorn an der Tafel stand ein Mann und wandte ihr den Rücken zu. Er schrieb etwas, was sie nicht lesen konnte, und sie kam näher heran, um es besser zu sehen. Da drehte der Mann sich zu ihr um: Es war nicht der Magister, sondern Balthes Spaich. Er fletschte die Zähne und grinste. Dann griff er nach dem Korb, den sie auf dem Rücken trug, und nahm ihn ihr ab. Er kippte den Inhalt auf den Boden: Steine waren darin, sonst nichts. Schmutzige Steine hatte sie mit letzter Kraft hier hochgeschleppt. Balthes stemmte die Hände in die Hüften und lachte, genau wie die Mutter, die plötzlich neben ihm stand, sie lagen sich in den Armen und lachten und lachten…
Schon am ersten Morgen, als Barbara versucht hatte, ihrer Mutter nicht von der Seite zu weichen, hatte Gertrud sie sanft, aber bestimmt zurückgewiesen.
«Ich gehe mit aufs Feld, wir wollen Unkraut hacken. Dafür bist du noch zu klein. Sieh zu, dass du dich hier im Haus und bei den Tieren nützlich machst, verstanden? Es soll keiner denken, wir wären nur zwei Esser mehr!» Auch ohne den warnenden Blick hätte Barbara genau verstanden, was das bedeutete: Balthes Spaich würde sie kaltblütig aus dem Haus werfen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wenn sie ihm nur einen Vorwand dafür lieferten.
«Soll er doch!», dachte sie ein paar Tage später. Balthes war ein furchtbarer Mann, vor dem sie Angst hatte, seit sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, seine Frau und die Kinder waren verschreckte Mäuse, die nicht wagten, auch nur ein Wort gegen ihn zu sagen. Und die Mutter ließ sich behandeln wie ein Stück Dreck. Von ihr konnte sie keine Hilfe erwarten, wenn Balthes ihr ins Gesicht schlug, so wie gerade eben, nur weil sie ein Schälchen Molke verschüttet hatte. Sie blieb stehen und lauschte: In der Stube war es still. Balthes war wahrscheinlich ins Wirtshaus gegangen, während seine Frau mit den Kindern in der Kirche die Abendandacht betete. Sie nahm sich den Leinenbeutel, stopfte eine Decke hinein und schlich dann auf Zehenspitzen hinüber zum Herd. Oben im Kamin hingen ein paar Stücke getrocknetes Fleisch, mehr brauchte sie nicht. Der Magister würde ihr alles kaufen, was noch fehlte. Wenn sie nur erst dort war. Zuerst musste sie den Fluss finden, dann war es leicht: immer flussabwärts, dann würde sie irgendwann die Stadt sehen.
«Was machst du da, Barbara?» Erschreckt sah sie sich um. Die Mutter stand plötzlich hinter ihr und nahm ihr den Beutel aus der Hand. Mit einem Blick sah sie, was darin war, und ihre Lippen wurden schmal. «Was hat das zu bedeuten? Na?», schrie sie. Trotzig verschränkte Barbara die Arme vor der Brust.
«Ich gehe zurück nach Rottenburg», sagte sie mit fester Stimme. «Du kannst ja hierbleiben, wenn du so gern willst, aber ich nicht. Mit mir war der Magister nicht böse, und ich mag ihn viel lieber als den Onkel. Viel lieber.» Gertrud nahm ihr die Decke ab und warf sie auf die Wandbank, dann griff sie nach dem Trockenfleisch.
«Woher hast du das? Du darfst nicht einfach etwas wegnehmen, das weißt du doch», schalt sie ihre Tochter. Plötzlich fing Barbara an zu schreien: «Ich gehe weg, hörst du? Ich will nicht hier sein! Du bist schuld, dass wir hierherkommen mussten, in dieses schreckliche Haus! Ich will zurück. Ich will zurück!» Mit hartem Griff packte Gertrud ihre Tochter bei den Armen und schüttelte sie, bis sie ruhig wurde.
«So spricht man nicht mit seiner Mutter», sagte sie streng. «Sei jetzt ruhig und hör mir zu, sonst hole ich den Balthes, und du weißt, was dann passiert.» Barbara starrte sie fassungslos an. So hatte die Mutter noch nie mit ihr gesprochen! Sie wollte den Onkel zu Hilfe holen und zusehen, wie er ihr eigenes Kind verprügelte! Sie wich zurück und drückte sich in die hinterste Ecke der Kammer.
«Hör jetzt zu», wiederholte Gertrud und versuchte, Barbara an sich zu ziehen, aber das Kind ließ es nicht zu. Nie wieder würde sie sich von dieser Mutter anfassen lassen, die sie an den Onkel verraten wollte, nie wieder!
«Wir können nicht zurück, Kind, glaub mir das.» Sie würde ihr nie mehr glauben, kein einziges Wort! «Der Magister selbst hat uns fortgeschickt, dich auch. Er wollte uns nicht mehr bei sich haben. Wenn du zu ihm gehst, wird er dich wieder fortschicken.» Die Stimme der Mutter war betont ruhig jetzt. «Wenn dein Onkel uns nicht bei sich aufgenommen hätte, dann müssten wir auf der Straße leben und betteln. Du musst ihm dankbar sein.»
«Ich hasse den Onkel», flüsterte Barbara. Wut und Schmerz ließen ihre Augen endlich überlaufen, und sie begann zu schluchzen. «Ich hasse euch alle!»
Gertrud schloss die Augen, als sie das Kind so vor sich sah, mit zusammengeballten Fäusten, das Gesicht eine einzige Anklage. Sie wollte das nicht sehen. Sie hatte doch nur getan, was sie tun musste!
«Barbara, mein Mädchen», flüsterte sie. «Komm, ich zeig dir was. Komm her, Kind.» Sie zog das Mädchen in ihre gemeinsame Kammer und beugte sich über ihren Strohsack. Dann löste sie das Band und griff mit beiden Händen ins Stroh. Schon nach wenigen Augenblicken hatte sie gefunden, was sie gesucht hatte. Sie holte das Kästchen heraus und legte es Barbara in den Schoß, dann nahm sie den winzigen Schlüssel von der Kette, die sie unter ihren Kleidern um den Hals trug, und reichte ihn ihr.
«Mach es auf», sagte sie. Zögernd nestelte Barbara mit dem kleinen Schlüssel herum, bis sie endlich das Kästchen geöffnet hatte. Sie griff hinein und holte staunend eine der goldenen Münzen heraus.
«Es sind dreißig Gulden. Der Magister hat sie mir gegeben, als Bezahlung für–» Sie stockte. Bezahlung für die Nächte, die er mit mir verbracht hat. «Für die Dienste, die ich ihm all die Jahre geleistet habe», vollendete sie den Satz.
«So viel Geld!» Barbaras Stimme klang ehrfürchtig, als sie mit den Händen vorsichtig in das Kästchen griff, als hätte sie Angst, die Münzen würden sich vor ihren Augen in Luft auflösen.
«Es ist nicht genug, um damit in der Stadt leben zu können», murmelte Gertrud. Nicht als alleinstehende Frau mit zwei unehelichen Kindern. «Aber es ist genug, um dich gut zu verheiraten hier im Dorf. Du wirst nicht immer hier unter diesem Dach bleiben müssen, das verspreche ich dir.» Sie nahm das Kästchen und verstaute es wieder sicher in seinem Versteck. «Dein Onkel darf nichts davon erfahren, verstanden?» Barbara nickte. «Und dass du mir nicht noch einmal solche Dummheiten machst, Kind.»
Barbara sah die Mutter unverwandt an. Das eine musste sie noch wissen.
«Hättest du – hättest du wirklich den Onkel geholt?», fragte sie. Gertrud hielt mitten in ihrer Bewegung inne.
«Nein», sagte sie schließlich leise und küsste das Kind auf die Stirn. «Bestimmt nicht.»
2
Gertrud saß unter der Linde am Dorfplatz und beobachtete die Kinder, die am Fluss spielten. Sie lehnte sich zurück und strich sich mit den Händen über ihren Leib, der sich inzwischen deutlich rundete. Die Schwangerschaft ließ ihren Körper aufblühen wie den eines jungen Mädchens, machte ihre Haut wieder rosig und weich und das Haar dick und glänzend. Als wollte der Herrgott einen entschädigen für die Last, die man zu tragen hat und die mit jedem Monat schwerer wird, dachte Gertrud. Aber vielleicht machte er sich ja auch nur seinen Spaß. Sie wusste schließlich, was es hieß, ein Kind zu gebären: unter Schmerzen, so wie alle Frauen seit der Vertreibung aus dem Paradies. Und hatte man sich glücklich wieder aus dem Wochenbett erhoben, dann fielen sie aus, all die schönen Haare, in großen Büscheln, sodass man Angst haben musste, kahlköpfig zu werden. Sie wünschte, sie hätte all das schon hinter sich.
«Und, Gertrud? Wie kommst du so zurecht? Ist sicher nicht ganz leicht für dich und die Kleine, nicht wahr?» Wie kommst du zurecht? Was sollte sie darauf schon sagen! Sie warf Georg Breitwieser, der sich neben ihr niedergelassen hatte, einen schrägen Blick zu. Er war einer von denen, an die sie sich noch gut erinnern konnte, sehr gut erinnern. Ein großer, starker Bursche war er gewesen, und jetzt war er ein kräftiger Mann. Für einen Augenblick gab sie der Versuchung nach, sich vorzustellen, der Mann, der hier neben ihr saß und sich mit ihr unterhielt, sei ihr Mann und ihr Gespräch der Austausch von Alltäglichkeiten zwischen vertrauten Eheleuten. Sie seufzte. Niemals hätte sie geglaubt, dass es so schwer wäre, wieder in ihr altes Leben zurückzukehren. Die Herbstsonne schien ihr freundlich ins Gesicht, und sie schloss die Augen. Heute war der Festtag des heiligen Michael, und selbst hier in Glatt ruhte die Arbeit, soweit es sich nicht um Dinge handelte, die unbedingt getan werden mussten. Die Tiere wussten schließlich nichts von den Feiertagen der Menschen.
«Nein, es ist nicht leicht», antwortete sie schließlich. «Du kennst ja meinen Bruder. Er ist keiner von denen, die es einem leichtmachen.»
«Weißt du, auch Balthes hatte eine harte Zeit», beeilte sich Breitwieser zu versichern. Sie lächelte ein wenig schief.
«Brauchst ihn nicht zu entschuldigen, Georg. Ich weiß noch ganz gut, wie’s war, als ihr beide junge Burschen wart, mit kaum was zu erben und nichts außer eurer Kraft und eurem Verstand. Und sieh dir an, wie’s heute ist! Du sitzt auf dem besten Hof im Dorf, Stall und Scheune sind voll, und deine Söhne sind stark und tüchtig und nehmen dir die Arbeit ab, während Balthes immer noch in seiner alten Bruchbude hockt und säuft.»
Breitwieser zuckte mit den Achseln. «Du glaubst es vielleicht nicht, aber bei uns könnte auch das eine oder andere besser sein. Nicht, dass ich klagen wollte, weiß Gott nicht. Die Agnes ist eine gute Frau, eine bessere könnt ich nicht finden. Aber du hast sicher – sicher hast du inzwischen von unserem Ältesten gehört, von unserem Bernhard.» Vom Flüsschen kamen jetzt laute Stimmen zu ihnen herübergeweht, und Gertrud sah, wie sich eine Gruppe von Kindern um einen blonden Kopf scharte, der alle überragte; auch Barbara war dabei. Bis hierher konnte sie Simon Breitwiesers Lachen aus den anderen Stimmen heraushören.
«Ja, Mia hat mir von ihm erzählt… ich kann mich noch gut an ihn erinnern, er muss damals acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als ich fortgegangen bin. Es war ein Unfall, nicht wahr?»
«Ein Unfall, ja.» Breitwieser atmete jetzt schwer. «Es war im November, weißt du, wenn die Flößer kommen… Sie hatten schon das Wasser hochgestaut, wie sie’s immer machen.» Gertrud nickte. Die Flößer, das war immer eine willkommene Abwechslung im eintönigen Dorfeinerlei: weit gereiste, wilde Gesellen mit braungebrannten Körpern und bärenstarken Armen, die vom Spätherbst an das Holz aus dem Schwarzwald auf den Flüssen herunterbrachten bis an die großen Städte an Neckar und Rhein. Im Dorf selbst hatte die Glatt nicht genug Strömung, sodass die Flößer Schwellbretter auslegen mussten und der Wasserstand oft um mehr als das Doppelte anstieg. Und abends saßen die Fremden in der Schänke und erzählten haarsträubende Geschichten von den Abenteuern, die sie Gott weiß wo erlebt haben wollten, und mehr als eine hockte mit weit aufgerissenen Augen dabei und ließ sich den Kopf verdrehen. Aber das war nicht klug, gar nicht klug. Denn nach ein paar Tagen schon waren die Flößer wieder weg, nicht zu halten, wie die Strömung selbst, und sie dachten nicht mehr an die Mädchen, denen sie vielleicht ein Andenken im Schoß zurückgelassen hatten. Gertrud lächelte bitter.
«…die Jungen wollten natürlich runter ans Wasser. Und irgendwie sind sie bis auf die Schwellbretter rausgeklettert.» Georg Breitwieser knetete seine großen Hände. «Plötzlich muss Andres hineingefallen sein. Die anderen Kinder schrien und riefen um Hilfe, und Bernhard sprang hinterher. Er konnte schwimmen, Andres aber nicht.» Er brach ab und wischte sich über die Augen. Es dauerte einige Zeit, bis er fortfahren konnte. «Ich weiß es noch wie heute. Wie ich endlich an den Fluss kam, und überall das gurgelnde Wasser, eine Strömung, die man sich an einem Tag wie heute gar nicht vorstellen kann. Andres hatte es irgendwie wieder herausgeschafft, er kniete am Ufer und spuckte Wasser, aber Bernhard konnte ich nirgends sehen. Ich watete in den Fluss, aber ich konnte ihn nicht finden.» Die Tränen liefen ihm jetzt über das Gesicht, und Gertrud legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter. «Diese Strömung! Selbst mich hätte sie fast umgerissen, und gleich hinter dem Wehr muss es noch schlimmer gewesen sein. Wir haben ihn mehrere hundert Schritt weiter flussabwärts gefunden, erst Stunden später.»
«Was für ein furchtbares Unglück!», flüsterte Gertrud. Breitwieser nickte.
«Ja. Der alte Pfarrer hat versucht, uns zu trösten, aber ich sag dir, monatelang hatte ich Angst davor, schlafen zu gehen, weil ich’s jede Nacht wieder erlebt hab, jede Nacht. Die Agnes ist grau geworden in dieser Zeit. Und der Andres – nicht, dass wir je ein Wort des Vorwurfs gegen ihn gesagt hätten, glaub das nicht!»
«Er war ja auch noch ein Kind.»
«Aber von dem Tag an hat er damit aufgehört, Trudchen. Er war kein Kind mehr. Zwölf Jahre alt, aber kein Kind mehr.»
«Er ist ein verantwortungsvoller junger Mann geworden, einer, auf den du stolz sein kannst, das hab ich gleich gesehen», murmelte Gertrud. Auf seine Art fiel Andres Breitwieser in einer Gruppe von jungen Leuten ebenso auf wie sein Bruder Simon: ernst, zuverlässig und pflichtbewusst, ein Bursche, der nur selten lachte oder trank. Jeder sah das. «Sei froh, dass du jemanden hast, an den du später beruhigt deinen Hof weitergeben kannst, Georg. Auf den Andres kannst du dich verlassen.»
Plötzlich war ein lautes Klatschen zu hören: Simon Breitwieser war ins Wasser gesprungen und schüttelte sich wie ein nasser Hund. Die anderen lachten, aber Georg Breitwieser kniff missmutig den Mund zusammen.
«Sie sind so verschieden», murmelte er. «Ich frag mich immer: Wie können zwei Brüder nur so verschieden sein? Und sie verstehen sich nicht. Das ist das, worüber ich mir wirklich Sorgen mache. Was wird, wenn ich mal nicht mehr da bin? Der Andres kriegt den Hof, das ist schon recht, aber der Simon–»
«Sicher wird Andres ihn nicht aus dem Haus jagen! Nicht einmal mein Bruder hat das mit mir getan.»
«Sie vertragen sich nicht», wiederholte Georg und starrte auf den Boden. «Das nimmt kein gutes Ende, wenn die beiden unter einem Dach leben sollen als Herr und Knecht. Am liebsten wär mir, ich könnt den Simon wegschicken in die Stadt, dass er irgendein Handwerk lernt.»
«Das kostet viel Geld.» Gertrud spürte plötzlich ein Kribbeln in den Fingerspitzen, denn ihr war ein Gedanke gekommen. Das war sie, die Gelegenheit! Sie musste nur ganz ruhig bleiben und auf den entscheidenden Augenblick warten.
«Ich weiß. Verdammt viel Geld, für den Meister, und dann die Lösegebühr für den Grundherrn. So viel Geld habe ich nicht.»
Gertrud griff nach seiner Hand.
«Ich weiß, was du tun kannst», sagte sie leise.
«Agnes?» Agnes Breitwieserin blickte flüchtig hoch. Seit dem frühen Morgen war sie dabei, die Äpfel zum Dörren vorzubereiten; sie zu schälen, in Scheiben zu schneiden, auf Schnüre aufzuziehen. Es war ein gutes Apfeljahr gewesen, und sie hatten immer noch Körbe voller Früchte draußen stehen, die verarbeitet werden wollten. Und dann waren die Zwetschgen an der Reihe: Die Bäume hingen voll davon.
«Agnes, wir müssen etwas besprechen.» Schwer ließ sich Georg Breitwieser auf dem Hackklotz nieder.
«Dann sprich.» Sie griff nach dem nächsten Apfel.
«Du weißt doch, dass ich mir immer Gedanken gemacht hab, wie das mal werden wird mit dem Andres und dem Simon.»
«Womit du dich nur immer quälst! Sind gute Söhne, alle beide.»
«Sicher.» Breitwieser griff nach der Axt und strich gedankenlos mit dem Finger über die Schneide. «Sicher, das weiß ich. Solange sie nicht zusammen sind.»
«Wie meinst du das?»
«Sobald sie aufeinandertreffen, fangen sie an zu streiten. Das ist nicht gut.»
«Werden sich die Hörner schon noch abstoßen, die zwei. Lass sie nur erst erwachsen werden.»
«Der Simon, der würd einen guten Schreiner abgeben, oder einen Zimmermann. Der hat ein Gespür für das Holz. Weißt du noch, die Truhe, die er dir mal gebaut hat?»
Agnes legte Apfel und Messer aus der Hand und fasste ihren Mann scharf ins Auge.
«Schlag dir das aus dem Kopf! Ein Handwerk lernen!? Wo soll das Lehrgeld dafür herkommen?, frag ich dich. Und du weißt doch genau, dass der Renschacher keinen einfach ziehen lässt! Der will für jeden seiner Fronbauern fünf Pfund Pfennig, das war schon immer so!»
Unruhig rutschte Georg Breitwieser auf dem Klotz hin und her.
«Die Gertrud hat dreißig Gulden aus Rottenburg mitgebracht», sagte er schließlich leise.
«Na und? Was nutzen uns dreißig Gulden, die uns nicht gehören?»
«Sie hat doch die Tochter, die Barbara. Und da dachte sie–»
Fassungslos starrte Agnes ihren Mann an. Dann ging ein Ruck durch sie hindurch.
«Du willst uns doch wohl nicht ernsthaft dieses Mädchen ins Haus holen, von dem keiner weiß, wer der Vater ist? Das als Mitgift das zusammengeluderte Geld ihrer Mutter mitbringt? Auf keinen Fall, Georg! Auf gar keinen Fall!»
Breitwieser biss die Zähne zusammen.
«Die Gertrud ist nicht schlechter als andere hier im Dorf, die mehr Glück gehabt haben», sagte er rau. «Und die Kleine ist ein hübsches Ding, anstellig und fleißig und gottesfürchtig. Ich bin sicher, dass sie unserem Andres ein gutes Eheweib wird.»
Agnes Breitwieserin sprang auf und warf wütend den letzten Apfel auf die Erde.
«Du kannst doch deinen Sohn nicht an ein Hurenkind verschachern! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, hast du das noch nicht gehört? Das darfst du nicht tun! Ich lasse das nicht zu!»
Schweigend zog Breitwieser einen Lederbeutel aus der Tasche und stellte ihn vor sich auf den Tisch. Die Münzen klimperten leise.
«Wir machen es so, wie ich es sage, Agnes. Ich habe alles mit Gertrud besprochen, wir haben uns die Hand darauf gegeben und Schluss. Ich bin sicher, Andres wird sich freuen, dass ich ihm eine Braut gefunden habe. Und nächste Woche gehe ich mit Simon nach Horb und versuche einen Meister zu finden, der ihn als Lehrjungen aufnimmt.» Versöhnlich griff er nach Agnes’ Hand. «Schau dir das Mädchen doch erst mal an! Das ist ein echter Schatz, sag ich dir, so eine findet man nicht nochmal im Dorf. Und die dreißig Gulden–»
Mit verkniffenem Gesicht machte Agnes sich los und trat einen Schritt zurück.
«Dreißig Gulden», zischte sie. «Für dreißig Silberlinge hat Judas den Herrn Jesus Christus verkauft! Ich spucke auf das Geld, hörst du? Es wird uns nur Unglück bringen, denk an meine Worte! Genau wie dieses Mädchen.» Sie drehte sich um und stampfte zornig davon.
Teil II · 1523/24
1
Barbara schreckte aus ihren Träumen auf. Irgendetwas hatte sich verändert, irgendetwas war nicht mehr so wie zuvor. Noch halb benommen hob sie den Kopf und verlagerte ihr Gewicht. Die Haut an ihren Knien war rot und aufgeschürft nach diesen endlosen Stunden der Wache, und sie spürte jedes der kleinen Sandkörnchen, die auf die blankgescheuerten Dielenbretter gestreut waren. Die Stimmen der Frauen hatten nicht nachgelassen, ebenso wenig wie das Gesumm der Fliegen, die durch die Stube schwärmten und gierig über schweißfeuchte Nacken krochen. «Jetzt und in der Stunde unseres Todes…» Die alte Kathrein schmatzte die Worte zwischen ihren zahnlosen Kiefern hervor, während ihr der Speichel in langen Fäden aus den Mundwinkeln troff. Plötzlich brach sie mitten im Satz ab und lauschte mit offenem Mund. Das Röcheln, das schwere, beklemmende Röcheln, war verstummt.
«Hol den Andres, Mädchen», sagte die Frau neben ihr dumpf. «Er soll herkommen. Sein Vater stirbt.» Hastig, mit gefühllosen Beinen, stolperte Barbara zur Tür, über den Hof und zum Stall hinüber. Schon von draußen hörte sie die Kuh gequält brüllen.
«Du musst kommen, Andres! Es – es ist so weit.»
«Gnade uns Gott.» Der junge Bauer sah erschöpft zu ihr hoch. Er war purpurrot vor Anstrengung: ein schwerer, breitschultriger Mann, dem das dunkle Haar in nassen Strähnen an der Stirn klebte, während er neben dem stöhnenden Tier auf dem Boden kniete, den Arm bis zum Ellbogen in dessen Eingeweiden versenkt. Hastig zog er seine Hand heraus und wischte sich Blut, Schleim und Fett an seinem Kittel ab.
«Wir werden beide verlieren», flüsterte er bitter. «Die Kuh und das Kälbchen.»
«Andres, bitte, du musst dich beeilen!» Das Mädchen legte ihm die Hand auf die Schulter und spürte, wie er unter seinem Hemd zitterte.
«Was für ein Tag!» Schwer atmend stand er vor ihr. «Als ob ein Unglück nicht genug wäre!» Sie hob die Hand, um ihm tröstend über die Wange zu streichen, aber er wich kaum merklich zurück.
«Komm jetzt», forderte sie ihn auf. Andres murmelte leise vor sich hin und stolperte nach draußen. Das Töpfchen voll Schmalz, mit dem er sich den Arm eingerieben hatte, zersprang unter seinem Schritt. Mit lautem Krachen flog die Tür zu; Staub wirbelte hoch, und die Kuh stieß ein markerschütterndes Gebrüll aus.
Zögernd ging Barbara zum Wohnhaus zurück. Die frische Luft hier draußen tat so gut! Nie würde sie den Todesgeruch vergessen können, der sich im Lauf der letzten Stunden in der Krankenstube angesammelt hatte, seit sie Georg Breitwieser vom Faselstall hereingetragen hatten: diese Mischung aus Dreck und Blut, Fäulnis und Verzweiflung, so als hätte die Hölle schon ihre Pforten weit geöffnet, um die verdammte Seele willkommen zu heißen. Heute Morgen war der Zuchtbulle auf den Alten losgegangen, hatte ihn gegen die Stallwand gedrängt und ihm mit seinem Horn den Unterleib aufgeschlitzt. Die Erinnerung an die rotgraue Masse, die aus der Wunde hervorgequollen war, drehte Barbara den Magen um. Keiner, der den Alten so gesehen hatte, konnte auch nur den Hauch eines Zweifels haben, dass sein Ende bevorstand. Mit leichenblassem Gesicht und flatternden Lidern hatte er den ganzen Tag gegen den Tod gekämpft. Seine Schreie waren durch das ganze Dorf gegellt und hätten wohl jeden in die Flucht geschlagen, nur den einen gerade nicht: Gevatter Tod, der schon geduldig seine Sense schärfte.
Barbara biss die Zähne zusammen und wollte gerade wieder zurück ins Haus gehen, als sie jemanden den Hof betreten sah, einen jungen Mann, der sich lässig einen Sack über die Schulter geworfen hatte. Sie konnte ihn bis hierher vor sich hin summen hören: Es war Simon Breitwieser.
«Simon! Wie gut, dass du hier bist!» Da hatte auch er sie gesehen, tänzelte heran und winkte.
«Barbara, meine Hübsche! Was für eine angenehme Überraschung, dich hier zu treffen! Bist du nur zu Besuch hier, oder habt ihr etwa schon geheiratet, während ich nicht da war?» Er grinste sie an, fasste sie um die Taille und schwenkte sie herum, noch bevor sie ein weiteres Wort sagen konnte. «Und, sag mir, willst du dich nicht lieber für mich entscheiden?» Sie wurde rot, machte sich los und schob ihn von sich weg.
«Geh schnell hinein, Simon. Es ist etwas Schreckliches passiert, ein Unfall. Dein Vater liegt im Sterben», sagte sie. Das heitere Lachen, das gerade noch über seine Züge gezuckt war, erstarb plötzlich. Seine Augen weiteten sich, die Lippen wurden schmal.
«Im Sterben?», fragte er ungläubig. Sie nickte ernst.
«Der Stier hat ihn angegriffen und schwer verletzt, heute Morgen», erwiderte sie.
«Im Sterben…» Simon sah sie an, als begegneten sie sich heute zum ersten Mal. Für einen Augenblick war sie nicht sicher, ob er überhaupt verstanden hatte, was sie ihm gerade gesagt hatte, aber dann stieß er einen lauten Schrei aus und stürzte in die Stube. Sie folgte ihm zögernd, während sie noch die Berührung seiner kräftigen Hände auf ihrem Körper fühlte.
Die Gegenwart des Todes war im Raum so deutlich zu spüren, dass Barbara sich nicht gewundert hätte, wenn er ihr plötzlich leibhaftig entgegengetreten wäre. Inzwischen hatte jemand Kerzen angezündet und dem Alten ein Kruzifix in die gefalteten Hände gesteckt. Zwei Frauen waren dabei, ihm das Haar zu kämmen und das Kinn hochzubinden. Aber nichts konnte die Spuren des verzweifelten Kampfes aus seinem Gesicht löschen. So, mit diesen verzerrten Zügen, würde er vor seinen Richter treten müssen. Barbara bekreuzigte sich. Die Hände krampfhaft ineinander verklammert, stand Andres am Fußende des Totenbettes, während Simon an seiner Seite haltlos schluchzte. Daneben hockten in einer Gruppe die Frauen am Boden um die alte Bäuerin herum wie eine Schar schwarzer Hühner und stießen abwechselnd hohe Klagelaute aus. Die weißhaarige Kathrein wiegte ihren Oberkörper rhythmisch hin und her, als wäre sie nicht ganz bei Verstand. Im Hintergrund warteten die Männer, Verwandte, Nachbarn, Dorfbewohner, schließlich der junge Pfarrer, der sich mühte, mit seiner dünnen Stimme gegen das Wehklagen der Frauen anzukommen.
«Lasst uns gemeinsam das Paternoster sprechen für den Verstorbenen! Pater noster, qui es in caelis…» Die Seele musste hinausgeleitet werden auf ihrem Weg in die Ewigkeit, vorbei an den Dämonen, die der Teufel ausgesandt hatte. Die Männer stießen die Fensterläden auf, bevor sie in das Gebet einstimmten.
Drei Tage lang würden sie Wache halten, drei Tage, in denen das Leben im Dorf durch die Anwesenheit des Todes gedämpft wurde. Georg Breitwieser war ein angesehener, fast wohlhabender Mann gewesen, dessen Wort in der Dorfgemeinschaft Gewicht gehabt hatte. Es wäre nicht anständig gewesen, ihn die letzte Schwelle allein überschreiten zu lassen. Abwechselnd knieten die Männer und Frauen an der Seite des aufgebahrten Leichnams nieder und sprachen ihre Gebete, und nur die Kerzen zählten die Stunden, in denen der Tod noch zugegen war.
Auch die Kuh war gestorben. Noch am Abend des Sterbetags hatte Andres selbst sie geschlachtet, mit unsicheren, abgehackten Bewegungen, sodass man fürchten musste, er würde sich selbst verletzen, aber es war gutgegangen. Wenigstens würde es reichlich frisches Fleisch geben zum Leichenschmaus, dachte Barbara, als sie am nächsten Tag damit beschäftigt war, eine Salzlake anzusetzen, die sie zum Einpökeln der Reste verwenden würden. Das ausgeblutete Tier hing noch, an den Hinterläufen hochgezogen, am Gerüst; die alte Kathrein und ihre Tochter waren dabei, ihm das Fell abzuziehen. Sie arbeiteten in völligem Gleichklang und sangen dabei beständig leise vor sich hin, als müssten sie mit ihrer Litanei den Rhythmus vorgeben. Es war wichtig, das Fell möglichst unversehrt und in einem Stück abzulösen, um seinen Wert nicht zu mindern. Die Alte sah kaum hin und folgte nur dem Gespür ihrer Finger, die nach jahrzehntelanger Übung blind das Messer führten. Kathrein und die trauernde Witwe waren Schwestern, mit dem gleichen Buckel und den gleichen ein wenig schief stehenden Augen, und schon in wenigen Tagen würden ihre Männer nebeneinander auf dem Kirchhof liegen und zu Staub zerfallen. Barbara legte einen Deckel auf das Fass mit der Salzlake und ging hinüber zum Haus, um nach der Bäuerin zu sehen.
Aus der Stube mit dem aufgebahrten Leichnam drangen Stimmen, und sie verhielt ihren Schritt. Andres und Simon stritten so laut, dass sie jedes Wort verstehen konnte.
«…Vater hätte mich verstanden! Wie würde es dir gefallen, immer nur verächtlich und von oben herab behandelt zu werden?» Simons Stimme war laut und erregt und schien sich bei jedem Satz überschlagen zu wollen. «Denk nicht, die würden auch nur eine Sekunde vergessen, dass einer aus dem Dorf kommt!»
«Na und? Dann muss man eben die Zähne zusammenbeißen! Weißt du nicht, was es Vater gekostet hat, dich in die Stadt zu schicken? Der Erste aus dem Dorf, der in Horb ein Handwerk lernt! Ha! Wenn ich daran denke, wie stolz er darauf war! Und du wirfst den Bettel einfach hin! Fast bin ich froh, dass er das nicht mehr erleben muss.» Jemand schluchzte laut auf, es musste wohl Agnes sein. Barbara biss sich auf die Unterlippe. Da hatte Simon also seine Lehre aufgegeben, nach all den Jahren! Sie konnte sich noch gut an die wenigen Besuche im Dorf erinnern, die er in den letzten acht Jahren gemacht hatte, an seine ausweichenden Antworten, daran, dass er zweimal den Lehrherrn gewechselt hatte, und an Georgs verbitterten Gesichtsausdruck, mit dem er den Sohn verteidigte, diesen Sohn, der mit der Lehre einfach nicht fertig werden wollte. Und jetzt hatte Simon offenbar endgültig aufgegeben.
«Vater ist noch nicht unter der Erde, und ihr könnt keinen Frieden halten!…», ließ sich Agnes’ Stimme vernehmen.
«Das hat nichts damit zu tun! Ich will nur wissen, wie er sich das in Zukunft vorstellt. Ob er jetzt mir auf der Tasche liegen will. Glaub nur nicht, dass du von mir auch nur einen Heller mehr bekommst, als ich dir geben muss!»
«Und ich dachte, du bist mein Bruder. Ich dachte, auf dich kann ich mich verlassen, wenn ich in Not bin! Ich dachte…»
Jetzt ist es genug, sagte sich Barbara, öffnete die Tür und trat in die Stube. Mehr als genug.
Die Brüder standen sich mit gesenkten Köpfen gegenüber und atmeten schwer. Simon hatte die Fäuste geballt, Andres umklammerte seine verschränkten Arme, als müsste er sich selbst festhalten. Sie waren bereit zuzuschlagen, alle beide, und einen Augenblick lang zögerte Barbara, zwischen sie zu treten.
«Ich wollte nach eurer Mutter schauen», sagte sie leise und sah von einem zum anderen. Wie konnten zwei Menschen sich so ähnlich sehen, in gleicher Weise ihre Augen verengen und die Mundwinkel verächtlich nach unten ziehen, und doch so gegensätzlich in ihrem Wesen sein? Alles, was an Andres schwer war, war an Simon leicht geraten, zu leicht vielleicht. Simon war die Wasserfläche, die in der Sonne flirrte, Andres die dunkle Tiefe darunter.
Agnes Breitwieserin kam dankbar zu ihr herüber, mit dem ersten freundlichen Blick, den sie seit langem für ihre zukünftige Schwiegertochter übrig hatte. Sie streifte mit der Hand die Wange des Verstorbenen und führte dann den Rosenkranz an ihre rissigen Lippen; die Perlen klackten leise. Mitleidig betrachtete Barbara die gebeugte Gestalt. Die alte Bäuerin war am Ende ihrer Kräfte. Seit dem Tod ihres Mannes hatte sie nur ein paar Schlucke Wasser zu sich genommen. Ihr Gesicht war gelblich und eingefallen, und unter ihren verschwollenen Augen lagen dunkle Schatten. Barbara fasste sie behutsam am Ellbogen und schob sie vor sich her.
«Komm, ich bring dich ein bisschen an die frische Luft», sagte sie leise. «Du setzt dich auf die Bank unter der Linde, und ich hole dir einen Becher Wein.» Widerstandslos ließ sich die Alte nach draußen bringen. Als Barbara in die Stube zurückkehrte, war Andres nicht mehr da. Nur Simon lehnte am Kamin und zerbröselte gedankenlos die getrockneten Kräuter, die an einem Bindfaden an der Wand hingen. Ein schwacher Duft nach Pfefferminz mischte sich mit dem Geruch von Rosmarin und Thymian. Die Frauen hatten kleine duftende Kräutersträußchen auf Georg Breitwiesers Totenbett gelegt.
«Warum hast du das nur getan, Simon? Deinem Vater war es so wichtig…» Die Gegenwart des Verstorbenen ließ Barbara leise sprechen. Sie bemerkte, dass Simon es vermied, seinen Vater auf dem Totenbett anzuschauen. «Er hat immer so gehofft, aus dir einen Schreiner zu machen. Einen Meister», fuhr sie fort.
Ungeduldig schlug Simon mit der flachen Hand gegen den Kaminsims. «Herrgott, was sollte ich denn tun? Früher oder später hätte der Alte mich sowieso an die Luft gesetzt! Ich bin eben kein Handwerker. Ich bin ein Bauer», rief er.
«Deshalb lässt man doch nicht alles stehen und liegen.»
Simon sah sie nicht an; er blickte aus dem Fenster und fixierte einen Punkt irgendwo weit in der Ferne.
«Ich habe mir Geld aus seiner Kasse geliehen», sagte er endlich tonlos. «Ich bin ein geschickter Würfelspieler, du weißt es ja. Ich war sicher, ich könnte meinen Einsatz an einem Abend verdoppeln. Aber der andere war besser.»
«Du hast deinen Meister bestohlen», flüsterte Barbara fassungslos.
«Nicht bestohlen, nein. Ich hab’s zurückgelegt, jeden einzelnen Heller. Ich musste alles zu Geld machen, was ich hatte, sogar meine Stiefel, damit ich’s zurückgeben konnte. Aber in dem Augenblick hat er mich erwischt.»
«Wie konntest du nur so – so dumm sein!» Sie war maßlos enttäuscht. Am liebsten hätte sie ihm ins Gesicht geschrien.
«Ich weiß es nicht, Barbara. Ich weiß es selbst nicht. Wenigstens gab er mir einen Tag Zeit, um zu verschwinden, bevor er mit der Zunft sprechen wollte. Sie werden dafür sorgen, dass mich kein Meister mehr nimmt. Deshalb bin ich zurückgekommen. Ich konnte ja nicht wissen, dass Vater–» Seine Stimme zitterte kaum merklich, und er verstummte.
«Hast du es Andres gesagt?»
«Nein.» Plötzlich kam er auf sie zu und fasste sie an den Schultern. Seine Augen schwammen. «Du sagst es ihm auch nicht, Babeli, nicht wahr?», bat er.
«Nein, ich glaube nicht. Es wird schwer genug werden», entgegnete sie.
«Kannst du nicht mit ihm sprechen und ein gutes Wort für mich einlegen? Was ich sage, ist ihm ja gleichgültig, aber auf dich hört er bestimmt.» Simon sah sie an wie ein kleiner Junge, der etwas ausgefressen hat und sich vor Strafe fürchtet. Sie nickte unsicher.
«Ich kann es versuchen, Simon, mehr nicht.» Aber Andres würde nur tun, was er selbst für richtig hielt, und wenn ein Engel vom Himmel herunterstiege, um ihn zu bitten. Das wusste sie. Sie griff nach dem Krug, füllte einen Becher mit Wein und ging hinaus.
Die alte Bäuerin saß bei der Linde und murmelte in ihrer Trauer vor sich hin. Barbara brachte ihr den Becher, Agnes griff mit zittriger Hand danach und begann zu trinken. Wein tropfte von ihrem Kinn auf den Kittel. Es schien, als wäre sie durch den Tod ihres Mannes von einem Tag zum anderen zu einer Greisin geworden. Ihre Augen waren trüb, die Haut grau. Barbara war erleichtert, als sie Andres mit dem Pferd aus dem Stall kommen sah. Er führte einen dreijährigen Fuchs mit schlanken Fesseln und einem schwarzweißen Flecken auf der Stirn am Zügel, der noch nie einen Pflug gezogen hatte.
«Ich bin gleich wieder bei dir», sagte sie hastig zu Agnes und stand auf.
Andres hatte gerade begonnen, dem Fuchs mit einer Bürste das Fell zu striegeln. Für gewöhnlich verwandte er deutlich mehr Sorgfalt auf seine Tiere als auf sein eigenes Äußeres, aber heute arbeitete er in ungewohnt groben Strichen, fahrig und unkonzentriert. Der Streit mit seinem Bruder schien ihm noch nachzugehen. Sie musste ihre Worte sorgfältig wählen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten.
«Andres?»
Er blickte kaum auf. «Ich habe zu tun.»
Sie biss sich auf die Lippen. Es war genauso schwierig, wie sie befürchtet hatte. Nur das Pferd schien zu spüren, wie ihr zumute war. Es beugte den Kopf zu ihr herunter und rieb sich an ihrer Schulter. Dankbar hob sie die Hand, um ihm über die weichen Nüstern zu streichen.
«Kannst dich schon mal verabschieden von dem Gaul», knurrte Andres unfreundlich.
Verwirrt hielt sie mitten in der Bewegung inne.
«Was meinst du damit?», fragte sie.
«Na, irgendwann kommt der Vogt vorbei, vielleicht heute schon, denk ich, und schaut sich den Stall an», presste der junge Bauer zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Er blickte auf, um seine Mundwinkel zuckte es. «Jetzt, wo unsere beste Kuh gestorben ist… du weißt doch. Er wird das Pferd nehmen. Ich – ich will ihn noch einmal striegeln…» Seine Stimme war plötzlich weich geworden. Abrupt wandte er sich ab.
«Kuh und Pferd sind dir wichtiger, als der Vater es war!» Unbemerkt war die alte Agnes herübergewatschelt und fiel ihm jammernd ins Wort. «Achgottachgottachgott, was für Söhne! Was für Söhne sind mir geblieben! Herrgott und alle Heiligen, wie habt ihr mich gestraft, und ich hab doch nie…»
«Ruhig! Sei ruhig und setz dich wieder dahin!», befahl Andres unbeherrscht. Barbara schob die Alte auf die Bank zurück. Hilflos sah sie in das verbitterte Gesicht des jungen Bauern, in seine verdunkelten Augen. Das Pferd war Andres’ ganzer Stolz; sie konnte sich noch gut an den ungewohnt übermütigen Ausdruck auf seinem Gesicht erinnern, als er es zum ersten Mal in den Stall geführt hatte. Und nicht nur das: An diesem Tag hatte er ihr vom Markt in Horb ein Geschenk mitgebracht, ein buntes Band für ihr Haar, und sie hinter dem Stall unbeholfen geküsst. An diesem Tag hatte sie zum ersten Mal wirklich daran geglaubt, dass sie schon bald seine Bäuerin sein würde, dass das Schicksal sie tatsächlich aus der düsteren Gegenwart ihres Onkels herausführen wollte. Und heute musste sie ihm beweisen, dass sie es auch wert war, dass sie ihn in dieser schmerzlichen Stunde nicht alleinließ. «Du musst sein Herz gewinnen, Kind, dann wird alles gut werden!», hatte ihre Mutter gesagt.
«Du könntest – du könntest das Pferd in den Wald bringen, hinten an die Brunkelwiese», hörte sie sich plötzlich selbst flüstern, ohne zu wissen, wer ihr diesen Gedanken eingegeben hatte. «Da wird’s der Vogt nicht finden.»
Unruhig zerrte Andres an einem Knoten in der Mähne, der sich nicht lösen wollte.
«Das ist gegen das Recht, Barbara», murmelte er. «Wenn der Bauer tot ist, dann kommt der Vogt und holt für den Herrn das beste Stück Vieh aus dem Stall, das weißt du so gut wie ich. Für den Herrn von Renschach.» Er sprach den Namen aus wie einen Fluch; in seinen Zügen arbeitete es. «Mein Pferd, für das ich selbst geschuftet habe wie ein Ochse.» Er schaute über den Hof und den Dorfplatz hinweg, bis sein Blick an der Wasserburg hängen blieb. Im ganzen Dorf gab es keinen Ort, von wo aus man sie nicht hätte sehen können.
«Vielleicht weiß der Vogt gar nicht so genau, was die Bauern im Stall stehen haben.» Sie konnte kaum glauben, dass sie selbst das gesagt hatte. Ein Gedanke brachte den nächsten hervor. «Er ist doch erst seit Lichtmess auf der Burg und oft unterwegs.»
«Vielleicht weiß er es nicht», wiederholte Andres langsam und ließ die Bürste sinken. Plötzlich ballte er die Fäuste. «Gut, ich werd’s tun», stieß er hervor. «Ich tu’s. Soll er sich doch die alte Sau mit in seinen Schweinekoben nehmen!» Brüsk griff er nach dem Zaumzeug, das an einem Haken an der Stallwand hing, und legte es dem Fuchs um. «Soll er doch zur Hölle fahren mit seinem ganzen Gesindel!» Der Fuchs wieherte leise. Andres knüpfte noch einen langen Lederriemen an das Geschirr und schnalzte mit der Zunge. «Los, Roter!» Gehorsam setzte sich das Pferd in Bewegung.
Barbara blickte ihnen nach, als sie in Richtung auf den Waldrand verschwanden. Ihr Herz klopfte gegen ihre Rippen wie ein ungebetener Gast. Wie mochte es sein, mit so einem Mann verheiratet zu sein: Tag für Tag und Woche für Woche und Jahr für Jahr mit ihm zusammen?
«Komm zu mir rüber, Kind», krächzte da die alte Agnes. Barbara beugte sich über sie und sah, dass ihre Augen schon wieder voller Tränen standen.
«Denk nicht, er wär ein schlechter Mann, mein Andres. Das ist er nicht, kein schlechter Mann.» Die Alte war kaum zu verstehen. Barbara nahm ihre Hand.
«Nein, ich weiß», antwortete sie, während ihre Augen unruhig nach Andres’ sich entfernender Gestalt suchten, die in der Ferne kaum noch auszumachen war. «Mach, dass es gutgeht, lieber Gott», murmelte sie leise. «Lass es nur gutgehen.»
«Das wird ein anderes Leben da für dich werden als hier bei uns.» Gertrud stand in ihrer kümmerlichen Kammer über die Truhe gebeugt und kramte darin herum, als Barbara nach Hause kam. «Ein besseres Leben. Sie haben den großen Hof, du hast’s ja gesehen, und alles geht jetzt an den einen Erben, den Andres… Natürlich, für den Bruder ist es bitter. Aber Georg hat immer gesagt, der Junge will ja gar nicht. Der will hinaus in die Welt, hat nichts als Flausen im Kopf… ach, dass der Alte so gestorben ist, ich kann’s immer noch nicht glauben!» Sie richtete sich triumphierend auf und legte Barbara das feine Kettchen um den Hals, das sie seit dem Verlöbnis sorgfältig in ihrer Truhe verwahrt hatte wie eine Reliquie: das Unterpfand einer besseren Zukunft.
«Das solltest du ruhig tragen jetzt, Bärbchen! Zeig, wo du hingehörst. So eine hübsche Kette, Kind… Und, was sagst du?» Barbara wich dem erwartungsvollen Blick aus. Das Metallkettchen, der erste Schmuck, den sie je besessen hatte, lag ungewohnt kühl auf ihrer Haut.
«Ich – ja. Es ist ein großes Haus.»
«Mit einer eigenen Schlafstube! Freust du dich denn gar nicht?»
«Doch.» Barbara nickte. «Es geht nur jetzt so schnell auf einmal. Ich dachte, mir bleibt noch mehr als ein Jahr.»
Die Mutter strich ihr aufmunternd mit dem Zeigefinger über die Wange.
«Ich hab’s auch gedacht, Bärbchen, aber jetzt, wo der Georg nicht mehr ist… der Andres übernimmt den Hof, da braucht er eine Frau. Und die alte Agnes, na ja, du hast sie ja gesehen… Von der kann er keine große Hilfe mehr erwarten.»
Das war nun allerdings nichts, was eine künftige Hausfrau beruhigen konnte: eine wacklige Alte auf dem Hof, mehr Last als Hilfe. «Außerdem, du weißt ja… es war ein schweres Stück Arbeit, bis sie damals endlich eingewilligt hat in die Hochzeit. Wenn der Georg das Geld nicht so nötig gebraucht hätte… Und jetzt ist er nicht mehr da. Ihr





























