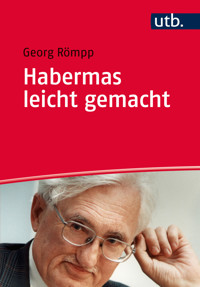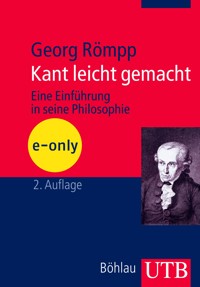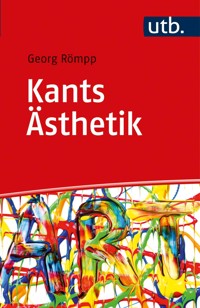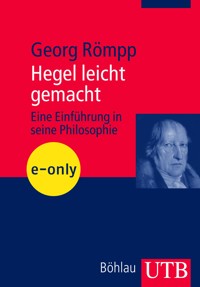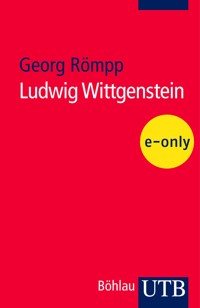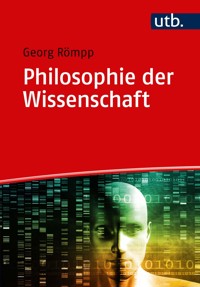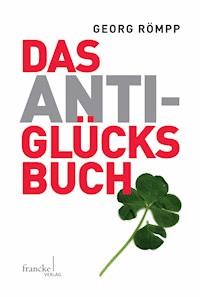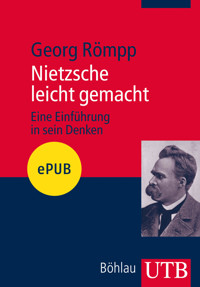
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Leicht gemacht
- Sprache: Deutsch
Das Studienbuch stellt das Werk Friedrich Nietzsches im Kontext der Entwicklung des philosophischen Denkens insgesamt vor. So wird der Zusammenhang seines Denkens mit der traditionellen Philosophie und zugleich seine Absetzung von ihr deutlich. Nietzsche wird also nicht auf die Rolle eines philosophischen Literaten oder Aphoristikers reduziert, sondern als ein Denker dargestellt, der sich an die Geschichte der Philosophie anschließt und sich gerade deshalb kritisch von ihr distanzieren kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Farmington Hills
facultas.wuv · Wien
Wilhelm Fink · München
A. Francke Verlag · Tübingen und Basel
Haupt Verlag · Bern · Stuttgart · Wien
Julius Klinkhardt Verlagsbuchhandlung · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden
Orell Füssli Verlag · Zürich
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn · München · Wien · Zürich
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK/Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
vdf Hochschulverlag AG an der ETH · Zürich
Georg Römpp
Nietzscheleicht gemacht
Eine Einführung in sein Denken
BÖHLAU VERLAG KÖLN WIEN WEIMAR · 2013
Georg Römpp hat Philosophie, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert und wurde in Philosophie promoviert.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Umschlagabbildung: Friedrich Nietzsche, Porträtaufnahme, 1882. © akg-images.
© 2013 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Wien WeimarUrsulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.comAlle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Illustrationen: Rolf Bunse, Aachen
Satz: synpannier. Gestaltung & Wissenschaftskommunikation, Bielefeld
Druck und Bindung: AALEXX Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in Germany
UTB-Band-Nr. 3718 | ISBN 978-3-8252-3718-9
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Einleitung und Gebrauchsanweisung
Nietzsche als Philosoph
Gebrauchsanweisung
1 Das Problem des Erkennens: ‚Die Geburt der Tragödie‘
1.1 Kritische Philosophie der Wissenschaft
1.2 Apollo und das individuierende Bestimmen
1.3 Das Grauen und der Zauber des Dionysischen
1.4 Die philosophische Bedeutung der Tragödie
1.5 Richard Wagner und die Wiederkehr des Tragischen
1.6 Von Dionysos und Apollo zum ‚Sokratismus‘
1.7 Platon und der Optimismus der Logik
1.8 Der griechische Ursprung der Wissenschaft
1.9 Die Tragödie, die Wissenschaft und der Staat
1.10 Die ästhetische Rechtfertigung der Welt
2 Die Moral des Erkennens
2.1 Ethik als Kantkritik
2.2 Vertrauen in die Moral als Grundlage der Erkenntnis
2.3 Das Prinzip der Sittlichkeit
2.4 Das Sittliche und das Nützliche
2.5 Die Bedeutung einer Kritik der Moral
2.6 Der Ursprung von Gut und Böse
2.7 Herren- und Sklavenmoral
2.8 Das ‚Herdentier‘ und das Individuum
2.9 Die Kritik an einer Ethik des Mitleidens
2.10 Das Christentum und die ‚Gleichen‘
2.11 Die Seele und das ‚schlechte Gewissen‘
2.12 Gott und seine Schatten
3 Der Glaube des Erkennens
3.1 Die Wissenschaft, das Erklären und seine ‚Manieren‘
3.2 Die Geschichtlichkeit des Erkennens
3.3 Evolutionäre Erkenntnistheorie bei Nietzsche?
3.4 Das Erkennen und der Wille zur Macht
3.5 Der Begriff der ‚Wissenschaft‘
3.6 Wissenschaft und Wahrheit
3.7 Die Sprache und die Wahrheit
3.8 Philosophie, Logik und der Glaube an die Erkenntnis
3.9 Philosophie jenseits der Kritik?
3.10 Eine ‚positive‘ Philosophie bei Nietzsche?
3.11 ‚Idealität‘ und neues ‚Ideal‘
3.12 ‚Der Wanderer und sein Schatten‘
4 Die Vermittlung des Erkennens: ‚Also sprach Zarathustra‘
4.1 Einleitung
4.2 Zarathustra: Erster Teil
4.2.1 Zarathustras Vorrede
4.2.2 Die Reden Zarathustras
4.3 Zarathustra: Zweiter Teil
4.3.1 Die Gerechtigkeit und die Rache
4.3.2 Die Denkbarkeit der Welt und der Wille zur Macht
4.3.3 Gründe, das Schweigen und die Stille
4.4 Zarathustra: Dritter Teil
4.4.1 Über sich selbst hinaus
4.4.2 Die ewige Wiederkehr des Gleichen
4.5 Zarathustra: Vierter Teil
4.5.1 Lehren und Missverstehen
4.5.2 Seltsame ‚Nachfolger‘
4.5.3 Horchen und Gehorchen
4.5.4 Das Zeichen
5 Zum Schluss: Der ‚freie Geist‘ und seine ‚Zeit‘
Zitierweise
Literaturverzeichnis
Begriffsregister
Rückumschlag
Einleitung und Gebrauchsanweisung
Nietzsche als Philosoph
Vor den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts war es durchaus nicht selbstverständlich, Nietzsche als einen ernstzunehmenden Philosophen aufzufassen. In der Regel galt er in der Zunft der ernsthaften Philosophen als philosophierender Schriftsteller nicht unbedingt von höchstem Rang und von eher zweifelhaftem Ruf. Zu dieser schlechten Reputation hatten sicherlich Versuche beigetragen, Nietzsche dem nationalsozialistischen Staat als Hofphilosophen anzudienen, verbunden mit einer auch später noch anhaltenden Rezeption, die sich in erster Linie auf eine sehr und allzu einfache Lektüre seiner Schriften beschränkte und dabei vor allem die plakativen und lauten Stellen in den Vordergrund stellte, um zu einer merkwürdigen Art von Popularphilosophie im schlechtesten Sinne zu gelangen.
Jedem Anfänger in der Lektüre von Nietzsches Werken wird sehr schnell deutlich, warum eine solche Rezeption gerade bei diesem Autor möglich und vielleicht sogar verständlich und naheliegend war: Nietzsche ist dem ersten Anschein nach sehr einfach zu verstehen. Natürlich ebnete diese Gestalt seiner Schriften den Weg in ein entsprechend einfaches Verständnis, während etwa Descartes, Kant, Hegel und Wittgenstein sich schon beim Lesen dagegen sperren, allzu einfach aufgefasst zu werden. Bei diesen Autoren versteht man meistens sehr wenig bis überhaupt nichts, wenn man ohne entsprechende Vorbildung einfach zu lesen beginnt. Bei Nietzsche dagegen glaubt man immer etwas zu verstehen und in vielen Schriften stößt man auch beim Fortschreiten kaum auf Schwierigkeiten.
In der Regel verstehen wir dort am leichtesten, wo wir einen mühelosen Anschluss an das herstellen können, was wir sowieso schon wissen oder zumindest zu wissen glauben. Man könnte deshalb vermuten, Nietzsches populäre ebenso wie die nationalsozialistische Rezeption habe sehr viel damit zu tun gehabt, dass sich seine Gedanken leicht mit den entsprechenden Vorurteilen verbinden ließen. Allerdings sind Vorurteile nichts per se Unanständiges – eigentlich sind sie sogar die Voraussetzungen dafür, überhaupt etwas zu verstehen und Erklärungen zu akzeptieren, die ‚Vor-Urteile‘ brauchen, um Sinn zu erzeugen und auf Akzeptanz stoßen zu können. Ein Leser, der überhaupt keine Urteile aus seinem Denken vor der Lektüre mitbringt, wird weder Descartes, Kant, Hegel und Wittgenstein noch Nietzsche verstehen können.
<–9| Seitenzahl der gedruckten Ausgabe
Demnach hängt das, was wir verstehen, also vor allem davon ab, welche Vor-Urteile wir mitbringen? Mit dieser Frage sind wir schon tief in Nietzsches Philosophie – tiefer als die populäre Rezeption jemals vorgedrungen war, von der nationalsozialistischen ganz zu schweigen. An dieser Stelle drängt sich jedoch eine andere Frage auf: wenn Nietzsche seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als ein genuin philosophischer Autor rezipiert wird, lässt sich daraus nicht schließen, dass es seit damals gelingt, andere Vor-Urteile bei der Lektüre seiner Werke zu aktivieren? Das würde aber bedeuten, dass sich wichtige Strömungen in der Philosophie seit Nietzsches Zeit genau in eine solche Richtung entwickelt haben müssen, aus der sich Anschlussmöglichkeiten für eine Rezeption von Nietzsche als Philosoph anbieten. Sollten wichtige Teile der Gegenwartsphilosophie also gerade in Nietzsche sich selbst erkennen können?
Das werden wir am besten dadurch herausfinden, dass wir uns auf eine solche Lektüre Nietzsches aus philosophischer Perspektive einlassen. Was kann es also heißen, Nietzsche leicht machen zu wollen, wenn es nicht darum gehen kann, ihn als Popularphilosophen oder als quasi-philosophischen Paukenschläger leicht zu machen, sondern als Philosophen? Sehr vereinfacht gesagt, besteht die Aufgabe dieses Buches vor allem darin, andere und zwar genuin philosophische Vor-Urteile für die Lektüre Nietzsches vorzuschlagen. Aus dieser Perspektive ist der ‚wirkliche‘ Nietzsche gerade nicht der Schriftsteller mit den lauten, plakativen und aggressiven Formulierungen, der gegen das Christentum, den Sozialismus, die ‚Entartung‘ des Menschen und das Mitleiden wütet und von Menschenzüchtung und natürlicher Selektion in Tönen jubelt, die nur noch durch seine Bewunderung für diejenigen übertroffen werden, die er als ‚die Starken‘ abwechselnd in Gestalt Napoleons und einer ‚blonden Bestie‘ verkörpert sieht.
In gewisser Weise besteht der erste Schritt für ein ‚Leichtmachen‘ Nietzsches als eines philosophischen Autors also darin, ihn ‚schwer‘ zu machen in dem Sinne, dass wir seine scheinbar allzu leicht verständlichen Texte auf Anschlussmöglichkeiten für die Philosophie von Platon über Kant bis hin zu Wittgenstein untersuchen. Die Rezeption der letzten Jahrzehnte hat bereits gezeigt, dass das möglich ist. Es ist sogar so gut möglich, dass sich daraus erstaunliche Aufschlüsse über die Problemlage einer Philosophie ergeben, welche die Reflexion auf das Wissen und das Erkennen so weit treiben will, dass wichtige denkgeschichtliche Grundlagen dabei auf eine radikale Weise infrage gestellt werden. Die weitere Entwicklung des philosophischen Denkens hat einen Horizont geschaffen, in dem sogar eine neue Perspektive auf Nietzsche als einen der zentralen Denker am Beginn des Entstehens dieses Horizontes möglich wurde. Nietzsche hatte dies übrigens selbst
<–10|
vorausgesagt: „Ich selber bin noch nicht an der Zeit, Einige werden posthum geboren.“ (EHVI-3, 296)[1]
Nietzsche ‚schwer‘ und dadurch leicht zu machen heißt aber natürlich nicht, ihn als einen ‚Philosophen der Schwere‘ aufzufassen. Gerade das Gegenteil muss der Fall sein bei jemandem, der sein Denken an einer Stelle so zusammenfasste: „Und wenn Das mein A und O ist, dass alles Schwere leicht, aller Leib Tänzer, aller Geist Vogel werde: und wahrlich, das ist mein A und O!“ (Z VI-1, 286) An anderer Stelle drückte er sich so aus: „Wir müssen die Dinge lustiger nehmen, als sie es verdienen; zumal wir sie lange Zeit ernster genommen haben, als sie es verdienen.“ (M V-1, 333) Wir werden vor allem in Zusammenhang mit dem ‚Zarathustra‘-Buch noch näher auf die Bedeutung solcher Wendungen gegen das ‚Schwere‘ stoßen.
Gebrauchsanweisung
Wie lässt sich Nietzsche also auf die richtige Weise schwer und leicht machen? Es wird sinnvoll sein, den Weg dieses Buches kurz zu skizzieren, um damit eine gewisse Gebrauchsanleitung zu geben. Ziel dieses Leichtmachens muss es offenbar sein, dem Leser solche Anschlussmöglichkeiten – wenn man will: ‚Vor-Urteile‘ – an die Hand zu geben, mithilfe derer er Nietzsches Texte auf einem philosophischen Niveau lesen kann, ohne sich durch die vielen allzu einfachen Stellen beirren zu lassen, die eine entsprechend vereinfachte Rezeption nahelegen könnten.
Das Buch beginnt (1.) mit einer Exposition derjenigen philosophischen Themen, die in Nietzsches Denken wichtig wurden. Nietzsche ist einer der wenigen Autoren, die in einer einzigen frühen Schrift fast alles vorgestellt haben, womit sie sich weiter beschäftigen wollten. Bei ihm ist dies die Schrift ‚Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik‘, wobei man sich durch den merkwürdigen Titel nicht verwirren lassen sollte. Wir werden deshalb eine Interpretation dieser Schrift verwenden, um Nietzsches Themen zur Exposition zu bringen. Mit den meisten werden wir uns danach ohne Beschränkung auf ein einziges Werk weiter beschäftigen, mit einigen nicht, von denen man aber wenigstens gehört haben sollte.
Bekanntlich hat sich die Philosophie seit ihren griechischen Anfängen mit dem beschäftigt, was wir tun sollen und was wir wissen können. Wir folgen nach der Exposition genau diesem Schema und versuchen zunächst einen philosophischen Zugang
<–11|
zu dem zu gewinnen, was Nietzsche für die Ethik bedeutet (2.). In Wahrheit sind wir allerdings damit schon beim Erkennen, was bald deutlich werden wird – deshalb ist dieses Kapitel auch überschrieben mit ‚Die Moral des Erkennens‘. Explizit wird Nietzsches Philosophie des Wissens dann im nächsten Kapitel (3.) zum Thema, wo es um den ‚Glauben des Erkennens‘ gehen soll. Diese Thematik führt am Schluss auf die Frage nach dem, was man – wenn überhaupt – als so etwas wie Nietzsches ‚positive‘ Philosophie bezeichnen könnte, also jenseits der umfassenden Kritik an den Grundlagen des abendländischen Denkens. Hier zeigt sich, wie intensiv Nietzsche über sein eigenes Philosophieren und dessen Bedingungen reflektiert hat.
Dieses Kapitel wird abgeschlossen mit einer Interpretation eines derjenigen Texte, die schon auf dem Sprung in eine mehr oder weniger literarische Darstellungsform stehen. Deshalb kommen wir eigentlich durch den Gang der Erörterung selbst auf dasjenige Werk, das Nietzsche ganz bewusst und weitgehend als Literatur und nicht als philosophische Erörterung gestaltet hat – d. h. zu ‚Also sprach Zarathustra‘. Wir werden dieses Werk abschließend an exemplarischen und wichtigen Stellen interpretieren (4.). Dabei werden die zentralen Themen aus Nietzsches Denken in einer neuen Einkleidung wieder auftauchen, aber es wird sich auch zeigen, dass dieses Buch selbst ein zentrales Thema hat, das sich wiederum aus Nietzsches Philosophie notwendig als Problem ergibt: die Frage der Vermittlung seines Denkens.
<–12|
1 Die Zitierweise wird auf Seite 303 erklärt.
1 Das Problem des Erkennens: ‚Die Geburt der Tragödie‘
1.1 Kritische Philosophie der Wissenschaft
Die Grundpositionen seiner Philosophie hat Nietzsche schon bemerkenswert früh festgelegt. Hier ist eine Schrift von geringem Umfang wichtig, die den merkwürdigen Titel trägt „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“. Natürlich hat Nietzsche später sein Denken umgebaut, verfeinert, expliziert, ergänzt – aber doch nie in den zentralen Bereichen in eine gänzlich andere Richtung gelenkt. Man sollte sich darüber nicht durch jene seltsame Überschrift täuschen lassen. Es geht in dieser Schrift in der Tat auch um die Tragödie und um den ‚Geist der Musik‘, aber damit sind nicht im engeren Sinne literaturhistorische oder musiktheoretische Themen gemeint. Im Grunde verbirgt sich in dieser Thematik ein – oder vielleicht das – zentrale philosophische Problem, das Kant so formuliert hatte: ‚Was können wir wissen?‘. In der Gegenwart stimmen die meisten Menschen der Auffassung zu, dass das Wissen Sache der Wissenschaft ist. Nietzsche hatte diese Gleichsetzung noch nicht ganz vor Augen. Zwar war der Begriff ‚Wissenschaft‘ auch im 19. Jahrhundert und zuvor in Gebrauch, aber er wurde noch nicht eingeschränkt auf die Naturwissenschaft verwendet – bzw. auf die Wissenschaft, die nach dem Modell der Erkenntnisgewinnung arbeitet, das für die modernen Naturwissenschaften und hier wiederum für die Physik leitend wurde.
‚Wissenschaft‘ war in erster Linie der Inbegriff desjenigen Wissens, das Allgemeinheit und Notwendigkeit beanspruchen kann, d. h. welches stets und für alle Menschen in allen Kulturen gilt, und dessen Inhalt wir mit dem Bewusstsein verbinden, es müsse sich notwendig so verhalten. Damit werden Sätze wie ‚Die Ehe ist unauflöslich‘ oder ‚Tübingen liegt am Neckar‘ offensichtlich aus dem Bereich dessen ausgeschlossen, was ‚Wissenschaft‘ heißen soll, denn der erste Satz gilt in vielen Kulturen und Religionen nicht, und der zweite gibt keinen notwendigen Zusammenhang wieder. Aber auch viele Sätze aus den Naturwissenschaften sind nach diesem Verständnis eigentlich nicht ‚wissenschaftlich‘ – in der Zoologie ist es etwa nicht notwendig, dass bei der Einteilung der Säugetiere irgendwo auch die Unterscheidung in Feliden und Kaniden vorkommt, denn man könnte auch eine andere Einteilung finden als in Katzen und Hunde. Die
<–15| Seitenzahl der gedruckten Ausgabe
Sätze der Newtonschen Mechanik sollen dagegen (im Makrobereich) ebenso notwendig und allgemein gelten wie E=mc2.
Was heute als ‚Wissenschaft‘ bezeichnet wird, deckt sich also nur zum Teil mit dem, was für Nietzsche diesen Begriff ausmachte. Er umfasste weit mehr als den Bereich des Wissens, den wir heute demjenigen Denk- und Handlungszusammenhang zuordnen, welchen wir als ‚Wissenschaft‘ bezeichnen und ihn damit von einem anderen Denken unterscheiden, das etwa in der Politik mit dem Ziel des Entscheidens über Regeln des Zusammenlebens, in den Religionen mit dem Ziel einer Vorgabe für das richtige Handeln für Menschen, die sich auf eine bestimmte Weise verpflichtet fühlen, oder auch in der Philosophie mit dem umfassenden Anspruch einer Reflexion auf die Grundlagen des Wissens durchgeführt wird. Diese Unterscheidung war noch nicht in der uns bekannten Weise selbstverständlich geworden, anders gesagt: der Bereich des allgemeinen und notwendigen Wissens war noch nicht auf den Bereich der Naturwissenschaft nach dem Muster der Physik eingeschränkt, wie dies heute im ‚mainstream‘ der Überzeugungen zumindest der Menschen in der westlichen Welt der Fall ist. Lange Zeit hatten aus Begriffen und reinem Denken (und sehr vielen Annahmen, die man einfach als selbstverständlich akzeptierte) entwickelte Sätze über Gott, die Welt und den Menschen bzw. seine Seele ebenso als Bestandteile eines notwendigen und allgemeinen Wissens gegolten.
Erst Kant hatte die Frage nach der Möglichkeit und der Legitimation für ein solches Wissen neu und radikal gestellt. Seine erste Einsicht war, dass ein Wissen, dem Notwendigkeit und Allgemeinheit zugeschrieben werden kann, keinesfalls aus der Erfahrung genommen werden kann, d. h. nicht a posteriori (also ‚nach‘ und in Abhängigkeit von der Erfahrung) gelten kann, sondern es muss sich um ein Wissen a priori handeln, also ‚vor‘ und ohne Abhängigkeit von der Erfahrung. Da wir von Wissen aber nur dann sprechen, wenn wir durch die Vertrautheit mit ihm etwas über die Welt erkennen (und nicht nur über die Weise, wie wir unsere Begriffe verwenden), deshalb darf es sich auch nicht nur um eine Analyse unserer Sprache handeln – offenbar sehen wir Sätze wie ‚Schimmel sind weiße Pferde‘ oder ‚Junggesellen sind unverheiratete Männer‘ nicht als Bestandteile unseres Wissens, sondern als Erklärungen der Bedeutung von Wörtern an. Die Frage nach dem Bereich dessen, was wir als ‚Wissenschaft‘ bezeichnen können, nahm deshalb in Kants Denken die Form einer Frage nach der Begründung apriorisch-synthetischer Urteile an, also solcher Sätze, die zum einen vor und unabhängig von der Erfahrung gelten und deshalb beanspruchen können, notwendig und allgemein zu gelten, und die uns zum anderen nicht nur etwas über unsere Sprache sagen, also nicht ‚analytisch‘ sind, sondern eine Synthese von zwei verschiedenen Vorstellungen enthalten, deren Verbindung uns zuvor noch nicht bekannt war.
<–16|
Kant hatte auf dieser Grundlage eine Antwort gefunden, die eine solche Wissenschaft nur noch in einem bestimmten Bereich gelten ließ, nämlich in dem, was er als erste ‚Möglichkeitsbedingungen‘ des Erfahrens von Objekten identifizierte. Diese ‚subjektiven‘ Voraussetzungen für unsere Erfahrung stellte er unter dem Titel ‚Kategorien‘ zusammen und arbeitete sie schließlich als ‚Grundsätze‘ desjenigen Gebrauchs unseres Verstandes aus, in welchem wir in ihm selbst apriorisch-synthetische Urteile gewinnen können. Das Entscheidende an diesem Gedanken ist, dass darüber hinaus gerade kein Wissen im genannten Sinne von ‚Wissenschaft‘ mehr möglich ist. Der Bereich dessen, was wir als ‚Wissenschaft‘ in diesem strengen Sinne bezeichnen können, ist auf diese Weise offenbar sehr klein geworden. Vor allem umfasst er nicht den Bereich des Wissens, das wir heute als Wissenschaft bezeichnen, wenn wir entweder alles, was in ‚Universitäten‘ genannten Institutionen als ‚Wissen‘ bezeichnet wird, oder zumindest den Teil davon, der nach den Grundsätzen des Modells der Naturwissenschaften erzeugt wurde, dem Bereich der ‚Wissenschaft‘ zurechnen. Das geht nach Kants Denken natürlich schon darauf zurück, dass es sich bei dem in diesem Sinne ‚wissenschaftlichen‘ Wissen nicht um ein apriorisches Wissen handelt und deshalb nicht um ein Wissen, das mit dem Anspruch auf Allgemeinheit und Notwendigkeit auftreten kann.
Das scheint uns heute nichts Besonderes zu sein. Inzwischen ist es für die meisten Menschen selbstverständlich geworden, dass die Wissenschaft nicht nur ausschließlich aus der Erfahrung stammendes und methodisch in ihr begründetes Wissen ansammelt, sondern dass dieses Wissen auch keine Ewigkeitsbedeutung besitzt und schon gar keine Notwendigkeit. Diese Einsicht verbreitete sich vor allem durch Poppers Gedanken, dass das Wissen eigentlich nie verifizierbar ist, sondern nur falsifizierbar, d. h. wir gewinnen Erkenntnisse, indem wir versuchen, Geltung beanspruchende Sätze zu widerlegen. Gelingt uns dies nicht, so können wir sie akzeptieren – aber nur in dem Sinn, dass wir sie als ‚noch nicht falsifiziert‘ auffassen, was ein Verständnis von Wissenschaft als System notwendig und universell geltender Aussagen natürlich ausschließt. Im Anschluss daran wurde ein Selbstverständnis der modernen Wissenschaft entwickelt, das sie weitgehend als die Ausarbeitung solcher Zusammenhänge von Aussagen auffasst, die gemäß den Kriterien für Wissenschaftlichkeit, wie sie innerhalb der ‚scientific community‘ gelten, als ‚lebensfähig‘ aufgefasst werden, d. h. es lohnt sich, an ihnen festzuhalten, weil sie nicht widerlegt wurden, sich bewährt haben und man einfach keine besseren Theorien zur Verfügung hat. Man sollte allerdings beachten, dass es immer noch reflexionsfreie Zonen in der Wissenschaft gibt, in denen etwa manche Hirnforscher ihre Ergebnisse als endgültige Aufklärung über das Wesen des Menschen ansehen oder Physiker hoffen, auf der Grundlage ihrer Forschungen ‚Gottes Gedanken vor der Erschaffung der Welt‘ lesen zu können.
<–17|
Zunächst aber sollten wir festhalten, dass sich bei Nietzsche der Begriff vom Wissen als Wissenschaft noch aufs Engste mit dem Wissen als Philosophie verband. Das heißt nicht, dass er Kant widerlegen oder hinter dessen Denken zurückgehen wollte. Die Richtung seiner Fragen war vielmehr eine andere. Das gerade ist aus der Schrift über ‚Die Geburt der Tragödie‘ gut zu erkennen. Wir können schon an dieser Stelle sagen: seine Frage war anders als die von Kant nicht nach der Geltung des Anspruchs von Sätzen auf Wissenschaftlichkeit, sondern nach der Genesis dieses Anspruchs. Man könnte auch sagen, er stellte sich die Frage nach dem Ursprung einer Philosophie, aus derem Denken eine Auffassung von Wissen entstehen konnte bzw. musste, das als Wissenschaft in dem eben skizzierten Sinne einer Erkenntnis mit dem Anspruch auf dauernde und absolute Geltung auftreten muss. Man sollte hier beachten, dass es sich dabei nicht um ein Wissen handeln kann, das nur zum Problemlösen dienen soll. In diesem Fall nämlich könnte sich unser Wissen ganz fundamental ändern, ohne dass sich die ‚Gegenstände‘, auf die sich das Wissen bezieht, geändert haben. Der Bezugspunkt eines solchen Wissens wären nicht die Gegenstände in der Welt ‚an sich‘, sondern unsere menschlichen Probleme mit ihnen, und wenn diese Probleme sich ändern, so würde sich auch das Wissen ändern, das wir nur zu deren Lösung entwickelt haben, und auch wenn sich die menschlichen Probleme kurzfristig nicht sehr verändern mögen – auf lange Sicht tun sie es doch.
Wenn Nietzsche von ‚Wissenschaft‘ schreibt, so sollten wir also beachten, dass es dabei (a) nicht einfach um das geht, was wir heute so bezeichnen, und auch nicht um das, was man auf der Grundlage des Selbstverständnisses vieler Wissenschaftler als das Methodenideal der Wissenschaft bezeichnen könnte, das nach dieser Auffassung meistens in der Physik am besten realisiert angesehen wird, und dass dabei nichtsdestoweniger (b) ein anspruchsvoller Begriff von Wissenschaft verwendet wird. Dass dieser Anspruch eingelöst werden kann, dies war für Nietzsche jedoch keineswegs selbstverständlich, ebenso wenig wie es ihm sicher erschien, dass das Wissen nur in der Wissenschaft zu finden sein soll, wie sie dem Ideal der Wissenschaftler entsprach. Jedenfalls sah er in diesem Anspruch ein Problem, und wir können vorwegnehmend schon festhalten, dass dieses Problem zu einer der wenigen – wenn auch nicht der einzigen – Leitfragen seiner Philosophie werden sollte. In dem viel später geschriebenen „Versuch einer Selbstkritik“ zu jenem Buch über die Tragödie und deren Geburt aus dem Geiste der Musik reflektierte Nietzsche so über dieses zentrale Thema: „Was ich damals zu fassen bekam, etwas Furchtbares und Gefährliches, … heute würde ich sagen, dass es das Problem der Wissenschaft selbst war – Wissenschaft zum ersten Male als problematisch, als fragwürdig gefasst.“ (GTIII-1, 7) Seine Philosophie sollte nach dieser Leitfrage also nicht in erster Linie die Aufgabe haben, ein Wissen
<–18|
zu entwickeln, das sich auf die Welt und den Menschen richtet, sondern es sollte von Anfang an um eine Reflexion auf das gehen, was als Wissen bezeichnet wird – also auf das ‚Problem der Wissenschaft‘.
Mit dieser Einschränkung – Reflexion auf das Wissen statt Wissen – begann Nietzsche auf dem Stand zu denken, den die Philosophie schon längere Zeit vor ihm als für sich angemessen gefunden hatte. Dieser Weg begann grundsätzlich bereits bei Descartes, dem es in seiner berühmten Begründung alles Wissens im seiner selbst gewissen Ich und d. h. in der Selbstreflexion auf den Akt des Denkens in erster Linie auf die Frage ankam, was wir wirklich mit Sicherheit und Gewissheit wissen können und wie wir diesen Status auf die Art und Weise der Gewinnung unseres Wissens übertragen können. Endgültig hatte jedoch Kant die Aufgabe der Philosophie auf die einer solchen Reflexion – was bei ihm ‚Kritik‘ hieß – begrenzt, und eine der wichtigsten Aufgaben seiner theoretischen Philosophie bestand gerade darin, die Ansprüche einer ‚rationalen‘ Theologie, Psychologie und Kosmologie auf für alle Menschen notwendig geltende Erkenntnisse abzuweisen. Damit sollte natürlich nicht behauptet werden, dass wir nichts über Gott, den Menschen und den Kosmos wissen können, aber solche Erkenntnisse können gemäß Kants Einsicht nicht auf ‚rationalem‘ Wege, d. h. durch das bloße Denken gewonnen werden, sondern nur durch eine auf Erfahrung gegründete Wissenschaft (Psychologie und Kosmologie) bzw. durch eine Auslegung von Texten, die beanspruchen, uns Auskunft über Gott geben zu können (Theologie). Das schließt aber die Begrenztheit des Anspruchs solcher Erkenntnisse ein – es handelt sich nicht um ewige und letztbegründete Einsichten, die von niemandem bezweifelt werden können, sondern um solche, die kritisiert, revidiert und im Laufe der Zeit vielleicht sogar vollständig verändert werden können. Wenn Kant seine Statusbestimmung des philosophischen Denkens als ‚kritisch‘ bezeichnen konnte, so können wir den Begriff ‚kritisch‘ also in eben diesem Sinne auch für Nietzsches Denken gelten lassen – mit Veränderungen, die noch deutlich werden.
1.2 Apollo und das individuierende Bestimmen
Wenn eine solche Frage nach dem Wissen und der Wissenschaft mithilfe des Problems einer „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ untersucht werden soll, so wird beansprucht, diese Untersuchung auf der Grundlage einer Reflexion auf die Kunst durchführen zu können. In der Tat hat Nietzsche auch in seinem späteren Kommentar zu seinem eigenen Frühwerk diesen Zusammenhang betont: das Problem der Wissenschaft könne nicht auf dem Boden der Wissenschaft erkannt werden
<–19|
(GTIII-1, 7), weshalb es gelte, „die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen“ (GTIII-1, 8) Man sollte sich zumindest vorläufig verdeutlichen, wogegen sich eine solche Perspektive absetzt: es soll Wissenschaft offenbar nicht zum Thema werden unter dem Gesichtspunkt, wie sich Sätze möglichst adäquat auf Zusammenhänge in der Welt beziehen können, was traditionell als ‚Wahrheit‘ bezeichnet wurde (adaequatio intellectus et rei). Aber vielleicht versuchte sich Nietzsche gerade mit der Frage nach der Kunst dem Problem der Wahrheit zu nähern. Die Richtung der Reflexion geht aber auf das Entstehen dieser Auffassung von Wahrheit, die uns als adaequatio geläufig wurde, und auf die Herkunft jener Vorstellungen über den richtigen Umgang mit jenen wahren Erkenntnissen, die mit dem so definierten Begriff verbunden wurden.
Dass dieses Buch ein zunächst nur unter künstlerischen Gesichtspunkten bedeutsames Thema mit der Frage nach der Wissenschaft zusammenführt, stellt auf jeden Fall den Ausdruck des Anspruchs dar, dass in ihm gerade das Künstlerische, das Kreative, das ästhetische Weltenschaffen als die Grundlage des möglichen Wissens von der Welt und vom Menschen erklärt werden könne. Später wird Nietzsche in seiner Reflexion auf dieses Buch von einer „ästhetischen Weltauslegung“ sprechen. Den größten Gegensatz dazu wird er dann in der moralischen Weltauffassung des Christentums sehen (GTIII-1, 12). Die ‚artistische‘ Lehre wird damit als ein prinzipiell ‚anti-christliches‘ Denken aufgefasst (GTIII-1, 13). Es wird sich auch zeigen, dass Nietzsche bereits in seinem frühen Buch das Christentum als Erbe dessen auffasst, was er bald als ‚Platonismus‘ bezeichnet, also als die zu einer ‚Lehre‘ verfestigte Philosophie Platons.
Die Grundlage der Kunst findet Nietzsche in einer Dualität, die das eigentliche Thema dieses Buches darstellt: von Apollinischem und Dionysischem, und diese Ambivalenz des Künstlerischen scheint ihm für die Kunst eine analoge Bedeutung zu haben wie die Zweiheit der Geschlechter für die Fortpflanzung des Menschen (GTIII-1, 21). Diese Unterscheidung muss dann aber nicht nur für die Aufklärung der ‚Geburt der Tragödie‘ wichtig sein, sondern auch für das Thema der Aufklärung der Wissenschaft als einer – und heute meist der – Form des Wissens. Deshalb stellt im Zusammenhang des Denkens von Nietzsche das Verhältnis von Apollinischem und Dionysischem nicht ein Spezialthema unter der Perspektive einer Aufklärung der Kunstform der Tragödie, der Musik allgemein oder sogar der Kunst als solcher dar. In Bezug auf Wissenschaft, Sprache und das menschliche Denken handelt es sich in der Tat um einen der wichtigsten Züge in Nietzsches Philosophie. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn es gelingt, die wesentlichen Strukturen dieser Unterscheidung beizubehalten und sich dennoch von der Verengung auf eine allzu metaphorische Bedeutung zu lösen. Wir sollten aber schon an dieser Stelle und vor der Erörterung des Apollinischen und Dionysischen deutlich sehen, dass es hier nicht um zwei isolierte Kunsttendenzen
<–20|
oder Kulturrichtungen geht, sondern um die Bedeutung, welche deren Vereinigung gewinnt – und auch um die Notwendigkeit dieses Zusammenwirkens. Nietzsche wies ausdrücklich darauf hin, dass wir „in jenem Bruderbunde des Apollo und des Dionysos die Spitze ebenso wohl der apollinischen als der dionysischen Kunstabsichten anerkennen“ müssen (GTIII-1, 146).
Über das Verhältnis zwischen diesen beiden künstlerischen Prinzipien, die zugleich Prinzipien des Wissens und damit der menschlichen Beziehung zur Welt sind, hat sich Nietzsche nach zwei Richtungen geäußert. An manchen Stellen scheint es so, dass das Dionysische ihm als die Wahrheit der Welt galt, während das Apollinische ein bloßer Schein sein sollte, der diese Wahrheit verdeckt. Etwa sprach er diese Funktion dem apollinischen Bewusstsein zu (GTIII-1, 30). An einer anderen Stelle ist die Rede von der „glänzende(n) Traumgeburt des Olympischen“ (d. h. des Apollinischen), welches die Griechen vor „die Schrecken und Entsetzlichkeiten des Daseins“ stellen musste, um leben zu können (GTIII-1, 31). Noch an anderer Stelle schreibt Nietzsche von der ‚metaphysischen Annahme‘,
„dass das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine, als das Ewig-Leidende und Widerspruchsvolle, zugleich die entzückende Vision, den lustvollen Schein, zu seiner steten Erlösung braucht: welchen Schein wir, völlig in ihm befangen und aus ihm bestehend, als das Wahrhaft-Nichtseiende d. h. als ein fortwährendes Werden in Zeit, Raum und Kausalität, mit anderen Worten, als empirische Realität zu empfinden genötigt sind.“ (GTIII-1, 34 –35)
Hier findet sich aber bereits eine Charakterisierung des Verhältnisses zwischen apollinischem und dionysischem Prinzip, welche in eine andere Richtung weist, und diese Richtung ist auch diejenige, welche in Nietzsches Denken wirklich Bedeutung gewinnen sollte und die Struktur dieser Philosophie fundamental prägt. Zwar soll wohl das Dionysische das „Wahrhaft-Seiende“ darstellen, aber es ist offensichtlich ein sehr mängelbehaftetes Seiendes, wenn es den Schein geradezu „braucht“. So ganz wahr kann das Wahre nicht sein, wenn es noch etwas außer seiner selbst braucht, um zu dem zu kommen, was Nietzsche als dessen „Erlösung“ bezeichnet. Ganz entsprechend nennt Nietzsche die „Erlösung durch den Schein“ auch „das ewig erreichte Ziel des Ur-Einen“ (GTIII-1, 35). Dieser Schein ist allerdings kein ‚bloßer Schein‘, von dem wir etwa dann sprechen, wenn ein Gegenstand nicht wirklich vorhanden ist, wir aber doch durch bestimmte Sinneseindrücke glauben, er sei wirklich, wie dies vielleicht der Fall ist, wenn wir in der Dunkelheit einen Schatten als einen Hund wahrnehmen, was sich beim genaueren Hinsehen und bei besserer Beleuchtung als Irrtum herausstellt.
<–21|
Der von Nietzsche gemeinte Schein ist vielmehr gerade das, was wir als ‚wirklich‘ zu bezeichnen gewohnt sind, nämlich die „empirische Realität“ und deren „fortwährendes Werden in Zeit, Raum und Kausalität“, was er als „das Wahrhaft-Nichtseiende“ bezeichnete (GTIII-1, 35). Dieser Ausdruck klingt ungewöhnlich – vor allem deshalb, weil nicht das gemeint ist, was beim ersten Lesen verstanden werden könnte: nämlich das, was in Wahrheit nicht ist. Gemeint ist vielmehr das, was auf eine wahrhafte Weise nicht das ist, was im dionysischen Sinne ist, und dieses ‚wahrhaft‘ sollten wir hier mit Bezug auf ‚Wahrnehmung‘ oder ‚Wahrscheinlichkeit‘ auffassen. Die empirische Realität ist also insofern ‚wahrhaft‘, als sie der Schein ist, in dem „das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine“ zu seiner Erlösung kommt (GTIII-1, 34). Wenn es einer solchen Erlösung bedürftig ist, dann war es offensichtlich zuvor nicht vollständig das, was es sein muss. Dann aber ‚gibt es‘ das Dionysische nicht ohne das Apollinische und das Wahre nicht ohne sein Scheinen.
An dieser Stelle muss wohl darauf aufmerksam gemacht werden, dass Nietzsches bisweilen irreführende Formulierungen über das Dionysische als das ‚Wahre‘ oder der ‚Urgrund‘ der Welt in der Schrift „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ weitgehend auf den noch anhaltenden Einfluss der Philosophie Schopenhauers zurückgehen, der auf den merkwürdigen Gedanken gekommen war, Kants Rede von einem An-sich als einen Hinweis auf so etwas wie einen ‚Willen an sich‘ zu deuten, den er dann un-kantisch als den eigentlichen Grund der Welt verstand. In der vorliegenden Darstellung wird auf eine nähere Erläuterung von Schopenhauers vorübergehendem Einfluss auf Nietzsches Denken verzichtet. Bereits in der „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ wird bei genauerem Lesen deutlich, dass sich Nietzsche schon weitgehend von dem Denken jenes Schriftstellers gelöst hatte.
Nietzsches Auffassung ist auf jeden Fall besser zu verstehen, wenn wir sie mit Grundzügen der Kantischen Philosophie vergleichen. Nach Kant können wir eine Erkenntnis nur von der ‚Erscheinung‘ erreichen, unter welcher bei ihm das verstanden wird, was wir als Subjekte mithilfe unserer reinen Verstandesbegriffe aus den Sinnesdaten machen, die allein uns in der Form von Anschauungen gegeben sind. Wir konstruieren die Welt der Erscheinung also, obwohl dies kein willkürliches Tun ist, sondern ein Vorgang, der notwendig ist für ein Wesen, das sich von der Welt der Objekte unterscheidet und darin für sich selbst seine Identität finden kann. Insofern ist diese Erscheinung keineswegs ein Schein, der uns das verstellt oder falsch darstellt, was wirklich ist. Sie ist vielmehr das Wirkliche, nur dass wir das Wirkliche auffassen müssen als etwas, das zusammen mit der bewussten Identität des Subjekts in der Anwendung von Urteilsformen bzw. reinen Verstandesformen auf die Anschauung ‚hergestellt‘ wird – nämlich hergestellt wird als die Welt des Subjekts. Natürlich kann ‚hinter‘ dieser Welt keine andere sein,
<–22|
von der sie die Erscheinung wäre, denn eine solche ‚Hinterwelt‘ wäre eben keine Welt für ein Subjekt. Um von einer solchen ‚Hinterwelt‘ sprechen zu können, müssten wir den Gedanken eines ‚Meta-Subjekts‘ fassen, also eines Subjekts, für das Subjekt und ‚Hinterwelt‘ auffassbar wären. Wir müssten also den Standpunkt Gottes einnehmen, von dem wir jedoch gerade nach der Kantischen Lehre (Kritik der rationalen Theologie) nichts wissen können (obwohl wir daran glauben können).
Nietzsche führte allerdings nicht wie Kant die Entwicklung und Begründung von reinen Verstandesbegriffen aus der Notwendigkeit durch, mithilfe von Urteilsformen aus einem Satz eine genügend bestimmte Behauptung über die Welt machen zu müssen. Von einem Subjekt, das im Verhältnis zur objektiven Welt seine Identität findet, ist ebenfalls nicht die Rede. Dennoch ist der ‚Schein‘ und ‚Traum‘ des Apollinischen ebenso wenig ein ‚bloßer Schein‘, hinter dem irgendwie die Wahrheit stecken könnte, wie dies für Kants Welt der Erscheinung galt. Die empirische Welt ist im einen Fall eine Konstruktion des identischen Subjekts, im anderen Fall ist sie die Weise, in der sich das Formlose, Rauschhafte des Dionysischen darstellen kann. Vielleicht ist es nicht ganz überflüssig zu erwähnen, dass als ‚empirische Welt‘ hier – ebenso wie bei Kant – nicht die Welt der Sinneswahrnehmungen bzw. –daten zu verstehen ist, sondern, wie das Wort sagt, die Welt der Erfahrung, d. h. die Welt, in der wir Objekte erfahren, ihre Zusammenhänge feststellen und darüber (u. a.) wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln. Wir kommen also auch hier zurück zu der eingangs erwähnten Fragestellung nach der Form des Wissens, welche zu dem Phänomen gehört, das wir als Wissenschaft kennen. Diese Form des Wissens zeigte sich für Nietzsche nun in diesem frühen Stadium als eine Weise der apollinischen – d. h. umgrenzten und zur Gestalt gebildeten – Darstellung des Dionysischen, also als ein Geschehen des Bildens und des Erzeugens von Bestimmtheit.
Eine solche Darstellung setzt jedoch den Gedanken einer Dualität voraus. In Nietzsches ästhetischer Terminologie wird sie als Dualität zwischen „der Kunst des Bildners“ (Apollo) auf der einen und der „unbildlichen Kunst der Musik“ (Dionysos) ausgedrückt (GTIII-1, 21). Diese Dualität erläuterte Nietzsche durch die Unterscheidung zwischen den „getrennten Kunstwelten des Traumes und des Rausches“ (GTIII-1, 22). Das ‚Bilden‘ steht also mit dem ‚Traum‘ auf der einen Seite der Musik und dem ‚Rausch‘ auf der anderen Seite gegenüber. Wenn hier von ‚Traum‘ die Rede ist, so sollte man nicht an Albträume oder an visuelle Wunscherfüllungen denken, sondern in erster Linie daran, dass im Traum Gestalten und Bilder erschaffen werden, die so in der Wirklichkeit nicht existieren, auch wenn es Zusammenhänge mit der wirklichen Welt gibt. Ebenso ist wichtig, dass der Traum in einem ambivalenten Sinne als ‚Schein‘ gilt – jedenfalls in Bezug auf die Wirklichkeit, in der der Träumer erwacht,
<–23|
obwohl er ihm während des Schlafes meist sehr real erscheint. Nietzsche nennt hier die „maßvolle Begrenzung“ als Charakteristikum des Traum-Bildens, durch welche der Schein uns nicht als „plumpe Wirklichkeit“ betrügen könne, so dass sich durch dieses ‚Maß‘ der Schein von der Realität unterscheiden kann (GTIII-1, 24).
Die Seite des Gottes Apollo in der Kunst ist also diejenige der Begrenzung, des Gestaltens und damit des Schaffens von einzelnen Bildern bzw. Wesen. Nietzsche nannte Apollo deshalb den Gott „des principii individuationis“, „aus dessen Gebärden und Blicken die ganze Lust und Weisheit des ‚Scheines‘ samt seiner Schönheit“ zu uns sprechen (GTIII-1, 24). Apollo ist der „Gott der Individuation und der Gerechtigkeitsgrenzen“ (GTIII-1, 67). Der letztere Ausdruck besagt, dass damit ein Prinzip in der Welt ist, durch das die Dinge begrenzt sind bzw. so verstanden werden, und diese Grenzen werden als die eigenen der Dinge aufgefasst, die ihnen ‚gerecht‘ sind – m. a. W.: Apollo ist nach dieser Auffassung der Gott der Bestimmtheit der Dinge, so dass sie sind, was sie sind und nichts anderes, d. h. sie sind unterschieden. Das Prinzip der Individuierung (‚Gott der Individuation‘) ist hier nicht auf den Menschen eingeschränkt zu verstehen, sondern in seiner allgemeinsten Bedeutung, d. h. so, dass jede Abgrenzung einzelner Wesen, Begriffe, Gedanken und Ideen damit gemeint sein kann.
Es handelt sich also im Grunde um das Prinzip, dass A nicht B ist und dass sich beide von C unterscheiden, was auch immer als A, B oder C bezeichnet werden mag. Offensichtlich ist dies eines der Grundprinzipien des Sprechens und des Denkens überhaupt. Ohne dieses Prinzip könnten wir eigentlich überhaupt nichts sagen, denn das Gesagte würde stets auch etwas ganz anderes bedeuten können, so dass es dem Hörer nichts sagen würde, weshalb er ihm weder zustimmen noch widersprechen könnte. Wenn wir nichts sagen können, dann können wir aber auch nichts denken, jedenfalls nichts, was auf irgendeine Weise bestimmt wäre, und würden wir nur Unbestimmtes denken, so könnten wir uns eben nicht etwas denken und es auch nicht für uns selbst so festhalten, dass wir andere Gedanken daran anschließen können.
Dieses Prinzip mag uns als selbstverständlich erscheinen, aber wir sollten bedenken, dass die Möglichkeit des Denkens auch darauf beruht, dass wir die Individuierung wieder aufheben bzw. relativieren können, indem wir von A etwa behaupten, es sei unter einem bestimmten Aspekt doch B, weil A und B doch Fälle von C seien. Hauskatzen sind in der Regel keine Tiger, aber immerhin gehören beide der Gattung der Feliden an und unterscheiden sich damit von den Kaniden, die ebenso Wölfe wie Dackel sein können. Hauskatzen sind also Feliden, aber doch nicht ‚ganz‘, denn zum einen gibt es noch andere Feliden wie z. B. Großkatzen, und zum anderen unterscheiden sich Katzen durch eine spezifische Differenz von der Gattung ‚Feliden‘. Hauskatzen sind
<–24|
also unter einem besonderen Aspekt doch ‚so etwas‘ wie Tiger, weil beide Katzen sind, obwohl sie sich doch unterscheiden.
Solche Differenzierungen, durch die einzelne Entitäten als bestimmt aufgefasst werden, sind nach Nietzsche nun nicht einfach in der Welt vorhanden, sondern sie werden auf eine Weise ‚gemacht‘, die als kreativ und damit grundsätzlich als ähnlich demjenigen Schaffen aufgefasst wird, das wir als Kunst bezeichnen. Wenn Nietzsche hier von ‚Bilden‘ durch ‚Begrenzung‘ spricht, so macht er also darauf aufmerksam, dass eine solche ‚Individuierung‘ auf der Grundlage einer kreativen Tätigkeit geschieht und nicht von selbst in der Natur vorhanden ist. In der Welt des griechischen Denkens findet Nietzsche dafür das Prinzip eines Gottes (des Apollo), der sich von einem anderen Gott unterscheidet (dem Dionysos), obwohl beide in der griechischen Götterwelt doch selbst nur Individuen unter anderen waren.
Das individuierende Bilden ist aber nicht nur in der Kunst zu finden, sondern es handelt sich um ein Prinzip, das für alles Bestimmen gilt. Es ist also auch die Grundlage des Selbstbezugs, durch den sich ein Mensch von anderen Menschen unterscheidet. Dieses Ausbilden von Identität wurde in Griechenland in der Regel ethisch verstanden:
„Diese Vergöttlichung der Individuation kennt, wenn sie überhaupt imperativisch und Vorschriften gebend gedacht wird, nur Ein Gesetz, das Individuum, d. h. die Einhaltung der Grenzen des Individuums, das Maß im hellenischen Sinne. Apollo, als ethische Gottheit, fordert von den Seinigen das Maß und, um es einhalten zu können, Selbsterkenntnis. Und so läuft neben der ästhetischen Notwendigkeit der Schönheit die Forderung des ‚Erkenne dich selbst‘ und des ‚Nicht zu viel!‘ her.“ (GTIII-1, 36)
Das Maß des Menschlichen ist demnach das Ergebnis eines Prozesses, in dem das Individuelle entsteht, indem Begrenzung und Gestaltbilden geschieht. Auch das ‚Menschliche‘ ist nicht vorhanden, sondern entsteht in prinzipiell künstlerischen Prozessen, also aus der Verbindung des Dionysischen und des Apollinischen, in der Form, Begrenzung und damit Bestimmtheit geschaffen werden.
1.3 Das Grauen und der Zauber des Dionysischen
Dieses individuierende Begrenzen und Bilden wird nun allerdings auch als ‚Schein‘ und ‚Traum‘ bezeichnet. Also muss es etwas anderes geben, was dieses Phänomen infrage stellt und bis zu einem gewissen Grade aufhebt – wäre man nicht zumindest
<–25|
rudimentär mit dem bekannt, was wir als ‚Realität‘ bezeichnen können, so könnte man nicht davon Schein und Traum unterscheiden. Wir sollten hier schon berücksichtigen, dass Nietzsche damit nicht das andere Prinzip als die alleinige Wahrheit auszeichnen will, wie der Wachzustand etwa die Wahrheit gegenüber dem Traum wäre. Es handelt sich um Analogien, und man sollte die Analogiebildung nie in dem Sinne zu weit treiben, dass sie selbst in ihrer Individualität aufgehoben und mit dem, wofür sie eine Analogie darstellt, identifiziert wird. Auch mit der Bezeichnung ‚Rausch‘ für das Dionysische wird eine solche Analogie versucht. zu der die meist von Lust begleitete Aufhebung von Grenzen gehört – sei es in einer allgemeinen Verbrüderung von Trinkgenossen oder im Verschwimmen der visuellen Begrenzungen der Dinge oder im Undeutlichwerden von akustischen Eindrücken oder der Stimme. Nietzsche spricht hier von einer ‚wonnevollen Entzückung‘, „die bei demselben Zerbrechen des principii individuationis aus dem innersten Grunde des Menschen, ja der Natur emporsteigt.“ (GTIII-1, 24)
Das Zerbrechen des Prinzips der Individuierung ist also eine zentrale Bedeutung dessen, was Nietzsche als das Dionysische bezeichnet. An der gleichen Stelle weist er jedoch noch auf einen anderen Aspekt, der besonders unter der Perspektive der Reflexion auf Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit wichtig ist. Er spricht hier von dem ‚Grausen‘, „welches den Menschen ergreift, wenn er plötzlich an den Erkenntnisformen der Erscheinung irre wird, indem der Satz vom Grunde, in irgend einer seiner Gestaltungen, eine Ausnahme zu erleiden scheint.“ (GTIII-1, 24) Offensichtlich ist jener Rausch in Nietzsches Analogie nicht nur und nicht ausschließlich lustvoll, sondern auch grauenerregend, und dies geht gerade darauf zurück, dass uns der Gedanke der Kausalität in dieser Situation keinen sicheren Halt mehr bietet. Dass Nietzsche hier – unvermittelt, wie es scheinen könnte – vom ‚Satz vom Grund‘ und damit vom Prinzip der Kausalität spricht, lässt sich leicht mit Bezug auf Kants Philosophie verstehen. Dass ‚Kausalität‘ ein Gedanke ist, war bereits von Kant in seiner Ausarbeitung der Möglichkeitsbedingungen von Erfahrung und damit einer Welt von Objekten unabhängig von uns gedacht worden. Der Begriff der Kausalität gehört nach dieser Philosophie zu jenen Gedanken, die Kant als ‚reine Verstandesformen‘ bezeichnete, weil wir mit ihrer Hilfe die Welt in Urteilen bestimmen und damit überhaupt eine Welt von Objekten von uns als Subjekten unterscheiden können.
Eine solche Unterscheidung können wir in der Kommunikation zwischen Menschen nur so vornehmen, dass wir von Sätzen behaupten, dass sie gelten, d. h. etwas über die Welt aussagen – und nicht nur über den Sprecher und sein Bewusstsein selbst; sie sollen also unabhängig von ihm gelten. Das ist aber nur möglich, wenn sie so bestimmt sind, dass andere Menschen sie auf die Welt beziehen können und dadurch
<–26|
entscheiden können, ob es sich tatsächlich so verhält, wie mit dem betreffenden Satz behauptet wird. Erst dann ist etwas mit einem Satz ausgesagt, was auch ein anderer Sprecher so auffassen kann, wie dies der erste berichtet. Wir können ihn dann in der Kommunikation überprüfen und entscheiden, ob es wirklich so ist, d. h. ob er sich tatsächlich auf die objektive Welt bezieht oder vielleicht doch nicht. Kants Behauptung war es, dass wir genau für diesen Objektbezug von Sätzen den Begriff der Kausalität benötigen. Das heißt nicht, dass wir in jedem sinnvollen Satz sagen müssen, warum etwas so und nicht anders ist. Aber es muss das Verhältnis einzelner Eigenschaften zum Objekt angegeben werden, und zwar so, dass deutlich wird, es solle sich nicht nur für den Wahrnehmenden so verhalten, sondern dies solle ‚objektiv‘ gelten. Dafür müssen wir zumindest annehmen können, die verschiedenen Wahrnehmungen vom Objekt haben als ihre gemeinsame Ursache eben dieses Objekt – und nicht etwa unser Wahrnehmungsvermögen selbst. Wenn wir etwas von einem Objekt behaupten, so setzen wir deshalb den Gedanken der Kausalität als gültig voraus.
Wenn wir uns von Kants Überlegungen nun etwas lösen, so können wir auch sagen, dass die Vorstellung, alles was geschieht, habe eine Ursache, aufgrund derer es geschieht, uns die Welt verständlich und erklärbar macht. Es ist leicht zu sehen, dass der Grundsatz der Kausalität von jener Individuierung im begrenzenden Bilden abhängig ist, den wir schon als wichtigen Zug in Nietzsches apollinischen Prinzip erkannt haben. Ein Verhältnis von Ursache und Wirkung können wir nur erkennen, wenn wir beide Größen so individuieren können, dass wir genau wissen, um was es sich dabei handelt, und wenn wir zwischen beiden eine Beziehung finden, welche uns eindeutig angibt, an welcher Position der Kausalkette die eine und an welcher die andere steht. Wir könnten noch hinzufügen, dass damit auch eine eindeutige Individuierung in der Zeitfolge bestimmt ist, da die Ursache vor der Folge stehen muss (jedenfalls wenn wir uns auf die Grundlagen der klassischen Physik beschränken). Mit dem Prinzip der Individuierung wird demnach auch das Prinzip der Kausalität aufgehoben. Der Name des Gottes Dionysos bezeichnet in Nietzsches Denken also einen Zustand, in dem die Kausalität als Grundlage des Erklärens aus einem Grund ebenso außer Kraft gesetzt ist wie die bestimmte Identität der Dinge, der Begriffe und der Menschen. Genau deshalb spricht Nietzsche von einem ‚Grausen‘, wenn wir plötzlich in eine Situation kommen, in der der Satz vom Grund, demzufolge alles, was geschieht, eine Ursache hat und nichts geschieht ohne Ursache, ungültig zu sein scheint.
In einem solchen Zustand lösen sich die Begriffe ebenso auf wie die Dinge. Wir können demnach unter der alleinigen Geltung des dionysischen Prinzips auch nicht mehr von anderen Menschen als Urheber von Handlungen sprechen, d. h. wir können auch keine soziale Welt als eine Struktur von aufeinander bezogenen Handlungen mehr
<–27|
erkennen. Nietzsche formuliert dies in seinem bisweilen etwas blumigen Tonfall so: „Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen: auch die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen.“ (GTIII-1, 25) Hier wird über das ‚Verschwimmen‘ der Unterscheidung zwischen Menschen hinaus auch noch eine ‚Versöhnung‘ zwischen Mensch und Natur angesprochen. Natürlich sollten wir dabei nicht an Natur im Sinne einer zu schützenden Umwelt denken. Gemeint ist die Welt der Objekte, die sich, würde nur das dionysische Prinzip gelten, nicht von den Menschen unterscheiden könnte, ebenso wie sich Menschen in diesem Bezug nicht voneinander differenziert auffassen könnten. Erst das apollinische Prinzip schließt jene Unterscheidung zwischen Mensch und Objektwelt auf, die Kant mithilfe der reinen Verstandesbegriffe (wie etwa Kausalität) gedacht hatte. Ohne die Identifizierung von Objekten und von ihnen unterschiedener Menschen ‚verschwimmt‘ offensichtlich aber auch die Zuordnung von Objekten zu Menschen und damit wird das Erkennen von Veränderungen als Handlungen unmöglich.
Wir hatten eingangs als das zentrale Problem, welches das jetzt thematische Werk stellt, das Verhältnis zwischen einer Reflexion auf das Wissen der Wissenschaft und einer Untersuchung des Ursprungs der Tragödie aus dem Geiste der Musik bezeichnet. Eine erste Antwort können wir nun aus der Charakterisierung des dionysischen Prinzips entnehmen. Nietzsche schreibt hier: „Singend und tanzend äussert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit: er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen.“ (GTIII-1, 26) Offensichtlich hat nach dieser Formulierung die Auflösung des apollinischen Prinzips der Individuierung, der Begrenzung und des Gestaltbildens etwas mit der Musik in der Form von Singen und Tanzen zu tun. Darin sieht Nietzsche eine Auflösung der Individualität des Menschen und seinen Übergang in eine rein gemeinschaftliche Gestaltung. Für den einzelnen heben sich die Grenzen bis zu einem gewissen Grad auf, und aus der Perspektive von außen ist eine neue Gestalt wahrzunehmen, in der der einzelne nur im aufgelösten Zustand enthalten ist: „Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden.“ (GTIII-1, 26) Offenbar ist gerade das Kunstwerk in ganz ausgezeichneter Weise der Ort, an dem der Übergang vom Ungeformten zur Form und damit das Entstehen einer neuen Gestalt geschieht. Dieser Übergang muss schließlich weiterführen bis zu solchen bestimmten Formen, die Gegenstand von Wissenschaft sein können, weil sie in bestimmten Begriffen zum Ausdruck kommen und damit die Grundlage für ein allgemeines und mit dem Bewusstsein von Notwendigkeit auftretendes Wissen darstellen.
<–28|
1.4 Die philosophische Bedeutung der Tragödie
Welche Bedeutung für Nietzsche die Tragödie (und zuvor die Musik) in diesem Zusammenhang hat, ergibt sich vor allem daraus, dass die Prinzipien des Apollo und des Dionysos alleine nicht bestehen können; sie sind fundamental defizitär, wie Nietzsche in der folgenden zusammenfassenden Formulierung verdeutlicht: das Apollinische und das Dionysische sind „künstlerische Mächte“,
„die aus der Natur selbst, ohne Vermittlung des menschlichen Künstlers, hervorbrechen, und in denen sich ihre Kunsttriebe zunächst und auf direktem Wege befriedigen: einmal als die Bilderwelt des Traumes, … andererseits als rauschvolle Wirklichkeit, die wiederum des Einzelnen nicht achtet, sondern sogar das Individuum zu vernichten und durch eine mystische Einheitsempfindung zu erlösen sucht.“ (GTIII-1, 26)
Nichtsdestoweniger gibt es doch charakteristische Kunstformen für diese künstlerischen Mächte, obwohl sie ohne die Präsenz des jeweils entgegengesetzten Prinzips nicht existieren könnten. Es sind dies die Plastik und das Epische auf der Seite Apollos, während der „dionysische Musiker“ und der „lyrische Genius“ Gestalten auf der dionysischen Seite der Kunst darstellen:
„Der Plastiker und zugleich der ihm verwandte Epiker ist in das reine Anschauen der Bilder versunken. Der dionysische Musiker ist ohne jedes Bild völlig nur selbst Urschmerz und Urwiederklang desselben. Der lyrische Genius fühlt aus dem mystischen Selbstentäusserungs- und Einheitszustande eine Bilder- und Gleichniswelt hervorwachsen, die eine ganz andere Färbung, Kausalität und Schnelligkeit hat als jene Welt des Plastikers und Epikers.“ (GTIII-1, 40)
Die Unterscheidung zwischen dem Epischen und dem Lyrischen bezieht sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Bedeutung des Erzählten – der Geschichte – in der ersteren Form und auf das Entstehen aus der Musik, die für die Kunstform des Lyrischen charakteristisch ist: „Die Melodie gebiert die Dichtung aus sich, und zwar immer wieder von Neuem.“ (GTIII-1, 44 –45) Man könnte jedoch auch sagen, dass das Epische in erster Linie die Sprache zur Beschreibung von gestalteten und gebildeten Ereignissen außerhalb der Sprache einsetzt, während in der Lyrik der Ursprung die (Sprach-)Musik selbst ist und der Klang im Vordergrund steht, weshalb sie der Musik weit näher steht – üblicherweise werden Gedichte vertont, nicht aber Romane. Nietzsche beschreibt diesen Vorgang so:
<–29|
„Hiermit haben wir das einzig mögliche Verhältnis zwischen Poesie und Musik, Wort und Ton bezeichnet: das Wort, das Bild, der Begriff sucht einen der Musik analogen Ausdruck und erleidet jetzt die Gewalt der Musik an sich. In diesem Sinne dürfen wir in der Sprachgeschichte des griechischen Volkes zwei Hauptströmungen unterscheiden, je nachdem die Sprache die Erscheinungs- und Bilderwelt oder die Musikwelt nachahmte.“ (GTIII-1, 45)
Wir könnten uns dieses Verhältnis von Poesie und Musik so denken: wenn Beethoven ein Musikstück als ‚Pastorale‘ bezeichnet, so wird natürlich nicht beansprucht, mit dieser Musik werde eine ländliche Szene beschrieben, sondern die Beschreibung einer ländlichen Szene wird als eine mögliche verbale Haltung gegenüber dieser Musik vorgeschlagen, die selbst natürlich keineswegs von beschreibendem Charakter ist.
Die hier gemeinte Musik beschreibt also nicht, sondern führt aus sich selbst heraus zu einer – poetischen – Sprache, weshalb „die lyrische Dichtung als die nachahmende Effulguration der Musik in Bildern und Begriffen“ betrachtet werden muss (GTIII-1, 46). Der lyrische Künstler deutet also die Musik in Bildern (GTIII-1, 47). Aufgrund ihrer Ursprünglichkeit ist es notwendig, der Musik „einen verschiedenen Charakter und Ursprung vor allen anderen Künsten“ zuzuerkennen (GTIII-1, 99 –100). Nietzsche schrieb sogar, gerade dies sei die „wichtigste Erkenntnis aller Ästhetik, mit der, in einem ernstern Sinne genommen, die Ästhetik erst beginnt.“ (GTIII-1, 100) Deren Frage ließe sich aufgrund dieser Bedeutung der Musik deshalb auch so charakterisieren: „wie verhält sich die Musik zu Bild und Begriff?“ (GTIII-1, 100) Offenbar handelt es sich hier um eine Übersetzung dessen in eine kunsttheoretische Frage, was Nietzsche auch als das Verhältnis von Dionysischem und Apollinischem beschreibt. Die Musik ist also nicht einfach irgendeine Kunst, sondern von besonderer Bedeutung, weil sie, obwohl selbst nicht sprachlich, doch eine Sprache aus sich entstehen lässt, die sich ursprünglich nicht aus einer Beziehung auf Zusammenhänge in der Welt rechtfertigt. Nietzsche spricht hier von der „Befähigung der Musik, den Mythus d. h. das bedeutsamste Exempel zu gebären und gerade den tragischen Mythus: den Mythus, der von der dionysischen Erkenntnis in Gleichnissen redet“ (GTIII-1, 103)
Aber auch innerhalb der Musik gab es nach Nietzsche in Griechenland eine entsprechende Unterscheidung zwischen einer apollinischen und einer dionysischen Form. Die apollinische Musik wird hörbar nur „in angedeuteten Tönen“ und als „Wellenschlag des Rhythmus“ – dies war nach Nietzsche vor allem die Musik der Kithara. Dagegen macht den Charakter der dionysischen Musik „die erschütternde Gewalt des Tones, der einheitliche Strom des Melos und die durchaus unvergleichliche Welt der Harmonie“ aus (GTIII-1, 29). Darüber hinaus ist diese Musik in erster Linie Tanz – „die
<–30|
volle, alle Glieder rhythmisch bewegende Tanzgebärde.“ (GTIII-1, 29 –30) Auch innerhalb der Musik erscheint also wieder die Unterscheidung zwischen dem Rauschhaften, Undifferenzierten, Unartikulierten auf der einen Seite und dem Besonnenen, Individuierten und Artikulierten auf der anderen Seite.
Nietzsches Verständnis der Lyrik geht also davon aus, „dass die Lyrik ebenso abhängig ist vom Geiste der Musik als die Musik selbst, in ihrer völligen Unumschränktheit, das Bild und den Begriff nicht braucht, sondern ihn nur neben sich erträgt.“ (GTIII-1, 47) Die Musik ist demnach von allen Künsten am fernsten der Individuierung und dem Gestaltbilden. Ist sie deshalb die ‚wirklichere Wirklichkeit‘ oder die ‚eigentliche Wahrheit‘, wie Nietzsches Formulierungen an manchen Stellen anzudeuten scheinen, wenn er etwa darauf hinweist, dass gerade die Musik sich symbolisch auf das „Ur-Eine“ und damit auf eine Sphäre „über aller Erscheinung und vor aller Erscheinung“ bezieht (GTIII-1, 47)? Dies würde nur gelten, wenn wir diese Sphäre als die Wahrheit und die Erscheinung (den Bereich der ‚Bilder‘ als individuierter Gestalten) demgegenüber als ‚bloßen Schein‘ und Unwahrheit auffassen müssten.
Wir werden noch näher darauf eingehen, dass dies in Nietzsches Denken keineswegs der Fall ist; aber schon die Bedeutung der Tragödie zeigt, dass der apollinische Schein nicht das Negative ist, das einfach beseitigt werden müsste, damit das Wahre übrig bleibt, denn die Tragödie enthält bekanntlich nicht nur Musik und Lyrik, sondern auch eine zusammenhängende Geschichte, die Bedeutung für das Leben des Publikums beansprucht. Auf dieser Grundlage wird bei Nietzsche die Erscheinung und damit die empirische Welt als Ergebnis einer ordnenden, bildenden, gestaltenden und damit individuierenden – also apollinischen – Leistung auf der Basis des dionysischen Ursprungs in Musik und Lyrik aufgefasst. Die Musik wird dann verstanden als eine symbolische Darstellung des Zustandes, der dieser ordnenden Leistung vorausliegend angenommen werden muss, um überhaupt von einer solchen Leistung sprechen zu können, also als eine Darstellung im Sinne einer Repräsentation oder einer Referenz auf das, was im Reich der Ordnung, der Gestalten und damit der Individuierung anders nicht erscheinen kann.
Wichtiger als die isolierende Auffassung dieser beiden Prinzipien ist jedoch die Möglichkeit einer Vereinigung von Apollinischem und Dionysischem: „Diesen unmittelbaren Kunstzuständen der Natur gegenüber ist jeder Künstler ‚Nachahmer‘, und zwar entweder apollinischer Traumkünstler oder dionysischer Rauschkünstler oder endlich – wie beispielsweise in der griechischen Tragödie – zugleich Rausch- und Traumkünstler.“ (GTIII-1, 26) Damit sind wir offensichtlich bei dem Thema angelangt, das im Titel des Werkes ‚Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik‘ steht. Für Nietzsche war die Tragödie – und zwar speziell die griechische Tragödie und
<–31|
hier wiederum die Werke von Äschylus und Sophokles – deshalb so wichtig, weil er darin eine Vereinigung der beiden Prinzipien des Apollinischen und des Dionysischen sah, d. h. eine Vereinigung des Bildens, des Gestaltens und der Ordnung des Individuierten mit seiner Herkunft.
Wir müssen dazu nicht eine andere Welt des Ungeordneten, Ungestalteten oder ‚Ur-Einen‘ annehmen, welche in der Tragödie zur Sprache kommen könnte. Zur Sprache könnte diese Welt schon deshalb nicht kommen, weil die Sprache die Artikulation in Sätze und Wörter erfordert, also eben jenes individuierende Bilden und Gestalten, das gerade dem Apollinischen zugehört. Wir dürfen uns also das Dionysische nicht als eine Welt vorstellen, die es irgendwo ‚gibt‘ und die dann in die apollinische Welt eingeht, wie das flüssige Glas in der Fabrik in die Form von Champagnerflaschen gebracht wird. Solche Bilder sind für ein philosophisches Verständnis von Nietzsches Schriften in der Regel nur schädlich, obwohl sie auch von ihm selbst bisweilen nahegelegt zu werden scheinen.
Es ist weit angemessener, die Bedeutung der Tragödie für Nietzsche darin zu sehen, dass er in dieser Kunstform das Geschehen der Individuierung, des Gestaltens und Bildens selbst dargestellt und deshalb erscheinend sah. Das entscheidende Element dabei ist eine Besonderheit der griechischen Tragödie, nämlich die Bedeutung des Chores und damit des Lyrischen in der Einheit mit der Musik. Die Bedeutung der Tragödie liegt also vor allem darin, dass in ihr die Musik zu Sprache und Ausdruck wurde, so dass sie etwas zu sagen begann, allerdings nicht so, dass ein sprachlicher Inhalt eine musikalische Untermalung oder Illustration suchte, sondern in dem Sinne, dass die Musik darin aus sich selbst zur Sprache und zum Ausdruck wurde. Zentral für Nietzsches Auffassung ist also, „dass die Tragödie aus dem tragischen Chore entstanden ist und ursprünglich nur Chor und nichts als Chor war: woher wir die Verpflichtung nehmen, diesem tragischen Chore als dem eigentlichen Urdrama ins Herz zu sehen.“ (GTIII-1, 48) Die griechische Tragödie ist also der dionysische Chor, aber nicht in einer isolierten dionysischen Welt, sondern in einer artikulierten Form, indem er „sich immer von neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet.“ (GTIII-1, 58)
Auch der Chor ist demnach keineswegs eine Darstellung oder Erscheinung des Dionysischen – das Dionysische kann nicht erscheinen, weil es nicht artikuliert und gestaltet sein kann ohne die apollinische Individuierung. Aber dieses Verhältnis ist im Chor der griechischen Tragödie dargestellt, während es – so Nietzsches daran anschließende Kritik – in späteren Kunstformen und vor allem in der Form des Wissens, das wir als Wissenschaft kennen, nicht mehr dargestellt werden kann. Damit, so wird die Kritik weiter lauten, handelt es sich um eine abstrakte Form des Wissens und zuvor schon der Kunst, in der das apollinische Ergebnis (die individuierte Gestalt) allein
<–32|
dargestellt werden kann, aber nicht mehr der Prozess, in dem und aus dem diese Gestalt entsteht. Nietzsches Theorie der Tragödie zeigt sich schon hier als Ansatz zu einer ‚grenzbestimmenden‘ Kritik einer bestimmten Form des Wissens, das seinen Ursprung zwar aus der Kunst nahm, aber schon innerhalb der Kunst eine Tendenz zu einem Verdecken dieses Ursprungs selbst enthält. Das Wissen der Wissenschaft und das Vorherrschen der apollinischen Seite in der Kunst hängen demnach eng zusammen.
Die Tragödie ist also keineswegs eine Darstellung des Dionysischen, Rauschhaften, ‚Ungebildeten‘ und Formlosen. Sie erscheint Nietzsche vielmehr als eine „apollinische Versinnlichung dionysischer Erkenntnisse und Wirkungen.“ (GTIII-1, 58) Apollinisch ist in der Tragödie eigentlich nur der Dialog und davon abgeleitet die Handlung. Der Chor dagegen erzeugt die „Vision“ (GTIII-1, 59) und stellt sie dar – während das Bild, das in dieser Vision entsteht, als individuierte Gestalt im Dialog erscheint. Erst damit wird die Vision deutlich, verständlich und schön. Entscheidend für die Bedeutung der Tragödie in Nietzsches Denken ist also nicht, dass in ihr Mythen bzw. mythologische Begebenheiten dargestellt werden, sondern dass durch die Musik und damit durch den Chor der Mythos mit einer neuen Bedeutung interpretiert wird (GTIII-1, 69 –70). Die Interpretation geschieht jedoch nicht durch einen sprachlichen Vorgang, sondern nur durch die Musik, und gerade deshalb kann die Tragödie jenen Bezug zu der Darstellung des Gestaltens und Bildens selbst herstellen, welchen Nietzsche mit der „in einander gewobenen“ (GTIII-1, 78) Dualität des Apollinischen und des Dionysischen beschreibt. Die Tragödie interpretiert also nicht, indem sie in die Sprache übersetzt, sondern indem sie das Sprachliche aus dem Geiste der Musik entstehen lässt.
Dass es gerade die Tragödie ist, in der eine solche Darstellung des dionysisch-apollinischen Grundes der Artikulation in der Kunst entstehen musste, hat jedoch auch einen Grund, der sich auf den Inhalt bezieht. Allerdings weist Nietzsche darauf hin, dass dieser Inhalt in der griechischen Tragödie gerade nicht isoliert von der musikalischen Form verstanden werden kann. Das Tragische ist die Vernichtung des Individuums durch ein Geschehen, das jenseits des Individuums waltet, und das es selbst nur in Gang bringt, nicht aber verursacht. Das Tragische ist deshalb eine Manifestation des Prinzips der Musik im Inhalt der Tragödie:
„erst aus dem Geiste der Musik heraus verstehen wir eine Freude an der Vernichtung des Individuums. Denn an den einzelnen Beispielen einer solchen Vernichtung wird uns nur das ewige Phänomen der dionysischen Kunst deutlich gemacht, die den Willen in seiner Allmacht gleichsam hinter dem principio individuationis, das ewige Leben jenseits aller Erscheinung und trotz aller Vernichtung zum Ausdruck bringt. Die metaphysische Freude am Tragischen ist eine
<–33|
Übersetzung der instinktiv unbewussten dionysischen Weisheit in die Sprache des Bildes: der Held, die höchste Willenserscheinung, wird zu unserer Lust verneint, weil er doch nur Erscheinung ist, und das ewige Leben des Willens durch seine Vernichtung nicht berührt wird.“ (GTIII-1, 104)
Der musikalische Grund der Tragödie setzt sich also durch die Vernichtung des Individuum