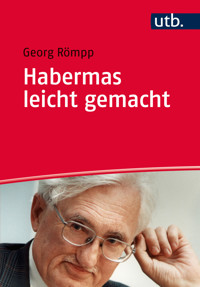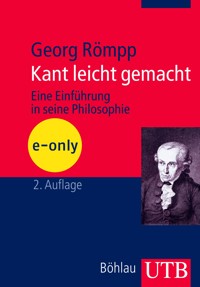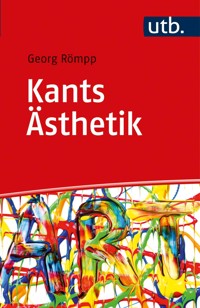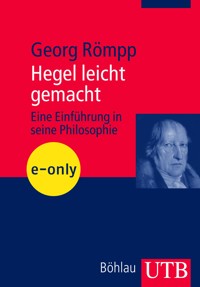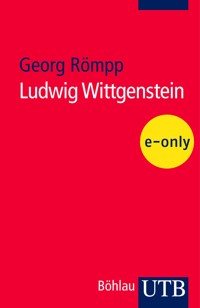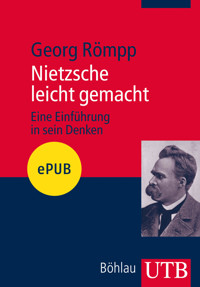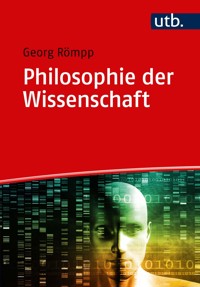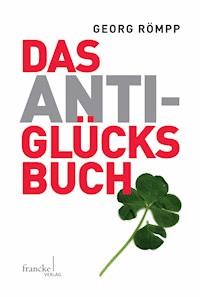24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt eine systematische Einführung in die Philosophie, indem es nicht vorrangig das Denken einzelner Autoren darstellt, sondern in die Problemlage und das gedankliche Zentrum einführt, das die Philosophie heute antreibt und in Atem hält. Somit bringt es auch Lesenden ohne besondere Vorkenntnisse die Grundprobleme der Philosophie näher und regt zum philosophischen Mitdenken an. Dabei behandelt es Denker wie Plato, Descartes, Kant und Wittgenstein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Georg Römpp
Philosophisch denken
Eine Einführung
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN
Dr. Georg Römpp ist Philosoph und Autor zahlreicher Studienbücher zur Philosophie.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb.de
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2023 Böhlau, Lindenstraße 14, D-50674 Köln, ein Imprint der Brill-Gruppe(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei,
Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: agsandrew/Shutterstock.com
Korrektorat: Rainer Landvogt, HanauUmschlaggestaltung: siegel konzeption | gestaltung, StuttgartSatz: büro mn, BielefeldEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage |www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
UTB-Band-Nr. 6017
ISBN 978-3-8252-6017-0
eISBN 978-3-8463-6017-0
Inhaltsverzeichnis
1. Wie man nach der Philosophie fragen kann
1.1 Was ist das – die Philosophie? Und eine Rückfrage
1.2 Philosophie ist, was Philosophen tun?
2. Die Vergangenheit der Gegenwart
2.1 Platons Obsession mit der Richtigkeit der Begriffe
2.2 Descartes’ seltsame Suche nach Gewissheit
2.2.1 Wer braucht so etwas wie Gewissheit?
2.2.2 Zweifeln, und zwar radikal
2.2.3 Der Zweifel, das Zweifeln und ein denkendes Ding
2.2.4 Einfache Verbindungen und das Wissen aus Erfahrung
2.3 Kants Liebe zu den Bedingungen der Möglichkeit
2.3.1 Philosophische Begriffe und ihre Affäre mit dem Erfahrungswissen
2.3.2 Wozu ist die Kausalität als Begriff des Verstandes gut?
2.3.3 Die Philosophie lässt sich von der Wissenschaft scheiden
2.3.4 Eine – welche? – kopernikanische Wende?
3. Der Ursprung der Gegenwart der Philosophie
3.1 Von Begriffen und Wörtern
3.2 Das Meinen in den Begriffen
3.3 Mit Worten einen Unterschied machen
3.4 Der Widerstand der Welt
4. Verständigung und die Bedeutung der Begriffe
4.1 Der Anfang der Philosophie im Akt der Verständigung
4.2 Die Wörter und die Dinge
4.3 Übersetzen und Verstehen
4.4 Identität in Begriffen
4.5 Definitionen und unsere gemeinsame Welt
4.6 Von Bedeutungen und Gegenständen
5. Die Gegenwart der Philosophie und die richtigen Begriffe
5.1 Wie wir über die richtigen Begriffe sprachen und sprechen
5.2 Richten der Begriffe in idealen Gesprächen?
5.3 Die Philosophie vergewissert sich ihrer selbst
5.4 Wissen – direkt, indirekt, reflexiv?
6. Die richtigen Begriffe und die Welt
6.1 Welt, Natur, Wirklichkeit, Objektivität, es gibt und es ist
6.2 Ist es wirklich so?
6.3 Das kleine Wörtlein ‚ich‘ und das Zeugnis der Sinne
6.4 Die Wirklichkeit und ihr Erklären
6.5 Die Wahrheit über die Objekte
6.6 Kennen wir die wirkliche Welt?
7. Ob es eine Sprache der richtigen Begriffe gibt
7.1 Was der Fall ist
7.2 Die Welt aus Tatsachen und ihr Kontext
7.3 Eine Theorie wissenschaftlicher Sätze als Bilder
7.4 Sinnvolle und sinnfreie Sätze
7.5 Wie man Bedeutungen erklärt und was das für Folgen hat
7.6 Denken als Krankheit und die Philosophie als Therapie
8. Die Philosophie und die Gegenwart des Wissens
8.1 Erfahrung, Wissenschaft und unbestimmte Begriffe
8.2 Der Erfolg der Wissenschaft
8.3 Diesseits und jenseits von Grenzen
8.4 Philosophische und wissenschaftliche Gegenstände
8.5 Probleme mit einem universellen Determinismus
8.6 Das Messen und der Erfolg der Physik
8.7 Gründe und Ursachen
9. Der Sinn des Philosophierens
9.1 Kann sich die Philosophie nützlich machen?
9.2 Wie man die Wissenschaft kritisiert
9.3 Argumentieren in der Philosophie
9.4 Wie die Philosophie Begriffe erklärt
9.5 Und was nun?
Literaturhinweise
1.Wie man nach der Philosophie fragen kann
1.1Was ist das – die Philosophie? Und eine Rückfrage
Jeder Philosoph kennt einen schlimmen Albtraum: Jemand fragt ihn unbekümmert und mit fröhlicher Miene, was denn das sei, die Philosophie. Daraus erwacht er schweißgebadet und zitternd, und er findet nur Trost in dem Gedanken, dass so schreckliche Dinge nur im Traum, aber nicht im wirklichen Leben vorkommen. Und doch – sie geschehen. Also was tun?
In anderen akademischen Fächern ist das alles so einfach. Die Medizin erforscht den menschlichen Körper und gibt uns Rat, falls wir lästige Erscheinungen an demselben loswerden und vielleicht sogar noch möglichst lange leben wollen. Die Juristinnen sagen uns, was nicht in den Gesetzen steht, aber trotzdem gilt, wenn wir in rechtliche Beziehungen zu anderen Menschen eintreten. Die Literaturwissenschaftler erzählen uns, was die Schriftstellerinnen wirklich verbrochen haben und was wir angeblich nicht selbst in Romanen und Gedichten lesen können. Musikologen erklären, was die Musik ist, wenn man sie nicht hören, sondern lesen will. Die Ökonominnen lehren – die einen – das Geldverdienen durch die Erzeugung von Nachfrage nach Gütern, die niemand wirklich braucht, und – die anderen – dass die Wirtschaft über die Geldversorgung oder die Preise oder beides oder überhaupt nicht funktioniert. Ach, wir armen Philosophen – wo ist Lob und Preisgesang aus dem von uns vertretenen Reich?
Was tut der Philosoph also, wenn er sich seinen Albträumen stellen will, widerwillig vermutend, dass in ihnen ein berechtigtes Anliegen seinen schreckhaften Ausdruck findet? Er stellt eine Gegenfrage und öffnet so die Büchse der Pandora, aus der nur Unheil kommen kann. Aber ein Philosoph muss tun, was ein Philosoph tun muss, und so beginnt er zu erklären, dass eine solche Frage von der Art ‚Was ist das oder die oder der xyz?‘ doch durchaus nicht selbstverständlich sei. Diese Gegenfrage ist aber durchaus nicht rhetorisch gemeint, sondern gehört in der Gegenwartsphilosophie schon fast zum guten Ton. Dieser Ton herrschte in der Philosophie allerdings nicht immer. Es gab viele Jahrhunderte, in denen Philosophinnen bei allem, was ihnen vor die Flinte kam, ebendiese Frage stellten: ‚Was ist dies?‘ oder ‚Was ist das?‘ und auch noch ‚Was ist jenes?‘ Die Antwort fand sich dann in einer ausgeklügelten und bisweilen sehr komplizierten Definition, also nicht unähnlich dem, was heute in den Naturwissenschaften geschieht, wenn ein für alle Mal und für alle, die sich als der Zunft angehörig ausweisen wollen, festgelegt wird, was man unter ‚Masse‘ oder ‚Blei‘ oder ‚Grottenolm‘ oder ‚ein Grad Celsius‘ oder ‚Elektron‘ oder ‚Anti-Materie‘ oder ‚Gasdichte‘ zu verstehen hat, und auch nicht unähnlich dem, was Juristen heute tun, wenn im Strafgesetzbuch festgelegt wird, was ‚Mord‘, ‚Betrug‘ oder ‚Notwehr‘ heißen soll und woran sich künftig jeder halten muss, der ein gesetzestreues Leben führen will.
Aber das Vorgehen der Philosophen war in jenen dunklen Jahrhunderten auch nicht unähnlich dem, was wir heute im Alltag ganz selbstverständlich tun, wenn wir uns im Gespräch als die besseren oder wenigstens klügeren Zeitgenossinnen darstellen wollen. Wir verwenden dann die Wörter nicht einfach so, wie wir es gelernt haben, sondern belästigen uns selbst und andere mit Fragen wie ‚Was ist Liebe?‘ (statt einfach zu lieben) oder ‚Was ist Hass?‘ (statt einfach herzhaft zu hassen) oder ‚Was ist ein Gesetz?‘ (statt den geltenden Gesetzen treu zu sein) oder ‚Was ist die Welt?‘ (statt einfach in ihr zu leben) oder gar ‚Was ist der Mensch?‘ (statt einfach einer zu sein) oder auch nur ‚Was ist Inkompetenzkompensationskompetenz?‘ (statt einfach vorzugeben, etwas zu können, wovon wir keine Ahnung haben) und vielleicht auch bisweilen ‚Was ist in dieser Flasche?‘ (statt sie einfach zu leeren). Aber halt – die beiden letzten Beispiele passen nicht in diese Reihe. In der vorletzten Was-Frage wird nur nach einer Begriffserklärung gesucht, die uns Dr. Google kostenlos anbieten wird, wenn wir ihm ein gehöriges Maß an Daten überlassen, und im letzten Beispiel erkundigt sich jemand nach der Art des Stoffes, der sich vermutlich an diesem Ort befindet, und mit der Antwort ‚Champagner‘ wird jeder zufrieden sein.
Warum können die anderen Fragen aber so seltsam anmuten und warum nehmen wir bei ihnen den süßen Duft der Philosophie wahr, mehr oder weniger dezent? Warum unterscheiden wir zwischen Fragen, die durch bloße Begriffserklärungen beantwortet werden können, und solchen, bei denen wir zu wissen begehren, ‚was eine Sache ist‘? Bei der drittletzten Frage etwa wird kaum jemandem die Antwort genügen: ‚Was ist der Mensch?‘ – ‚Ach, ein zweibeiniges und ungefiedertes Lebewesen‘, wohl wissend, dass die Zweibeinigen unter dem, was auf diesem Planeten sonst noch so herumläuft, alle gefiedert sind und die Ungefiederten nicht zweibeinig sind. Bereits in der Antike bestand die Antwort darauf aber im kühnen Wurf eines gerupften Huhnes über die Mauer, welche die Gefilde der Philosophen damals von der schnöden Außenwelt abgrenzte. Natürlich hätte man dagegen erwidern können, dass ein Huhn nicht natürlicherweise so herumläuft, weshalb der Einwand nicht gelte.
Diese fiktive Erwiderung und ihr Scheitern geben uns aber doch etwas über Was-ist-Fragen zu denken. Wird in Fragen vom Typ ‚Was ist x oder y oder z?‘ vielleicht das gesucht, was das an der Stelle von x oder y oder z Stehende ‚von Natur aus‘ oder eben ‚natürlicherweise‘ oder ‚wirklich‘ und vielleicht ‚eigentlich‘ oder sogar ‚in Wahrheit‘ ist? Aber das ist doch nicht bei allen Fragen von dieser Art so. Bei der Frage nach der Inkompetenzkompensationskompetenz geben wir uns rasch mit einer Worterklärung zufrieden, wenn wir sie an unser gegebenes Verständnis von der Welt und wie es in ihr zugeht, anschließen können. Mit der Frage nach dem Inhalt einer Flasche erheischen wir ebenfalls nicht eine Auskunft über die ‚Natur‘ der Sache, sondern es geht uns darum, mit der Welt der Dinge möglichst angenehm und nach den Regeln der üblichen Bräuche umgehen zu können, und wenn es zu diesen gehört, den Champagner und andere attraktive Flüssigkeiten in Flaschen zu liefern, dann ist es eben so und damit Schluss.
Was-ist-Fragen dienen uns also in der Regel dazu, mit der Welt und den anderen Menschen einen möglichst problemfreien Umgang pflegen zu können; aber es gibt doch auch solche, bei denen es damit offenbar nicht sein Bewenden haben soll. Warum gibt es die Fragen der zweiten Art? Wieso belasten wir uns mit ihnen, wo es doch schon so schwierig ist, sich in Manhattan auszukennen und in Wahlprogrammen zusammenzuklauben, was die Parteien wirklich wollen, und dann erst der tägliche Umgang mit der Quantenphysik …? Was hatte es in der Philosophie auf sich mit ihnen und warum waren sie viele Jahrhunderte lang so anziehend für Menschen, die für den Kriegsdienst nicht infrage kamen, für das Gewinnen von Reichtümern nicht schlau genug und für die Politik nicht skrupellos genug waren?
Und damit sind wir bei dem Problem, das solche Fragen heute darstellen und mit dem wir einen ersten Hinweis darauf erhalten, wie sich das philosophische Denken der Gegenwart von dem unterscheidet, was jahrhundertelang Philosophie genannt wurde. Es unterscheidet sich auf diese Weise jedoch auch von dem, was im Alltag auch heute ganz selbstverständlich geschieht. Schließlich wacht fast jeder Mensch blinzelnd mit der Frage auf ‚Was ist der Mensch?‘ und schläft abends ein mit einem seufzenden ‚Was ist Wahrheit?‘, und sollte der Tag kommen, an dem er sein Glas versehentlich mit Wasser füllt, so gibt er bereitwillig zu, dass es sich dabei ‚eigentlich‘ um H2O handelt.
Muss es auf solche Fragen tatsächlich eine ganz bestimmte, eindeutige und die Sache ein für alle Mal zu Ende bringende Antwort geben? Oder sind die Antworten situationsbedingt, ohne dass daraus je eine endgültige Bestimmung entwickelt werden könnte, mit der wir Gewissheit und Wahrheit über das erhalten, ‚was etwas wirklich ist‘? Im Falle von Fragen wie ‚Was ist der Staat?‘ oder ‚Was ist die Bundesrepublik Deutschland?‘ oder ‚Was ist der Kokainschmuggel?‘ sieht man in der Regel leicht ein, dass dabei keine Antwort gesucht ist, die erst mit der Bestimmung des ‚Wesens‘, der ‚Natur‘ oder des ‚wirklichen Seins‘ solcher legaler oder illegaler Institutionen in ihr Ziel kommt. Es hat ‚a Gschmäckle‘, wie die Schwaben sagen würden, auf solchen Fragen herumzureiten. Jeder wird zugeben, dass sinnvolle Fragen etwa lauten: ‚Was darf der Staat?‘ oder ‚Wer entscheidet in der Bundesrepublik Deutschland über die Steuerverteilung?‘ oder ‚Wie bekämpft man am besten den Kokainschmuggel?‘
Aber, so lautet ein naheliegender Einwand, um fragen zu können, was der Staat darf, muss man doch erst wissen, was sein Wesen ist, und um die Entscheidungszentren der Steuerverteilung in der Bundesrepublik zu bestimmen, muss man doch die ‚Natur‘ dieses Staates kennen, und um den Kokainschmuggel erfolgreich bekämpfen zu können, sollte man doch besser genau wissen, was er ‚ist‘. Wirklich? In der Wirklichkeit stellen sich solch allgemeine Fragen wie danach, was der Staat darf, nur in Philosophiekursen der höheren Klassen der Gymnasien, und dort konkretisieren sie sich bald auf die besseren Fragen, wie etwa danach, wie weit der Staat die Grenzen des Körpers und seiner Freiheit verletzen und etwa eine Pflicht zu bestimmten Impfungen anordnen darf, um die Freiheit des einen mit der Freiheit des anderen in ein begründbares Verhältnis zu bringen. Wer in der Bundesrepublik über die Steuerverteilung entscheidet, ist eine empirische Frage, die durch die eingehende Lektüre der Verfassung und deren ausgestaltender Gesetze beantwortet werden kann. Und der Kokainschmuggel kann sehr effektiv bekämpft werden, wenn man nur die tatsächlichen Strukturen der Käufer-Verkäufer-Beziehungen verfolgt.
Versuchen wir aber noch einmal, Was-ist-Fragen zu beantworten. Was ist Geschichte (d. h. die historische Wissenschaft)? Was ist Physik? Was ist Politik? Was ist eine Katze? Was ist ein Elektron? Was ist die Zeit? Warum können wir ‚Was ist …‘-Fragen im Falle der Katze und des Elektrons ziemlich leicht beantworten, aber die anderen Beispielfragen nur mit vielen Worten und dann auch nicht präzise? Was tun wir, wenn wir jemandem, der die deutsche Sprache beherrscht, aber nicht weiß, was eine Katze und was ein Elektron ist, eine Erklärung geben sollen? Vielleicht versuchen wir es so: Eine Katze ist ein Tier mit Pelz, das den ganzen Tag schläft und isst und bei richtiger Behandlung schnurrt. Ein Elektron ist ein Elementarteilchen mit negativer Ladung. Alles ganz einfach also.
Aber was tun wir dabei? Wir nehmen einen übergeordneten Begriff (Tier, Elementarteilchen) und stellen den zu erklärenden Begriff in ihn ein (eine Katze ist ein Tier, ein Elektron ist ein Elementarteilchen). Zusätzlich grenzen wir den zu erklärenden Begriff aber von dem übergeordneten Begriff ab (eine Katze ist ein Tier mit Pelz – nicht alle Tiere tragen einen Pelz, eine Katze ist ein Tier, das den ganzen Tag schläft und isst – nicht alle Tiere verbringen so ihre Tage; ein Elektron ist ein Elementarteilchen mit negativer Ladung – nicht alle Elementarteilchen sind negativ geladen). Um es vornehm auszudrücken: Definitio fit per genus proximum et differentia specifica, oder weniger vornehm gesagt: Man definiert, indem man die Gattung (eine ‚höhere‘ Art) angibt und zusätzlich eine oder mehrere Eigenschaften, durch die sich genau diese Art, die wir definieren wollen, von anderen Arten unterscheidet, die derselben Gattung angehören. Katzen sind Tiere, aber es gibt auch Tiere, die keine Katzen sind, also müssen wir angeben, wodurch Katzen sich von anderen Tieren unterscheiden, und wir nehmen jetzt einfach an, dass sie das tun, weil sie einen Pelz tragen und den ganzen Tag schlafen und essen. Zoologisch ist das wohl nicht ganz korrekt, aber zu Illustrationszwecken reicht es. Elektronen sind Elementarteilchen, aber die Quantenphysik kennt inzwischen einen ganzen ‚Zoo‘ von Elementarteilchen, also müssen wir angeben, wodurch sich Elektronen von anderen Elementarteilchen unterscheiden, und wir nehmen jetzt einfach an, dass sie das tun, indem und weil sie negativ geladen sind.
‚Was ist …‘-Fragen können wir offenbar ziemlich leicht beantworten, wenn wir dieses Schema anwenden: Wir geben die Gattung (die höhere Art) an und zusätzlich die Unterscheidung von anderen Arten in dieser Gattung. Genauso ist es. Leider gibt es ein kleines Problem. Das haben die scharfsinnigen Lesenden natürlich bereits bemerkt. Die nächsthöhere Gattung für Katzen ist natürlich nicht Tier, und möglicherweise ist die nächsthöhere Gattung für Elektron auch nicht ‚Elementarteilchen‘. Lassen wir das letztere Problem beiseite und konzentrieren uns auf Katzen. Die nächsthöhere Gattung wäre natürlich ‚Feliden‘, wenn wir uns mit dem Ausdruck Katze auf Hauskatzen beziehen, wie wir das in der Regel tun. Und dann geht es weiter über mehrere Zwischenstufen, bis endlich ‚Tier‘ erreicht wird. Also müssten wir für eine Definition zur Beantwortung von ‚Was ist …‘-Fragen im Prinzip ohne Ende weiter Art-Gattungs-Verhältnisse angeben, damit wir irgendwann wissen, was eine Sache in Wahrheit ist?
Warum in aller Welt weiß der Mensch mit relativ guten Deutschkenntnissen, der den Ausdruck ‚Katze‘ nicht kannte, mit einer solchen Erklärung aber nun plötzlich sehr gut, was eine Katze ist, obwohl wir nur eine Abgrenzung innerhalb der Gattung ‚Tier‘ vorgenommen haben? Vermutlich ist die Antwort die: Ob eine Einteilung aufschlussreich ist, so dass die Hörerin dann weiß, worum es geht (also weiß, dass ‚Katze‘ sich auf jene Lebewesen bezieht, von denen etwa die Katze Lucy ein Exemplar ist), hängt vom Vorwissen der Hörerin ab. Wer mit unserer Antwort auf die Frage nach dem, was Katzen sind, zufrieden ist, muss mit dem Ausdruck ‚Feliden‘ vertraut sein; darüber hinaus aber muss er schließlich mit dem Begriff ‚Tier‘ etwas anfangen können, sonst geraten wir als Erklärende in ‚dire straits‘ – in immer weitere Kalamitäten. Aber die Hörerin muss auch akzeptieren können, dass man eben auf diese Weise definiert und erklärt, und das ist uns zwar selbstverständlich, aber es versteht sich keineswegs ‚von selbst‘, sondern wir haben es in einem langen Prozess gelernt und sind darin eingeübt.
Aber was Geschichte, Politik, die Zeit oder eben auch die Philosophie ist, das lässt sich nicht ganz so leicht in ein Vorverständnis einordnen. Ähnlich verhält es sich mit den immer wieder in Mode kommenden Fragen wie ‚Was ist Geist?‘ oder ‚Was ist der Mensch?‘ oder auch ‚Haben wir einen freien Willen?‘ Alle Diskussionen zu diesen Fragen kranken an der mangelnden Reflexion auf das, was in ihnen bereits vorausgesetzt wird, also auf das, was in ihnen als entschieden und gültig angenommen wird, um sie überhaupt stellen zu können. Vorausgesetzt und als gültig unterstellt wird etwa Folgendes: Fragen in der Form ‚was ist …‘ sind sinnvoll ebenso wie Feststellungen in der Form ‚… ist …‘. Jenes ‚Haben‘ setzt die Gültigkeit der Ansetzung eines ‚Wir‘ als Substanz und einer Akzidenz als Eigenschaft, die ihr in der Form des ‚Habens‘ zugeschrieben wird, voraus. Außerdem müssen natürlich Ausdrücke wie ‚Geist‘, ‚Mensch‘ und ‚freier Wille‘ in dem Sinne als bekannt vorausgesetzt werden, dass wir über eine vorgängige Vertrautheit mit diesen zu thematisierenden Gegenständen verfügen, so dass überhaupt die Ausdrücke auf ‚etwas‘ Bezug nehmen können, das ‚es gibt‘, obwohl eine solche Form der Feststellung nicht weniger Fragen aufwirft wie jenes ‚ist‘ in Fragen von der Form ‚Was ist …?‘
Unser erstes Fazit könnte also lauten: Meistens zeigt sich bei ‚Was ist …?‘-Fragen, dass sie eigentlich überhaupt nicht so gemeint sind, wie sie lange Zeit in der Philosophie verwendet wurden. Wir geben uns durchaus mit situationsbedingten Antworten zufrieden, die sich an einem bestimmten Problem ausrichten oder sich an ein spezielles Publikum wenden oder uns einfach das Weiterarbeiten an den Aufgaben ermöglichen, mit denen wir eben gerade beschäftigt sind. Und doch suchen wir bei bestimmten Fragen immer wieder nach Antworten, die uns ‚das Wesen‘ oder ‚die Natur‘ der Sache angeben oder das, was sie ‚wirklich‘ oder ‚eigentlich‘ ist, oder sogar einfach, was etwas ‚ist‘, ohne dass wir dieses ‚ist‘ durch ein Prädikat näher ergänzen, wie wir das in der Regel tun, wenn wir fragen, ob der Kaffee heiß oder der Himmel blau ‚ist‘. Fragen wie ‚Was ist der Mensch?‘ oder ‚Was ist Wahrheit?‘ oder ‚Was ist das, die Philosophie?‘ scheinen dazu zu gehören, aber wir neigen dazu, auch Fragen, was ‚Wasser‘ denn ‚eigentlich‘ ist, in dieser Form zu stellen, und sind dann oft mit der Antwort ‚H2O‘ zufrieden, obwohl wir damit doch nur eine chemische Formel mit der Auskunft über die molekulare Zusammensetzung von Wasser erhalten.
Was tun wir also nun mit der Frage nach dem, was das philosophische Denken ist? Suchen wir eine Antwort, die uns in einer gegebenen Fragesituation weiterhilft, weil sie der Gesprächspartnerin einleuchtet, so dass sie uns nicht weiter mit Rückfragen löchert, oder beantworten wir sie, indem wir das ‚Wesen‘ der Philosophie angeben oder das, was sie ‚eigentlich‘ oder ‚in Wahrheit‘ ist, oder indem wir sogar ihre ‚Natur‘ zum Ausdruck bringen? Oder können wir einen Zusammenhang von Art-Gattungs-Beziehungen finden, in den wir ‚our craft or sullen art‘ – wie Dylan Thomas die Poeterei bezeichnete – zur Zufriedenheit aller einordnen? Wie weit müssen wir dann gehen? Müssten wir in diesem Fall nicht bereit sein, ein alle Begriffe umfassendes ‚Begriffsschema‘ aufzustellen, weil nur durch einen universell umfassenden Kontext und Zusammenhang ein einzelner Begriff seine präzise Stellung erhalten könnte? Gibt es ein solches Schema und, wenn ja, wer hat die Zeit und die Lust zu einem solchen Spiel des Platzierens von Begriffen?
1.2Philosophie ist, was Philosophen tun?
Aber ist das, was das philosophische Denken der Gegenwart umtreibt, denn tatsächlich so, dass man von ihm nicht mehr sagen kann, was es ist? Nun, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, und schließlich stellen wir auch im Alltag ‚Was ist …‘-Fragen und kommen zu befriedigenden Antworten, ohne endlos weiter fragen zu müssen. So ist es wohl auch mit Fragen nach dem, was die Philosophie denn ist. Und eine in vielen populären und weniger populären Büchern praktizierte Methode besteht darin, Geschichten von der Geschichte der Philosophie zu erzählen. Das Prinzip eines solchen Vorgehens ist sehr einfach: Philosophie ist, was Philosophen tun. Das ist eine einfache Definition. Sie entspricht dem, was in anderen Wissenschaften üblich ist, etwa in der Nationalökonomie: Economics is, what economists do. Gelegentlich kommt es allerdings vor, dass jemand zurückfragt, woher man denn wisse, dass das, was jemand tut, tatsächlich das Tun einer Philosophin ist, wenn man noch nicht weiß, was Philosophie ist. Dieser Jemand möchte also das Tun des ‚richtigen‘ Philosophen von dem unterscheiden, was eine andere tut, die sich zwar als Philosophin ausgibt, aber nicht der ‚Richtigkeit‘ des Seins eines Philosophen entspricht.
Man könnte dagegen aber einwenden, dass es sich immerhin um eine ‚historische‘ Definition handelt, denn sie gibt an, was Menschen getan haben, die sich in den letzten etwa 2300 bis 2500 Jahren als Philosophen bezeichneten. Und damit ist sogar etwas Richtiges getroffen. Aber das gilt natürlich nur, wenn man schon bereit ist, auf eine ‚sachliche‘ oder ‚sachangemessene‘ Antwort auf die Frage nach dem, was Philosophie ist, zu verzichten. Ist man dazu bereit? Ja? Oder doch besser nein? Das ist eine folgenschwere Entscheidung. Denn: Wenn ja, dann muss alles, was je als Philosophie bezeichnet wurde, auch tatsächlich als Philosophie gelten. Folgenschwer ist diese Wahl, weil man sich damit alle Möglichkeiten nimmt, gegen zumindest einige der Bemerkungen von sich als Philosophen bezeichnenden Menschen einzuwenden: ‚Aber das kann doch nicht wirklich Philosophie sein!‘ oder schlicht: ‚Aber das ist doch purer Unsinn!‘ Mit anderen Worten: Man nimmt sich dann alle Möglichkeit zur Kritik der Philosophie oder der verschiedenen Philosophien auf der Grundlage eines besseren Wissens.
Eventuell könnte man nun geographische oder zeitliche oder sprachliche oder auch andere Beschränkungen heranziehen, um ‚wirkliche‘ Philosophie von ‚nicht wirklicher‘ Philosophie zu unterscheiden. Dann müsste man vielleicht sagen: Alles, was in Europa als Philosophie bezeichnet wurde, ist eben Philosophie. Gehört dann die angelsächsische Philosophie dazu? Oder nur die britische, aber nicht die amerikanische, wenn man das große Britannien denn als zu Europa gehörig zu akzeptieren geneigt ist, was bei den Vereinigten Staaten nicht mehr gelten kann? Oder man könnte behaupten, dass alles, was ab 1781 unter dem Titel Philosophie veröffentlicht wurde, als Philosophie zu gelten hat, und alles zuvor aber nicht. Warum 1781? Weil das das Erscheinungsdatum der ersten Auflage von Kants ‚Kritik der reinen Vernunft‘ war, und die meisten Philosophen würden heute wohl zugeben, dass damit ein Buch erschienen war, das die gesamte folgende Philosophie beeinflusste, ob man nun zustimmte, kritisierte oder es rundweg ablehnen wollte. Aber dieses Buch antwortete auf zahlreiche Probleme, die zuvor unter der Bezeichnung der Philosophie aufgeworfen worden waren. Waren das keine Philosophen? Und schließlich könnte man noch vorschlagen, dass alles, was sich in deutscher, englischer und französischer Sprache als Philosophie bezeichnete, eben als Philosophie zu gelten hat. Dann würde Altgriechisch wohl wegfallen und damit Platon und Aristoteles und noch einige andere. Es sieht so aus, als fiele man bei solchen Versuchen, eine ‚historische‘ Definition durch eine ‚geographische‘ oder ‚sprachliche‘ zu ersetzen, von einer Schwierigkeit in die nächste.
Auf die einfache Abkürzung gebracht, scheint es sich mit der Philosophie nun so zu verhalten. ‚Der Champagner ist kalt‘ – ein normaler Mensch, den man in der Philosophie gerne als ‚das natürliche Bewusstsein‘ bezeichnet, geht mit diesem Satz im Sinne der gegebenen Information um. Was tut er damit? Er entnimmt die Kunde, dass sein Lieblingsgetränk kalt ist. Und dann trinkt er. Was tut aber die Philosophin damit? Natürlich ist die Philosophin zumindest gelegentlich auch Mensch, und dann tut sie genau das Gleiche wie der ‚normale Mensch‘ oder das ‚natürliche Bewusstsein‘: Sie trinkt. Aber was tut sie ‚als Philosophin‘? Sie wundert sich über das ‚ist‘ in jenem Satz. Schnell lernt sie, dass es in diesem Zusammenhang als ‚Kopula‘ bezeichnet wird, obwohl es auch andere Bedeutungen haben kann. Es verbindet also ein Substantiv, das in der Regel für einen Gegenstand in der Welt steht, mit einem Adjektiv so, dass das Letztere zu einer Eigenschaft des Ersteren erklärt wird und eine Prädikation entsteht.
Aber damit wird auch eine Behauptung aufgestellt und ein Geltungsanspruch erhoben: Es soll wirklich so sein – der Champagner soll nicht warm oder lau sein, sondern er soll genau das eine sein: kalt. Aber in einer unvollkommenen Welt wie der unseren ist bekanntlich der Champagner nicht immer kalt. Also hängt es von den Umständen ab, dass ein solcher Geltungsanspruch zu Recht erhoben wird, weil es nur unter bestimmten Umständen wirklich so ist, wie im Satz behauptet wird. In anderen Umständen ist der Champagner aber nicht kalt, und der Geltungsanspruch in diesem Satz wird nicht zu Recht erhoben, anders gesagt: Er kann nicht eingelöst werden. Das lässt sich auch so ausdrücken: Dieser Satz kann wahr oder falsch sein. Er ist wahr, wenn der Champagner kalt ist, und er ist falsch, wenn er sich nicht in diesem glücklichen Zustand befindet. Und auch wenn wir eine historische Definition der Philosophie geben und Geschichten über ihre Geschichte erzählen, dann soll das doch alles wahr sein in dem Sinn, dass die Geschichten ‚wirklich‘ von der Philosophie und nicht von der Kunst des Körbeflechtens handeln. Darüber lässt sich aber doch nur entscheiden, wenn wir schon wissen, ‚was‘ die Philosophie ist. Also ‚back to square one‘?
Nun haben wir also versucht, uns vor einer Antwort auf die Frage nach dem, was Philosophie ist, zu drücken, indem wir die Form einer solchen ‚Was ist …?‘-Frage zum Problem gemacht haben, und wir haben festgestellt, dass eine historische Definition, die einfach davon ausgeht, dass Philosophie ist, was Philosophen tun, in unlösbare Schwierigkeiten führt, mit denen wir zur ‚Was ist Philosophie?‘-Frage zurückkehren müssten, um von da aus wieder mit einer historischen Definition zu beginnen, usw. usw. bis zum Ende aller Zeiten. Jeder gewitzte Mensch sieht natürlich sofort, wo der Ausweg aus dieser Misere zu finden ist. Wir machen einfach die Problematik von ‚Was ist …‘-Fragen zum Thema und suchen ihre Grundlage dort, wo sie historisch zum ersten Mal aufgetaucht sind. Zufällig ist das auch der Anfang dessen, was heute Philosophie heißen kann. Aber noch wichtiger ist, dass wir auf diese Weise und an diesem historischen Anfangspunkt auf den Gedankengang stoßen, der Antworten auf ‚Was ist …‘-Fragen zu einer Notwendigkeit und einer Bedingung dafür entwickelte, dass wir die Welt verstehen können.
Und wir geraten damit an die Gedanken, von denen sich das ‚Ideen-Gestirn‘, um das sich die Philosophie der Gegenwart dreht, gerade absetzen und unterscheiden will. Das Denken ist nie unabhängig von dem, wogegen es sich kritisch wendet. Insofern werden wir mit dem problembeladenen Ausgang von Was-ist-Fragen auch etwas über das Denken erfahren, das die Philosophie heute umtreibt. Natürlich beginnt die Gegenwartsphilosophie nicht mit Platon, außer in dem Sinn, dass sie aus der Auseinandersetzung mit der langen, sehr langen Nachwirkung seines Denkens hervorgegangen ist. Es wird sich zeigen, dass es noch eine entscheidende und heute noch nachwirkende Wendung gab, in der versucht wurde, die platonische ‚Was ist …‘-Frage mit den gedanklichen Mitteln einer ‚Subjekt-Philosophie‘ zu bearbeiten. Erst in der Kritik an dieser Wendung entstand schließlich in den zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts der lose Gedankenzusammenhang, der sich als das bewegende Kraftzentrum des philosophischen Denkens in seiner Gegenwart auffassen lässt. Das ist aber leichter zu verstehen, wenn wir das, was jetzt zu Platon folgt, nicht als eine Geschichte über die Geschichte der Philosophie verstehen.
2.Die Vergangenheit der Gegenwart
2.1Platons Obsession mit der Richtigkeit der Begriffe
Am Ursprung des philosophischen Denkens findet sich Platons Besessenheit von der Frage nach der Richtigkeit unserer Begriffe. Auf den ersten Blick erscheint sie auch heute noch plausibel. Wenn wir nicht wissen, was ‚das Gute‘ ist, wie sollen wir dann richtig urteilen, ob eine Handlung, eine Feststellung oder ein von Menschen gemachtes Werk gut ist? Wie sollen wir eine gesetzliche Regelung des Zusammenlebens unter Menschen als gut (oder nicht gut) bezeichnen? Und wenn wir nicht wissen, was eine Katze ist, wie sollen wir dann richtig urteilen können ‚das ist eine Katze‘, wenn wir eine sehen? Und können wir überhaupt sicher sein, dass wir eine Katze wahrnehmen, wenn wir nicht den richtigen Begriff davon haben, was eine Katze ist? In solchen Fragen hallt nach mehr als 2000 Jahren noch das platonische Denken nach. Von selbst versteht sich diese Auffassung von den Funktionsbedingungen unseres Denkens und Urteilens durchaus nicht. Schließlich sagen uns die Dinge der Welt – ob lebendig oder unbelebt – nicht, was sie sind. Steine, Pflanzen, Planeten, Elektronen und all das andere, das so in der Welt herumliegt, haben schlicht keine Fähigkeit, uns auf irgendeine Weise Auskunft über das zu geben, was sie sind. Und auch die intelligentesten Tiere wie Katzen, Delphine, Ratten, Raben und Schweine wurden noch nie bei Erklärungen über ihre richtigen Begriffe beobachtet. Einzig Papageien kann man mit einiger Mühe die Äußerung beibringen ‚ich bin ein Papagei‘, aber dieses Tier ahmt dann ganz offenbar nur das nach, was ihm Menschen einige tausend Male vorgesagt haben, und versteht durchaus nicht, was es sagt.
Aber Platons Vorstellung war, dass es für Menschen möglich sein muss, die richtigen Begriffe zu kennen und damit richtig zu bestimmen, wie alles Vorkommende sprachlich zu bezeichnen ist. Das Ergebnis dieser Besessenheit von den richtigen Begriffen war die Lehre von den ‚Ideen‘. Deren Grundgedanke war, dass es feststehende und eindeutig bestimmte Begriffe von allem, was wir bezeichnen wollen, geben muss, weil wir andernfalls nie wissen können, ob dieses Bezeichnen richtig geschieht oder vielleicht mit Irrtümern behaftet ist, so dass wir eine Gesetzesvorschrift ‚gut‘ nennen, die vielleicht nach dem richtigen Begriff von ‚gut‘, den wir in ‚dem Guten‘ angeben, überhaupt nicht gut ist. Die richtige Einsicht dahinter war, dass wir nie wissen können, ob unsere Begriffe tatsächlich richtig sind, was uns die Möglichkeit eröffnet, alle unsere Feststellungen für kritische Fragen offenzuhalten. Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz als ‚gut‘ erachtet, so können Bürger immer darauf bestehen, dass es keineswegs gut ist oder vielleicht sogar rundweg schlecht ist, auch wenn sie sich aufgrund der Durchsetzungsmacht gesetzlicher Regelungen daran halten müssen. Richtig an Platons ursprünglicher Einsicht war also deren Bezug auf die Freiheit, die wir gewinnen, wenn wir nicht so genau wissen, wann die Begriffe richtig sind und wann nicht.
Falsch war offenbar aber Platons Kritik an dieser Freiheit. Es ist wichtig zum Verständnis des Ursprungs des philosophischen Denkens, das erst im 19. und 20. Jahrhundert einer Kritik unterzogen wurde, die schließlich zur Philosophie der Gegenwart führte, zu wissen, was Platon jener Freiheit entgegenzusetzen hatte. Für uns zeigt sich in der Möglichkeit, die Begriffe anders zu gebrauchen, als es die Gesetzgeber und andere zentrale Begriffe bestimmende Instanzen für richtig halten, die Fähigkeit zur Kritik an allem, was eben für richtig gehalten wird. Platons Antwort darauf wäre etwa so: Aber eine solche Kritik ist ohne Grund, wenn sie nicht beansprucht, die Begriffe richtiger zu gebrauchen als die zu kritisierenden faktischen Gesetzgeber der Begriffe; die richtige Bestimmung der Begriffe ist also gerade die Voraussetzung der Möglichkeit zu einer trefflichen Kritik, die sonst kein Fundament in dem haben kann, was die Sache – wie Gesetze rechtlicher oder wissenschaftlicher Art oder Feststellungen über das, was gut, wahr oder schön ist – selbst ist. Und genauso denken wir heute noch in weitem Ausmaß in unseren alltäglichen Kritikbemühungen, wenn wir darauf verweisen, dass ‚die Sache‘ sich doch ‚in Wahrheit‘ und ‚eigentlich‘ ganz anders darstellt. Wie hätte Platon also ein kritisches Denken ohne eine Grundlage in den richtigen Begriffen der Dinge gesehen? Vermutlich so: Ohne die richtigen Begriffe ist alles Diskutieren und sind alle Diskurse nur eitler Tand, keiner weiß recht über die Sache Bescheid, aber jeder gibt seine bloße Meinung zum Besten, alles ist nur ein bloßes Gerede aus Vorurteilen und kann nie zu einem in der Sache begründeten Ergebnis kommen.
Und ebenso denken wir regelmäßig in politischen, moralischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Im Alltag sind und bleiben wir wohl noch lange Platonisten. Aber Platons Grundlegung der richtigen Begriffe in Gestalt einer ‚Ideenlehre‘ ist in einer langen Geschichte der Kritik an ihr selbst in der Philosophie höchst zweifelhaft geworden. Das beruht vor allem auf einer anderen Sicht auf die Grundlagen kritischer Diskurse. Diese Sicht entstand aus dem Zweifel daran, dass die platonistische Forderung nach der Sache nach richtigen Begriffen als Bedingung der Möglichkeit des Streites um die richtigen Gesetze, über die richtige Moral, das gesellschaftlich Richtige und um die richtige Normierung des Wissens in der Wissenschaft tatsächlich sinnvoll und notwendig ist. Die Alternative ist keineswegs die Beliebigkeit des Meinens und des Vorurteils im pejorativen Sinn.
Der Zweifel entstand aber auch aus der nüchternen Einsicht, dass niemand so genau wissen kann, wie die ‚Ideen‘ der Dinge denn bestimmt zu denken sind. Platon war so klug, sie in eine Dimension jenseits der Welt des Halbwissens, der Vorurteile und der Meinungen zu verlegen, von der die Menschen im Diesseits nur im Ungefähren wissen können. Aber der Preis dafür war hoch, denn welchen Nutzen können sie dann für uns Sterbliche unter der Sonne aufweisen? Über die Zusammenhänge zwischen dem Jenseits der Ideen und dem Diesseits des Zanks über die richtigen Begriffe blieb er sehr vage. Ein Versuch war die Lehre von angeborenen Wahrheiten, die er mithilfe der geistigen ‚Hebammenkunst‘ zu begründen versuchte; bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass Platons Stimme Sokrates dem Sklaven, der eine geometrische Aufgabe vermeintlich ‚von selbst‘ lösen konnte, alle Schritte suggeriert hatte. Ein anderer Versuch war der Verweis auf ausgezeichnete Erfahrungen, in denen wir die Ideen von selbst ‚schauen‘ können, wie etwa in der Schönheit, die Platon allerdings nicht in der Kunst am Werke sah.
Aber worauf können wir uns dann in kritischen Diskursen berufen? Platons Paradigma war das Bestehen eines maßgebenden Urbildes der richtigen Begriffe in der Wirklichkeit selbst, zu deren Erkenntnis sie uns anleiten, so dass wir eine Vorstellung davon haben, was es heißt, richtig zu denken. Dieses Muster beherrschte das Denken bis weit in die Neuzeit hinein, und es ist heute noch leitend für das Selbstverständnis in lebensweltlichen ebenso wie in wissenschaftlichen Diskursen. Für die Philosophie lässt sich das Ende dieses Denkens und der Übergang zu einem ganz anderen Verständnis von ‚Richtigkeit‘ in der Verwendung von Begriffen und im Formulieren von Feststellungen über die Welt und über die Lebewesen, die ein solches Formulieren beherrschen, relativ präzise bestimmen. Und dieser Übergang ist mit einem einzigen Namen verbunden: René Descartes.
2.2Descartes’ seltsame Suche nach Gewissheit
2.2.1Wer braucht so etwas wie Gewissheit?
Hier stoßen wir wieder auf die seltsame Erscheinung, dass das philosophische Denken von ganz wenigen Personen geprägt wurde. Im 17. Jahrhundert war es Descartes, der mit einer einfachen Frage so etwas wie eine philosophische Revolution ins Rollen brachte. Es war die Frage nach der Gewissheit: Wie und wo finden wir absolute Gewissheit? Wir sollten die Sonderlichkeit – oder vielleicht sogar Absonderlichkeit – dieser Frage nicht außer Acht lassen, wenn nach dem gesucht wird, was Philosophie heute ist. Denn wer sucht nach einer ‚absoluten‘ Gewissheit, also einer solchen, an der niemand mehr Zweifel anbringen kann? Wer außer René Descartes? Es gibt eine Antwort darauf, aber es ist eine historische und eine psychologische: Es war der religiöse Mensch, der in Furcht und Zittern vor seinem absoluten Herrn lebte und dringlich die Gewissheit darüber brauchte, wie er die Gnade dieses Herrn erlangen könne. Von dieser Gnade sah er zwar nicht das Glück seines irdischen Lebens, aber das seines ganzen zukünftigen und unendlichen Lebens abhängig. Sollte er hier einen Fehler machen, so würde sich das auf seine eigene Ewigkeit auswirken, es konnte geradezu den Unterschied zwischen ewiger Seligkeit in Gemeinschaft mit den Heiligen und immerwährender Verdammnis mit Höllenqualen bedeuten. Man kann sich vorstellen, dass ein Mensch, der sich im Angesicht der Ewigkeit von der Gnade eines Gottes abhängig sah, nach nichts mehr strebte als nach einer solchen Gewissheit.
Was spricht gegen eine solche Antwort? Zunächst natürlich die historisch-psychologischen Grundlagen. Hier stellt sich sofort die Frage, ob es ausreichend ist, die Motive, die wir heute in der die Historie machenden Rückschau und psychologisierend annehmen, als tatsächlich ausreichende Gründe für eine solche Suche nach Gewissheit aufzufassen. Wir ‚retrojizieren‘ womöglich die Vorstellungen, zu denen wir in der Zwischenzeit gekommen sind, in die Zeit von Descartes und seinen Nachfolgern, die in seinem zentralen Gedanken einen Ansatzpunkt sahen, um die am Ende seines Zweifels gefundene unbezweifelbare Gewissheit zu einem eigenständigen Wissen der Philosophie auszugestalten. Auch hier liegt es wieder nahe, zu nahe, psychologisch zu denken: Ebendiese Eigenständigkeit war durch die Wissensansprüche der entstehenden und immer erfolgreicheren empirischen Naturwissenschaft in Gefahr geraten. Mussten die Philosophen also schnellstmöglich nach einer unbezweifelbaren Basis für ihr Denken suchen, um nicht von der unliebsamen Konkurrenz überrollt zu werden?
Es ist deutlich, dass solche Vorstellungen über Zusammenhänge zwischen der Begründung der Philosophie in einer unbezweifelbaren Gewissheit und dem religiösen Bewusstsein sowie über die Wissenskonkurrenz der Philosophie mit den empirischen Naturwissenschaften eigentlich unphilosophische Vorstellungen sind. Wir müssen uns damit nicht befassen. Es genügt für die Frage nach dem, was das philosophische Denken in seiner Gegenwart ist, die Seltsamkeit einer solchen Suche nach absoluter Gewissheit festzustellen und deren Notwendigkeit nicht vorschnell als gewiss anzusehen.
Es ist seltsam und nicht selbstverständlich, dass im 17. Jahrhundert nach vielen Jahrhunderten ohne große Fortschritte im Denken eine Art Revolution gerade durch diese Frage und ihre radikale Bearbeitung durch René Descartes zustande kam. Wer um Himmels willen sucht im Alltagsleben nach absoluter Gewissheit? Hat man nicht stets genug zu tun mit dem, was unter dem Anspruch einer relativen und zeitlich begrenzten Gewissheit geschieht? Muss man absolut gewiss sein, dass der Champagner kalt ist, wenn der Butler dies versichert, und darf der Chirurg einen Bypass nur dann legen, wenn er absolut gewiss über dessen segensreiche Wirkung ist, und darf der Gesetzgeber einen Mindestlohn nur dann festsetzen, wenn er absolut gewiss ist, dass damit kein einziger Arbeitsplatz abgebaut wird?
Eine verlässliche Gewissheit ist in vielen Angelegenheiten zwar ein verständlicher Wunsch, aber muss diese Gewissheit gleich in etwas Unbezweifelbarem gründen? Eine der wichtigsten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit ist der demokratische Rechtsstaat – ist er aber in Gefahr, wenn man das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens nicht mit absoluter Gewissheit voraussehen kann? Würde es überhaupt gerichtliche Streitbeilegung geben, wenn deren Resultat bereits absolut gewiss wäre? Niemand würde dann sein Recht mehr gerichtlich suchen. Gäbe es noch Strafprozesse oder könnte jeder dann den Schuldspruch und das Strafmaß mit absoluter Gewissheit a priori erkennen? Macht es die evidenzbasierte Medizin schlechter, wenn es keine absolute Gewissheit für den Einzelnen gibt, dass die geprüfte Wirkung auch bei ihm nach Vorschrift eintritt? Was würde aus unseren Liebesverhältnissen, wenn wir Fragen vom Typ ‚Aber liebst du mich denn auch wirklich?‘ oder ‚Bin ich denn auch ganz gewiss dein Traummann?‘ tatsächlich im Sinne absoluter Gewissheit stellen und beantworten wollten? Würden unsere moralischen Urteile nicht noch gnadenloser werden, wenn wir sie auch noch mit dem Bewusstsein der absoluten Gewissheit fällen würden statt mit der Einsicht in unsere eigene Fehlbarkeit, an der wir es schon viel zu oft fehlen lassen?
Wir müssen uns also nur die Folgen eines solchen Bewusstseins von Gewissheit für das Zusammenleben der Menschen ausmalen, um zu sehen, dass die Suche nach Gewissheit nicht nur ein nicht ganz naheliegendes Unterfangen ist, sondern dass ihr Erfolg das Leben der Menschen auf diesem Planeten fundamental verändern würde, und durchaus nicht zum Besseren. Man kann deshalb von Glück reden, dass Descartes nur an einer einzigen Stelle an den gesuchten Punkt gelangte, von dem aus er nur mit gewagten Spekulationen zu weiteren Gewissheiten fortschreiten konnte, die mehr ungewiss waren, als der Erfinder sich gewünscht hatte, und die in der Geschichte des Denkens auch nur geringe Spuren hinterlassen haben. Die folgenreiche Spur von Descartes’ Suche nach Gewissheit und ihrem Ergebnis war ganz anders, als es sich der Erfinder gedacht hatte.
2.2.2Zweifeln, und zwar radikal
Descartes’ radikal durchgeführter Zweifel an allem, was man wissen kann, ließ auch die Frage nach den richtigen Begriffen nicht unverändert. Der Zweifel an allem endete in Descartes’ ‚Meditationes‘ erst bei der Selbstgewissheit des zweifelnden Ichs selbst. Alle Begriffe, und seien sie noch so plausibel, könnten auf Täuschung beruhen. Alle Erkenntnisse, auf die wir uns in unserem Umgang mit der Welt verlassen, könnten doch falsch sein. Das allerdings bedeutet nicht, dass wir uns ihrer nun nicht mehr bedienen sollten. Descartes bezeichnete seinen Gedankengang nicht ohne Grund als eine ‚Meditation‘, also als eine ‚Betrachtung‘, ein ‚Schauen‘, also als ‚theorein‘, was eben ‚sehen‘ heißt. Aber sein Meditieren mag zwar in der ‚praxis‘ (also in der Frage nach dem Richtigen im Zusammenleben der Menschen und in der Selbstgestaltung des menschlichen Lebens) ebenso wie in der ‚techne‘ (also in der Suche nach den richtigen Mitteln für gegebene Ziele) ohne Folgen angelegt sein, in der ‚theoria‘ (also in der Suche nach Wissen) war es keineswegs folgenlos.
Wenn wir an allem radikal und unaufhörlich zweifeln, dann erreichen wir nach Descartes’ Argumentation keineswegs das Nirwana des absoluten Nichts. Denn es gibt einen festen Punkt, an dem aller Zweifel endet, und er ist dort, wo der Zweifel sich auf sich selbst ‚zurückbeugt‘ oder auf sich selbst ‚zurückkommt‘. Diesen Vorgang kann man auch als ‚Reflexion‘ bezeichnen. In seinen ‚Meditationes‘ zweifelt Descartes an Vielem, was Menschen üblicherweise als gewiss ansehen, aber wir können diesen Weg überspringen. Wo endet er? Dort, wo der Zweifelnde auf seinen Zweifel zurückkommt und sich als Zweifelnden erkennt. Auch wenn er an allem zweifelt, bleibt doch immer noch der Zweifel selbst. Ihn kann man sich nicht wegdenken, wenn man auf der Suche nach letzter Gewissheit ist und zu diesem Behuf den Zweifel in letzter Konsequenz praktiziert. Was gewiss ist, ist also der Zweifel selbst. Gefunden ist damit: ‚ich zweifle, ich bin‘ – was bin ich: ‚das Zweifeln‘. Das ist aber nicht ganz der Gedanke von Descartes. Er nämlich fügte sofort hinzu: also bin ich, denn ich zweifle. Und da das Zweifeln ein Denken ist, kann er auch sagen: ‚ich denke, also bin ich‘ – ‚cogito, sum‘. Ich kann also nicht an das Ende des Zweifelns gelangen, ohne einzugestehen, dass ich bin und dass ich ein Zweifelnder und Denkender bin.