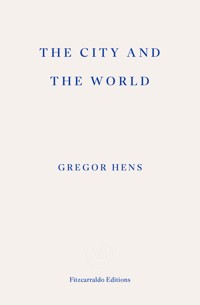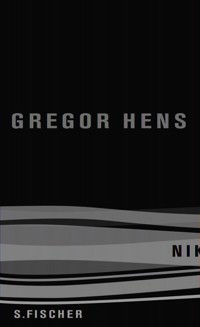
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Hommage an die Zigarette und eine Erkundung der Sucht – Gregor Hens hat aufgehört zu rauchen und sucht nach den Nikotinspuren in seinem Leben. "Ich rauche nicht mehr, aber es gibt immer wieder Momente, in denen ich an nichts anderes denken kann als an Zigaretten. Gerade ist so ein Moment. Ich sollte dieses Buch wirklich nicht schreiben, es ist viel zu riskant." Gregor Hens geht das Risiko ein und erinnert sich: An die erste Zigarette in einer kalten Silvesternacht, mit der er Raketen anzündete und schließlich daran zog, um seine Mutter zu beeindrucken, an den dichten blauen Dunst im Mercedes 280 SE seiner Eltern auf der Fahrt in die Ferien, und natürlich an den Genuss des Rauchens, an die Lust auf die nächste Zigarette und viele phantasievolle Spielarten des Aufhörens. Ein leidenschaftlicher Versuch, die Sucht schreibend zu bannen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gregor Hens
Nikotin
Über dieses Buch
»Ich rauche nicht mehr, aber es gibt immer wieder Momente, in denen ich an nichts anderes denken kann als an Zigaretten. Gerade ist so ein Moment. Ich sollte dieses Buch wirklich nicht schreiben, es ist viel zu riskant.«
Gregor Hens geht das Risiko ein und erinnert sich: An die erste Zigarette, mit der er in einer kalten Silvesternacht Raketen anzündete, an die dichten Schwaden im Mercedes 250 S seiner Eltern auf den Fahrten in die Ferien, an das Gefühl von Freiheit, als er in seiner ersten Nacht in New York im menschenleeren Central Park rauchte. Er erzählt von der Lust auf die nächste Zigarette, von den phantasievollen Spielarten des Aufhörens und entdeckt das Schreiben als Fortsetzung der Sucht mit anderen, literarischen Mitteln.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Hinweise zur Zitierfähigkeit dieser Ausgabe:
Textgrundlage dieser Ausgabe ist: Gregor Hens,Nikotin
Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 2011. 1. Auflage.
Die grauen Zahlen in geschweiften Klammern markieren jeweils den Beginn einer neuen, entsprechend paginierten Seite in der genannten Buchausgabe. Die Seitenzahlen im Anhang beziehen sich ebenfalls auf diese Ausgabe.
Covergestaltung: Hißmann, Heilmann, Hamburg
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400856-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Eine Handlung negieren, das [...]
Ich habe weit über [...]
Eine Raststätte an der [...]
Ich habe einmal ein [...]
Es war nicht mein [...]
Na gut, ja, sagt [...]
Bereits vor dieser ersten [...]
Drei Uhr am Nachmittag, [...]
Mein Vater hatte über [...]
Die unbedeutendste Großstadt der [...]
1976 wurde ich aus [...]
Zum Rauchen ging ich [...]
Die letzten Wochen waren [...]
Nachbemerkung
Bildnachweise
Eine Handlung negieren, das ist ungefähr, wie wenn man einem bewegten Körper eine andere Richtung gibt. Eine Unterbrechung, eine Null-Geschwindigkeit ist nötig im Augenblick des Wechsels von der einen zur anderen.
Moshé Feldenkrais
Ich habe weit über hunderttausend Zigaretten in meinem Leben geraucht, und jede dieser Zigaretten hat mir etwas bedeutet. Einige haben mir sogar geschmeckt. Ich habe gute, sehr gute und miserable Zigaretten geraucht, trockene und feuchte, scharfe und beinahe süße. Mal habe ich hastig geraucht, mal langsam und genüsslich. Ich habe Zigaretten geschnorrt, geklaut und geschmuggelt, ich habe sie mir erschlichen, und ich habe um sie gebettelt. An einem New Yorker Flughafen habe ich dreizehn Dollar für ein Päckchen bezahlt. Ich habe halbvolle Schachteln weggeschmissen und wieder aus dem Müll geangelt, nur um sie unter dem Wasserhahn endgültig unbrauchbar zu machen. Ich habe kalte Kippen, Zigarren, Zigarillos, Bidis, Kreteks, Joints und Stroh geraucht. Ich habe Flüge verpasst und Löcher in Hosen und Autositze gebrannt. Ich habe mir Wimpern und Augenbrauen abgeflämmt, bin beim Rauchen eingeschlafen und habe von Zigaretten geträumt, von Rückfällen und Bränden und bitterem Entzug. Ich habe bei plus 45 und bei minus 25 Grad geraucht, in Bibliotheken und Seminarräumen, auf Schiffen und Berggipfeln, auf den Stufen von Aztekenpyramiden, heimlich in einer alten Sternwarte, in Kellern und Scheunen und Betten und Schwimmbädern, auf Luftmatratzen und in dünnwandigen Plastikschlauchbooten, auf dem Nullmeridian in Greenwich und auf Fidschi am hundertachtzigsten Längengrad. Ich habe geraucht, weil ich satt war, und ich habe geraucht, weil ich hungrig war. Ich habe geraucht, weil ich glücklich war, und ich habe geraucht, weil ich niedergeschlagen war. Aus Einsamkeit habe ich geraucht und aus Freundschaft, aus Angst und aus Übermut. Jede Zigarette, die ich je geraucht habe, hatte eine Funktion – sie war Zeichen, Medikament, Aufputsch- oder Beruhigungsmittel, sie war Spielzeug, Accessoire, Fetisch, Pausenfüller, Erinnerungsstütze, Kommunikationsinstrument oder Meditationsobjekt. Manchmal war sie alles auf einmal. Ich rauche nicht mehr, aber es gibt immer wieder Momente, in denen ich an nichts anderes denken kann als an Zigaretten. Gerade ist so ein Moment. Ich sollte dieses Buch wirklich nicht schreiben, es ist viel zu riskant.
Aber ich lasse mich nicht beirren. Ich werde über all das schreiben, und zwar ohne es zu mystifizieren, ohne es zu verteufeln. Denn ich bereue nichts. Jede Zigarette, die ich geraucht habe, war eine gute Zigarette.
Es gibt Menschen, mit denen ich gern eine Zigarette rauchen würde – Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, Künstler, die ich bewundere. Dass es dazu wohl nicht mehr kommen wird, liegt nicht allein an mir und meiner Entscheidung. Die meisten von ihnen rauchen nicht mehr. Einige sind schon tot. Mit meinem Großvater, in dessen riesiger, schwieliger Hand die Zigarette immer so dünn und zerbrechlich aussah, hätte ich gern eine geraucht. Er ist zu früh gestorben. Ich bin überzeugt, dass er gestorben ist, weil man ihm in dem Krankenhaus, in das er nach einem Sturz eingeliefert wurde, die Zigaretten weggenommen hat. Obwohl er nur fünf bis zehn am Tag geraucht hat, sechzig Jahre lang. Mein Großvater war ein überaus maßvoller Mensch. Wenn er ganze Vormittage in seiner Küche in Koblenz-Pfaffendorf saß und auf einer ausgebreiteten Zeitung Linsen sortierte, Kartoffeln schälte oder mit einer Speckschwarte Ostereier polierte, lag die Schachtel Lux mit dem zugesteckten Streichholzheftchen immer daneben, wie ein Versprechen.
Ich habe oft davon geträumt, einmal in einem kunsthistorischen Museum zu rauchen. Ich habe mir vorgestellt, ich würde mich auf eine dieser glatten, von der schräg einfallenden Nachmittagssonne gewärmten Massivholzbänke setzen, vor ein schnell gemaltes, strenges Gruppenporträt von Frans Hals zum Beispiel, und mir eine Finas Kyriazi Frères anstecken, eine filterlose Orientzigarette, die leider seit einigen Jahren vom Markt verschwunden ist. Ich habe keinen Zweifel, dass dies ein Moment absoluter Klarheit für mich wäre, vielleicht mein allergrößtes Glück.
Es wird nicht dazu kommen. Ich rauche nicht mehr. Aber ich kann ja darüber schreiben. Und wenn ich schreibend das Thema meiner Sucht umkreise, das tatsächlich ein Lebensthema für mich ist, kann ich mir gleich einige Fragen stellen: Wie bin ich eigentlich zum Raucher geworden? Aus welchem Bedürfnis heraus? Haben die unzähligen Zigaretten, die ich in meinem Leben geraucht habe, dieses Bedürfnis gestillt? Wie bin ich mit meiner Sucht umgegangen, mit der gelegentlichen Sorge, sie nicht bedienen zu können? Hatte ich Angst vor den Gefahren?
Die Gründe, die zu meinem Entschluss geführt haben, brauche ich nicht aufzuzählen. Jeder kennt die Argumente, die sozialen und die medizinischen. Rauchen ist ein zwanghaftes Verhalten. Wer Zwänge überwindet, gewinnt an Freiheit. Ich bin oft genug rückfällig geworden und weiß, dass ich ganz am Anfang stehe. Diesmal, so habe ich beschlossen, schreibe ich mich aus meiner Sucht heraus, indem ich ihre Geschichte erzähle. Ich widme einer Struktur, die beinahe mein ganzes Leben beherrscht hat und die ich zu verschiedenen Zeiten tatsächlich mit meinem Leben verwechselt habe, zum ersten Mal meine ganze Aufmerksamkeit. Einige meiner Verhaltensmuster, meiner Automatismen und Denkgewohnheiten habe ich immer für selbstverständlich gehalten, ich habe sie überhaupt nicht bemerkt. Erst jetzt, in der Rückschau, setze ich mich mit ihnen auseinander und beginne sie zu verstehen.
Dabei fällt mir etwas Erstaunliches auf: Ich habe weit über hunderttausend Zigaretten geraucht und kann beim besten Willen nicht sagen, ob man beim Anzünden das Papier knistern hört wie in der Kinowerbung. Ich habe offenbar niemals, nicht ein einziges Mal, darauf geachtet.
Eine Raststätte an der Autobahn A1, Mitte der Neunzigerjahre, irgendwo in Westfalen. Eine blau-weiße Tankstelle, Motordröhnen und das Rauschen von Reifen hinter staubigem, westdeutschem Dorngehölz. Ich habe meinen Wagen geparkt und warte auf meinen Bruder, der mich nach Delmenhorst mitnehmen wird, wo unsere Großtante, die Frau mit dem hundertjährigen Zigarettendeputat, gewohnt hat.
Ein dänischer Speditionslaster kommt zum Stillstand, die Hydraulik zischt. Der Fahrer trägt eine Bundfaltenhose und ein helles, kariertes Hemd, er wirkt frisch, beinahe sportlich. Ich sitze vor dem Shop auf einem Stapel in Plastikfolie eingeschweißtem Kaminholz, trinke Jacobs Krönung aus einem Pappbecher und sehe in den matten Himmel. Ich weiß nicht wohin mit dem dünnen Rührstäbchen. Der Däne stellt sich neben mich, steckt sich eine rote Gauloise an. Wortlos bietet er mir eine an. Ich zeige mit dem Rührstäbchen auf die Tanksäulen. Zu nah, sage ich. Too close. Boom. Der Mann lacht. Vor uns rollt ein silbergrauer Maserati aus. Das Seitenfenster senkt sich ab, mein Bruder schiebt die Brille hoch und fragt: Wartest du schon lange? Ich nicke dem Dänen zu und gehe um das niedrige Auto. Boom, sagt er noch einmal grinsend und zeigt mit den Händen, wie so eine Explosion aussehen könnte. Wie eine exotische Blüte, die im Zeitraffertempo aufgeht, denke ich, wie ein Silvesterfeuerwerk. Ich stütze mich ab, ziehe den Kopf ein, rutsche in den Schalensitz. Stefan wirft einen skeptischen Blick auf den Dänen, dann auf meinen Pappbecher. Er mag es nicht, wenn ich im Auto trinke. Mein Vater war genauso. Stefan gibt Gas. Wir reden nicht viel. Wir rauchen, und manchmal sagt Stefan Sätze wie: Ich glaube nicht, dass sie einsam war. Oder: Weißt du, sie hat immer noch diese Butterfahrten nach Helgoland gemacht. Es sind gnädige Sätze, Sätze, auf die ich nicht reagieren muss. Sie schwingen noch eine Weile nach, bevor sie im Rauschen der Autobahn, im satten Dröhnen des Zwölfzylinders untergehen. Sie ist zweiundachtzig geworden.
Kurz vor Bremen fahren wir von der Autobahn. Mein Bruder steuert sicher durch die Vororte, er kennt sich noch sehr gut aus. Er ist vier Jahre älter als ich und erinnert sich besser. Hier das Einkaufszentrum, sagt er, weißt du noch? Und da lang geht es zum Kohl-und-Pinkel-Essen. Ich versuche mir vorzustellen, was ich gesehen, was ich bemerkt hätte, wenn ich damals etwas älter gewesen wäre. Einmal im Jahr, an einem Samstagmittag im Januar, hat die Tante die ganze Familie in das beste Restaurant von Bremen eingeladen. Es gab Braunkohl und fettige, körnige Würste, geeisten Schnaps. Ich erinnere mich an Holzbänke mit Auflagen, an dicke, teppichartige Tischdecken, an Kellnerinnen, die ungläubig fragten, ob ich das alles selbst gegessen hätte.
Wir fahren an einer Schule vorbei. Ich erkenne die rote Klinkerfassade, den weißen Zaun, den Sportplatz mit der kleinen, aus sechs aufsteigenden Bankreihen bestehenden Tribüne. Offenbar lagern die Bilder noch in meinem Gehirn, irgendwo. Ich erinnere mich, dass auf dem Schulhof Kinder spielten, wenn wir am Anfang des Sommers zu Besuch kamen. Ihre Ferien begannen später. Sie müssen mir sehr fremd vorgekommen sein, als lebten sie in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone. Wer waren diese Kinder hinter dem Zaun? Sprachen sie überhaupt meine Sprache?
Während im Radio die Windgeschwindigkeiten an Nord- und Ostsee verlesen werden, biegen wir in die Siedlung ein. Sie besteht aus weißen Bungalows, die sich hinter silbrig flimmernden Büschen und hohen Hecken wegducken. Ein Junge auf einem BMX-Rad kommt uns entgegen, erst im letzten Moment weicht er lässig, einhändig aus. Die Einfahrt steht offen. Stefan fährt über wacklige Platten bis kurz vor das Garagentor, das eine Delle hat. Tante Anna hat damals gleich ihren Wagen verkauft, sie ist nach dem Unfall überhaupt nicht mehr gefahren. Dabei hatte sie nur die falschen Schuhe an, die Kupplung ist ihr unter den glatten Jackie-Kennedy-Pumps weggerutscht. Der Wagen muss mit einem einzigen Satz, wie eine Kröte, gegen das Garagentor gesprungen sein. Warum hat sie es nie ausbeulen und nur notdürftig streichen lassen? Das war eigentlich nicht ihre Art.
Im Eingang steht eine Frau mittleren Alters. Sie trägt eine viel zu große, rosa marmorierte Brille, über ihrem Arm hängt eine Pelzjacke, die sie an die Brust drückt, als hätte sie Angst, dass man sie ihr wegnehmen könnte. Sie wirkt angespannt, nervös, wer weiß, wie lange sie schon wartet. Wir steigen aus. Stefan spricht mit ihr. In hastigen, abgehackten Sätzen redet die Frau auf ihn ein. Ich zünde mir eine Zigarette an und sehe mich im Garten um. Als das Haus fertig gebaut war, hat meine Großtante eine Schaukel installieren lassen, dabei waren wir nur ein oder zwei Wochen im Jahr zu Besuch. Die restlichen fünfzig Wochen war die Schaukel sichtbares Zeichen dafür, dass in diesem Haus etwas fehlte.
Die Frau reicht Stefan einen Schlüsselbund und einen Zettel mit ihrer Telefonnummer. Hast du mal dreißig Mark?, fragt mein Bruder. Sie nimmt das Geld, das Tante Anna ihr schuldet, bedankt sich mit einem kurzen Nicken und geht die Einfahrt hinunter. Sie hat hier immer geputzt, sagt mein Bruder, manchmal hat sie Rommé mit der Tante gespielt. Sie war es, die den Krankenwagen gerufen hat. Das Fräulein Meyer, sagt Stefan, erst hat sie sie Fräulein Meyer genannt, dann auf einmal Ihre Tante Änne. Ich glaube nicht, dass ihr die Tante die Pelzjacke wirklich vermacht hat.
Tante Anna scheint kaum etwas verändert zu haben. Beinahe zwanzig Jahre ist es her, seit ich zum letzten Mal hier war. Vor dem Schlafzimmer steht eine Gehhilfe. Der Durchgang zur Küche, eine scheckig-dunkelrote Falttür, ist geschlossen. Die Gebläseheizung rauscht leise. Ich finde den Lichtschalter nicht. Ich taste mich ins Wohnzimmer vor und ziehe einen Vorhang auf. Es bleibt schummrig, die Büsche vor der Terrasse sind lange nicht beschnitten worden. Schwere, tatsächlich unverrückbar schwere Sessel mit geklöppelten Schonern, die Armlehnen breit genug, um große Kristallaschenbecher darauf abzustellen. Wenn ich solche Sessel sehe, muss ich immer an Deng Xiaoping denken.
Oft haben wir hier Spiel ohne Grenzen gesehen und auf der in einem glänzenden, lackierten Kirschholzschrank untergebrachten Phonoanlage 78er-Schallplatten gehört, die mit einem Klacken von der Stange des Wechslers fielen. Tante Anna häkelte bunte Acryldecken, die niemand haben wollte, weil sie im Winter nicht wärmten. Es roch nach Hühnersuppe mit Eierstich, nach Rauch und Teppichreiniger. Der Fernseher lief ohne Unterbrechung. Wenn im Sommer die Terrassentür offen stand und ein leichter, kühlender Luftzug hereinkam, bimmelte über dem Esstisch der Lampion, den sie aus Hongkong mitgebracht hatte.
Auf den Beeten, an Büsche und Bäume gehäufelt, lag frischer, duftender Torf, der in der Umgebung gestochen wurde. Aus den Erzählungen der Tante wusste ich, dass gleich hinter der Schule, gleich hinter den Grenzen der Stadt, ein geheimnisvolles Land lag, das von Torfstechern und Moorleichen bevölkert war. Dort draußen, ergänzte mein junges Hirn, wimmelte es von ewig rastlosen Untoten, von Deichgrafen, von verwilderten Wieder- und Doppelgängern. Draußen vor der Stadt legten die Torfstecher die Skelette ganzer Sträflingskompanien frei und die kleinen Körper unerwünschter Kinder, die Leichen der Missgeburten, der Bastarde und der Mongoloiden. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin. Graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn.
Im Wohnzimmer, in der Diele hängen an den altweißen Wänden passepartoutgerahmte, teilweise goldumrandete Fotos von Betriebsversammlungen und Firmenjubiläen, auf denen das Fräulein Meyer mal allein, mal im größeren Kreis mit dem Vorstandsvorsitzenden der Brinkmann AG zu sehen ist. Auf dem Fernseher, einem Grundig, stehen mehrere Fotos meiner Mutter. Ich trete auf das Gitter der in den Boden eingelassenen Gebläseheizung und lausche dem eigentümlichen, lang nachklingenden Rasseln, und mir fallen all die Legosteine, Murmeln und Würfel ein, die ich in dem Schacht verloren habe. Stefan steht im Schlafzimmer vor dem Sekretär, er hat Schubladen herausgezogen, Papiere hervorgekramt. Er hat die Linke in die Tasche gesteckt und blättert lässig einen kleinen Stapel Kontoauszüge und Korrespondenz durch, er steht da, als wollte er nach einem langen Arbeitstag nur schnell einen Blick auf die Post werfen. Er sucht eine Verfügung, Anweisungen wegen der Beerdigung, erklärt er. Hat sie nicht sogar schon ein Grab gekauft, einen Sarg ausgewählt und den passenden Blumenschmuck? Wenn wir nichts finden, meint er, machen wir eine Feuerbestattung. Was hältst du davon? Von mir aus, sage ich. Stefan ascht, als wollte er die Entscheidung auf diese Weise besiegeln, in einen Zinnteller mit dem Roland von Bremen.
Sie besaß nicht einmal ein Adressbuch. Sie hatte eine Schwester, unsere Oma, mit der sie jahrzehntelang nur über einen Anwalt korrespondierte, und drei Schulfreundinnen, die einmal in der Woche zum Canasta vorbeikamen und ihre Großzügigkeit ausnutzten. Die Damen kamen mit dem Bus aus der Bremer Innenstadt, tranken den guten Schnaps der Tante, aßen ihren selbstgebackenen Kirschkuchen, spielten ein paar Runden und verschwanden wieder. Mit einer, sie hieß Elke und war ebenfalls unverheiratet, hat die Tante 1975 oder 1976, kurz nach ihrer Pensionierung, eine Gastager Weltreise gemacht. Sie hat die Super-8-Rollen von unterwegs an meinen Vater geschickt, der sie an Kodak weiterschickte, wo sie entwickelt wurden. Sie waren alle verwackelt. Heute würde ich sofort an Parkinson denken, aber damals haben wir nur gelacht.
Ich bin mir sicher, dass sie dieser Elke auch noch die Weltreise bezahlt hat, sagt Stefan. Er muss in diesem Moment denselben Gedankenweg gegangen sein wie ich. Den Film aus Hongkong haben wir uns damals trotzdem ganz angesehen: Sechs wertvolle Kodakminuten mit den verwackelten Hintern eines deutschen Rentnerinnenpulks in Kowloon haben einen tiefen Eindruck in mir hinterlassen. Wie sich die Damen über die Nathan Road schoben, vorbei am Park und an den gigantischen, verdreckten Chungking Mansions, in denen ich wenige Jahre später einen drückenden Sommer verbracht habe, nur mit einer Unterhose bekleidet in einem von Indern bevölkerten Schlafsaal liegend, um dort, auf einem Hochbett knapp unter der schwitzenden, gelb-grün geschlierten Zimmerdecke, mit meinem Bleistift einen Stapel Kladden vollzuschreiben, gut vierhundert Seiten, die sich nie zu einem einzigen Ganzen, zu dem großen postkolonialen Roman, zusammenfügen wollten, den ich geplant hatte.
Es klingelt, ich zucke kurz zusammen. Die Tür steht noch offen. Ein Mann hält mir ein Schreibbrett und einen Kugelschreiber hin. Er bittet mich zu quittieren und drückt mir zwei Stangen Zigaretten in die Hand. Er wünscht einen schönen Nachmittag und kehrt zu seinem weißen Lieferwagen zurück, der mit laufendem Motor an der Straße steht. An der Garderobe neben der Tür hängt ein Nerz. Die beiden Pelzhüte auf der Ablage sehen warm und lebendig aus, als würden sie nur schlafen. Über einer alten, verzinkten Milchkanne, in der mehrere bunte Regenschirme stecken, hängt ein Feuerlöscher von der Firma Gloria. Ich gehe mit den Zigaretten ins Wohnzimmer.
Sie war nie verheiratet. Sie war ihr gesamtes Arbeitsleben der Firma Brinkmann in Burgdamm bei Bremen treu, einer Zigarettenfabrik, die unter anderem die damals marktführende Leichtzigarette Lord Extra produzierte. Tante Anna hatte als ehemalige Betriebsrätin eine sehr anständige Pension und ein monatliches Zigarettendeputat von einer Stange Lord Extra und einer Stange Peer Export, das ihr per Kurier ins Haus geliefert wurde und erst 2071, einhundert Jahre nach ihrer Pensionierung, auslaufen sollte, und zwar unabhängig von ihrer eigenen finalen Exhalation, ihrem letzten exspiratorischen Akt.
Ich hielt Deputate in meiner Kindheit für eine Selbstverständlichkeit. Mein Urgroßvater väterlicherseits war Fahrer bei der Sektkellerei Deinhardt in Koblenz gewesen, und noch meine Koblenzer Großmutter verwaltete bis über seinen Tod hinaus ein beträchtliches Sekt- und Weindeputat, mit dem sie während der Trümmerjahre zur unbestrittenen Schwarzmarktkönigin von Koblenz aufstieg. Sie tauschte den Bubbes, so nannte sie die Flaschen, gegen Butter, Kohle, Kartoffeln und natürlich Zigaretten. Die Deinhardt-Sektkellerei war als kriegswichtiger Betrieb eingestuft gewesen und hatte die Kriegsjahre hindurch für die Offizierskasinos produziert. Wenn ich meinen Klassenkameraden von den Deputaten erzählte, sahen sie mich verständnislos an, beinahe, als würden sie an meinem Verstand zweifeln. Selbst die Grundschullehrerin schien nicht zu wissen, was ich meinte, als ich einmal in einem Aufsatz über meine Erkundungsausflüge in die Pfaffendorfer Vorratskeller neben den eingemachten, ungesüßten Stachelbeeren, die mit flüssiger Sahne serviert wurden, auch das Bubbes-Deputat erwähnte.
Tante Anna rauchte nur noch gelegentlich und gab den Großteil ihrer Monatsration gern an unsere Mutter, später auch an uns Kinder weiter. Ich habe mir in meiner Jugend nur wenig aus Filterzigaretten gemacht, ich habe sie immer nur geraucht, wenn ich kein Geld für Tabak oder filterlose Zigaretten hatte. Manchmal habe ich mit einer kurzen Drehung aus dem Handgelenk heraus den Filter abgerissen. Zwar rauchte die Tante nur noch wenig, aber sie tat es mit einer eigenartigen Gier, wie auch mein Großvater und viele alte Leute, die ich seither beobachtet habe. Als hätten sie ihr Leben lang auf diesen einen, ersten Zug gewartet. Oder als wäre es ihr letzter. Sie schob die Zigarette bis in die Winkelspitze zwischen Zeige- und Mittelfinger und hielt beinahe die ganze Handfläche vor den Mund, weshalb sie immer einen erschrockenen Eindruck machte, wenn sie rauchte. Sie inhalierte tief und hektisch, mit weit geöffneten Augen, manchmal mit einem eigenartigen, stockenden Japsen wie eine Erstickende.
Es war ein offenes Geheimnis in der Familie, dass Tante Anna immer in den Vorstandsvorsitzenden der Brinkmann AG